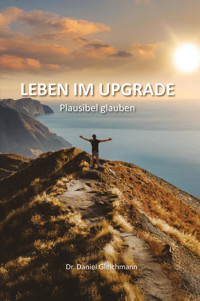
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Nur das glauben, was glaubwürdig ist. Wäre gut. Im Fokus: Der christliche Glaube. Als Arzt und Christ hat sich der Autor einer echten Challenge unterzogen: Den eigenen Glauben auf Plausibilität zu prüfen. Hat sein Glaube genug Kraft, an der guten Nachricht von Jesus Christus festzuhalten? Wie im Beruf, so auch hier: Der Facharzt für Innere Krankheiten prüft, verwirft, wagt neue Blickwinkel und entdeckt Erstaunliches. Nicht nur für sich und seinen Glauben. Dabei ist ein Buch herausgekommen, das Ihnen frisches Denken ermöglicht, wenn sich Ihr Glaube leer anfühlt. Das Sie da abholt, wo Sie christliche Vorstellungen nicht stimmig finden. Das den Dialog sucht und berühren will. Trotz seiner Brisanz. Eine Einladung, persönlich und nachvollziehbar zu glauben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dr. Daniel Gleichmann
Leben im Upgrade
Plausibel glauben
© 2025 Dr. Daniel Gleichmann
Lektorat: Gerhard Sündermann
Coverdesign: Taren Bleß-Singh
ISBN
Paperback
978-3-384-28228-6
e-Book
978-3-384-28229-3
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5,
22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Dr. Daniel Gleichmann, Fasaneriestr. 1, 36124 Eichenzell, Germany.
Kontakt-Adresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
VORWORT
TEIL I: FISCH FANGEN
KAPITEL 1: PLAUSIBLER GLAUBE
1.1. Plausibilität, die vernachlässigte Basis
1.2. Glaube durch Vertrauen
1.3. Glaube aufgrund höchster Plausibilität
KAPITEL 2: KOMMUNIKATIONSWEGE
2.1. Die Bedeutung der Bibel
2.2. Das Wort Gottes
KAPITEL 3: ERKENNTNISTHEORIEN
3.1. Die Existenz Gottes
3.2. Ein Mensch als Abbild Gottes
3.3. Schöpfung oder Evolution
3.4. Ist Gott gut?
3.5. Gott ist für uns
TEIL II: GRÄTEN ENTFERNEN
KAPITEL 4: DER SCHULDKOMPLEX
4.1. Sünde – Trennung von Gott?
4.2. Gott rettet Verlorenes
4.3. Schuld und Sühne
KAPITEL 5: OPFERKULT
5.1. Der Opferkult im biblischen Kontext
5.2. Religiöse Ersatzhandlung
5.3. Bewertung des Opferkults
KAPITEL 6: AKZENTVERSCHIEBUNGEN
6.1. Vom Retter zum Opfer
6.2. Vom Zeugnis zur Kampagne
6.3. Vom Grundkonzept zum Sonderstatus
6.4. Von Neuschöpfung zur Rückprojektion
6.5. Von Vertrauen zu Erwartungshaltung
6.6. Von Gewissensfreiheit zu Kadavergehorsam
6.7. Vom Menschen zur Sache
6.8. Vom Bund zum Kult
6.9. Von Jesus zu Paulus
6.9.1. Von Klarheit zur Erklärungsnot
6.9.2. Vom Subjekt zum Objekt
6.9.3. Vom Absoluten zum Relativen
6.9.4. Von Gnade zum Tauschhandel
6.9.5. Von Gerecht-Machen zu Gerecht-Sein
6.9.6. Vom Retten zum Richten
6.9.7. Vom Denken zur Doktrin
6.10. Von innen nach außen
KAPITEL 7: SÜHNE AM KREUZ?
7.1. Die Überlieferungslücke
7.2. Die Verhältnismäßigkeit
7.3. Die Rechtmäßigkeit
7.4. Die Übertragbarkeit
7.4.1. Jom Kippur
7.4.2. Lamm
7.4.3. Menschenopfer
7.4.4. Schlussfolgerungen
7.5. Das Gottesbild
7.6. Die Konsequenzen
TEIL III: FILET BRATEN
KAPITEL 8: WARUM WURDE JESUS UMGEBRACHT?
8.1. Leugnung des Offensichtlichen
8.2. Irritierende Plausibilität
8.3. Störende Menschenfreundlichkeit
8.4. Bedrohte Reinheitsvorstellungen
8.5. „Trinken von Blut“
8.6. Absolutheitsanspruch
8.7. Der Justizskandal
KAPITEL 9: WOFÜR NUTZTE JESUS DEN MARTERTOD?
9.1. Die menschliche Bestimmung
9.2. Der Bruch mit Gott
9.3. Die Frage nach der Sterblichkeit
9.4. Unser Weg vom Luxusgarten ins Vaterhaus
9.4.1. Eine ungenügende Exposition
9.4.2. Die Plausibilität des Sündenfalls
9.4.3. Das Wesen von Liebe
9.4.4. Liebe in einer neuen Dimension
9.4.5. Rettende Liebe
9.4.6. Die eigene Mission
9.4.7. Abschluss eines Projektes
9.4.8. Abschaffung des Sühneprinzips
9.4.9. Ein Sieg für die Menschheit
9.4.10. Machtverhältnisse
KAPITEL 10: WAS BEDEUTET DIE AUFERSTEHUNG?
10.1. Ein Gott von Lebenden
10.2. Die Plausibilität leiblicher Auferstehung
10.3. Begegnung mit dem Auferstandenen
10.4. Die Integrität des Auferstandenen
10.5. Schlussfolgerung
KAPITEL 11: WAS WAR DAS EIGENTLICHE OPFER?
KAPITEL 12: WAS WAR JESU MOTIV?
KAPITEL 13: WIE IST MIT SÜNDE UMZUGEHEN?
13.1. Legitimierte Vergebung
13.2. Bedingungslose Vergebung
13.3. Unbegrenzte Vergebung
KAPITEL 14: WAS IST BUßE?
TEIL IV: FISCH ESSEN
KAPITEL 15: LEBEN IM UPGRADE
15.1. Upgrade des Gottesbildes
15.2. Upgrade des Körpers
15.3. Upgrade der Identität
15.3.1. Notwendigkeit der Status-Änderung
15.3.2. Freiwilligkeit der Status-Änderung
15.3.3. Neuer Glaube und neue Identität
15.3.4. Neue Beziehungen
15.3.5. Neue innere Qualität
15.3.6. Neue innere Kopplung
15.3.7. Neues Zuhause
15.3.8. Neuer Scheideweg
15.3.9. Kompletter Neustart
15.4. Effekt des Upgrades: Geisterfülltes Leben
15.5. Ziel des Upgrades: Das Angesicht Gottes
KAPITEL 16: DER „MASTERPLAN“
KAPITEL 17: ASPEKTE IM UPGRADE
17.1. „Wahrheit“
17.2. „Prophetie“
17.3. „Beten“
17.3.1 Vater
17.3.2. Name
17.3.3. Reich und Wille
17.3.4. Das tägliche Brot
17.3.5. Vergebung
17.3.6. Versuchung
17.3.7. Der „Rest“ des Vaterunsers
17.3.8. Zusammenfassung
17.4. „Sündenbekenntnis“
17.5. „Taufe“
17.5.1. Bußtaufe
17.5.2. Glaubenstaufe
17.5.1. Geistestaufe
17.6. „Gute Nachricht“
17.7. „Gemeinde“
17.8. „Jesus – das Lamm“
17.9. „Abendmahl“
17.10. „Anbetung“
KAPITEL 18: GLAUBE DURCH ERFAHRUNG
KAPITEL 19: FREIHEIT
19.1. Generalamnestie
19.2. Fehlentscheidungen
19.3. Leben in Freiheit
EPILOG
DANKSAGUNG AN GERHARD SÜNDERMANN
DANKSAGUNG AN DARIUS GÖTSCH
DANKSAGUNG AN DIE FAMILIE
ÜBER DEN AUTOR
Leben im Upgrade
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
VORWORT
ÜBER DEN AUTOR
Leben im Upgrade
Cover
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
VORWORT
Ich bin schon so lange Christ, dass ich nicht mehr weiß, wie es sich anfühlt, keiner zu sein. Schon als Teenager hatte ich die beste Entscheidung überhaupt getroffen. Nämlich die, Jesus Christus mein Leben anzuvertrauen.
Auf meinem Weg mit Jesus war ich Arzt geworden. Hatte geheiratet. Die Begegnung mit anderen Christen genossen und den Austausch über den Glauben immer wie einen wertvollen Schatz behandelt.
Doch im Sommer 2022 rang ich um Antworten. Ich war unzufrieden. Nicht mit Jesus. Sondern mit meinem Glauben. Der wirkte mittlerweile vage, verschwommen. Auch, weil ich manche getroffen hatte, die ebenfalls glaubten, aber ihre besonderen Vorstellungen mit Bibelworten begründeten, die ich in keiner Weise plausibel fand. Sowohl im Hinblick auf die Bibel als auch auf die Lebenswirklichkeit. Besonders fiel mir das während der Corona-Krise auf. Und das brachte mich zu der überaus beunruhigenden Frage, was meinen christlichen Glauben überhaupt ausmacht.
Unvermittelt befand ich mich in einer intensiven Auseinandersetzung mit allem, was ich bis dahin in meinem Glaubensverständnis für unumstößlich gehalten hatte. Nichts weniger als „das Eigentliche“ sollte es nun sein, mit dem ich mich zufrieden geben wollte. Ich wollte nur das behalten, was mich selbst überzeugte.
Es galt genau den zu überzeugen, der ich war: Ein mit Jesus verbundener Nachfolger; und ein von meiner eigenen Geschichte und meinem Beruf geprägter Mensch im 21. Jahrhundert. Ich wollte nochmal ganz von vorne glauben. Falls das überhaupt möglich war…
Als Arzt bin ich durchdrungen vom Gedanken der Plausibilität oder „Stimmigkeit“. In jedem Arztgespräch höre ich auf die vom Patienten beschriebenen Symptome und gleiche sie mit den Mustern von Krankheitsbildern ab. Mit Mustern, die damit übereinstimmen und unter Berücksichtigung aller Befunde – hoffentlich – die richtige Diagnose stellen lassen. Diesen Blick auf „Stimmigkeit“ beziehungsweise Plausibilität habe ich grundsätzlich auch beim Lesen der Bibel. Nun aber sollte das Konsequenzen haben.
Als ich begann, meinen christlichen Glauben und mein Verständnis der Bibel einer eingehenden Überprüfung zu unterziehen, ahnte ich nicht, was mich am Ende erwartete. Ich gestehe, zunächst hatte ich etwas Scheu davor. Aber ich spürte eine besondere Dringlichkeit bei verschiedenen Themen. Heute bin ich froh, mich diesem Prozess gestellt zu haben. Er hat mir viele neue Blickwinkel eröffnet, die ich nicht mehr missen möchte.
Und all das möchte ich teilen. In diesem Buch. Wenn ich im Folgenden die Bibel zitiere, verzichte ich ganz bewusst auf theologische Sekundärliteratur. Es geht mir um das, was mir mit meiner Prägung direkt aus der Bibel entgegenleuchtet. Was mir einleuchtet.
Insofern ist mein Buch ein „Diskussionsbeitrag“ im Kontext anderer Glaubensauffassungen.
Das Verhältnis zwischen meinem Glauben an Jesus und der Bibel möchte ich heute so beschreiben: Die Bibel enthält Worte Gottes. Jesus ist Wort Gottes. „Das Wort wurde Fleisch…“ stellte Johannes fest. Jener Schüler, der ihm besonders nahestand.
Ich bin tief beeindruckt davon, was über Jesus in den Evangelien berichtet wird. Darin erkenne ich einen Jesus, der allen Menschen, die mit ihm verbunden sein wollen, sein überfließendes Leben verspricht. Und der dieses Versprechen auch einlöst – in seinem Sterben, seiner Auferstehung und der Erfüllung des Glaubenden mit seinem Geist.
Ich erkenne in ihm aber auch jemanden, der immer für ein klares Verständnis von Glauben eintritt, der Nachvollziehbarkeit geradezu einfordert. Dies belegen die vielen Gleichnisse, die er benutzt hat, um seine gute Nachricht zu veranschaulichen. Und die vielen Streitgespräche mit den religiösen Führern seiner Zeit. Mit denjenigen, die alle Gotteserkenntnis ausschließlich auf das Gesetz Moses und das Reden der Propheten bezogen. Die „Gott“ geradezu eingemauert hatten in Texten. Und die für die Interpretation derselben auch noch Exklusivrechte beanspruchten.
Jesus ist anders. Er lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Er erzeugt Vertrauen und Verstehen gleichzeitig, ist selbst Gründer und Garant unseres Glaubens (vergleiche Hebräer 12, 2).
Dieser Glaube ist für mich „stimmig“.
Weil er sich innerhalb des eigenen Erfahrungshorizonts bestätigen lässt. Fehler sind hierbei erlaubt, vorläufige Deutungen gegebenenfalls neu zu justieren. Denn bei Jesus geht es immer um einen dynamischen Prozess, einen Weg, der Mut verlangt und nicht auf andere übertragbar ist.
„Folge du mir nach!“ sagt Jesus (gemäß Johannes 21, 22), als sich einer seiner Leute darüber wundert, dass noch ein anderer auf dem Weg ist.
Auf meinem Weg habe ich festgestellt: Glaube an Jesus ist eigentlich genial einfach. Persönlich, aber nicht beliebig. Weil er in Jesus einen konkreten Bezug hat.
Seine Nachfolge ist unzweifelhaft individuell, seine Nachricht nicht. Sie gilt allen. Und sie will erzählt und verstanden sein. Von Zeugen. Manchen gelingt es gar, den großen Bogen in der Geschichte Gottes mit den Menschen zu spannen.
Professionell tun das Theologen. Mit unterschiedlichen Methoden und Ergebnissen. Ich rechne mich eher zu den Zeugen, wage aber mit diesem Buch auch „etwas Theologie“.
Mein Ansatz: Ärztliches Denken im Umgang mit dem christlichen Glauben und der Bibel.
Mein Ziel: Das Erfassen der guten Nachricht von Jesus in ihrer ursprünglichen Bedeutung.
Ich meine, dass Plausibilität unseren Blick auf Jesus frei machen kann. Frei von wilder Spekulation und gleichzeitig frei von dogmatischer Verengung.
Dabei ist mir voll bewusst, dass ich mich in einem Spannungsfeld zwischen persönlicher und gemeinschaftlicher Glaubenswirklichkeit befinde.
Dieses Spannungsfeld ist von Jesus selbst vorgegeben: Bei ihm gilt „Geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ zu!“ genauso wie „Liebt einander, damit ihr in dieser Welt als meine Nachfolger erkannt werdet!“ (vergleiche Matthäus 6, 6 sowie Johannes 13, 34-35).
Das heißt für mich: Weit mehr als vom eigenen Ansatz bin ich überzeugt von dem, der Menschen unterschiedlichster Prägung in seine Familie holt. Von Jesus. Ihm will ich auch dort vertrauen, wo meine Fragen offen bleiben oder anders zu beantworten wären. Das vorliegende Buch erhebt daher keinen Absolutheitsanspruch. Aber vielleicht sind die hier vorgestellten, teils radikalen Denkanstöße genau das:
Anstoß, in tiefer und ehrlicher Weise über den eigenen Glauben und seine Plausibilität nachzudenken. Anstoß für einen neuen Dialog mit Gott und Menschen. Das würde mich freuen.
Dr. Daniel Gleichmann
Im Dezember 2024
TEIL I: FISCH FANGEN
KAPITEL 1: PLAUSIBLER GLAUBE
1.1. Plausibilität, die vernachlässigte Basis
Warum halte ich Plausibilität im Glauben für unverzichtbar?
„Plausibel“ ist, was einleuchtet und nachvollzogen werden kann. Das lateinische Lehnwort kann auch mit „glaubhaft“ wiedergegeben werden. „Plausibilität“ bezeichnet dementsprechend die Glaubwürdigkeit eines Inhalts.
Als Arzt erlebe ich nahezu täglich, dass Plausibilität Leben rettet. Sie ist die Basis meiner Arbeit, die Basis jeder einzelnen Behandlung.
Seit Jahren versucht die medizinische Wissenschaft, für ihre Aussagen ein Höchstmaß an Plausibilität zu erreichen und so Allgemeingültigkeit herzustellen. Das wird Evidenz genannt. Hierfür gibt es verschiedene Stufen, sogenannte Evidenzgrade. Beispielsweise haben Experten-Meinungen einen geringen Evidenzgrad, Studien dagegen, die alle Qualitätsstandards erfüllen, einen hohen.
Dieser Ansatz ist bewährt und unterliegt einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Doch auch wenn sich die Behandlungsprinzipien ändern sollten, wird die Medizin selbst dadurch nie in Frage gestellt.
Im Gespräch mit Christen fällt mir allerdings immer wieder auf, dass die Frage nach der Plausibilität von Glaubensaussagen als Problem angesehen wird. Sogar als Abwertung des gesamten Glaubens. Wieso?
Plausibilität rettet in meinem Beruf Leben. Warum sollte ich dann ausgerechnet in den Lebensfragen darauf verzichten?
Wenn die Suche nach plausiblen Antworten im christlichen Umfeld nicht geschätzt wird, scheint das Interesse an Qualität erschreckend gering. Aussagen wie „Das muss man halt glauben“ entsprechen in keiner Weise meiner Lebenserfahrung. Sie wirken oberflächlich und wirklichkeitsfremd. Außerdem fühle ich mich nicht ernst genommen, wenn es mir knapp entgegenschallt: „Verlass dich nicht auf deinen Verstand“ (in Anlehnung an Sprüche 3, 5).
Gelegentlich bekomme ich zu hören, dass Glaube gar nicht rational betrachtet werden könne und dürfe. Stattdessen werden Unwissenheit und Irrationalität als Bereiche hingestellt, wo sich der „Glaube“ abspielen soll. Also grundsätzlich bei allem, was menschliches Verstehen übersteigt oder ihm klar widerspricht.
Sollte jene Intelligenz, die das Universum auf Naturgesetzen, also unstrittig auf höchster Plausibilität, aufgebaut hat, ausgerechnet Irrationalität von uns erwarten?
Wenn das wirklich stimmen würde, wenn also Unwissenheit und Irrationalität die Bereiche wären, für die der christliche Glaube reserviert ist, hätte das eine fatale Konsequenz: Dieser „Glaube“ samt seiner Inhalte wäre nämlich ausschließlich vom Maß unseres Erkennens abhängig.
Dadurch hätte er aber langfristig keinen Bestand. Denn er müsste genau in jenem Maße schwinden, wie unsere Erkenntnis zunimmt!
Wer Verstehen-Wollen als Eitelkeit ablehnt, hält es oft schon für ausreichend, dass eine Sache extrem unwahrscheinlich oder widersinnig ist, um sie bereitwillig zu glauben. Die schräge Haltung vieler Christen in der Corona-Krise oder bei ihrer Bewertung von autokratischen Führern, aber auch von seriöser Wissenschaft zeugt davon. Da hat das Nachvollziehbare einen schweren Stand…
Eigentlich hatte ich daher vorgehabt, diesem Buch den Titel „Wir haben Gott klein gemacht“ zu geben. Aber das klang zu frustriert. Abgesehen davon wäre ein solcher Titel Gott nicht gerecht geworden, weil wir ihn nicht klein machen können, allenfalls „klein reden“.
In der Wahrnehmung vieler Menschen befindet sich die Glaubwürdigkeit christlicher Kirchen im freien Fall. Mittlerweile bezeichnet sich mehr als die Hälfte der Deutschen als konfessionslos. Das mag zum Teil darin begründet sein, dass das öffentliche Bild der Kirchen und ihre inhaltlichen Schwerpunkte in einer liberalen Gesellschaft nicht mehr glaub-würdig erscheinen.
Dann drängt sich aber die Frage auf, was den christlichen Glauben überhaupt ausmacht. Ob er ein grundsätzliches Glaubwürdigkeitsproblem hat und in der Vergangenheit lediglich eine höhere soziokulturelle Akzeptanz finden konnte.
Deshalb ist zu klären, was ihn plausibel, also nachvollziehbar und einleuchtend macht. Das gelingt nur, wenn er von unnötigen Modifikationen befreit und in seiner ursprünglichen Bedeutung erfasst wird.
Diese Aufgabe kann nicht Theologen und Institutionen vorbehalten bleiben. Manche mögen es bedauern – aber die Ära autoritärer Vordenker und des kirchlichen Monopols in Glaubensfragen ist vorbei.
Umso mehr ist die Eigenverantwortlichkeit mündiger Christen gefragt. Sie entspricht ohnehin viel besser dem christlichen Grundgedanken, der so progressiv ist, dass er zu allen Zeiten gedeckelt wurde. Nicht nur im Patriarchat.
Eigenverantwortlichkeit war noch nie so gut umsetzbar, aber auch noch nie so überlebenswichtig wie heute. Innere Stärke durch plausibles Denken muss zur Glaubensgrundlage des Einzelnen werden, wenn er nicht vom Zeitgeist überrollt werden will.
Glaube ist zwar keine exakte Wissenschaft, aber doch etwas, das nachvollzogen werden kann und soll. Wie das gelingt, zeigt uns Jesus von Nazareth. Er argumentiert logisch, klar und präzise. Seine Rationalität bietet Menschen eine exzellente Orientierungshilfe, um schlüssige Antworten auf existenzielle Fragen zu bekommen.
Im Übrigen findet sich bereits biblisch der Versuch, „Glaube“ als Grundkompetenz des einzelnen Menschen zu definieren: Als das „Für-Wahr-Halten von dem, was man nicht sieht“ (vergleiche Hebräer 11, 1). Als etwas ganz Persönliches, nicht Allgemeingültiges.
In diesem Punkt wäre Glaube sogar deckungsgleich mit Plausibilität; denn diese ist definiert als „subjektive Bewertung des Wahrheitsgehalts einer Aussage“.
Plausibilität beziehungsweise die individuell zu treffende Entscheidung darüber, ob etwas einleuchtet, wird allerdings von „weichen Faktoren“ beeinflusst: Von Wahrnehmung, Verständnis, Prägung, Gefühl und Wille. Also von variablen Kriterien. Demnach ist Plausibilität irgendwo im Spektrum zwischen Abwegigem und Offensichtlichem anzusiedeln. Mit der „reinen Wahrheit“ darf Plausibilität deshalb nicht verwechselt werden. Auch wenn sie innerhalb der christlichen Werteordnung unbedingt der Wahrheit verpflichtet sein sollte. Außerdem bedeutet Glaube so viel mehr…
Letztendlich glauben wir aber nur das, was wir für wahr halten.
Das entspricht uns einfach. Und falls unsere Kriterien gut sind und eindeutig erfüllt, dann können wir – analog zur Wissenschaft – getrost bei unserer Erkenntnis bleiben.
Selbst wenn ein Glaubensinhalt schon ein paar Tausend Jahre zurückliegt. Oder unsichtbar ist. Oder nicht wiederholbar.
Die Prüfung auf Plausibilität ist dementsprechend ein individuelles, äußerst hilfreiches und in diesen Tagen dringend benötigtes Werkzeug, um zum Kern der guten Nachricht von Jesus vorzudringen. Zu dem, was glaub-würdig ist. Was uns zuversichtlich macht in unsicheren Zeiten und eindeutig besser leben lässt.
Die vielfältigen Überlegungen und Entscheidungshilfen in diesem Buch dienen nur diesem einen großen Ziel.
Und die gute Nachricht könnte sogar besser sein, als wir bisher geglaubt haben…
Deshalb wendet sich das Buch an alle, die die Wahrheit im christlichen Glauben suchen.
Die noch zweifeln. Oder die ihren Glauben verloren haben und ihn neu wagen wollen.
Das ist nicht immer ganz leicht. Hier und dort sehr herausfordernd. Aber es wird sich lohnen. Ich vergleiche diesen persönlichen Prozess gerne mit einer besonderen Expedition: einem Ausflug zum Fischfang.
Der Fisch hüpft uns nicht auf den Teller. Sondern lässt sich suchen. Und einmal gefangen, will auch der beste Fisch noch entgrätet werden. Die Hoffnung ist:
Am Ende können wir ein kostbares, gut zubereitetes Fisch-Filet genießen.
1.2. Glaube durch Vertrauen
Es passiert uns immer wieder: Da begegnen wir etwas Neuem, gänzlich Unbekanntem. Und doch glauben wir, es in seiner Bedeutung sofort erfassen und einordnen zu können. Weil wir mit so etwas Ähnlichem schon einmal zu tun hatten. Natürlich wissen wir, dass das Neue nicht dasselbe ist wie das, was wir kennen. Aber wir bewerten es als gleich. „Der ist genau wie sein Vater.“ Glauben wir…
Wir müssen uns klar machen, dass unser Denken auf dem Erkennen und Verarbeiten von Mustern beruht. Dafür benötigen wir die Fähigkeit zu vertrauen. Diese Fähigkeit ist angeboren. Vertrauen ist so existenziell, dass unser Überleben davon abhängt.
Wahrnehmen, Verstehen, Lernen, der Bezug zu anderen Wesen und unserer Umwelt – all das ist uns überhaupt nur durch Vertrauen möglich.
Vertrauen vereinfacht das Leben. Weil es uns zu Entscheidungen kommen lässt, ohne jede Option selbst geprüft zu haben. So werden Prozesse beschleunigt, Wissenslücken schneller geschlossen. Vertrauen ist die implizite Basis für Kommunikation. Wir glauben unserem Gesprächspartner, setzen seine Aufrichtigkeit voraus.
Wir glauben vor allem Bezugspersonen, bewährten Persönlichkeiten und Institutionen. Zum Beispiel Ehepartnern und Familienmitgliedern. In der Regel haben wir weder Veranlassung noch Interesse daran, ihre guten Absichten in Frage zu stellen.
Ähnliches gilt für die Wissenschaft, der wir glauben, ohne selbst alles wissen zu können.
Auch glauben wir bevorzugt Menschen, die zur selben sozialen oder politischen Gruppe gehören.
Informationen vertrauen wir vor allem, wenn sie für uns nachvollziehbar sind. Oder nützlich erscheinen.
Wir gelangen nicht selten zu unumstößlichen Überzeugungen, indem wir ständig wiederkehrende, gleichlautende Informationen akzeptieren. Selbst wenn deren Wahrheitsgehalt noch nie überprüft wurde. Einfach deshalb, weil ihre Häufung eine Bestätigung darzustellen scheint. Dabei schenken wir eher solchen Aussagen das Vertrauen, die unseren erlernten Mustern entsprechen.
Auf diese Weise entwickeln wir ganze Lebenseinstellungen, unsere Weltsicht: den eigenen Glauben.
Wir behalten einen derartigen „Glauben“ oft auch dann noch bei, wenn sich bereits offene Widersprüche auftun. Einfach, weil wir glauben wollen.
1.3. Glaube aufgrund höchster Plausibilität
Wir glauben also gern und primär. Da erfordert der Versuch, als Christ den eigenen Glauben zu hinterfragen, schon etwas Mut. Weil hierdurch immer tief in uns verankerte Denkmuster berührt werden. Muster, die längst zu unserer Identität geworden sind.
Zugleich unterziehen wir unsere Integrität einer Nagelprobe. Sind wir ehrlich genug, für alle unsere Glaubensbereiche Plausibilität einzufordern? Auch auf die Gefahr hin, etwas zu verlieren? Vielleicht die Akzeptanz unserer christlichen Gruppe? Was, wenn wir zu unerwarteten Schlüssen kommen, die weitreichende Konsequenzen haben?
Müssen Glaubensinhalte wirklich plausibel sein?
Ja, unbedingt! Sonst hielten wir die Erde gemäß kirchlichem „Glauben“ immer noch für eine Scheibe, und Kolumbus hätte nie Amerika entdecken können.
Wir erinnern uns:
Der Wissenschaftler Galileo Galilei hatte im 16. Jahrhundert mit seinen Erkenntnissen über die Kugelform der Erde dem verengten Bibelverständnis seiner Kirche widersprochen. Daraufhin war er von eben dieser Kirche zu lebenslangem Hausarrest verurteilt worden. 400 Jahre später, im Jahre 1992, wurde dieser geniale Wissenschaftler von der katholischen Kirche rehabilitiert.
Und dabei soll Galilei ein gläubiger Mensch gewesen sein, der seine Kirche vor einem Irrtum bewahren wollte…
Erlauben wir uns, den Glauben umfassender zu sehen und zu verstehen! Wenn der christliche Glaube mit dem Erfassen der Wirklichkeit zu tun hat, wird er all unseren Fragen standhalten können. Jesus sagt:
„… ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“
(Johannes 8, 32)
Vielen Menschen scheint nicht bewusst zu sein, wie gefangen sie sind.
Deshalb ermutigt Jesus seine Zuhörer, sich nicht mit eingefahrenen Denkmustern zufrieden zu geben. Er steht für die erfolgreiche Suche nach unverbrüchlicher Wahrheit.
„Wer sucht, findet; wer anklopft, dem wird aufgetan.“
(Lukas 11, 10)
Thomas
Leider wird denen, die nach eindeutigen Belegen für Glaubensinhalte suchen, oft ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat entgegengehalten:
„Wie glücklich sind diejenigen, die [mich] nicht sehen und trotzdem glauben!“
(Johannes 20, 29)
Dies sagte der auferstandene Jesus zu seinem Jünger Thomas, der eben noch an seiner Auferstehung gezweifelt hatte.
Hintergrund: Im Gegensatz zu allen anderen aus dem Jünger-Kreis war Thomas dem Auferstandenen noch nicht begegnet.
Natürlich hätte sich Thomas einfach auf die Auferstehungsberichte der anderen verlassen können. Wie es für soziale Gruppen charakteristisch ist.
Dass er an dieser Stelle zögerte, lag wahrscheinlich auch an seiner Persönlichkeit. Aber vor allem daran, dass die meisten kurz vorher ihre gesamte Glaubwürdigkeit eingebüßt hatten:
Judas hatte Jesus verraten, Petrus ihn verleugnet, und alle außer Johannes waren untergetaucht.
So wird verständlich, dass Thomas das Ganze nur glauben will, wenn er den Auferstandenen selber berührt. Dass er persönliche Plausibilität für das „Unfassbare“ einfordert.
Überraschender Weise geht Jesus gern darauf ein. So dürfte Thomas der einzige Mensch gewesen sein, der seine Hand in die Wunden des Auferstehungsleibes legen konnte.
Gleichwohl: Jesus warnt hier seine Nachfolger, nur das als Wahrheit zu akzeptieren, was dem eigenen Muster entspricht. Er setzt vielmehr auf unsere Bereitschaft, neues Denken zu wagen und nicht nur Vordergründiges zur Glaubensbasis zu machen.
Wer höchste Plausibilität für seinen Glauben anstrebt, begnügt sich daher nicht mit „Indizien“, sondern ist jederzeit bereit, alte Denkmuster für die Wahrheit zu verlassen. Im Zweifel „alles zu verlassen“. Das ist ja gerade die Kernkompetenz derer, die Jesus folgen.
Und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach.
(Lukas 5, 11)
Jesus ist heute unsichtbar. Das ist aber kein Grund, „blind“ zu glauben. Wahrheit will eben nicht unterstellt, sondern erkannt werden. Vielleicht braucht unser Erkennen etwas Reife. Dazu trägt ein Grundprinzip bei: Wahrheit ist am Ende immer plausibel, Plausibles aber nicht immer wahr.
Glaube vollzieht sich auf zwei Ebenen, einer sachlichen und einer persönlichen.
Sachlicher Glaube im Sinne von „Für-Wahr-Halten“, wie er im Hebräerbrief definiert ist, kann daher nur vorläufig sein. Bestenfalls ein Vehikel auf unserer Straße zur Wahrheit. Bis wir dort angekommen sind, sollte unser Glaube allerdings in sich stimmig sein. Nicht weniger plausibel als die Wahrheit selbst! Am Ziel wird ein solcher Glaube dann nicht mehr gebraucht. „Für-Wahr-Halten“ wird abgelöst von Wahrheit.
Demgegenüber wird ein personaler Glaube, also ein Glaube, der auf „Vertrauen“ in eine Person gründet, immer bestehen bleiben. Falls er jemandem gilt, der unser Vertrauen absolut verdient. Jesus wäre so jemand. Die Menschen, die ihm vor zweitausend Jahren begegnet sind, kamen unweigerlich zu einer Bewertung seiner Person, seiner Vertrauenswürdigkeit.
Die Wenigsten erfassten die Wahrheit in seinen Worten sofort. Aber viele die tiefe Wahrheit in seiner Person. Oft nach nur einer Begegnung. Menschen vertrauten ihm. Dazu mussten sie ihn aber erst einmal hören, ihn sehen, alle Sinne einsetzen und alle verfügbaren Informationen nutzen. „Jesus musst du gesehen haben!“ wurde zum Leitmotiv.
Nathanael: „Was kann aus Nazareth Gutes kommen?“ – Philippus: „Komm und sieh!“
(Johannes 1, 46)
Die Einwohner von Sichar gingen aus ihrer Stadt heraus, um Jesus direkt zu treffen, nachdem ihnen eine moralisch fragwürdige Frau Außergewöhnliches von ihm berichtet hatte. Anschließend sagten sie zu ihr:
„Nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist.“
(Johannes 4, 42)
Jesus löste bei den Menschen seiner Zeit starke Reaktionen aus. Manchmal hakte er deshalb nochmal nach. So forderte er seine Jünger direkt dazu auf, ihm Feedback zu seiner Person zu geben. Er war an ihrer Einschätzung interessiert, an dem, was sie von ihm hielten – inspirierte Gedanken eingeschlossen.
Petrus fasste seine Erkenntnis so zusammen:
„[Ich halte dich] für den von Gott gesandten Retter!“
(Lukas 9, 20)
Als Jesus die Jünger später in einer schwierigen Phase seines Dienstes fragte, ob sie sich nicht auch von ihm distanzieren wollten wie einige andere, begründete Petrus ihr Dableiben so:
„Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens.“
(Johannes 6, 68)
Jesus ermutigt seine Nachfolger also immer zu eigenen Schlussfolgerungen. Dies gilt für Sachverhalte, Moralvorstellungen, theologische Themen. Vor allem aber für die Bewertung seiner eigenen Person, seiner Glaubwürdigkeit.
Für gelingenden Glauben sind ihm ganz eindeutig unsere Erkenntnisse, unsere Begründungen wichtig. – Uns selbst auch? –
Dann sollten wir „plausibel glauben“.
KAPITEL 2: KOMMUNIKATIONSWEGE
2.1. Die Bedeutung der Bibel
Die Bibel gilt als unverzichtbar für den christlichen Glauben. Sie ist keine Monographie, sondern eine Sammlung verschiedener Schriften über einen langen Zeitraum.
Ihre Autoren treffen Aussagen über das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Insofern ist sie einzigartig.
Es greift allerdings zu kurz, die Bibel als abgeschlossene Gottesoffenbarung zu begreifen. Dagegen spricht Folgendes:
1. Die Bibel wird der Größe Gottes nicht gerecht, weil ihre Texte nur Einzelaspekte eines weit größeren Zusammenhangs aufzeigen. Dieser Tatsache waren sich ihre Schreiber durchaus bewusst, wie es zum Beispiel die Aussage aus Johannes 21, 25 zeigt:
„Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem andern aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären.“
(Johannes 21, 25)
2. Auch die Schöpfung offenbart Gottes Wesen. Diesen Bezug stellt Paulus im Römerbrief her:
„Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie [die Menschen] deutlich sichtbar; er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen.“
(Römer 1, 19-20)
3. Die biblischen Schriften wurden um 400 nach Christus in einem sogenannten „Kanon“ zusammengestellt. Sicher nicht ohne eingehende Prüfung. Damit stellt „die Bibel“ aber nicht mehr als die Literaturauswahl einer bestimmten Epoche dar.
4. Der Adressatenkreis





























