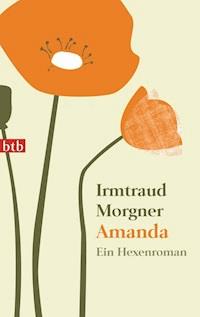Irmtraud Morgner
Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© dieser Ausgabe 2010 Luchterhand Literaturverlag GmbH, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
ISBN 978-3-641-04014-7V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis von Hauptfiguren des Romans
Vorsätze
Erstes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
1. gesellschaftliche Grundlagen (Wissenschaft, nach E. Köhler)
2. Die historische Rolle der Frau von Herrn de Poitiers (Wissenschaft, nach E. Köhler)
3. Die unhistorische Rolle der Frau des Herrn de Poitiers (Nachtrag zum 1. Kapitel)
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Zweites Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Erstes Intermezzo
Drittes Buch
Viertes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Zweites Intermezzo
Fünftes Buch
Sechstes Buch
Siebtes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Drittes Intermezzo
Achtes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Viertes Intermezzo
Neuntes Buch
Fünftes Intermezzo
Zehntes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Sechstes Intermezzo
Elftes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
»Am Anfang war die andre Tat.«
Verzeichnis von Hauptfiguren des Romans
Beatriz de Dia, Trobadora
Guilhem de Poitiers, erster Ehemann
Théophile Gerson, Ladenhändler, zweiter Ehemann
Raimbaut d’Aurenga, Trobador, erster Liebhaber
Alain, Student, zweiter Liebhaber
Lutz Pakulat, Bauingenieur, dritter Liebhaber
Laura Salman, Diplomgermanistin, Bauarbeiterin, Triebwagenführerin, Spielfrau
Uwe Parnitzke, Journalist, erster Ehemann
Benno Pakulat, Zimmermann, zweiter Ehemann
Juliane, Lauras Tochter
Wesselin, Lauras Sohn
Johann Salman, Lokführer, Lauras Vater
Olga Salman, Lauras Mutter
Lutz Pakulat, Bauingenieur, Lauras zeitweiliger Liebhaber
Valeska Kantus, Ernährungswissenschaftlerin
Uwe Parnitzke, Journalist, in zweiter Ehe mit Valeska verheiratet
Rudolf Uhlenbrook, Ernährungswissenschaftler, zweiter Ehemann
Arno, Valeskas Sohn
Franz Kantus, Setzer, Valeskas Vater
Berta, Valeskas Mutter
Katschmann, Triebwagenführer, Bertas Lebensgefährte
Oskar Pakulat, Zimmermann, Bennos und Lutz’ Vater
Anna Pakulat, Oskars Frau
Vorsätze
Natürlich ist das Land ein Ort des Wunderbaren. Mir fiel es auf, als mir eine Frau entgegentrat. In meiner Straße. Eines Morgens im April. Die fremde Frau fragte, ob ich Geld hätte. Da ich nüchtern Gesprächen abgeneigt bin, grüßte ich zurück. War auch in Eile, auf dem Weg zum Kindergarten. Die Frau, an deren linker Hand ebenfalls ein Junge zerrte, holte mich ein, nötigte mir mit der rechten Hand ein Paket auf und sagte: »Fünftausend.« Wir starrten einander an. Die Jungen rissen sich los. Ich hörte der Zahl nach. Als sie mir bewußt wurde, versuchte ich, die Last loszuwerden. Aber die Frau wich zurück und grub ihre Hände in die Taschen ihres Mantels. Seine reichliche Weite war gefüllt. Das kurze Kleidungsstück ließ keineswegs Knie sehen, kaum Waden. Obgleich ich allen Grund hatte, der aufdringlichen Frau eine Entschuldigung abzugewinnen, entschuldigte ich mich. Ließ mir von ihren braunen Knopfaugen das Gesicht durchmustern. Duldete, wer weiß, warum, das unverlangte Gewicht. Erst als ich spürte, daß die Paketverschnürung meine Fingerkuppen abgebunden hatte, schickte ich mich an, das Heck eines parkenden Personenwagens als Ablageplatz zu benutzen. »Dreitausend«, sagte die Frau. Dann zog sie ein Zellstofftaschentuch aus der Manteltasche und rieb ihre Augen. Bald die Nase. Meine kitzelte Regenwasser. Es floß vom Scheitel ab. Die Kunstlocken der Frau waren bereits in ein Stadium demoliert, das Wolle einer aufgetrennten braunen Socke vermuten ließ. Drei Schluchzer. Da war mir der Tragschmerz entfallen. Ich wartete ergeben auf wer weiß was. Als das Packpapier durchnäßt und geworfen war, roch ich dran. »Einmalig«, sagte gleich die weinende Frau, »die Gelegenheit, Ihre große Chance, greifen Sie zu.« Dem Ausdruck des rundlichen, sommersprossigen Gesichts war das sächsische Idiom harmonisch angemessen. »Ruhm«, hub sie wieder an in diesem Idiom, wobei sie sich vorsichtig näherte und mit einem dicken Zeigefinger nach dem Paket stach, »Weltruhm, garantiert, Sie sind doch Schriftsteller – oder?« Es folgte die ausführliche Schilderung eines Gesprächs mit dem hiesigen Konsumfleischer, das ihr angeblich meinen Beruf zur Kenntnis gebracht hätte. Die Kinder würden sich wahrscheinlich vom Spielplatz kennen. Seitdem sie verheiratet wäre, könnte sie leider nicht mehr mit Sicherheit auf einen Kindergartenplatz rechnen. Das hieße: vage Aussichten für ihren eigentlichen Beruf. Und der andere wäre ihr mit dem Tod der Freundin verlorengegangen. Falls ich zögern würde, könnte dieser wunderlichen Frau kein angemessener Grabstein gekauft werden. Ich sprach mein Beileid aus. Gespannt. Die Frau schwieg aber plötzlich. Ich sah gleichgültig in den Himmel, den eine Gaswerkwolke zusätzlich verdunkelt hatte. Scharrte mit den Schuhen Glassplitter vom Fußweg. Unschlüssig lief ich zur Pfütze und bat den Sohn der Frau, das Paket zu übernehmen. Der etwa dreijährige Junge entgegnete, Kapitän zu sein. Er beschrieb mir die Chancen seines Zerstörers in der Seeschlacht. Richard, mein Sohn, beschrieb die Chancen seines Zerstörers. Die Kriegsschiffe wurden von Eislöffeln dargestellt. Erleichtert lief ich zurück und erklärte, daß Schriftsteller keine Manuskripte kaufen würden, weil sie selbst welche verfertigen könnten. Die Frau nahm ein neues Taschentuch in Arbeit. Der erpresserische Einsatz von Augenwasser mäßigte meine mitleidigen Regungen. Statt jedoch das Verfahren mit dem nächstliegenden, einfachsten, wahrsten und hierzulande keineswegs ehrenrührigen Argument abzukürzen, verschwieg ich den Geldmangel und setzte mich und meine Profession mit Beschreibungen arbeitshinderlicher Mühen, die Manuskriptverkäufe mit sich brächten, in schlechtes Licht. Versuchte auch mit anderen geschäftlichen Erörterungen Zeit zu gewinnen. Schließlich sagte ich: »Was, Sie verlangen nicht nur aufreibende Verhandlungen umsonst, sondern obendrein dreitausend Mark? Für einen Grabstein dreitausend Mark?« – »Jawohl«, sagte die Frau und daß die berühmte Beatriz de Dia noch größere Ehrenbezeigungen verdient hätte. Ich bedauerte wörtlich, daß mir der Ruhm der verstorbenen Freundin nicht zu Ohren gekommen wäre. Da ich das Alter der kleinen dicken Frau auf Mitte Dreißig schätzte und ihren Umgang in der entsprechenden Generation vermutete, schien es mir aber leicht, den Makel der Unbildung von mir zu wenden. Ich erinnerte vorsorglich an einige Genies, die ein früher Tod um die Annehmlichkeiten der Publizität zu Lebzeiten gebracht hätte. Die Frau gab das Alter der Freundin achthundertdreiundvierzig Jahre an. Da mir die körperliche und geistige Verfassung der Frau kerngesund erschien, fragte ich zurück. Die Frau wälzte ihre Knopfaugen und wiederholte die ungeheuerliche Angabe. Augenblicklich dachte ich, wenn die Frau keine Erzlügnerin ist, sagt sie eine große Wahrheit. Und ich spürte schon den Sog. Entdeckte zugleich Grübchen in den Pausbacken gegenüber. Plötzlich klopfte sich die Frau die Zellstoffkrümel vom Mantel, nahm mir das Paket ab und sprach: »Ich war die Spielfrau der Trobadora Beatriz. Mein Name ist Laura.« – »Halt«, sagte ich. Ach, dieser unwiderstehliche Sog der Neugier, ich wußte längst, daß ich der Verschuldung nicht entgehen würde. Unwillkürlich nestelte ich an der Paketverschnürung. Frau Laura sagte: »Erst wenn ich die Mäuse habe, können Sie klauen. Soviel Sie wollen. Meinetwegen alles. Tausend, weil Sie es sind. Die Aufzeichnungen ersparen Ihnen mindestens zehn Reisen, hundert Produktionsstudieneinsätze und tausend Gespräche. Die ganze Welt auf fünf Pfund Papier. Siebenhundert Mark auf die Hand, und Sie sind eine gemachte Frau.« Ich raffte das Paket von Lauras Arm, den Sohn von der Pfütze und bat in meine Wohnung. Dort händigte ich mein Monatsbudget gegen Quittung aus. Als ich die Verschnürung zerschnitten hatte, fragte ich Laura, weshalb sie nicht eine gemachte Frau werden wollte. »Ich bin eine«, entgegnete sie, »sobald ich wieder meine Züge durch die Stadt fahren kann, bin ich eine. Seßhafte Beschäftigungen bekommen mir nicht. Auch fiele mir schwer, zu entscheiden, ob gelacht oder geweint werden sollte. Schluß mit dem Geschreibsel.« Ich steckte meinen Sohn in trockne Hosen und Schuhe, lieferte ihn verspätet, das heißt gerügt, im Kindergarten ab und konnte endlich in der neunten Stunde des 3. April mit der Lektüre beginnen. Die Dokumente rechtfertigten das Kaufrisiko auf ideale Weise. Meine Erwartungen wurden ganz und gar übertroffen. Ich begann sofort mit der Ordnung und Bearbeitung der sensationellen Zeugnisse für den Druck. Die vorliegende Buchfassung folgt in der Beschreibung aller wesentlichen Ereignisse streng den Quellen. Schriftstücke wurden unverändert in neuer, dem Leser entgegenkommender Reihenfolge wiedergegeben. – Am 7. April erwies ich Beatriz de Dia die letzte Ehre. Ihr Leichnam hatte drei Wochen gekühlt Wissenschaftlern zur Forschungszwecken zur Verfügung gestanden. Während der Trauerfeier im kleinen Saal des Krematoriums Berlin-Baumschulenweg konnte ich das Gesicht der Trobadora bewundern. Alles an ihm war schmal und lang, die Stirn, die Nase, das Kinn, selbst der Mund erschien höher als breit, wie geschmälert von maßlosem Stolz. Allerdings halbkugelig gewölbte Riesenaugendeckel. Und rundbogenförmige Brauen weit drüber. Schwarz. Das am Ansatz klein gelockte Haupthaar war ebenfalls nicht ergraut. Es erreichte die Oberarme. Auch der Sarg erschien mir überlang. Ein Mann, den ich zunächst für einen gemieteten Grabredner hielt, pries die Schönheit der alterslosen Erscheinung in dunklen Worten. Laura behauptete, er wäre der bekannte Pomerenke. Schließlich gelobte er der Toten, als Dichter den Schleier zu nehmen, allen schönen Klängen zu entsagen und das Vermächtnis der Trobadora in politischen Kämpfen ausfechten zu wollen. Außer Laura, deren Ehemann Benno und mir waren keine Zeugen zugegen.
Berlin, 22.8. 1973
Irmtraud Morgner
Erstes Buch
1. Kapitel
Darin beschrieben ist, was Laura von Beatriz de Dia über deren wunderseltsame Her- und Rückkunft anfänglich erfährt
Beatriz de Dia war die Gattin von Herrn Guilhem de Poitiers, eine schöne und edle Dame. Sie verliebte sich in Herrn Raimbaut d’Aurenga und dichtete auf ihn viele gute und schöne Lieder, von denen wenige in Sammlungen altprovenzalischer Trobadorlyrik nachzulesen sind. Neben den aparten Strophen von Raimbaut d’Aurenga (frz. d’Orange). Er liebte das Spiel mit schwierigen Reimen und der Mehrdeutigkeit der Worte, raffiniert stellt sich die metrische Struktur seiner Werke dar. Von deren Exklusivität überzeugt, suchte der dauerverschuldete Graf ständig nach komplizierten Worten mit der Endung -enga, um sie auf Aurenga reimen zu können, und zeigte Geringschätzung für alle unaristokratischen Verskünstler. Deshalb sah sich Beatriz genötigt, in ihrer Kanzone von der verratnen Liebe an ihren Adel zu erinnern, auch an Geist, Schönheit, Treue und Leidenschaft. Überflüssigerweise, praktisch war dem Herrn nicht der Sperling in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach, was verständlich erscheinen müßte, ihm war der Sperling in der Hand lieber als die Taube in der Hand. Anläßlich dieser Erfahrung beschloß die Comtessa, die mittelalterliche Welt der Männer zu verlassen. Auf unnatürlichem Wege, Persephone verlangte pro Schlafjahr 2920 Arbeitsstunden. Die Trobadora nannte die größte Zahl, die ihr bekannt war. Das Versprechen
2. Kapitel
Darin nachzulesen ist, welche Worte der Ingenieur (Ing.) und der Sprengmeister (Sp.mstr) am Montag, dem 6. Mai 1968, miteinander wechseln, nachdem sich Beatriz verliebt hat
Sp.mstr: Ein Wunder.
Ing.: Es gibt keine Wunder.
Sp.mstr: Natürlich.
Ing.: Wie?
Sp.mstr: Ich sagte: klar. Straßenschlachten hatten wir oft. Aber Sie sehen doch selbst …
Ing.: Ein verstaubtes Gemäuer, ein verstaubtes Weib, ich bin kein amerikanischer Tourist, der die Kurzgeschichte seiner Heimatstadt kompensiert, indem er vor jeder Antiquität auf dem Bauch liegt. Ich bin Franzose. Und ich bezahl meinem Sohn das Studium. Wenn er Barrikaden bauen will, muß er sich nach einer anderen Geldquelle umsehen.
Sp.mstr: Das bringt mich auf eine Idee: Wir verkaufen das Wunder.
Ing.: Und?
Sp.mstr: Sind reich.
Ing.: Arm.
Sp.mstr: Noch ärmer?
Ing.: Wenns rauskommt, verlieren wir den Job, man sperrt uns ein … he, hat dich die Ruine so verstört, daß du vergißt, wem der Baugrund gehört, mit allem, was drauf steht?
Sp.mstr: Das Weib ist keine Ruine. Und das Gebäude ist auch bestens erhalten. Normalerweise überdauern unsere Burgen die Zeiten nur dann so, wenn sie als Gefängnisse benutzt wurden. Bei der landläufigen Aufklärungsquote von fünfzig Prozent kommen nur dilettantische Unternehmen raus. Ein studierter Mann wie Sie …
Ing.: Schätze, elftes Jahrhundert. Außerdem kann man Wunder gar nicht verkaufen.
Sp.mstr: Warum nicht?
Ing.: Weil es keine gibt.
Sp.mstr: Natürlich, wir müssen uns beeilen, bei Wundern weiß man nie, wie lange sie halten. Erst wenn wir den Scheck in der Tasche haben …
Ing.: Du meinst, es besteht Hoffnung, daß das Wunder eins ist und alsbald verduftet?
Sp.mstr: Natürlich.
Ing.: Und wenn es nicht verduftet?
Sp.mstr: Abrißvertrag. Der muß den Käufer verpflichten, die Burg bis zu dem für uns verbindlichen Straßenbautermin abzutragen. Kürzlich hab ich von einem amerikanischen Millionär gelesen, der in England irgendeine ältere störende Brücke für teures Geld erstanden hat. Er ließ sie abtragen, mit Schiffen nach Kalifornien oder so transportieren und dort auf seiner Ranch wieder aufbauen. Die Burg ist mindestens doppelt so alt …
Ing.: Was sich im Preis niederzuschlagen hätte. Nicht zu vergessen die eingesparten Kosten für die Räumarbeiten …
Sp.mstr: … und die Sprengung …
Ing.: Alles unser Geld.
Sp.mstr: Sechzig Prozent für mich.
Ing.: Wieso?
Sp.mstr: Meine Idee.
Ing.: Mein Objekt.
Sp.mstr: Halbe-halbe.
3. Kapitel
Das nebensächlich vom Jäten und hauptsächlich vom Wiedersehen berichtet
Beatriz konnte dem Gespräch der beiden Männer wörtlich folgen, obgleich es in südfranzösischem Dialekt geführt wurde. Als es beendet war, riß sie den Ingenieur aus ihrem Herzen und wies die Herren aus dem Gemach. Staub wölkte von Bett, Nachthemd und Gliedern. Beatriz blies in die Wolken. Hustete. Nieste. Rief aber nicht nach Gesinde. Weil ihre Schwägerin sie über die jeweiligen Lagen in der Burg und der Welt auf dem laufenden gehalten hatte. Grob. Hypnopädisch. Die steif gewordenen Glieder knackten, der Rücken, das Herz. »Warum zum Teufel hat sie mich vorfristig geweckt«, sagte Beatriz altprovenzalisch zu sich, um ihr Mundwerk zu üben. Denn die beiden Herren entsprachen ganz und gar nicht den Erwartungen der Trobadora. Warum hatte die Schwägerin Marie von Lusignan zwei Jahre vorm Termin plötzlich die Erlaubnis erwirkt, zum Aufstehen drängen zu dürfen? Maulfaules Weib! Geschaftlhuberin! Dennoch war das Wiedersehen überwältigend. Dieses Spiel der Staubteilchen im Sonnenstrahl! Er brach durch leere Bleifassungen, die vollen waren staubverdunkelt. Beatriz eilte vorsichtig zur Bank im Fensterschacht. Die ungeübten Beine versagten fast den Dienst. Die Bank war so lang wie das Mauerwerk dick: zwei Meter. Beim stürmischen Öffnen des Fensters ging der Glasrest zu Bruch: O Provence! Windflüchtig nach Süden geneigtes Land. Mistralgezähmte Lieblichkeit. Palisadengezähmte Wildheit. Unbeschreiblicher Genuß, in höhlenhaftem Schutz die Raserei des nördlichen Fallwindes zu erleben, wie er das Rhônetal hinabstürzt. Wie er heult. Wie er faucht. Wie er orgelt in der Burg. Was für ein Instrument! Almaciz war noch immer die schönste Windorgel der Provence. Beatriz kniete auf der Steinbank und reckte ihren Kopf aus dem Marmorschutz. Gleich wurde ihr Haar ergriffen vom Mistral und gezaust wie das Gitterwerk der Zypressen und Pappelzäune in der Ebene. Bei kurzen Flauten lauschte Beatriz auch dem herrlichen Klang der Mittagshitze: Akkord aus Zikadengesäg. Und sie empfing schon die berauschenden Lavendel- und Rosmarindüfte, die bald herübergeweht würden von den Hügeln. Rührung und Sturm wässerten die Augen der Trobadora. Die großen Lider portionierten das Wasser zu Tropfen, die die Wangen nach und nach freilegten. Auch das Haar wurde gründlich entstaubt.
4. Kapitel
Aufbruch und Erdtauchen
Kaum erwacht, sah sich Beatriz also bereits vor richterliche Entscheidungen gestellt. Allein. Denn ein melusinischer Moment konnte erfahrungsgemäß tagelang dauern. Wenn sie den verstreichen ließ, würden Beatriz und die Menschheit von zwei Fossilien aufgehalten. Außerdem erschien der Trobadora die Burg für die berufliche Arbeit unentbehrlich. Deshalb gönnte sich die Frau nur flüchtige Blicke auf Almaciz. Sah auch nur flüchtig in den Spiegel. Zaghaft zunächst. Aber die innere Vorstellung – von einem heftigen physischen und geistigen Kraftbewußtsein bestimmt, das sich im Zenit des Lebens einstellt – war mit der äußeren nach wie vor vereinbar. Und die außerordentliche Körperhöhe, der Makel von einst, war auch erhalten geblieben. Gut. Lediglich die Privatgemächer von Guilhem de Poitiers nahm die Trobadora genau in Augenschein, um sich zu vergewissern. Sie waren menschenleer. Da schnaufte Beatriz erleichtert. Und sie schloß, daß ihr Gatte und das Gesinde offenbar noch beerdigt werden konnten, bevor die Rosenhecke die Burg umwuchs. Verschiedene Andeutungen des Sprengmeisters ließen übrigens vermuten, daß die Hecke jäh in den Ringgraben gestürzt und versunken war. Über den Zeitpunkt des Ereignisses hatte Beatriz nichts Genaues vernommen. Jedenfalls konnte sie auf den mit Entengrütze bedeckten Grabenwassern nur einige Rosenblätter erkennen, als sie vom Rondell des Vorwerks herabblickte. Sie badete also unverzüglich in der Zisterne, sortierte das am wenigsten zerschlissene Kleid aus ihrer Truhe, legte es an und machte sich noch am späten Nachmittag auf den Weg nach Tarascon. Die Sonne war der Gewalttätigkeit bereits abgeneigt, dem Horizont zu. Die Palisaden wogten flacher. Beatriz hatte den Mistral im Rücken. Er schob sie gen Süden. Schwalben schnitten mit ihren Flügelmessern die duftende, tönende Luft dicht über den Gräsern. Bratgerüche von Erde, Kräutern, Unkräutern und Harz. Grillengezirp. Windbeflügelt schlug sich Beatriz durch die Feldschneisen. Das Getreide wuchs ihr erst bis zu den Knien, das Rohr weit übern Kopf. Und immer weiter, sie vermutete den Süden bald drinnen. Es schien ihr, als ob sie einführe.
5. Kapitel
Laura gibt apropos eine Erinnerung zum besten, die ihr Privatleben befaßt
Elemente: Da das Thüringische keine tätigen Vulkane aufweist, beschlossen wir, uns am letzten Urlaubstag in eine Höhle zu stürzen. Die Anfahrt zur unendlichen Natur, mit der uns zu vereinigen wir aus unterschiedlichen Gründen nicht länger entraten wollten, erfolgte mittels Kleinbahn. Anhang, Verlust der Illusion, daß die Länge der Lebensgeschichte die Entscheidungsfreiheit kaum verkürze, von Umständen erzwungene Halbheiten, Notlügen und verwandte ungemäße Trivialitäten sowie die füllige Melancholie des September näherten uns der Erde. Und den anderen Elementen, Feuer, Wasser, Luft, die wir von den Triebkräften Liebe und Haß bewegt wußten. Der Zug transportierte auch Arbeiterinnen der zweiten Schicht einer Baumwollspinnerei und Pilzsucher. Er kam siebenundzwanzig Minuten verspätet am Höhlenort an. Lutz trug einen blumenbedruckten Perlonbeutel, darin Landkarten und Schirm verstaut waren. Die Pilzsucher schleppten von Riesenstein- und Birkenpilzhäuptern schaumäßig abgedeckte Körbe. Das weckte meinen Appetit. Lutz empfand den Einfall, vorher ausführlich zu essen, nicht stilwidrig. Im Gegenteil, der Wirt der örtlichen Schenke empfing uns mit Handschlag. Die Begrüßung, am Tisch vor Aufnahme unserer Wünsche getan, nicht vertraulich, sondern wie nebenbei, betonte den Abstand zu den Hergelaufenen. Die Wirtin, dickhintrig, mit männlichem Gesicht, trug Essen auf, das sie selbst gekocht hatte. Der Wirt unterhielt sich mit Stammgästen über Fußball, schenkte Bier und vermerkte die Anzahl der Gläser durch Bleistiftstriche am Rand von Bierdekkeln, die er handgefaßten Deckelstößen hoch entfallen ließ, kassierte. Als wir gemeinschaftlich drei Portionen Sauerbraten mit Mehlklößen verzehrt, zwei Gläser Bier geleert und gezahlt hatten, machten wir uns, je einen Arm überm Rücken des anderen gekreuzt, auf den Weg zur Höhle. Der war mit großen buntbemalten Schildern und holzgeschnitzten Weisern markiert. Die überirdischen Anlagen der Sehenswürdigkeit erinnerten an den örtlichen Bahnhof, waren jedoch im Unterschied zu diesem auffällig gepflegt, Bauten und Bänke wie frisch gestrichen. Neben dem Empfangsgebäude links zwei Andenkenbuden. Rechts hinter einem Steingarten etliche, zwei Meter hohen Masten aufgesetzte, bewegliche Figurengruppen in offenen Schaukästen, ähnlich den Weihnachtsbergen, jedoch windradgetrieben. An den Masten obolusfordernde Sprüche und Gebrauchsanweisungen. Gereimt. Darunter briefkastenförmige Geldkästen. Lutz warf zwei Groschen durch den Schlitz und bewegte ein Windrad entgegen der Richtung, die mit Pfeilen auf den Flügeln vermerkt war. Die an treibriemenähnlichen Bändern befestigten Holzfiguren bewegten sich rückwärts, fielen rücklings in die antipodische Phase, tauchten rücklings auf: Bergmänner. Das Blattwerk der Bäume war vollzählig. Um unsere Schuhe, die nicht aus Metall, sondern aus Leder gefertigt waren, wölkte Staub. Hitze drückte die Scheitel. Wir kauften am Schalter des Empfangsgebäudes perforierte Eintrittskarten, die wie Kinokarten von Rollen gerissen wurden. Neben der Kasse photokopierte Druckseiten eines die Höhle besingenden Balladenwerks, gerahmt, hinter Glas. Das Fenster der Stirnseite war mit Grünpflanzen garniert, die an Baumäste gebunden waren. Rechts, in der Reihenfolge der Aufzählung, Türen mit den Aufschriften »Damen«, »Herren«, »Verwaltung des Rates der Stadt«, »Höhleneingang«. Sobald die Besucherzahl zwanzig erreicht hatte, bat die Führerin um Aufmerksamkeit, stellte sich namentlich vor, gab etliche tausend Jahre als vermutliches Alter des Naturdenkmals an und riß vorm Höhleneingang Abschnitte von den Eintrittskarten. Dann drehte sie an Lichtschaltern und forderte Vorsicht. Eisengeländer abwärts. Treppen. Der Zementboden
6. Kapitel
Darin schließlich wieder ein Mann vorkommt
Beatriz ging mit dem Kopf mitten durch die Erde bis zur Kreuzung. Da die Autobahn den Feldweg schnitt. Abschnitt. Die vorüberrasenden Autos unterschieden sich von denen, die Beatriz im Schlaf vor Augen geführt worden waren, durch Lärm, Gestank und Anzahl. Benommen davon und vom jähen Auftauchen wartete sie. Auf den Augenblick, da eine Lücke im Autostrom ihr gestatten würde, die Straße zu überqueren. Sie wartete und wartete. Nach einer Weile entdeckte sie in der Ferne einen Menschen, der ebenso wie sie an der Straße stand. Er ruderte mit den Armen. Anfangs glaubte Beatriz, er winkte ihr solidarisch, weil er sich in gleicher mißlicher Lage befände, und sie erwiderte den Gruß. Als er jedoch nicht nachließ mit Rudern, deutete sie die Geste als Verkehrszeichen, das den Wunsch nach Überschreiten der Straße anzeigen sollte. Beatriz ruderte also ebenfalls. Und kurz darauf hielt auch ein Auto. Eins. Auf dem Feldweg. Ein Mann mittleren Alters reckte seinen Kopf durchs offene Wagenfenster, musterte sie und fragte dann nach ihrem Reiseziel. »Tarascon«, antwortete Beatriz verblüfft. »Na also«, sagte der Mann. Und ehe Beatriz noch recht begriff oder sich wundern konnte, saß sie schon im ersten Auto ihres Lebens. Und fuhr. Und hatte ein Autoheck vor sich. Ständig. Nicht immer dasselbe. Seltsame Musik aus dem Autogewände. Die von seltsamen Nachrichten unterbrochen wurde. Beispielsweise erzählte eine männliche Stimme: »Als ich am Freitagnachmittag durch die Rue de la Harpe zum Boulevard Saint-Germain kam, wollte ich aus persönlichen Gründen den Boulevard Saint-Michel hinaufgehen. In Höhe des Museé de Cluny aber standen, mit dem Rücken gegen mich, behelmte und bewaffnete Polizisten und riegelten den Durchgang ab. Weiter oben, an der Rue des Ecoles – so etwas hatte ich noch nie gesehen -, wurden Polizeiwagen von der Menschenmenge mehr oder minder am Weiterfahren gehindert und mit Pflastersteinen beworfen, fünf oder sechs auf einmal kamen durch die Luft geflogen. Ich mußte den Boulevard Saint-Germain in Richtung Saint-Germain des Prés gehen und dann die Nebenstraßen bis ganz hinauf. Dort, an der Rue Soufflot, standen mehrere tausend Studenten, unter ihnen viele Mädchen. Man hatte den Eindruck, als könnten sie gar nicht anders. Viele hatten Bücher und Skripten unterm Arm. Manche kamen offensichtlich aus Nanterre, wo die Fakultät, wie mittags im Radio gemeldet wurde, geschlossen war. Nun erfuhr ich, die Polizei habe links orientierte Studenten, die sich im Hof der Sorbonne versammelt hatten, um gegen die faschistischen Machenschaften rechtsradikaler Gruppen zu protestieren, verhaftet, und auch die Sorbonne sei geschlossen worden. Man konnte deutlich unterscheiden: einige wenige, etwa dreißig, die in Höhe der Sorbonne die Polizisten der vordersten Linie herausforderten; dann alle jene, die ganz aus der Nähe zuschauten, um sich im gegebenen Moment einzumischen – die einen, bereits nervös, rissen die Verkehrsschilder oder die Schutzgitter der Bäume heraus, andere wiederum riefen dazu auf, Ruhe zu bewahren, nichts zu improvisieren und statt dessen lieber für Montag eine gezielte Aktion gegen die Polizeiprovokation vorzubereiten; und schließlich die große Mehrzahl, die untätig mit ihren Büchern und Heften herumstand, vielleicht ratlos, aber durchaus fröhlich und im übrigen entschlossen, nicht auseinanderzugehen. Sobald die Polizei angriff, fluteten die Studenten zurück, nahmen aber ihre Stellung sogleich wieder ein, wenn sich die Polizisten auf ihre Ausgangslinien zurückzogen. Der ganze Verkehr war so gut wie lahmgelegt«. – »Zustände«, sagte der Autofahrer. Beatriz erfreute ihn mit bewundernden Blikken. Die galten, da Schönheit geradezu fehlte, nicht äußeren Vorzügen, sondern inneren. Ethischen. Kein hohler Kavalierzierat – Hilfsbereitschaft. Selbstverständliche Brüderlichkeit. Schwesterlichkeit. Schöne Menschengemeinschaft. Beatriz bewunderte einen Repräsentanten. »Und ich hatte schon gefürchtet, ich wäre zu früh …« sagte Beatriz. »Im Gegenteil«, sagte der Mann, bog links ab, hielt, senkte die Sitzlehnen und warf sich auf die Trobadora. Sie stieß ihn zurück. Der Mann sagte: »Mach keine Faxen.« Sie wehrte sich. »Umsonst ist der Tod«, sagte der Mann schnaufend und ob sie aus dem Mustopf käme. Sie wehrte sich mit aller Kraft. Da schlug ihr der Mann die Lippen blutig, überwältigte sie mit dem Gewicht seines fetten Leibes, beschimpfte sie unflätig und erleichterte dabei seinen Beutel. Wie man eine Notdurft verrichtet. Als er seine Kleider geordnet hatte, erkundigte er sich sachlich, wo er Beatriz in Tarascon absetzen sollte. Sie stieg aus. »Dumme Gans«, sagte der Mann und reihte seinen Wagen wieder ein in den Autostrom, der sich lärmend und stinkend durch die Felder wälzte.
7. Kapitel
Von der Oberwelt fährt ein Bunker mit zwei abgesetzten Göttinnen herab
Die Trobadora wütete in schrecklichen Gedanken und fluchte: »Himmelsakra.« Unwillkürlich. Nicht, weil sie sich irgendwelche Hoffnungen machte. Aber ebenso wie vor achthundertacht Jahren fiel ihr plötzlich ein Bunker vor die Füße. Er war aus Beton gefertigt, würfelförmig und etwa acht Kubikmeter groß. Vor der eisernen Bunkertür zwei Stangen, die als Riegel seitlich in einbetonierten Haken klemmten. An der Tür klebte eine Öffnungsanweisung. Vergitterte Luftlöcher in drei Würfelflächen. Aus den Löchern tönte zweistimmiger Gesang. Beatriz hob wie einst anweisungsgemäß die Eisenstangen aus den Haken. Die Tür wurde von innen aufgestoßen – auch wie einst. Und schon schwoll der Gesang an zu jener eifernden Entschiedenheit, die Beatriz sogleich wieder unangenehm berührte. Sie verbarg aber ihre Abneigung hinter Lächeln und hörte sich einige programmatische Lieder an. Die erste Stimme wurde von der göttlichen Tochter gesungen, die zweite von der göttlichen Mutter. Gesperrte Münder, einwärts gerichtete Blicke, Persephone und Demeter beschrieben tatsächlich noch immer in den gleichen Rache- und Zukunftsgesängen die Wiedereinführung des Matriarchats. Auf denselben Strohsäcken? Andere Möbel hatte das Verlies nicht. Götter können notfalls auf Speise und Trank verzichten, sind also auf sanitäre Einrichtungen nicht angewiesen. »Sie haben uns gerufen?« fragte Persephone nach Beendigung eines Liedes. »Ja«, sagte Beatriz, »das heißt, eigentlich nicht, genauer gesagt: nicht direkt, aber es wäre natürlich herrlich, wenn Sie mir in mißlicher Lage …« – »Kaum auferstanden und schon schlapp«, erwiderte Persephone streng. Dann schimpfte sie auf Melusine und Konsorten, denen es noch immer nicht gelungen wäre, die Göttinnen wieder an die Macht zu bringen. Persephone nannte die erwähnten Frauen saumselig und vertragsbrüchig. Denn sie hatten sich durch Pakt verpflichten müssen, als Gegenleistung für Lebensverlängerung die alten matriarchalischen Zustände wieder einzuführen. Nur wer wie Beatriz de Dia zu praktischer politischer Arbeit ungeeignet erschien, durfte schlafen, wenn er sich verpflichtete, nach dem Erwachen der Linie entsprechend zu arbeiten. Den aktiven Mitgliedern der von Persephone nach und nach geschaffenen strategischen Organisation oblag zusätzlich, die passiven, schlafenden Mitglieder hypnopädisch zu schulen und von der Linie zu überzeugen. Als die schöne Melusine der Organisation beitrat, hatte sich dort die Opposition bereits formiert. Relativ unbehelligt, die inhaftierten Göttinnen konnten gut Beschlüsse fassen, schlecht kontrollieren. Die Opposition tagte als Tafelrunde zwischen Kaerllion am Usk und der Zukunft, aber etwas näher an Kaerllion. 1871 gewann die Opposition die Mehrheit. Die schöne Melusine gehörte der Opposition seit 1309 an. Beatriz wurde von der Schwägerin hypnopädisch von den reaktionären Bestrebungen der Göttinnen unterrichtet und entschied sich auch schnell für die dritte Ordnung. Die weder patriarchalisch noch matriarchalisch sein sollte, sondern menschlich. Bei der illegalen Arbeit für diese menschliche Ordnung nutzte die Opposition die legalen göttlichen Wunder. Die beschränkt waren. »Unsere Tatenzuteilung ist noch immer kontingentiert«, klagte Persephone. Ihr Gesicht und die Hände waren blau, aber dunkler als das Gewand. Demeters Grundfarbe war grün. Beatriz fragte, ob Persephone mit ihrem Bunker ein Loch ins Weizenfeld geschlagen hätte, nur um zu lamentieren. »Unsere Tatenzuteilung ist noch immer willkürlich kontingentiert«, lamentierte Persephone. »Manchmal erhalten wir drei oder vier Berechtigungsmarken jährlich, manchmal nur eine. Es gab aber auch schon Jahre, wo uns Herr Gott gar kein Wunder genehmigte. Umbringen kann er uns nicht, weil wir unsterblich sind, das ärgert ihn. Aber tatenlos kann er uns halten – das ist schlimmer als tot. Verlieren Sie also bitte keine Zeit mit Flüchen, sondern tun Sie was gegen seine Alleinherrschaft, damit wir bald aus diesem Verlies rauskommen. Der Himmel ist für Frauen da.« Den letzten Satz wiederholten Persephone und ihre Mutter Demeter anschließend siebenundzwanzigmal in einem Kanon. Dabei landeten zwei Engel exerziermäßig. Sie schlossen die Tür, legten die Stangen vor und schlugen an Eisenösen, die aus den Betonwänden ragten, vier Taue. Dann hob ein Engel schneidig den rechten Arm, und der Bunker entschwebte.
8. Kapitel
Betrübnis und Jauchzen
Als die oberweltliche Erscheinung verschwunden war, ahnte Beatriz, daß die schöne Melusine sie sehr oberflächlich über die Welt unterrichtet hatte. Und sie beschloß, sich auf allerlei Überraschungen gefaßt zu machen. Wobei sie den Himmel absuchte. Nach einer Weile zeigte sich ein Flugzeug. Aber auf die schöne Melusine wartete Beatriz vergebens. Sie beneidete die aktiven Organisationsmitglieder jetzt heftig um deren schwarzkünstlerische Fähigkeiten. Beistandslos und von Fahrtwinden an den Rand gedrängt, setzte Beatriz ihren Weg nach Tarascon fort. Niedergeschlagen. Rachebrütend. Nur der Glaube an die Freßlust des Reptils sowie die Unfruchtbarkeit ihres achthundertachtunddreißigjährigen Leibes ließen sie nicht verzweifeln. Als die Dämmerung hereinbrach, erreichte Beatriz die Abtei von Montmajour. Sie klopfte an verschiedenen Türen, rief, pfiff. Schließlich wurde aber doch geöffnet. Beatriz bat die Schwester um ein Nachtlager. Es war aber keine Schwester, sondern der Museumsdirektor. Er sprach: »Wir sind kein Gammlerlager, wir sind eine historische Kostbarkeit.« – »Ich bin auch eine historische Kostbarkeit«, entgegnete Beatriz und versuchte, sich zu erklären. Der Mann begriff aber nichts. Bald hielt er sie für eine Studentin auf der Flucht und fragte, was vom Quartier Latin übriggeblieben wäre. »Von welchem Quartier Latin?« fragte Beatriz. Da nickte der Mann verständnisvoll, versprach, keine weiteren Fragen stellen zu wollen, und führte Beatriz in seine Dienstwohnung. Vor einen Kasten. Der zeigte bewegte Bilder. Die Gattin des Museumsdirektors strickte vorm Kasten. Ab und zu ließ sie die Handarbeit fahren und brach in Worte aus. Beatriz konnte menschengefüllte Straßen erkennen, aufgerissene Straßen, von Wällen versperrte Straßen. Ein Wall wurde hauptsächlich von einem umgestürzten Bus gebildet. Hinterm Bus tauchten Köpfe auf. Auch Arme, die Steine schleuderten. Männer mit Helmen, Masken und Schilden warfen Stäbe vor und hinters Hindernis, die rauchten. Enthusiastische Stimmen kommentierten die bewegten Bilder. Die Kommentare wurden häufig durch Husten unterbrochen. Auch durch Lieder. »Dieser Ausbruch von Lebensfreude«, sagte eine Stimme, »dieser begeisterte Elan, diese brüderliche Atmosphäre. Die Straßen des Quartier Latin voller Menschen. Jeder spricht mit jedem, völlig enthemmt. Jeder hört jedem zu. Eine hoffnungsvolle, festliche Stimmung.« Als brennende Autos zu sehen waren, sagte die Gattin: »Wo wird das enden.« Der Museumsdirektor hob und senkte mehrmals die Schultern und gab ein Urteil ab über den kulturhistorischen Wert von Paris. Dann bot er Beatriz einen sicheren Heuboden an. Als Beatriz an in Felsen gehauenen leeren Sarkophagen vorbeigeführt wurde, schlug sie den Heuboden aus. Sie probierte die Höhlungen. Alle waren zu kurz. Schließlich nächtigte Beatriz unter einem Oleanderbusch des Klosterhofs. Sie lag schlaflos, solange der Vollmond blank am Himmel stand. Denn sie sorgte sich um die schöne Melusine. Hatte die sich an einem brennenden Auto die Flügel versengt? Später zogen Wolken auf, verschleierten den Mond, zogen Beatriz dann doch in Schlaf. Er war tief, voll wirrer Träume. Als sie erwachte, schien die Sonne bereits in den Hof. Und sie entdeckte an der Kapitellverzierung einer Kreuzgangsäule den Kopf vom Tarasc. Aus jedem Mundwinkel hing ihm ein Menschenbein. Der Anblick stärkte Beatrizens Zuversicht. Der Zustand ihres Gewands freilich erschien, bei Licht besehen, beklagenswert. Bei der Rauferei mit dem Autofahrer war das mürbe Gewebe vielerorts zerfahren, ein bodenlanger Ärmel war halb herausgerissen, rechts schleppte der Rock, nur die Stickereien hatten widerstanden. Aus Scham verbarg sich Beatriz vor anrückenden Touristen, deren Stimmen bereits die Gewölbe erfüllten. Da sie aber keine Hintertür finden konnte, war sie schließlich doch gezwungen,
9. Kapitel
Das nach dem LSD-Traum weitere glückliche Zufälle bringt und ein altes Lied von Beatriz de Dia, deutsch nachgedichtet von Paul Wiens
Beatriz erwachte im Straßengraben. Gesengt, gestaucht von der Sonne, erhoben vom Blau der Visionen. Seltsam friedfertig. Zufrieden. Gesättigt von Harmonie. Nur der leibliche Hunger trieb die Trobadora bald auf und voran. Sie betäubte ihn einstweilen mit Rhônewasser. Vor der Brücke, die über den Fluß in die Stadt Tarascon führte, hielt ein Bus. Touristen fielen raus. Der Mistral hüllte sie in Staubwolken. Die Reiseleiterin schrie das Programm: Besichtigung der Burg, der Kirche, Mittagessen. Der letzte Programmteil inspirierte Beatriz. Mit forscher Arglosigkeit, die ihr als Traumrest geblieben war, gesellte sich die Trobadora zur Truppe. Die Staubwolkentarnung verhalf ihr zu freiem Eintritt in die Burg des guten Königs René von Provence. Im Burghof hätten die letzten Trobadore ihre Lieder gesungen, behauptete der Burgführer. Die Zuhörer hätten in der Loggia und in den Fenstern gelauscht. Beatriz unterbrach das Erklärungsgerede des Burgführers mit drei Entschuldigungen und bat die Touristen in die Loggia. Sie folgten ihrer Bitte willig, wohl in Erwartung der im gekauften Programm vorgesehenen Überraschung. Der Burgführer und die Reiseleiterin, die sich gegenseitig der Initiative verdächtigten, zogen sich mit einer Zeitung unter die Kolonnaden zurück. Inzwischen besann sich die Trobadora, von Hunger inspiriert, eines Lieds, das sie vor achthundertvierzehn Jahren geschrieben hatte. Nach jenem folgenschweren Unfall mit dem Liebestrank. Als sie Raimbaut d’Orange bereits umgearbeitet hatte, um ihn bedichtenswert zu machen. Eine simple pragmatische Maßnahme. Nicht mal nur von weiblichen Dichtern praktiziert. Aber die schöne Melusine hatte gleich geschrien: Irreführung der Öffentlichkeit. Als ob denkfähige Menschen ernstlich glauben würden, eine Beatriz de Dia könnte sich derart für einen Menschen erhitzen, der Pfauenfedern nicht nur am Hut, sondern auch am Vers zu tragen pflegte, ja an der Seele. Wenn die Realität von Raimbaut nicht mit dem Bild übereinstimmte, das sich Beatriz kurz entschlossen von ihm gemacht hatte – um so schändlicher für die Realität. Der Trobadora knurrte der Magen. In der Loggia drängelten die Amerikaner schon eine Weile um vordere Plätze. Beatriz spreizte ihre Ellenbogen und sang:
»Den ich verlor, dem schönen Herrn,
läuft nach mein Lied aus lauter Leid,
ich will, daß wisse alle Zeit,
wie ich ihn hielt zum Schluchzen gern.
Denn um die Liebe arg betrogen,
weil meine ich vor ihm verbarg,
bin ich bestraft und einsam arg,
ob nachts im Bett, ob angezogen.«
Der Hofschacht gab der Stimme der Trobadora Größe. Die Touristen schoben sich zwischen den gotischen Säulen der Loggia. Der Burgführer und die Reiseleiterin traten mit ausgebreiteter Zeitung aus den Kolonnaden. Beatriz sah hinauf zum quadratischen Himmelsdeckel, der auf dem Schacht lag. Der Deckel war cölinblau. Doch undicht. Bisweilen langte eine Bö fauchend ins Gemäuer. Beatriz wartete, bis das Gemurmel der Touristen und der Sturm abgeflaut waren, und sang die zweite Strophe:
»Sehr möcht ich eines Abends ihn
in meinen nackten Armen schaun
und meine Brust ihm anvertraun,
die seinem Haupt als Kissen dien.
Das würde mehr an Lust mir geben, als Floris Blancaflora gab.
Sein sind mein Haar, Hauch, Herzensschlag, sein meine Augen und mein Leben.«
Die Touristen klatschten und warfen Geldstücke auf die Steinplatten des Hofs. Beatriz bat um Ruhe für die dritte Strophe und Papiergeld, indem sie sich vorstellte: als garantiert allerletzten und garantiert allerersten weiblichen Trobador. Dann sang sie:
»Freund, schön und gut und sinnereich,
hätt ich Euch bloß in meiner Macht
und könnte mit Euch eine Nacht
verliegen und verküssen weich,
wißt, daß dann groß mein Hunger wäre,
Euch gleich zu nehmen zum Gemahl,
weil Ihr versprächet, allemal
mir so zu tun, wie ich begehre.«
10. Kapitel
Das der LSD-Offenbarung Abbruch tut
»Der Tourismus ist der Krebs unseres Landes«, las Beatriz auf dem Weg zum Restaurant an einem Giebel. Der Spruch erschien ihr ungerecht, weil den soeben gemachten guten Erfahrungen widersprechend. Sie speiste Muschelsuppe, Artischokken mit Sauce vinaigrette, Pferdesteak, provenzalische Tomaten und geeiste Melone für 10 Dollar. Als sie die übriggebliebenen 2740 Dollar in einer Filiale der Bank von Frankreich zum Tageskurs gewechselt hatte und die Franken verstaut waren zwischen den Brüsten, kam ihr der ursprüngliche Zweck des Stadtbesuchs aber doch wieder in den Sinn. Wegen der bekannten Hellhörigkeit des Untiers hielt es Beatriz für angebracht, sich flüsternd nach dem derzeitigen Aufenthalt des Tarasc zu erkundigen. Ein alter Mann verwies sie laut an die Feuerwehr. Erbot sich sogar, Beatriz bis zum Spritzenhaus zu begleiten. »Kommen Sie aus Paris?« fragte der alte Mann unvermittelt. »Nein«, antwortete Beatriz natürlich. »Haben Sie Verwandte in Paris?« – »Meine Schwägerin muß dort sein, warum?« – Den Greis irritierte die Frage einen Augenblick, dann überwältigte ihn wieder die Neugier. Und er erkundigte sich, ob es Beatriz gelungen wäre, mit der Schwägerin zu telefonieren, er hätte nämlich bis jetzt noch keine telefonische Verbindung zu seinen Pariser Verwandten herstellen können. »Vielleicht haben sie schon das Telegrafenamt angezündet?« – »Ja«, sagte Beatriz, die andere Sorgen hatte, mechanisch. Kein weiter Weg. Aber Siesta. Leere, hitzedröhnende Straßen. Höchstens Hunde auf dem Pflaster. Sogar der Mistral war erstorben. Schmale Schatten. Beatriz ließ dem Begleiter die schmalen Streifen. Was ihr da allerorten aus den Poren sickerte und das Geld weichte, war überwiegend Angstschweiß. Nur mit Mühe konnte sie ihren Kleinmut verbergen. Beschämt über die Unerschrockenheit des Alten, die sie sogleich seiner Generation als allgemeine Tugend anrechnete. Als Beatriz das Wort »Tarasc« in großen, auf Leinwand geschriebenen Lettern über dem Spritzenhaustor erblickte, wandelten sich jedoch ihre Mutmaßungen. Beatriz nahm jetzt an, die Leute von Tarascon beziehungsweise von der Provence beziehungsweise von der Welt wären ihr zuvorgekommen und hielten den Tarasc mittlerweile als Haustier. Zur Stadtreinigung. Landreinigung. Weltreinigung. Sinnreiche Vernutzung des Niederen zu höheren Zwecken. Beatriz empfand sich hypnopädisch fehlinformiert und ihre Offenbarung in den Rang einer Erfindung gesetzt, die zum zweitenmal gemacht worden war. Was aber praktisch für das unmittelbare Vorhaben der Trobadora bedeutungslos blieb. Gottlob. Der Eingang war mit rotem Tuch verhängt. Dahinter schlief ein Greis am Schreibtisch. Beatrizens Begleiter schlug auf den Schreibtisch und sagte: »Alfonse.« Der Greis fuhr auf und sagte: »Ein Franc.« – »Pro Person?« fragte Beatriz. Der Greis zwirbelte seinen Schnurrbart und antwortete: »Gewiß, Madame.« Da bezahlte Beatriz drei Francs, einen für den Ingenieur, einen für den Sprengmeister und einen für den Autofahrer. Der Greis erhob sich, strich dankend das Geld ein und sprach einführende Worte in südfranzösischem Dialekt. Die Beatriz befremdeten. Sie erfuhr unter anderem, daß der Tarasc jährlich einmal durch die Straßen gefahren würde. »Im Käfig?« fragte Beatriz. »Im Festzug«, sagte der Greis und balancierte wieder eine Weile auf der Endsilbe. Dann schob er Beatriz in die Remise. Wo der Drachen stand. Aus grün gestrichenem Pappmaché gefertigt, die roten Stacheln aus Schaumgummi. Der gehörnte Kopf trug eine schwarze Langhaarperücke. Beiderseits des menschlichen Fratzkopfs zwei kostümierte Schaufensterpuppen. Die Beatriz als Schloßwachen des guten Königs René betrachten sollte. »Wir feiern den Tod der sagenhaften Bestie jedes Jahr«, sagte der Greis und schlug auf die grüne Pappe, »kein Südfranzose läßt sich einen Anlaß zum Trinken entgehen, erleben auch Sie das hinreißende Schauspiel, Madame, und betrachten Sie sich hiermit als offiziell eingeladen, Tarascon erwartet Sie mit seinen Sehenswürdigkeiten, nähere Auskünfte im Touristenbüro um die Ecke.«
11. Kapitel
Protokoll eines Interviews, darin Irmtraud Morgner (I. M.) den Dunkelheiten der bisher angeführten Zeugnisse rechercherlich zu begegnen versucht, indem sie Laura Salman (L. S.) Fragen zur Person stellt
I. M.: Da die Frau für den höfischen Ritter die Quelle aller Tugenden darstellte, aus der er in eigenem Bemühen zu schöpfen hatte, war die Frage, ob die Initiative in der Liebe dem Mann oder der Frau zukomme, für den hohen Minnesang a priori entschieden. Konnte sich eine standesgemäß erzogene Frau unter diesen Umständen überhaupt als Liebessängerin erkennen?
L. S.: Als Minnesängerin. Aber wer von uns hat nicht in jungen Jahren oder Augenblicken die Historie verlassen, dieses männliche Meer von Egoismus, wer ging nicht, als er noch ungebrochen war von Erfahrungen, mit dem Kopf durch die Wand, die dieses Meer trennt von der Zukunft. Denn der Augenblick Gegenwart, drin sich die beiden Ewigkeiten Vergangenheit und Zukunft berühren, erscheint mitunter vernachlässigbar. Beflügelt von Harmonien und Marxismus, überwanden wir die Ruinen von Chemnitz, indem wir flogen, jeder FDJler ein Sportler. Start von der Schulsternwarte. Zurück blieben die Reaktionäre, noch nicht entlarvte Lehrer, die ihre Gesinnung in Schikanen abreagierten, vom Klassenfeind vernebelte Schüler, die sich wie Hunde mit gesenkten Köpfen von einem materiellen Mangel zum anderen schnüffelten und nie die Kraft fanden, einen Blick auf die großen Gegenstände zu werfen: von der Schulsternwarte starteten nur Leute mit Charakter. Organisiert. Revolutionär sein setzt unter anderem eine bestimmte Unbedingtheit des Charakters voraus. Im Fluge wurde die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abgeschafft …
I. M.: … un die Ausbeutung der Frau durch den Menschen …
L. S.: … fiel in der Eile nicht auf, ein für allemal wurde Ordnung gemacht von Grund auf, die abgebrannte Stadt forderte gründliche Pläne geradezu heraus. Die steilsten Flüge gelangen an Feiertagen oder zu Wahlen. Voran der Akkordeonspieler, unter Absingen von Volks-, Kampf-, Partisanen- und Revolutionsliedern in russischer, spanischer, italienischer, englischer und französischer Sprache erreichten wir schnell die idealen Gefilde. Darin sich Empfindungen einstellten wie beim Betreten des elften Saals im Musée de Cluny zu Paris. Der Saal ist rund. Als einziger, die ausgestellten Gegenstände verlangen die ideale Vollkommenheit des Kreises. Ich rede von der berühmten Wandteppichfolge »Die Dame mit dem Einhorn«. Der Katalog behauptet, in fünf symbolhaften Darstellungen der menschlichen Sinne würde das Leben einer vornehmen Dame vorgeführt nebst der Sage vom wilden Einhorn, das bekanntlich nur von einer reinen Jungfrau gezähmt werden könnte. Der Sinn des sechsten Teppichs aber soll den Wissenschaftlern bis heute verborgen geblieben sein. Das blaugoldene Zelt nämlich, das vom Löwen und vom Einhorn offengehalten wird, damit die mittelalterliche Dame ans Licht kommt, trägt die Inschrift »A mon seul désir«. Was soviel heißt wie »Meinem einzigen Verlangen«. Ich will das von den Wissenschaftlern entschlüsselte scholastische Sujet nicht in Zweifel ziehen, Jean Paul war auch das erste beste Sujet gerade recht. Seine Kunst entfaltete sich in der Abschweifung. Da nun aber Kunst nur mit Leben bezahlt wird und in den Teppichen unzählige Frauenleben aufgehoben sind, die Leben der Knüpferinnen nämlich, mußte die Allegorie so eindrucksvoll verblassen. Zugunsten einer exzessiven Friedlichkeit. Der selbst Raubtiere unterliegen. Nie ist mir ein sanfteres Ideal weltlicher Harmonie vor die Augen gekommen, nie die Sehnsucht nach unkriegerischen Zuständen so rein und radikal: Die männliche Variante ist unterschlagen. Ein aus Verzweiflung gewachsenes Sehnsuchtsbild also – extreme Zustände bringen extreme Utopien hervor. Wer von uns hat nicht in zornigen Augenblicken oder Jahren sich verweigert, wer ist nicht als Schiffbrüchige des egoistischen Meeres, seinem einzigen Verlangen folgend, an dieses sanfte Land gegangen, darin Pflanzen, Getier und eine Menschenart schwesterlich hausen …
I. M.: Hatten Sie etwa als Schülerin bereits Verweigerungsanwandlungen?
L. S.: Im Gegenteil – obgleich meine Mutter zu Hause nichts zu sagen hatte -, ganz im Gegenteil. Aber als ich unlängst den elften Saal des Musée de Cluny betrat, wars wie ein Flug hinauf in altvertraute absolute Empfindungen. Die einst die militante Friedenssehnsucht nach dem zweiten Weltkrieg in uns wuchern ließ, sobald wir unsere Leiber breiteten über die sächsische Hügellandschaft …
I. M.: Männliche Leiber?
L. S.: Menschliche Leiber, in der Frage nach der Position geistert der Verdacht, daß aktive Beziehungen zur Welt a priori geschlechtsbedingt sind. Haben Sie nie auf einem erzgebirgischen Fichtenwalde gelagert oder wenigstens eine Stadt von der Größe Meißens angesetzt und geleert auf einen Zug?
I. M.: Alle Kinder legen sich auf das, was sie lieben …
L. S.: Also Sie sind kein Dichter.
I. M.: Moment mal …
L. S.: Wer sich diese und andere Fähigkeiten abdressieren läßt …
I. M.: Die weibliche Rollenerziehung dressiert diese und andere Fähigkeiten ab …
L. S.: … die dichterischen Fähigkeiten …
I. M.: … die schöpferischen. Wissenschaftlerinnen sind nicht weniger dünn gesät.
L. S.: Ich …
I. M.: Heute. Aber meine Frage bezieht sich auf damals. Kurz und gut: Beatriz de Dia ist ein Wunschbild.
L. S.: Eine historische Erscheinung.
I. M.: Also ein typischer Fall von Legendenbildung mittels Gesichtskorrektur. Warum soll eine Frau ihr Vorleben nicht nach Belieben umarbeiten dürfen, da doch Staaten und Völker von je so verfuhren.
L. S.: Beatriz de Dia war ein Trobador.
I. M.: Ein Mann, der weibliche Rollengedichte schrieb.
L.S.: Nein.
I. M.: Paradox.
L. S.: Zunächst nicht.
I. M.: Ein mittelalterlicher Liebessänger weiblichen Geschlechts ist paradox.
L. S.: Ja. Beatriz fiel doch als Minnesängerin schon reichlich aus dem Rahmen.
12. Kapitel
Neue unerhörte Überraschungen, auf die sich Beatriz beim besten Willen nicht gefaßt machen konnte
Nach der Entdeckung im Spritzenhaus fühlte sich die Trobadora erleichtert. Was ihr Kopf als beschämende Kurzsichtigkeit wertete. Denn wer konnte schnell für den Tarasc einspringen und den Ingenieur samt Sprengmeister fressen, um Almaciz zu retten? Wo lebte das nächste beste Untier? Mit welchen Verkehrsmitteln war es zu erreichen? Beatriz verabschiedete sich von den beiden alten Männern und bückte sich nach einer Zeitung. Die auf der Straße lag. Dann ging sie hinüber zur Rhônemauer, um darauf eine Kopfbedeckung zu falten. Die Mauer war heiß. Die Druckerschwärze färbte Beatrizens Hände. Erneut auffrischender Wind ließ jedoch den Sonnenschutz nicht lange auf dem Scheitel der Trobadora. Das Papier wurde ihr wieder und wieder in die Hände gezwungen, wegwerfen widerstrebte ihr aus umweltästhetischen Gründen, also daß sie schließlich das Blatt zu besichtigen begann. Es nannte sich »France Soir«. Beatriz las zum Beispiel: »Im Quartier Latin und im Quartier Saint-Germain-des-Prés gingen Tausende von jungen Leuten sechzehn Stunden lang gegen die Ordnungskräfte vor. Bilanz: 460 Demonstranten und 205 Polizisten verwundet und in Krankenhäuser aufgenommen. 475 Verhaftungen, darunter 35 Ausländer. 7 Autobusse und rund 20 Personenwagen beschädigt. Die Geplänkel zwischen Studenten und Polizisten begannen gegen 9 Uhr morgens und dauerten den ganzen Tag an. Gegen 20 Uhr arteten sie plötzlich zu einer regelrechten organisierten Schlacht aus. Mehrere hundert behelmte und mit Schlagstöcken bewaffnete Schutzleute und Mobilgardisten mit ihren Karabinern, CRS und Spezialeinheiten, die Brotbeutel voll Granaten, sahen mit einemmal etwa zehntausend junge Demonstranten gegen sich anbranden, die vom Meeting auf der Place Denfert-Rocherau zurückkehrten. Die Straße gehörte, zum erstenmal seit langer Zeit, den Demonstranten. Die Vertreter der Ordnung zogen sich zurück. Gegen 22 Uhr nahm die Schlacht ein Ende. Vereinzelte Kämpfe gingen aber da und dort weiter und dauerten bis nach Mitternacht. In der Rue de Rennes, von der Kirche Saint-Germain-des-Prés bis zum Bahnhof Montparnasse, sammelte man überall noch Verwundete auf. Spezialisten der Polizeipräfektur begannen bereits, die Hauptstraßen des Quartier Latin aufzuräumen und ihre Lastwagen mit den Trümmern aller Art zu beladen, die die Fahrbahnen versperrten. Das letzte Karree der Demonstranten in Stärke von 200 Studenten, unter die sich eine Gruppe von schwarzen Lederjacken gemengt hatte, hielt noch den oberen Teil der Rue de Rennes besetzt. Da tauchten vom Boulevard Saint-Germain her mit Sirenengeheul etwa 30 Polizeiwagen auf und bewegten sich auf die Demonstranten zu. Bevor sie sich endgültig zurückzogen, schleuderten die Hüter der Ordnung noch einige Tränengasgranaten gegen die Fenster der Wohnungen, aus denen man sie während des ganzen Abends mit diversen Wurfgeschossen bombardiert hatte.« War die schöne Melusine verschollen, weil sie an solchen Straßenschlachten teilnahm? Fanden solche Straßenschlachten nur in Paris statt? Beatriz lehnte sich über die heiße Mauer, starrte ins Wasser und betrachtete grübelnd die Strudelmuster. Konnten überhaupt Straßenkämpfe stattfinden zu einer Zeit, da Beatriz vorfristig geweckt wurde? Schließlich wußte die schöne Melusine doch, daß Beatriz riesige Arbeitsschulden auf sich genommen hatte, um menschliche Zeiten zu erreichen. Das heißt: harmonische, ihrem Beruf geneigte. Waren die jungen Leute etwa schon der harmonischen Zustände überdrüssig? Beatriz fühlte sich im Stich gelassen von der Schwägerin. Die Maria von Lusignan hieß, weil Raimund von Lusignan sie geheiratet hatte. Den Namen Melusine hängten ihr Raimunds Schlösser Melle und Lusignan an, die sie abwechselnd bewohnt hatte. Da die schöne Melusine es einst liebte, sich in ihre Gemächer einzuschließen und politische Bücher zu lesen, was zu ihrer Zeit einen seltenen und höchst eigensinnigen Geschmack voraussetzte, war man bald überzeugt, daß sie geheime Künste und Zauberei triebe. Und bald hieß es, daß sie sich jeden achten Tag wenigstens zur Hälfte in einen Drachen verwandelte und flöge. Genügte diese Hälfte nicht, um die fossilen Ungeziefer zu vertilgen? Auf Almaciz hatte die Hofgesellschaft Melusine oft jammern hören. Im Kamin, da weinte und klagte die machtlose Politikerin, weil sie nicht zu ihren beiden Kindern kommen konnte. Beatriz war froh, daß sie keine Kinder hatte zurücklassen müssen, als sie, dem Beispiel der schönen Melusine folgend, die mittelalterliche Welt der Männer verließ. Freilich mit anderen Mitteln. Der tyrannische Raimund von Lusignan aber, der seiner klugen Frau die beiden Söhne nahm und einem Feldhauptmann zur Erziehung anvertraute, wurde bei einem Turnier aus dem Sattel gehoben und brach sich das Genick. Erinnerungsbeflügelt von dieser Gerechtigkeit machte sich Beatriz auf, weil sie die schöne Melusine keinesfalls verfehlen wollte. Nicht zuletzt, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Denn sie hatte Beatriz weder vom Ableben des Tarasc unterrichtet noch von Geschehnissen, die gewissen, Beatriz unverständlichen Zeitungsmeldungen vorausgegangen sein mußten. Für derartige unverzeihliche Nachlässigkeiten würde sich die Herumtreiberin am Kamin des Rittersaals von Almaciz bald zu verantworten haben. Vielleicht schon in der kommenden Nacht. Beatriz stahl also einen Roller und eilte zurück. Als sie gegen Abend ankam, war die Burg verschwunden.
13. Kapitel
Das in authentischer Reihenfolge eine Übersicht der Flüche bringt, die Beatriz de Dia auf der Straßenbaustelle, vormals Almaciz, nach und nach entfuhren
Mistkrücken – Dreckdampfer – Stinktiere – Saubatzen – Bettscheißer – Arschkriecher – Windbeutel – Stumpfzähne – Tagediebe – Lümmel – Krachwedel – Hosenhuster – Hundsfötter – Lausewenzel – Flohbeutel – Galgenschwengel – Rotzlöffel – Schindäser – Maultaschen – Saufnickel – Prahlhänse – Taugenichtse – Flegel – Rotzer – Laffen – Deppen – Freßbälge – Vogelscheuchen – Bärenhäuter – Pinsel – Glatzköpfe – Kaulquappen – Galgenvögel – Hornochsen – Raubritter – Halsabschneider – Lumpen – Erzgauner – Ausbeuter – Mannsbilder.
14. Kapitel
Beatriz schlägt ein barmherziges Anerbieten ab, was ihr übel ausschlägt
Als die Sonne hinter den kräuterbewachsenen Hügeln verschwunden war, wurde die Baustelle mit Scheinwerfern erleuchtet. Bulldozer schürften Halden auf mit Schilden, Bagger trugen Halden ab mit Greifern, auf Lastwagen wurde Erde bewegt, auf Förderbändern, Schaufeln; beaufsichtigt von französischen Ingenieuren und Polieren, arbeiteten algerische, türkische, griechische und spanische Straßenbauarbeiter. Die Nationalitäten wurden Beatriz von einem Kalfaktor genannt, der die verstörte Trobadora vom Wohnwagen aus beobachtet hatte. Von einer Burg Almaciz wußte er nichts. Wollte auch keinen Ingenieur und keinen Sprengmeister kennen, auf die die Personenbeschreibung der Trobadora zutraf. Doch war er sonst freundlich, lud Beatriz in die Baubude, gab ihr Schinken, Brot und
15. Kapitel
Darin Laura die von I. M. angeforderte Beweisführung liefert
1. gesellschaftliche Grundlagen (Wissenschaft, nach E. Köhler)
a. Bei der kriegerischen Landnahme erfolgte die Verteilung anfänglich nach den zwischen Herr und Gefolgsmann geltenden