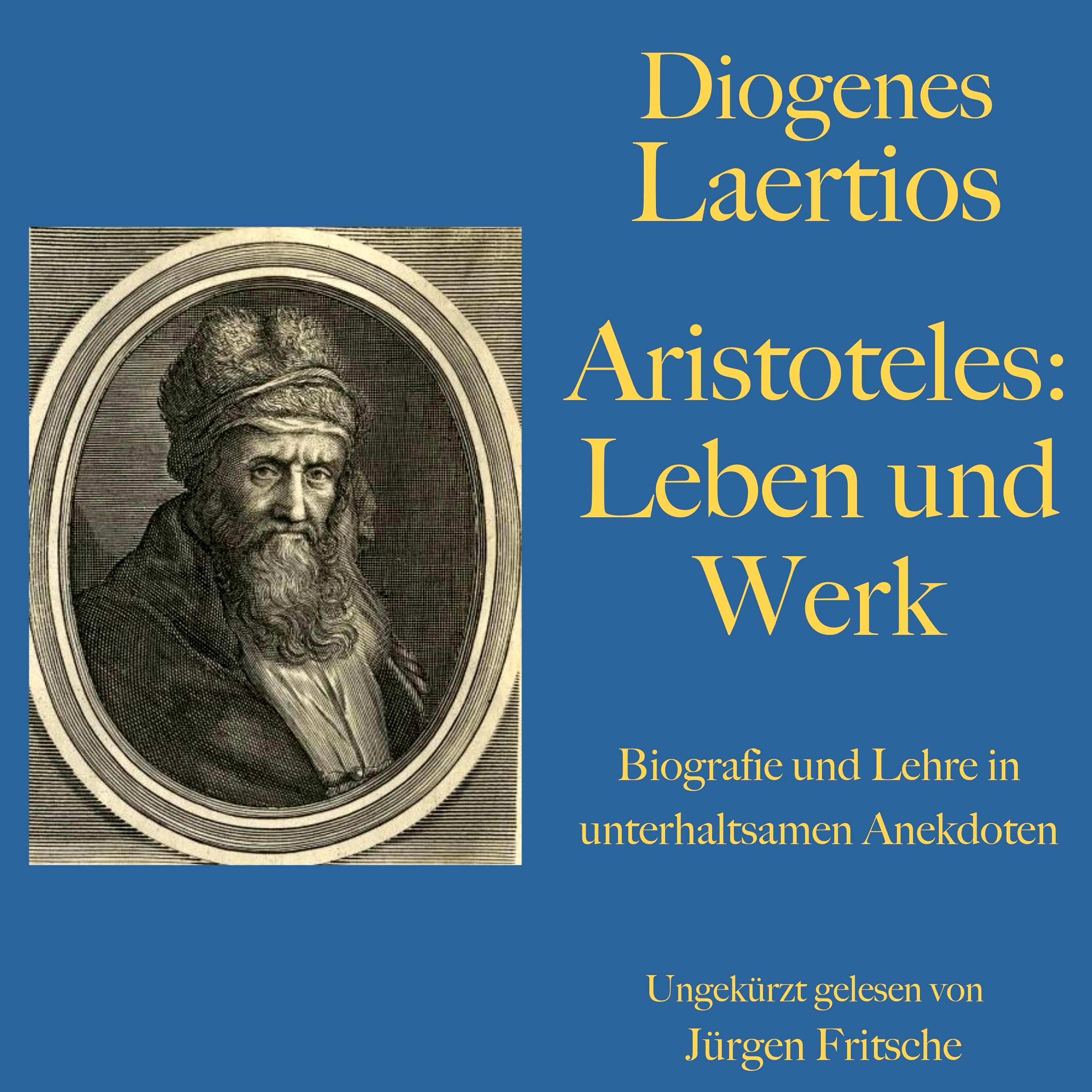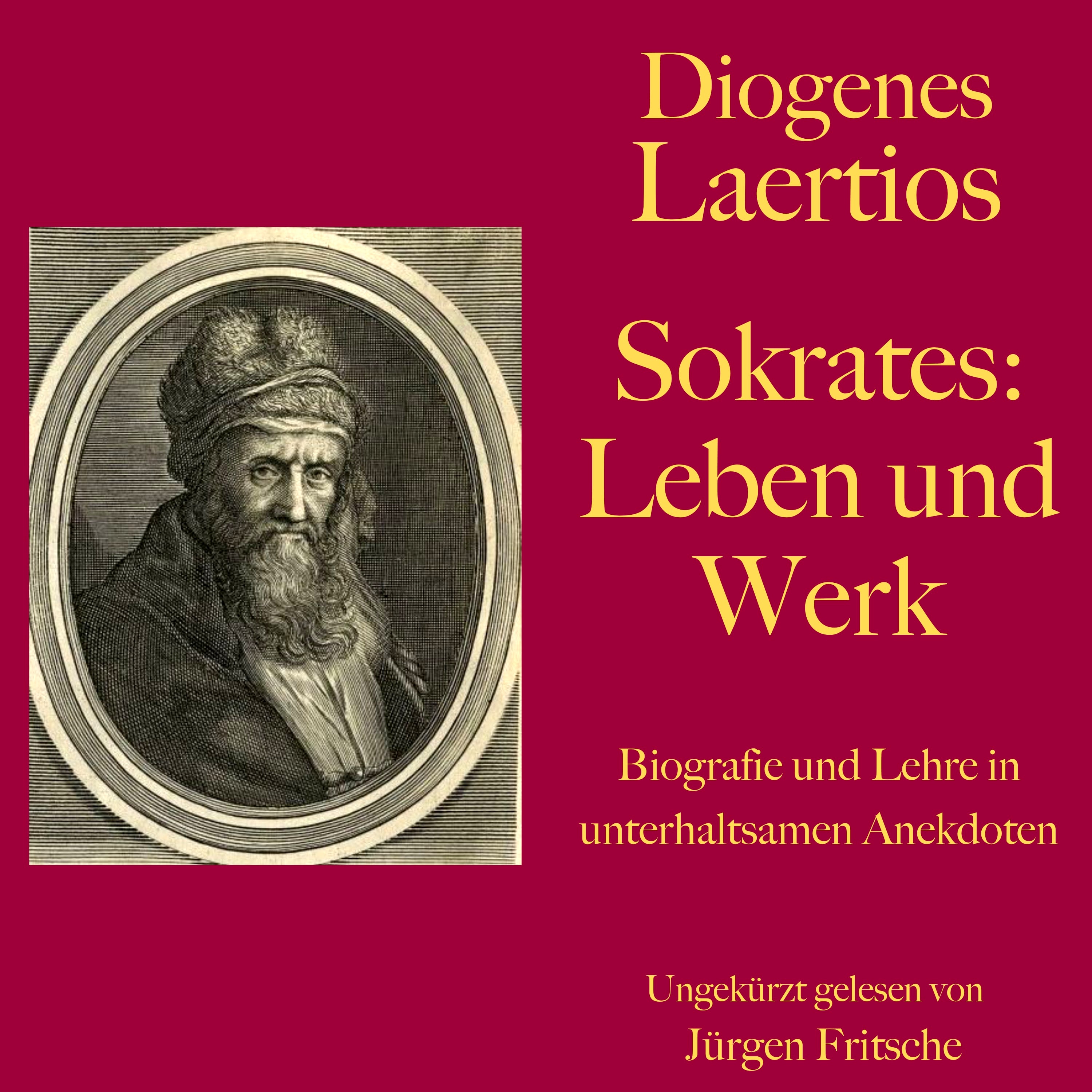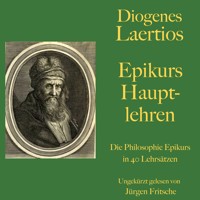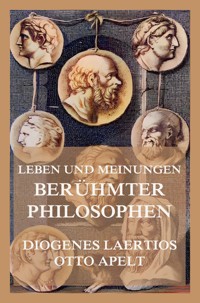
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Diogenes Laertios, der Biograph der griechischen Philosophen, soll seinen Nachnamen von der Stadt Laërte in Kilikien erhalten haben. Über die Umstände seines Lebens wissen wir nichts. Er muss nach Sextus Empiricus (ca. 200 n. Chr.), den er erwähnt, und vor Stephanus von Byzanz (ca. 500 n. Chr.), der ihn zitiert, gelebt haben. Es ist wahrscheinlich, dass er während der Herrschaft von Alexander Severus (222-235 n. Chr.) und seinen Nachfolgern wirkte. Das hier vorliegende Buch, mit dem er bekannt wurde, gibt vor, das Leben und Werk der griechischen Philosophen wiederzugeben und zu analysieren. Obwohl es bestenfalls eine unkritische und unphilosophische Zusammenstellung ist und uns einen Einblick in das Privatleben der griechischen Weisen gibt,veranlasste es Montaigne zu Recht zu dem Ausruf, dass er sich wünschte, es hätte statt eines Laertios ein Dutzend gegeben . Er behandelt sein Thema in zwei Abteilungen, die er als die ionische und die italienische Schule bezeichnet. Die Biographien der ersteren beginnen mit Anaximander und enden mit Klitomachos, Theophrastus und Chrysippus; die letztere beginnt mit Pythagoras und endet mit Epikur. Die sokratische Schule mit ihren verschiedenen Zweigen wird der ionischen zugeordnet, während die Eleaten und Skeptiker unter der italischen behandelt werden. Das gesamte letzte Buch ist Epikur gewidmet und enthält drei höchst interessante Briefe an Herodot, Pythokles und Menoeceus. Ein absolutes Muss für alle Studenten griechischer Geschichte, Philosophie und Literatur - und nicht nur für diese.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Diogenes Laertios
Leben und Meinungen berühmter Philosophen
OTTO APELT
Diogenes Laertios, Otto Apelt
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849680587
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort.1
Einleitung.3
Erstes Buch.15
Einleitung (Prooemium).15
Erstes Kapitel. Thales. 640—562 v. Chr.22
Zweites Kapitel. Solon. 635— 559 v. Chr.30
Drittes Kapitel. Chilon. Um 560 v. Chr.39
Viertes Kapitel. Pittakos. Um 600 v. Chr.42
Fünftes Kapitel. Blas. Um 570 v. Chr.45
Sechstes Kapitel. Kleobulos. Um 600 v. Chr.48
Siebentes Kapitel. Periander. 668— 584 v. Chr.51
Achtes Kapitel. Anacharsis der Skythe. Um 600 v. Chr.54
Neuntes Kapitel. Myson. Um 600 v. Chr.56
Zehntes Kapitel. Epimenides. Um 600 v. Chr.58
Elftes Kapitel. Pherekydes. Um 540 v. Chr.61
Zweites Buch.64
Erstes Kapitel. Anaximander. Um 611-546 v. Chr.64
Zweites Kapitel. Anaximenes. Um 546 v. Chr.65
Drittes Kapitel. Anaxagoras. 500--428 v. Chr.66
Fünftes Kapitel. Sokrates 469-399 v. Chr.70
Sechstes Kapitel. Xenophon. Etwa 430-354 v. Chr.80
Siebentes Kapitel. Aischines. Um 400 v. Chr.84
Achtes Kapitel. Aristippos. Um 435--350 v. Chr.86
Neuntes Kapitel. Phaidon. Um 400 v. Chr.98
Zehntes Kapitel. Eukleides. Um 400 v. Chr.99
Elftes Kapitel. Stilpon. Um 320 v. Chr.102
Zwölftes Kapitel. Kriton. Um 420 v. Chr.105
Dreizehntes Kapitel. Simon. Um 420 v. Chr.106
Vierzehntes Kapitel. Glaukon.107
Fünfzehntes Kapitel. Simias. Um 400 v. Chr.108
Sechzehntes Kapitel. Kebes. Um 400 v. Chr.109
Siebzehntes Kapitel. Menedemos. Etwa 350-276 v. Chr.110
Drittes Buch.117
Platon. 427-347 v. Chr.117
Viertes Buch.149
Erstes Kapitel. Speusippos. Etwa 407-339 v. Chr.149
Zweites Kapitel. Xenokrates. 396-314 v. Chr.151
Drittes Kapitel. Polemon. Um 310 v. Chr.156
Viertes Kapitel. Krates. Um 300 v. Chr.158
Fünftes Kapitel. Krantor. Um 310 v. Chr.159
Sechstes Kapitel. Arkesilaos. 316(?)-240 v. Chr.161
Siebentes Kapitel. Bion. Um 300 v. Chr.168
Achtes Kapitel. Lakydes. Um 240 v. Chr.172
Neuntes Kapitel. Karneades. Um 160 v. Chr.173
Zehntes Kapitel. Kleitomachos. Um 130 v. Chr.175
Fünftes Buch.176
Erstes Kapitel. Aristoteles. 384-322 v. Chr.176
Zweites Kapitel. Theophrast. Etwa 370-285.190
Drittes Kapitel. Straton. † 269 v. Chr.201
Viertes Kapitel. Lykon. 299-225 v. Chr.203
Fünftes Kapitel. Demetrios. Ungefähr 350-280 v. Chr.207
Sechstes Kapitel. Herakleides. um 360 v. Chr. (bis über 330).211
Sechstes Buch.214
Erstes Kapitel. Antisthenes. 444 bis etwa 368 v. Chr.214
Zweites Kapitel. Diogenes. 404—323 v. Chr.220
Drittes Kapitel. Monimos. Um 340 v. Chr.240
Viertes Kapitel. Onesikritos. Um 330 v. Chr.241
Fünftes Kapitel. Krates. Um 328 v. Chr.242
Sechstes Kapitel. Metrokles. Um 300 v. Chr.246
Siebentes Kapitel. Hipparchia. Um 300 v. Chr.247
Achtes Kapitel. Menippos. Um 300 v. Chr.249
Neuntes Kapitel. Menedemos. Um 300 v. Chr.250
Siebtes Buch.252
Erstes Kapitel. Zenon. Um 300 v. Chr.252
Zweites Kapitel. Ariston. Um 240 v. Chr.299
Drittes Kapitel. Herillos. Um 260 v. Chr.301
Viertes Kapitel. Dionysios Metathemenos. Drittes Jahrh. v. Chr.302
Fünftes Kapitel. Kleanthes. 331—232 v. Chr.303
Sechstes Kapitel. Sphairos. Im dritten Jahrhundert v. Chr.307
Siebtes Kapitel. Chrysippos. 282—209 v. Chr.308
Achtes Buch.319
Erstes Kapitel. Pythagoras. Etwa 582—500 v. Chr.319
Zweites Kapitel. Empedokles. 484-424 v. Chr.335
Drittes Kapitel. Epicharmos. Etwa 550-460 v. Chr.344
Viertes Kapitel. Archytas. Um 400 v. Chr.345
Fünftes Kapitel. Alkmaion. Zeit unbestimmt.347
Sechstes Kapitel. Hippasos. Viertes Jahrhundert v. Chr.348
Siebentes Kapitel. Philolaos. Um 440 v. Chr.349
Achtes Kapitel. Eudoxos. Etwa 4097-357 v. Chr.350
Neuntes Buch.352
Erstes Kapitel. Herakleitos. Um 500 v. Chr.352
Zweites Kapitel. Xenophanes. Um 540 v. Chr.358
Drittes Kapitel. Parmenides. Um 500 v. Chr.360
Viertes Kapitel. Melissos. Um 440 v. Chr.362
Fünftes Kapitel. Zenon. Um 460 v. Chr.363
Sechstes Kapitel. Leukippos. Um 450 v. Chr.365
Siebentes Kapitel. Demokritos. Um 430 v. Chr.367
Achtes Kapitel. Protagoras. 481-411 v. Chr.373
Neuntes Kapitel. Diogenes von Apollonia. Um 440 v. Chr.376
Zehntes Kapitel. Anaxarchos. Um 340 v. Chr.377
Elftes Kapitel. Pyrrhon. Um 360—270 v. Chr.378
Zwölftes Kapitel. Timon. 325—235 ν. Chr.394
Zehntes Buch. 397
Epikuros. 342—271 v. Chr.397
Vorwort.
Die vorliegende Übersetzung macht durchaus nicht den Anspruch ein auch nur vorläufiger Ersatz zu sein für die noch immer ausstehende kritische Ausgabe des Diogenes Laertios, dessen letzte in Deutschland erschienene Ausgabe meines Wissens die Tauchnitzsche vom Jahre 1833 mit ihren weiteren Abdrücken ist. Die längst notwendige und ersehnte kritische Ausgabe, die, wie ich im Verlaufe meiner Arbeit nach bereits begonnenem Druck zufällig erfuhr, jetzt in Vorbereitung ist, ist eine interne Angelegenheit der Philologie. Bei meiner Arbeit handelt es sich um etwas anderes: um Abtragung einer alten Schuld der Philologie an die nicht philologische Lesewelt, soweit sie für alte Philosophie Interesse hat. Es war nicht unberechtigt, wenn kürzlich die Verfasserin einer freien Übertragung von Stücken des Diogenes Laertios einen temperamentvollen Appell an die Philologen richtete, sich ihrer Pflichten gegen die Laienwelt in dieser Hinsicht bewusst zu werden. Schon längst vorher hatte der Verleger der Philosophischen Bibliothek in Erkenntnis des vorhandenen Bedürfnisses sein Augenmerk darauf gerichtet, seine bekannte Bibliothek durch eine vollständige Übersetzung des Diogenes zu ergänzen, doch dauerte es lange, ehe ich mich entschließen konnte, seinem Wunsche gemäß die Ausführung der Arbeit zu übernehmen. Das Hauptbedenken war eben das Fehlen einer kritischen Ausgabe. Die Cobetsche Ausgabe hat zwar ihre großen Verdienste, doch weiß jeder, der sich ihrer bedient, wie störend das Fehlen des kritischen Apparates ist. Immerhin sind im Verlaufe der letzten Jahrzehnte nicht unansehnliche Teile des Ganzen bekannt geworden durch die Arbeiten von Bonnet, Diels, Wachsmut, Usener, Arnim und anderen. Es erschien also nicht allzu gewagt, sich der Befriedigung des Bedürfnisses anzunehmen. Wenn die kurzen erklärenden Anmerkungen sich ab und zu auf Textfragen einlassen mussten, so ist das fast der einzige spezifisch philologische Tribut, den die Sachlage mir für die Anmerkungen auferlegte. In der Übersetzung macht sich die Berücksichtigung philologischer Interessen nur bei Wiedergabe der Schriftenkataloge insofern geltend, als ich da in den wichtigsten Fällen, nämlich bei Aristoteles, Theophrast und Chrysipp, die griechischen Titel ab und zu mit einigen Verweisungen hinzugefügt habe, die für die genauere Auffassung unentbehrlich sind. Vielleicht dürfte auch das ziemlich ausführlich gehaltene Register, wenn auch zunächst für das Bedürfnis der Laien berechnet, doch auch dem Philologen einigen Nutzen bieten, schon durch die bequemere Form der Verweisungen nach Büchern und Paragraphen als der einzig zweckmäßigen im Gegensatz zu der umständlichen und dabei häufig genug ungenauen und irreführenden Bezeichnungsweise bei Hübner und Cobet, welches letzteren Index nichts weiter ist als ein glatter Abdruck des Hübnerschen.
Die letzte (und wohl zugleich auch erste) vollständige Übersetzung liegt weit zurück. Est ist die in zwei Bänden erschienene Übersetzung von August Bor heck, Wien und Prag 1807, dann auch Leipzig 1809, für ihre Zeit eine achtbare Leistung, der in den erzählenden Partien eine gewisse körnige Altertümlichkeit des Ausdrucks einigen Reiz verleiht. Kurze Zeit vorher war eine Übersetzung erschienen von J. F. und P. L. Snell, Gießen 1806, die sich indessen auf Auszüge beschränkt. Erst unsere Zeit hat wenigstens einige Beiträge zu einer neuen Übersetzung geliefert, nämlich die oben erwähnte Schrift (Titanen und Philosophen von Anna Kolle, Charlottenburg A. Seydel Nachfolger) und eine Übersetzung (nebst kritischen Bemerkungen) des zehnten Buches von A. Kochalsky, Leipzig 1914.
Mein Absehen war auf eine lesbare Übersetzung des Überlieferten gerichtet, die den Diogenes wiedergeben soll wie er in seinem Buche leibt und lebt, nicht wie er etwa nach dem Wunsche eines Bearbeiters oder eines Lesers hätte leiben und leben sollen. Der Leser muss also die ganze Fülle der Zitate über sich ergehen lassen, in denen Diogenes sehr zum Nachteil des Flusses der Darstellung schwelgt: eine starke Belastung des Lesers, aber eine umso wertvollere Beigabe für den Forscher auf dem Gebiet der Geschichte der griechischen Philosophie. Die Erläuterungen zu diesem reichen Quellenmaterial in den Anmerkungen -beschränken sich in der Regel auf kurze Hinweise auf die einschlägige Literatur.
Ich kann dies Vorwort nicht schließen, ohne der treuen Beihilfe zu gedenken, die mir bei Abfassung des Buches meine Tochter Dr. Mathilde Apelt in unermüdlicher Bereitwilligkeit mit Bat und Tat geleistet hat.
Dresden, 1. November 1920.
Otto Apelt.
Einleitung.
Das Buch, um dessen Übersetzung es sich in den vorliegenden beiden Bänden handelt, nimmt eine ganz einzigartige Stellung in der gesamten Weltliteratur ein. Es ist eine populäre Geschichte der griechischen Philosophie als einer mit dem griechischen Volkstum engverwachsenen Sache. Kein anderes Volk der Erde war oder ist in der Lage, in diesem doppelten Sinne sich eine Geschichte seiner eigenen Philosophie darbieten zu können. Denn wo wäre die Philosophie — ich meine die praktische Philosophie, die Ethik, um die es sich hier zunächst nur handeln kann — auch nur annähernd zu einer Volkstümlichkeit gelangt wie bei den Griechen? Bei den Griechen ist diese Bedeutung so ersichtlich, dass, wer ein Bild von ihrem Volksleben in der Höhezeit ihrer Kultur geben will, einen wesentlichen Zug vermissen lassen würde, wenn er den Einfluss der Philosophie und ihrer Träger auf den Volksgeist mit Stillschweigen übergehen wollte. Die Philosophie war tatsächlich ein lebendiger Faktor in dem Denken und Treiben der Griechen. Das Auftreten ihrer Philosophen, ihr Wirken und ihre Schicksale stellen zugleich ein Stück ihres Volkslebens dar und wahrlich nicht das am wenigsten interessante.
Es wird immer eine bemerkenswerte Tatsache bleiben, dass die Griechen bei ihrer hoch entwickelten Empfänglichkeit für jedes Schöne in Natur und Kunst alles Kunstschöne zwar in seiner Wirkung auf den Beschauer wohl zu würdigen wussten, aber doch einen auffallenden Unterschied machten in der Bangstellung derjenigen Künstler, die sich dem Wesen ihrer Kunst zufolge mit der Materie zu befassen haben, und denjenigen, die sich rein geistig betätigen, einen Unterschied also zwischen Bildhauern und Malern einerseits und Dichtern anderseits. Den Dichtern aber schließen sich, was die höhere Wertschätzung und die Stellung im geselligen Leben anlangte unmittelbar die Denker, d. h. die Philosophen an. Man kann sagen: die Forderung des Schönen für das Auge war den Griechen so natürlich und selbstverständlich, dass sie die dahin gehörenden Leistungen wie einen schuldigen Tribut entgegennahmen, während ihnen rein geistige Leistungen, in ihren gelungeneren Darbietungen wenigstens, wie Offenbarungen aus einer höheren Welt erscheinen mochten. Dabei bilden die Dichter das Mittelglied zwischen den bildenden Künstlern und den Vertretern des reinen Gedankens, den Philosophen. Denn als Herrscher im Reich der freien Phantasie stellen sie zwar immer in engster Fühlung mit dem Formenreichtum der Sinnenwelt, die sie ihren jeweiligen Zielen gemäß nach den Gesetzen der Schönheit umgestalten, haben es aber nicht mit der Materie selbst zu tun, sondern mit der Auffassungsweise und geistigen Welt des Menschen.
Der bedeutsame Schritt von der phantasievollen Auffassung der Natur und des Lebens zu der denkenden Betrachtung derselben lässt die Griechen gewissermaßen sich über sich selbst erheben. Denn je mehr sie für die Freude am Anschaulichen und die künstlerische Verklärung derselben geschaffen erscheinen, umso schwerer, sollte man meinen, müsste ihnen der Schritt in das Reich des Abstrakten, m. a. W. der Anfang der Philosophie, geworden sein. Gleichwohl vollzog sich dieser Übergang nicht nur mit einer gewissen Selbstverständlichkeit sondern auch mit bewundernswerter Stetigkeit des Fortschrittes. Mehr und mehr suchen sich die Denker in der Welt der Abstraktionen heimisch zu machen, ohne dabei aber doch die Fühlung mit der Gedankenwelt und den Lebensbedingungen ihres Volkes in geselliger, staatlicher und religiöser Beziehung zu verlieren. Lässt man die lange Reihe der namhaften Philosophen an sich vorübergehen, so findet man darunter Ärzte, Gesetzgeber, Staatsmänner, Kaufleute, Feldherren, auch manche, die, aus den Kreisen des Gewerbes oder des Handwerkes hervorgegangen, es bis zur Gründung einer eigenen Schule oder zur Vorstandschaft über eine bereits bestehende brachten. Die Öffentlichkeit des Volkslebens, wie sie, begünstigt durch ein glückliches Klima und den angeborenen Geselligkeitstrieb der Südländer, schon an Werktagen sich allenthalben geltend machte, fand ihren erhöhten Ausdruck — von den großen nationalen Festtagen in Olympia, auf dem Isthmus usw. gar nicht zu reden — an den festlichen Tagen, die in reicher Fülle der Verehrung der Stammesgötter geweiht waren: hier berührte sich vornehm und gering, arm und reich, alt und jung, gebildet und ungebildet in unbefangener Offenherzigkeit. Neugierde einerseits, Mitteilungsbedürfnis anderseits ließ es an reger Unterhaltung niemals fehlen, die, getragen von dem Gefühl der Zusammengehörigkeit und Einheit, nicht wenig dazu beitrug, die auch in Griechenland nicht fehlenden Standesvorurteile auf ein vergleichsweise sehr bescheidenes Maß zu beschränken. Der demokratische Geist der Stadtverfassungen einerseits, der politische Ehrgeiz der Abkömmlinge altangesehener Familien anderseits sorgten schon an sich für eine gewisse Ausgleichung der Ansprüche; und was die Unterschiede der Bildung anlangt, so stand von vornherein die Masse der Ungebildeten dem Häuflein der Gebildeten nicht so schroff gegenüber wie bei uns, wo die grobe sowie die meiste rein mechanische Arbeit nicht einem Heer von Sklaven sondern den Volksgenossen selbst anheimfällt. Der freie Grieche war, bei leicht und billig zu beschaffender Befriedigung der Lebensbedürfnisse, nicht überlastet mit druckender Arbeit; es blieb noch Zeit und Stimmung übrig für Befriedigung des Triebes nach Geistesbildung, eines Triebes, der bei uns auch in den bürgerlichen Kreisen oft völlig überwunden wird von der nicht abzureisenden Sorge für des Lebens Nahrung und Notdurft, ja nur zu oft einer schrankenlosen Erwerbslust als dem einzigen Lebensinhalt Platz macht.
Kurz, die Bedingungen für eine volkstümliche Stellung und Wirkung der Philosophie waren in Griechenland, bei der angeborenen geistigen Gewecktheit des Volkes überhaupt, so günstig wie nirgendwo sonst. Und die Philosophen? Sie ließen es ihrerseits an sich nicht fehlen. Nicht, als ob sie alle aus innerstem Trieb gleich den Kynikern den Kreisen des niederen Volkes sich recht geflissentlich beigesellt und an Einfachheit und Natürlichkeit den geringen Tagelöhner womöglich noch übertrumpft hätten; ihre Neigungen waren in dieser Beziehung sehr verschieden, es gab auch den und jenen, auf den das Odi profanum volgus et arceo Anwendung findet; aber irgendwelche Fäden verbanden sie doch mit dem öffentlichen Leben. Nicht wenige Schulhäupter waren bei besonderen Anlässen geschätzte Ratgeber für öffentliche Angelegenheiten. Selbst die einem zurückgezogenen Leben huldigenden Lehrer wurden doch durch den beständigen Verkehr mit den Schülern über den Gang der äußeren Dinge immer auf dem Laufenden erhalten. -Wer die Anmaßungen der Demokratie und die unmittelbare Berührung mit ihr scheute, konnte, namentlich in der Diadochenzeit, gleichwohl zu Einfluss gelangen. Nicht wenige führte in der Regel mehr der Ehrgeiz der Herrscher als der eigene Ehrgeiz an diesen oder jenen Fürstenhof, wo die Fäden einer weitverzweigten Politik zusammenliefen. Auch als Gesandte oder in irgendwelcher Vermittlerrolle haben sie in dieser Beziehung zuweilen nicht unbedeutende Erfolge erzielt. Dem Volke waren sie alle wohlbekannt, und gerade solche, welche eine ganz ausgesprochene Neigung für Zurückgezogenheit hatten, fanden zuweilen bei der großen Menge die augenfälligste Achtung. Trat z. B. der etwas menschenscheue Xenokrates ab und zu einmal den Weg von der Akademie nach der Stadt an, so wichen ihm alle Schreihälse und Lastträger voller Respekt aus. Kein Wunder, denn er war eine achtunggebietende Persönlichkeit, die durch ihre bloße Erscheinung schon so etwas wie' Ehrfurcht einflößte. Und prägnante Figuren sind sie alle diese Philosophen, die der jüngeren Zeit so gut wie die der älteren, von der erhabenen Würde eines Parmenides, wie sie uns mit wenigen vielbesagenden Strichen Platon im Theaetet zeichnet, bis herab zu den skurrilen Exzentrizitäten eines Theodoros Atheos und Bion.
Dass die Komiker sich diese Gestalten in ihrer reizvollen Mannigfaltigkeit und zum Teil grotesken Absonderlichkeit nicht entgehen ließen, ist selbstverständlich, zugleich aber auch ein deutlicher Beleg für die Popularität dieser Gestalten. Denn ein dankbarer Stoff für die Bühne konnte die Philosophenzunft nur dann werden, wenn ihr eine gewisse Volkstümlichkeit anhaftete, als unentbehrliche Voraussetzung für ein entgegenkommendes Verständnis von Seiten eines zahlreichen gemischten Theaterpublikums. Der prickelnde Witz der Komiker ist nichts weniger als ein Zeichen der Geringschätzung oder gar der Verachtung: was sich liebt das neckt sich. Die Komiker waren gewiss in ihrem Herzen dem Schicksal dankbar, dass ihr Volk diese Philosophen, diese oft so sonderbaren Käuze, in sich fasste; und die Philosophen ihrerseits waren aufgeklärt und klug genug, um zu wissen, woran sie mit den Komikern waren. Mochte das Theater auch zuweilen von dem Gelächter über sie widerhallen, gleichviel: sie waren doch dessen ziemlich sicher dass das Volk ihnen nicht den Rücken kehren würde, und nicht minder sicher darüber, dass, wenn das Unerwartete gleichwohl geschähe, der Nachteil nicht auf ihrer Seite sondern auf der des Volkes liegen würde. Denn gewiss war Antisthenes nicht der einzige Philosoph, der die Frage welchen Gewinn er von der Philosophie gehabt mit den Worten beantworten konnte (Diog. L. VI 6): "Die Fähigkeit, mit mir selbst zu verkehren"
Aus dem Gesagten erhellt zur Genüge, dass ein Grieche etwa der Kaiserzeit, der ein Buch ähnlichen Charakters hatte schreiben wollen, wie Gustav Freytag es in seinen Bildern aus der deutschen Vergangenheit unserem Volk geschenkt hat, ein Buch also, das den Griechen das Bild ihrer Vergangenheit in den bezeichnendsten Zügen vor Äugen gestellt hätte, sich schwerlich die Schilderung des Anteils hätte entgehen lassen, den die Träger der Philosophie an der Entwicklung und Bildung des griechischen Volksgeistes gehabt haben. Und zwar wären das nicht die undankbarsten Partien des Werkes geworden. Zeigt doch die Menge der verloren gegangenen Monographien sowohl wie Sammelberichte über die Lebensläufe der Philosophen, über ihre Schulen und ihre Lehren, die wir aus unserem Diogenes Laertios kennen lernen, welche Anziehungskraft diese Art von Schriftstellerei gehabt haben muss. Und eben darin würde sich ein wesentlicher Unterschied kundgeben zwischen unserer deutschen Volksart in ihrer Entwickelung und der der Griechen. Man hat uns Deutschen nicht selten das (angesichts der Gestalt, in der wir uns jetzt der Welt präsentieren) besonders schmeichelhafte Kompliment gemacht, wir seien ein Volk von Denkern, von Philosophen. Gewiss, wir dürfen uns rühmen, einige der größten Denker die unsern zu nennen; allein die Volkstümlichkeit der Philosophie und der Philosophen, wie steht es damit? Ist sie ein charakteristischer Zug, sei es der Gegenwart sei es unserer. Vergangenheit? Man durchblättere das genannte Werk, das mit so viel Liebe und Sachkenntnis die charakteristischen Züge unseres Volkslebens auf den verschiedenen Stufen seiner geschichtlichen Entwickelung heraushebt: nur an einer Stelle wird man der Philosophie und einiger ihrer namhaften Vertreter (Leibnitz, Thomasius und Wolff) gedacht finden, und auch da nur mehr im Vorbeigehen als zu einlässlicher Betrachtung. Und niemand wird dem kundigen Verfasser einen Vorwurf daraus machen. Was von geistigen Strömungen wirklich unser Volksleben tiefer ergriff, war nicht die Philosophie, es waren die großen kirchlichen Bewegungen: im Mittelalter namentlich das Wirken der Mönchsorden, in der Neuzeit die Reformation mit ihren folgenschweren Wirkungen. Man hat oft die Wirksamkeit der Bettelorden mit dem Auftreten der Kyniker und ihren späteren Nachfolgern, den kynischen Wanderpredigern, verglichen. Gewiss nicht mit Unrecht. Allein man kann in dieser Richtung noch viel weiter gehen und sagen: die Probleme und Aufgaben der praktischen Philosophie (d. i. Ethik und Religionsphilosophie), die doch der Natur der Sache nach auch im Altertum allein das Band abgegeben hatte, das einen gewissen Zusammenhang zwischen Philosophie und Volksseele herstellte, waren längst vor Entwickelung unserer heimischen Philosophie eine Domäne der Kirche und Geistlichkeit geworden. Damit war der Boden der Volkstümlichkeit für die Philosophie von vornherein so gut wie verloren.
Was unsere philosophischen Angelegenheiten im Übrigen anlangt, so lassen sich zwar mit der wechselnden Vorherrschaft gewisser Schulen im Altertum manche Erscheinungen, namentlich der nachkantischen Philosophie, in Parallele stellen, indes die Frage der Volkstümlichkeit bleibt dabei völlig unberührt. Unsere Lebensgewohnheiten und unser Volkscharakter, bedingt durch Klima, wirtschaftliche Fragen und überwiegende Neigungen, verhalten sich mehr hemmend als fördernd zu einer volkstümlichen Richtung der Philosophie. Man denke an die schone und heitere Sitte der Symposien bei den Griechen r m den höheren Kreisen überall beliebt, in den Philosophenschulen sorgsam und nie ohne Beiziehung auch von Laien gepflegt, brachten sie Philosophen- und Laienwelt auf ungezwungenste Weise in fruchtbare Berührung miteinander und hielten das Interesse auch für philosophische Fragen in der höheren Bürgerwelt aufrecht. Wie steif, kalt, förmlich und unfruchtbar nimmt sich dagegen unsere Geselligkeit aus. Nur wenige unserer Philosophen sind zu einer gewissen Volkstümlichkeit gelangt und auch diese gab sich mehr aus respektvoller Entfernung als in unmittelbarer Berührung kund.
Dem entspricht es, dass es eine populäre Geschichte der Philosophie bei uns überhaupt nicht gibt, eine Tatsache, die über das Gesagte hinaus ihren höheren Grund darin hat, dass die Philosophie, rein wissenschaftlich genommen, zur Hauptaufgabe die hat, sich mehr und mehr der Abstraktionen zu bemächtigen und sich ihrer Bedeutung bewusst zu werden. Je mehr sie sich von ihrem Jugendalter entfernt, um so abstrakter werden die Vorstellungsweisen, mit denen sie es zu tun hat, umso größer also auch der Abstand von der Gedankenwelt des Durchschnittsmenschen. Wie viel günstiger also stand es damit bei den Griechen als bei uns. Sokrates und die Sokratiker hielten sich vorzugsweise an die Sittenlehre, womit sie auf die weitesten Kreise wirken konnten. Der eigentliche Erfinder und Begründer der Abstraktionen war Aristoteles. Aber eben an den Schicksalen seiner Lehre zeigte es sich, dass die große Masse der Griechen für diese Welt der reinen Abstraktionen wenig Auffassung hatte; daher das baldige Zurücktreten der peripatetischen Schule gegen die übrigen Schulen, die das Interesse für die ethischen und religiösen Fragen bei dem großen Publikum zu pflegen, ja zu steigern verstanden und sich eines Vordringens oder gar einer Herrschaft der abstrakten Richtung zu erwehren wussten. Dieser Umstand, in Verbindung mit dem hohen persönlichen Interesse, das die originellen Gestalten mancher Schulhäupter auch weiterhin bei der großen Menge erweckten, machtes erklärlich, dass bei den Griechen eine populäre Geschichte der Philosophie recht wohl möglich blieb, ja für Wissbegierige, deren es in der Kaiserzeit eine nicht geringe Menge gab, geradezu ein Bedürfnis ward.
Für eine diesem Belehrungsbedürfnis entsprechende populäre Geschichte der Philosophie war reichliches Material vorhanden. Und zwar teilt sich dies Material in zwei Hauptgruppen nach dem Gesichtspunkt einerseits der philosophischen Probleme selbst hinsichtlich ihres Ursprungs, ihrer Entwickelung und ihres Zusammenhangs untereinander, anderseits hinsichtlich der persönlichen Verhältnisse und des Charakters der Entdecker und Träger dieser philosophischen Dogmen. Man bezeichnet diese beiden Richtungen, die längere Zeit getrennt nebeneinander hergehen, kurz als die d o x o g r a p h i s c h e und als die biographische. Schon Platon hatte den Anfang gemacht zu einer kritischen Geschichte der Philosophie nach dem ersteren Gesichtspunkt, namentlich im Sophistes und im Theaetet. Weiterhin hatte Aristoteles in erheblich gesteigertem Umfang jeweilig im Zusammenhang mit der Entwickelung seiner eigenen Ansichten die Lehren der früheren Philosophen einer kritischen Beleuchtung unterzogen. Seinen Spuren folgend hatte dann sein Schiller und Nachfolger Theophrast ein umfassendes Werk über die Ansichten der Physiker geschrieben, das die Grundlage und Hauptquelle bildet für die weitere doxographische Literatur. Daneben regte sich dann mehr und mehr, vor allem auch in der peripatetischen Schule, das biographische Interesse, dem einige Schriften des Hermippos von Smyrna dienten, nachdem vorher schon einige andere, außerhalb einer bestimmten Schule stehende Schriftsteller diesen Weg eingeschlagen hatten, unter ihnen vor allem der geistreiche Antigonos von Karystos (um 225 v. Chr.).
Die nachchristliche Zeit vereinigte allmählich diese beiden Richtungen zu mehr oder minder lesbaren Gesamtübersichten, wie sie in den Werken der Pamphile und des Favorin und anderer zum Ausdruck kamen neben welchen auch Werke mehr kritisch-philosophischer Tendenz einhergehen, wie das des späteren Peripatetikers Aristokles, eine streitbare Geschichte der Philosophie, aus der uns Eusebios längere Bruchstücke bewahrt hat und späterhin des Porphyrios Geschichte der Philosophie, die gewiss auch eine starke Parteifärbung nicht verleugnet haben wird. Wir würden diesen beiden Werken vielleicht ein gewisses philosophisches Interesse abgewonnen haben. Ob damit aber der Wert des reichen Tatsachenmaterials aufgewogen worden wäre, das uns Diogenes bietet, bleibe dahingestellt.
Für eine auf ein großes Lesepublikum berechnete Geschichte der Philosophie kam viel darauf an, dass das doxographische Material .auf ein bescheidenes Maß beschränkt und in möglichst elementarer Form gehalten wurde unter grundsätzlicher besonderer Hervorkehrung der ethischen Momente. Dergleichen Bücher hat es in der Kaiserzeit gewiss mehr als eines gegeben und eines davon, vielleicht auch mehrere, mögen unserem Verfasser als nächste Unterlagen gedient haben. Aber wer war denn dieser Verfasser? Auf die Frage "Wer denn bist du, woher, weß Orts und welches Geschlechtes?" bleibt er uns leider die Antwort schuldig, man müsste denn in seinem Namen Diogenes Laertios selbst eine Art Antwort sehen, nämlich einen beabsichtigten Anklang an Homer, wie man gemeint hat. Damit aber ist uns nicht viel gedient. Nur so viel lässt sich nach gewissen Kombinationen mit einiger Bestimmtheit sagen, dass seine Lebenszeit in die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts nach Christus fällt. Indes diese Dürftigkeit der Personalnachrichten ist leicht zu verschmerzen angesichts des unschätzbaren Wertes, den das Werk trotz aller ihm anhaftenden Mängel hat. Ist es doch die einzige vollständige Übersicht über die Geschichte der Philosophie, die wir aus dem Altertum besitzen und ohne die wir nicht einmal eine Vorstellung hätten von der Fülle des uns verloren gegangenen Materials, das einem Schriftsteller der Kaiserzeit für eine derartige Arbeit zu Gebote stand.
Das Werk stellt sich, wie Fr. Leo in seiner Schrift über Griechisch-römische Biographie sagt, dar "als eine vor Diogenes vorhandene Kompilation, die er selbst durch größere oder kleinere Zusätze erweitert und, wie aus dem Exemplar des Hesychios hervorgeht, durch Streichungen gekürzt hat. Die Kompilation war in ihrer Masse aus biographischen Schriften verschiedener Art zusammengeflossen. Voran steht eine Reihe von Schulnachfolgen, zu denen man auch Diokles rechnen mag, das Ganze umfassend, wie Darstellungen einzelner Schulen, und ein nach Demetrios Magnes gearbeitetes Homonymenverzeichnis. Das gelehrte Material, auch Apollodor, ist in der Regel durch diese Biographien vermittelt; aber es muss immer mit dem Fall gerechnet werden, dass Bücher, die noch in späterer Zeit vorhanden waren, auch von den Kompilatoren gelegentlich zugezogen wurden. Den Grundstock bildet nicht eine einheitliche Darstellung der Schulnachfolgen, der das ganze Werk hindurch die übrigen nur ergänzend zur Seite getreten wären, vielmehr ist das Werk aus Teilen zusammengesetzt, die der Art ihres Bestandes und der zugrunde liegenden Forschung nach verschieden sind."
Mir will es scheinen, als ob dies Urteil, wenn es auch im Ganzen den Sachverhalt den Verhältnissen entsprechend darstellt, doch dem Diogenes einen etwas geringeren Anteil an dem Werke einräume, als ihm tatsächlich zukommt. Doch darauf kommt überhaupt nicht allzu viel an. Mit Recht nämlich hebt Leo im Anschluss an das eben Mitgeteilte hervor, dass es weniger darauf ankommt, den nächsten oder vornächsten Vordermann zu erkunden als darauf, die Primärquellen festzustellen und ihren Wert zu bestimmen. Auf diesem Wege sind fast verschollene Schriftsteller wie Apollonios von Tyros und namentlich Antigonos von Karystos, nachdem er schon früher durch Köpke von den Toten erweckt war, durch Wilamowitz wieder zu Blut und Farbe gelangt. Anfänglich nämlich hatte sich die ganze Diogenesfrage, seitdem sie durch Nietzsches Aufsätze im Rheinischen Museum (s. die Literaturübersicht) zur Diskussion gestellt war, darauf zugespitzt, die angeblich einheitliche nächste Vorlage zu bestimmen, als deren flüchtig überarbeitete Wiedergabe das ganze Werk des Diogenes zu betrachten sei. Aber der ganze darauf bezügliche mit echtem deutschen Gelehrteneifer geführte Streit ist im Grunde nichts als ein Streit um des Kaisers Bart. Die zahlreichen Mitteilungen aus guten Quellen, die sich in dem Werk des Diogenes finden, haben ihren Wert, der ganz unabhängig ist von der Frage nach der Entstehung des Werkes. Wenn mir irgend ein Bote eine auf den ersten Blick sich als authentisch ausweisende Urkunde überreicht, so kann es mir gleichgiltig sein, ob er der erste ist, der sie in die Hand bekommen, oder ob er sie erst von einem andern und dieser wieder von einem andern erhalten hat.
Die in dieser Richtung sich bewegenden Untersuchungen haben dahin geführt, dass man den Diogenes mitunter für einen völlig unselbständigen Skribenten, ja für einen halben Idioten erklärte, der seine Vorlage auch mit dem häufigen "Wir", ja sogar mit dem selteneren, aber durchaus nicht fehlenden "Ich" (vgl. z. B. II 97, VI i, VIII 53, IX 70) einfach abgeschrieben habe, so dass man fast meinen müsste, er habe seine eigenen zahlreichen Verse auch schon in seiner Vorlage vorgefunden. Ein großer Geist ist Diogenes gewiss nicht gewesen; er mag sich meist an gewisse Vorlagen — sicherlich nicht bloß an eine, sondern für verschiedene Partien an verschiedene — gehalten haben, aber ein bloßer mechanischer Abschreiber ist er schwerlich gewesen. Gewisse Liebhabereien, gewisse Spuren subjektiver Teilnahme an dem Gegenstande lassen sich, für mein Gefühl wenigstens, ziemlich deutlich erkennen. Er hatte ein Herz, er hatte Interesse für die Sache, ja war vielleicht selbst nicht ohne einen Anflug von philosophischer Parteifärbung, wie aus manchen Anzeichen hervorgeht, die ihn, sei es den Skeptikern sei es der Richtung des Epikur zuweisen. Er war ein Manu, in dem offenbar ein reger Wissenstrieb lebte verbunden mit einer ziemlich umfassenden Literaturkenntnis und einem bemerkenswerten Sammeleifer, ähnlich dem eines Aulus Gellius. Man wird kaum irre gehen, wenn man sich ihn im Besitz einer nicht unansehnlichen Bibliothek denkt, nicht zu eitler Schaustellung für etwaige Besucher sondern zu reger eigener Benutzung. Sein Werk lässt erkennen, dass er bis zum letzten Moment vor dem Erscheinen — wir würden sagen, bis zum Abschluss des Druckes — an der Vervollständigung desselben arbeitete; offenbar mit Hilfe seiner Bibliothek und einer sie ergänzenden Notizensammlung, die er sich angelegt. Aus diesem Notizenkasten stammen aller Wahrscheinlichkeit nach die mancherlei Zusätze, die er in letzter Stunde, eilfertig und unüberlegt, nicht .selten an unpassender Stelle noch einlegte. Er war, wenn nicht alles täuscht, ein gutmütiger, harmloser Mensch, literarisch interessiert und wohlbelesen, wenn auch ohne jede kritische Ader; dabei nicht frei von einer gewissen Eitelkeit, die sich in seinen dichterischen Prätensionen mehr naiv als verletzend kundgibt. Nicht ganz ohne Grund hat man die Vermutung ausgesprochen, sein Buch verdanke sein Entstehen dem Umstand, dass er mit seiner Gedichtsammlung, der "Pammetros", beim Publikum wenig Glück gemacht und nun versucht habe, den ihm besonders am Herzen liegenden Teil seiner Epigramme in neuem Rahmen vielleicht besser an den Mann zu bringen. Nur darf man dabei nicht vergessen, dass tatsächlich schon diesem Liederbuch eine ziemlich eingehende Beschäftigung mit den Schicksalen der Philosophen zugrunde gelegen haben muss, für die er offenbar ein ganz besonderes Interesse hatte.
War er ehrgeizig, so war sein Ehrgeiz jedenfalls von unverfänglicher Art. Sein Werk ist der beste Zeuge dafür, dass er ein ehrlicher Gesell war, der nicht mehr aus sich machen wollte als er wirklich war. Er hätte reichlich Gelegenheit gehabt, dem Leser etwas Sand in die Augen zu streuen hinsichtlich der Originalität seiner Darstellung; er hätte seine Quellen ausnutzen können ohne sie dem Leser namentlich vorzuführen — ein Gesichtspunkt, der freilich bei der Annahme bloßen Abschreiben aus einer nächsten Vorlage ganz ausscheiden müsste — , er hätte die Selbstverleugnung nicht so weit zu treiben gebraucht, wie es tatsächlich geschieht; denn er treibt das "ich singe nichts Unbezeugtes" auch äußerlich durch Namennennung geradezu auf die Spitze. Er scheint es als eine Art Ehrensache zu betrachten, die Gewährsmänner fast jederzeit zu nennen, eine Manier, welche, die Sache rein vom Standpunkt der Darstellungsweise betrachtet, weit mehr nachteilig als vorteilhaft wirkt, wie denn überhaupt von stilistischer Kunst, von einheitlicher Färbung des Ganzen, von wirksamer Gruppierung im Einzelnen, von eindrucksvoller Verteilung von Licht und Schatten und dergleichen wenig oder nichts zu spüren ist, wenn auch die Gesamtdisposition für das Werk, wie sie zu Anfang mitgeteilt wird, treu eingehalten ist.
Ungeachtet aller Ausstellungen indes hat er der Nachwelt, hat er der Wissbegierde unserer Tage, gleichviel ob bewusst oder unbewusst, einen unschätzbaren Dienst erwiesen, indem er sozusagen den Vorhang weggezogen hat, hinter dem sich für uns der Reichtum dieser ganzen Literaturgattung barg. Wir haben alle Ursache, ihm dankbar zu sein. Ohne ihn hätten wir überhaupt keinen Gesamtüberblick über die griechische Philosophie aus der Hand eines Griechen. Auch wird man nicht leugnen können, dass er einen gewissen Blick für die Bedürfnisse eines größeren Leserkreises wie seiner Zeit überhaupt hatte. Er hat es verstanden, den Geschmack der gleichzeitigen Lesewelt zu treffen. Es ist gewiss kein bloßer Zufall, dass von einer Reihe von Vorläufern seines Buches und vielleicht auch ein oder dem anderen gleichzeitigen Konkurrenzwerk keines auf die Nachwelt gekommen ist. Habent sua fata libelli! Gewiss, der Zufall ist ein gewaltiger Machthaber, ein launenhafter Verteiler von Ruhm und oft unverdienter Verborgenheit. Allein in Sachen der Büchervererbung sind seine Rechte doch keine schrankenlosen. Schon der Erfinder des angeführten Spruches, Terentianus Maurus, gibt ihn nur unter einer beachtenswerten Einschränkung: pro captu lectoris habent sua fata libelli heißt es bei ihm, wofür wir auch ruhig einsetzen können pro captu temporum. Ein Werk, das dem Geschmack und Bedürfnis nicht bloß des Augenblicks und der Gegenwart, sondern seiner Natur nach dem eines gebildeten Publikums überhaupt entspricht, hat in so höherem Maße Anwartschaft auf dauernde Erhaltung, in je höherem Grad dies Verhältnis auf es zutrifft. Der Zufall kann trotzdem manchen bösen Streich spielen. Warum mussten des Demokrit Werke, warum die des Poseidonios uns vorenthalten werden? Aber im Allgemeinen können wir gegenüber den mannigfachen Anlässen zur Zerstörung des alten Literaturbestandes immerhin noch zufrieden sein mit dem, was uns das Schicksal erhalten hat. Es war gewiss kein bloßer Zufall, dass Chrysipp, der Vielschreiber, der Vergessenheit anheimfiel, Platon aber uns erhalten blieb.
Was also unsern Diogenes betrifft, so hat er alle seine Konkurrenten aus dem Felde geschlagen. Wir dürfen sonach mit einiger Sicherheit sagen, dass, mag er auch weder eine Leuchte der Wissenschaft noch überhaupt ein hervorragender Geist gewesen sein, er doch ein. der Welt zusagendes Werk geschaffen hat. Sein Buch gehört nicht zu jenen schlechten Büchern, in Beziehung auf die Lesung sagte, kein Buch sei so schlecht, dass man aus ihm nicht doch dieses oder jenes lernen könnte. Es bedarf keiner Nachsicht, sondern fordert an erster Stelle zur Dankbarkeit auf für das Viele, was uns ohne es verloren wäre. Man durchblättere es: welche reiche Fülle des Inhalts verbunden mit welcher Mannigfaltigkeit des Gebotenen! Eine stattliche Galerie hervorragender Charakterköpfe, eine Versammlung der tonangebenden geistigen Lenker des geistvollsten Volkes der Erde, Männer von kräftigster Eigenart, hier eine Gruppe, würdevoll, imponierend, streng, ja wenn es not tut, grausam gegen sich selbst, dort eine andere, geistreich, lebensfroh bis zu frivoler Genusssucht, dabei aber doch in gewissem Sinne über die Nichtigkeiten des Erdenlebens erhaben, weiterhin mehr vereinzelt stehende bizarre Naturen bis fast an die Grenze der Karikatur, kurz Geisteshelden und Sonderlinge aller Art, interessant durchweg und jeder von ihnen Vertreter einer besonderen Geistes- und Lebensrichtung. Und ihre Schicksale, wie mannigfach und teilweise ergreifend zugleich und erhebend. Daneben heitere Bilder des Lebens, des Straßen- und Markttreibens, der Begegnungen nicht nur an Fürstenhöfen, sondern auch in Wirtshäusern oder am Brunnen, Schilderungen von Reisen und Seefahrten. Szenen aus dem Schulleben der einzelnen Sekten, aus dem Privatleben der Philosophen, aus Palästen und Hütten bis herab zu den Stätten der Unzucht. Und das alles nie ohne die Würze des geistvollen, schlagfertigen Witzes, der fast nie eine Antwort schuldig bleibt, und wo dies einmal der Fall ist, zu einem tragischen Ende führt (II 112). Das Ganze eine Wanderung vom Himmel durch die Welt zur Hölle, nur nicht in einfach regelrechtem Zuge, sondern so, dass die Bilder kaleidoskopartig wechseln, rasch überspringend von dem einen Gebiet auf das andere.
Ein gewisser Reiz liegt ferner auch in dem belebenden Wechsel zwischen anschaulichen Lebensschilderungen und den dogmatischen oder lehrhaften Partien. Zu diesen rechne ich nicht nur die im eigentlichen Sinne doxographischen Stücke, die nur zum Teil (vor allem die stoische und die skeptische Lehre) von Wert sind, sondern auch die Spruchweisheit der Philosophen, die einen sehr ansehnlichen Teil des Ganzen ausmacht und dem Buche auch über das Interesse der bloßen Unterhaltung und Belehrung hinaus einen gewissen erzieherischen Wert verleiht. Denn welche Fülle erprobter Lebensweisheit liegt in diesen Aussprüchen der großen griechischen Denker geborgen und wie gewinnen sie noch ab und zu durch den Eindruck der persönlichen Anlässe, durch die sie, sei es angeblich sei es tatsächlich, hervorgerufen wurden.
Das alles sind Momente, die dem Buch für ein gebildetes Publikum aller Zeiten seine Wirksamkeit sichern. Für uns Leser von heute gesellt sich dazu noch das philologische Interesse an all den literarischen Fragen, zu denen der reiche Inhalt des Werkes Anlass gibt. Davon braucht aber hier weiter nicht die Rede zu sein. Denn für den Philologen ist des Diogenes Buch keine Neuheit; er bedarf keiner Übersetzung, wogegen die gebildete Laienwelt mit Recht eine solche verlangen darf, da die einzige vollständige, die wir besitzen, dem Anfang des vorigen Jahrhunderts angehört. "Wer Vieles bringt, wird manchem etwas bringen." Das gilt gewiss von unserem Buch, wie bereits oben angedeutet. Gleich der Eingang des Werkes wird die sinnigen Leser zu nicht uninteressanten Betrachtungen anregen über die Wanderungs- und Wandelungsfähigkeit anekdotenartiger Erzählungen (Dreifußgeschichte) und ihm zugleich einen Begriff geben von der Fabulierlust der Griechen. Die durchschlagende Kraft der Spruch Weisheit wird ihre Wirkung auf ihn so wenig verfehlen, wie auf den antiken Leser, denn die Lebensweisheit bleibt im Grunde immer dieselbe, wie die Menschen immer dieselben bleiben. Die Charakterbilder der Philosophen werden bei dem einen Leser diese, bei dem andern jene verwandte Saite seiner Seele erklingen lassen, und was die nicht philologischen Studierten beträft, so wird der Jurist nicht ohne Gewinn ein Buch in die Hand nehmen, das uns als einzige derartige Quelle aus dem Altertum die Testamente einer ganzen Reihe von Philosophen im Wortlaute bietet. Niemand wird es dem Leser übelnehmen, wenn er manches ganz übergeht, manches mehr mit dem Finger als mit dem Auge liest: die Bücherlisten wird er eben nur durchblättern und vielleicht auch manches aus den doxographischen Pallien. Was dagegen die zahlreichen poetischen Beigaben anlangt, so wird er gewiss vieles, was aus Tragikern, Komikern, den Sillographen, Kallimachos und anderen stammt, nicht ohne Interesse lesen. Was aber die eigenen Beiträge des Diogenes betrifft, so wird er in schuldiger Rücksicht auf das viele Interessante, das ihm Diogenes geboten, sich diese unschuldigen Blüten einer dürftigen Phantasie gern gefallen lassen, wie man sich das Unkraut am Bande des Kornfeldes gern gefallen lässt, zumal wenn, wie in unserem Falle, ab und zu unter dem Unkraut auch ein anschuldiges Adonisröschen sich birgt.
Erstes Buch.
Einleitung (Prooemium).
Die Entwicklung der Philosophie hat, wie manche behaupten, ihren Anfang bei den Barbaren genommen. So hatten die Perser ihre Magier, die Babylonier und Assyrer ihre Chaldäer, die Inder ihre Gymnosophisten, die Kelten und Gallier ihre sogenannten Druiden und Semnotheen, wie Aristoteles in seinem Buche "Magikos" und Sotion in dem dreiundzwanzigsten Buch seiner "Sukzession der Philosophen (Diadoche)" berichtet. Ochos soll: ein Phönizier, Zamolxis ein Thraker und Atlas ein Libyer gewesen sein. Geben doch auch die Ägypter den Hephaistos, den sie für den Urheber der Philosophie halten, für einen Sohn des Nilstroms aus, und diejenigen, die über der Philosophie walten, seien eben seine Priester und Propheten.
Von da bis zu Alexander dem Makedonierkönig sollen 48 863 Jahre verflossen sein. Im Verlaufe dieser Zeit soll es 373 Sonnen- und 832 Mondfinsternisse gegeben haben. Von den Magiern ab aber, deren erster der Perser Zoroaster gewesen sein soll, bis zum Falle von Troja rechnet der Platoniker Hermodoros in seinem Buch von den Wissenschaften 5000 Jahre, der Lyder Xanthos von Zoroaster bis zum Übergang des Xerxes über den Hellespont 6000 Jahre; danach, sagte er, hätte es noch eine lange Reihe von Magiern gegeben, die einander ablösten, Ostanes und Astrapsychos, Gobryas und Pazatas, bis zur Auflösung des Perserreiches durch Alexander. Indes man täuscht sich und legt fälschlich den Barbaren die Leistungen der Griechen bei; denn die Griechen waren es. die nicht nur mit der Philosophie, sondern mit der Bildung des Menschengeschlechtes überhaupt den Anfang gemacht haben. Hat doch Musaios seine Heimat bei den Athenern und Linos bei den Thebanern. Den ersteren nennt man einen Sohn des Eumolpos und bezeichnet ihn als den Verfasser eines Gedichtes von der Theogonie und von der Himmelskugel. Ihm schreibt man den Ausspruch zu: Alles entstehe aus Einem und löse sich in das Nämliche wieder auf. Er solliseinen Tod in Phaleron gefunden haben, und auf seinem Grabmal soll folgende Aufschrift zu lesen gewesen sein:
Schaue das Grab! es birgt des Eumolpos Sohn, den Musaios;
Hier auf Phalerischer Flur ruhet, was sterblich an ihm.
Vom Vater des Musaios leiten auch die Eumolpiden in Athen ihren Namen her. Linos aber soll ein Sohn des Hermes und der Muse Urania sein. Er soll eine Kosmogonie gedichtet haben mit Schilderungen des Laufes von Sonne und Mond und der Erschaffung der lebenden Wesen sowie der Früchte. Der Anfang dieses seines Gedichtes lautet folgendermaßen:
Einstmals war eine Zeit, wo alles zugleich ward erschaffen.
Daraus entnahm Anaxagoras sein Wort von dem ursprünglichen Zusammensein aller Dinge und von dem Hinzutritt des Geistes, der sie ordnete. Linos soll in Euböa gestorben sein, getroffen vom Pfeil des Apollon. Seine Grabschrift soll gelautet haben:
Hier ruht Linos aus Theben gebürtig, Uranias Sprössling,
Die, mit Kränzen geschmückt, himmlischer Ehren genießt.
So hat denn die Philosophie ihren Ursprung bei den Griechen, und auch ihr Name schon weist jede Gemeinschaft mit den Barbaren entschieden von sich ab. Indes diejenigen, die den Ursprung der Philosophie auf die Barbaren zurückführen, berufen sich auf den Thraker Orpheus, indem sie ihn für einen Philosophen erklären, und zwar für den ältesten. Allein ich weiß nicht, ob man einen Mann, der sich über die Götter in so lästerlichen Reden erging, einen Philosophen nennen darf, noch weiß ich überhaupt, welche Bezeichnung man für den ausfindig machen soll, der den Göttern den ganzen Schwärm menschlicher Leidenschaften ohne jede Scheu und Schonung andichtet, selbst solche Unzüchtigkeiten, die nur selten von ein oder dem anderen Menschen, sogar mit dem Stimmorgan, begangen werden. Den Orpheus lässt denn die Sage durch die Wut von Weibern umkommen, wogegen seine Grabschrift zu Dion in Makedonien ihn durch Blitzschlag sterben lässt. Sie lautet:
Hier begruben die Musen den Thrakischen Sänger, den Orpheus,
Mit seinem flammenden Pfeil traf ihn der waltende Zeus.
Die Anwälte des barbarischen Ursprungs der Philosophie weisen auch noch hin auf die besonderen Gestaltungen der Philosophie bei jedem einzelnen dieser Volker. Sie behaupten, die Gymnosophisten und Druiden zielten in einer rätselhaften Sprechweise dahin, man solle die Götter ehren, nichts Böses tun und sich der Tapferkeit befleißigen. Was wenigstens die Gymnosophisten betrifft, so behauptet Kleitarchos im zwölften Buch (seines Lebens Alexanders d. Gr.), sie verachteten selbst den Tod, während die Chaldäer sich mit Astronomie und Sterndeutern befassten; die Magier aber befleißigten sich des Gottesdienstes, der Opfer und Gebete, überzeugt, dass sie allein erhört würden, auch gäben sie Auskunft über Wesen und Werden der Götter, die aus Feuer, Erde und Wasser bestünden; von Götterbildern aber wollten sie nichts wissen, und am allerwenigsten von der Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Gottheiten. Über das Wesen der Gerechtigkeit suchten sie ins klare zu kommen und hielten die Feuerbestattung für gottlos; für erlaubt dagegen halten sie den geschlechtlichen Verkehr mit Mutter und Tochter, wie Sotion im 23. Buch (der Diadochae) schreibt. Auch befassten sie sich mit der Seherkunst und der Prophetie, sogar unter der Versicherung, dass ihnen die Götter leibhaftig erschienen. Auch sei das Luftreich voll von Gebilden, die infolge der Ausdünstung sich in sanftem Fluss den Blicken der Scharfsichtigen mitteilten. Auffälligen Putz und goldenen Schmuck untersagten sie. Ihr Gewand war weiß, ihr Ruhebett war der Boden, ihre Nahrung Kohl, Käse und grobes Brot, ihr Stock ein Rohrstengel, mit dem sie — so sagt er — den Käse anspießten, um Bissen davon sich zu Munde zu führen. Zauberspuk kannten sie überhaupt nicht, wie Aristoteles in seinem "Magikos" behauptet und Deinon im 5. Buch seiner Geschichtsforschungen. Dieser meint auch, aus der Deutung seines Namens ergäbe sich, dass Zoroaster ein Sternpriester sei. Die nämliche Behauptung findet sich auch bei Hermodor. Aristoteles aber erklärt im 1. Buch seines Werkes über Philosophie, die Magier seien sogar älter als die Ägypter; es gebe nach ihnen zwei Urgründe, eine gute Gottheit und eine böse, die eine heiße Zeus und Oromastes (Ormuzd), die andere Hades und Areimanios (Ariman). Die nämliche Behauptung findet sich bei Hermippos, im 1. Buch über die Magier und bei Eudoxos in dem Buche "Periodos" und bei Theopomp im 8. Buch seiner Philippika. Dieser behauptet 9 sogar, nach dem Glauben der Magier würden die Menschen zu neuem Leben erwachen und unsterblich sein, und das All der Dinge würde infolge der Kreisbewegungen immer dasselbe bleiben. Dies berichtet auch der Rhodier Eudemos. Hekataios ferner meint, nach ihnen seien auch die Götter gewordene Wesen, und Klearch, der Solier, versichert in seinem Buche über Erziehung, auch die Gymnosophisten seien ihrem Ursprung nach auf die Magier zurückzuführen. Einige behaupten das Nämliche auch von den Juden. Außerdem sind die Geschichtsschreiber, die über die Magier berichten, sehr ungehalten über Herodot; denn weder habe Xerxes seine Geschosse gegen die Sonne gerichtet, noch habe er Ketten ins Meer hinabgelassen; denn das seien den Magiern zufolge Gottheiten; mit Götterbildern freilich wollten sie aus guten Gründen nichts zu schaffen haben.
Was aber die Philosophie der Ägypter anlange, so stünde es mit den Vorstellungen über die Götter und über die Gerechtigkeit folgendermaßen. Ihrer Behauptung zufolge ist der Urgrund die Masse (Materie) ; aus ihr haben sich die vier Elemente ausgeschieden und haben sich lebende Wesen gebildet. Ihre Götter, sagt man, sind Sonne und Mond, erstere Osiris genannt, letzterer Isis. Auf sie deuten sie in rätselartigen Bezügen hin durch den Käfer (den sogenannten Skarabäus) sowie durch eine Schlangenart und den Geier und andere Tiere, wie Manetho in seinem Abriß über Naturkunde berichtet und Hekataios in dem 1. Buch über die ägyptische Philosophie. Sie errichten Götterbilder und Heiligtümer, da man ja die Gestalt der Gottheit nicht kenne. Das Weltganze erklären sie für erschaffen und vergänglich und kugelförmig; die Sterne für Feuer, durch deren wohltemperierte Wärme alles Wachstum auf Erden erzeugt werde. Der Mond, meinen sie, verfinstere sich durch das Eintreten in den Erdschatten. Die Seele überlebe den Körper und wandere in andere Leiber. Regengüsse seien eine Folge des jeweiligen Luftwechsels. Auch über die weiteren Naturerscheinungen stellen sie ihre Betrachtungen an, wie Hekataios und Aristagoras berichten. Auch über die Gerechtigkeit stellten sie Leitsätze auf, die sie auf Hermes zurückführten; und die nützlichsten Tiere sahen sie für göttliche Wesen an. Sie selbst erklären sich für die Erfinder der Geometrie, Astrologie (Astronomie) und Arithmetik. So steht es mit ihren Erfindungen.
Den Namen Philosophie brachte zuerst Pythagoras auf und nannte sich selbst einen Philosophen in dem Gespräch, das er in Sikyon mit Leon, dem Tyrannen von Sikyon oder Phlius, führte, wie Herakleides, der Pontier, in seinem Buch über die entseelte Frau behauptet; denn kein Mensch sei weise, sondern nur die Gottheit. Ehedem wurde, was jetzt Philosophie heißt, vielmehr Weisheit genannt, und ein Weiser hieß, wer sich mit ihr berufsmäßig beschäftigte, also ein durch besondere Geistesschärfe hervorragender Mann, wählend Philosoph nur einen Liebhaber der Weisheit bezeichnet. Die Weisen wurden aber auch Sophisten genannt, und nicht nur sie, sondern auch die Dichter, wie denn Kratinos in den Archilochern in seinen Lobesworten auf Homer und Hesiod sie so nennt.
Für weise aber galten folgende Männer: Thales, Solon, Periander, Kleobulos, Chilon, Bias, Pittakos. Zugezählt werden ihnen Anacharsis der Skythe, Myson von Chen, Pherekydes von Syros und Epimenides von Kreta; von einigen auch noch der Tyrann Peisistratos. Das wären denn die Weisen.
Die Philosophie aber hat zwei Ausgangspunkte, den einen von Anaximander, den andern von Pythagoras. Der erstere war ein Schüler des Thales, Pythagoras dagegen hatte sich dem Pherekydes angeschlossen. Die eine Schule wurde die ionische genannt, weil Thales, ein Ionier, — er war nämlich Mifesier — des Anaximander Lehrer war; die andere die italische von Pythagoras her, weil er sich meist in Italien aufhielt. Es endigt aber die erstere, die ionische, mit Kleitomachos und Chrysippos und Theophrastos, die italische mit Epikur. Denn auf Thales folgen nacheinander Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras, Archelaos, Sokrates, der Begründer der Ethik, auf ihn dann die Sokratiker und unter ihnen vor allem Platon der Stifter der alten Akademie; auf diesen folgen dann Speusippos und Xenokrates, sodann Polemon, weiter Krantor und Krates, auf diesen Arkesilaos. der Begründer der mittleren Akademie; sodann Lakydes der die neuere Akademie ins Leben rief; ihm folgte Karneades und diesem Kleitomachos. So bildet denn Kleitomachos den Schluss dieser Reihe.
Der Abschluss mit Chrysippos vollzieht sich in folgender Reihe: auf Sokrates folgt Antisthenes, auf diesen Diogenes der Hund, auf diesen Krates von Theben, auf diesen Zenon von Kittion, auf diesen Kleanthes, auf diesen Chrysippos.
Die auf Theophrast führende Reihe ist folgende: auf Platon folgt Aristoteles, auf diesen Theophrastos. So endigt denn die ionische Schule.
Die italische aber zeigt folgenden Verlauf: auf Pherekydes folgt Pythagoras, auf diesen sein Sohn Telauges, auf ihn Xenophanes, auf ihn Parmenides. auf ihn Zenon von Elea, auf ihn Leukrppos, auf ihn Demokritos; auf diesen dann eine ganze Anzahl, unter ihnen vor allen namhaft Nausiphanes und Naukydes, an die sich Epikur anschließt. Für die hierhergehörigen Philosophen sind zwei Richtungen zu unterscheiden: die Dogmatiker und die Ephektiker (Skeptiker). Unter den Dogmatikern sind alle diejenigen zu verstehen, die von der Voraussetzung ausgehen, dass die Dinge unserm Verstände erfassbar sind; unter den Ephektikern alle diejenigen, welche mit ihrem Urteil zurückhalten in der Voraussetzung, dass die Dinge für unsern Verstand unfassbar sind. Unter ihnen gab es solche, die Schriften hinterließen, während andere überhaupt nichts schrieben, wie nach der Meinung einiger Sokrates, Stilpon, Philippos, Menedemos, Pyrrhon, Theodoros, Karneades, Bryson, nach einigen auch Pythagoras, Ariston aus Chios, abgesehen von einigen wenigen Briefen. Andere verfassten nur je eine Schrift wie Melissos, Parmenides, Anaxagoras, wogegen Zenon (der Eleate?) viele, Xenophanes noch mehr verfasste, noch mehr Demokrit, noch mehr Aristoteles und noch mehr Epikur und Chrysipp.
Ihre Namen haben die philosophischen Sekten nach verschiedenen Gesichtspunkten erhalten; die einen sind genannt worden nach ihren Heimatstädten; so die Eher, die Megariker, die Eretrier und die Kyrenaiker; andere nach ihren Lehrstätten: so die Akademiker und Stoiker; wieder andere nach zufälligen Umständen: so die Peripatetiker. Auch boshafter Spott konnte mitsprechen: so bei den Kynikern (den Hündischen); bei andern wieder war es die Gemütsverfassung, die für den Namen den Ausschlag gab, so bei den Eudaimonikern (den Befürwortern der Glückseligkeit), bei andern auch der Hinweis auf eine gewisse Eitelkeit, wie bei den Philalethen (Wahrheitsliebhabern) und Elenktikern (Widerlegungsmeistern) und Analogetikern (Analogiebeflissenen); noch andere benannte man nach ihren Lehrern wie die Sokratiker und Epikureer und sonstige. Was aber den Gehalt ihres Philosophierens anlangt, so werden die mit den Naturerscheinungen sich Beschäftigenden Physiker genannt, diejenigen, die es mit der Unterweisung für sittliche Bildung zu tun haben, Ethiker (Sittenlehrer) und die, welche sich mit wortklauberischer Begriffsbearbeitung abgeben, Dialektiker.
Was die Teile der Philosophie anlangt, so unterscheidet man deren drei: Physik, Ethik und Dialektik. Die Physik handelt von dem Weltganzen und dem, was in ihm ist; die Ethik von der Lebensführung und dem, was uns Menschen betrifft; die Dialektik endlich behandelt eingehend die begrifflichen Verhältnisse für beide Gebiete.
Die Dichtung auf das physische Gebiet herrscht bis auf Archelaos; mit Sokrates, wie schon früher bemerkt, trat die Wendung zur Ethik ein, mit Zenon, dem Eleaten, die Wendung zur Dialektik. Der ethischen Sekten gibt es zehn: die akademische, die kyrenaische, die elische, die megarische, die kynische, die eretrische, die dialektische, die peripatetische, die stoische, die epikureische. Der Vorsteher der alten Akademie war Platon, der mittleren Arkesilaos, der neuen Lakydes. Vorsteher der kyrenaischen Sekte war zuerst Aristipp aus Kyrene, der elischen Phaidon aus Elis, der megarischen Eukleides aus Megara, der kynischen Antisthenes aus Athen, der eretrischen Menedemos aus Eretria, der dialektischen Kleitomachos aus Karthago, der peripatetischen Aristoteles aus Stageira, der stoischen Zenon aus Kittion; die epikureische trägt den Namen ihres Stifters seihst. Übrigens vertritt Hippobotos in seiner Schrift über die Sekten die Ansicht, es gebe nur neun Sekten und Lebensrichtungen: erstens die megarische, zweitens die eretrische, drittens die kyrenaische, viertens die epikureische, fünftens die annikereische, sechstens die theodoreische, siebentens die zenonische oder stoische, achtens die alte akademische, neuntens die peripatetische. Von einer kynischen ist bei ihm ebenso wenig die Rede wie von einer elischen und dialektischen. Denn mit der pyrrhonischen Sekte wollen die meisten überhaupt nichts zu tun haben wegen ihres Mangels an Klarheit und Deutlichkeit; einige allerdings behaupten, in gewisser Hinsicht sei sie eine Sekte, in anderer wieder nicht. Was ihr den Schein einer solchen gibt, ist folgendes: Sekte nennen wir eine solche Gemeinschaft, die einer bestimmten Auffassung im Anschluss an das jeweilig Erscheinende folgt oder zu folgen scheint; und hiernach können wir die Skeptiker mit vollem Recht eine Sekte nennen. Denken wir uns aber unter einer Sekte eine Gemeinschaft, die sich an feste Lehrsätze hält, welche in voller Übereinstimmung miteinander stehen, dann passt der Name Sekte nicht mehr auf sie; denn sie hat keine (verbindlichen) Lehrsätze. So viel also von den Prinzipien, von den Sukzessionsreihen, von den Teilen der Philosophie und von ihren Sekten. Übrigens tat sich erst vor kurzem noch eine eklektische Sekte auf unter Führung des Potamon aus Alexandreia, der sich aus den Lehren aller Sekten auswählte, was ihm gefiel. Er ist, wie er in seinem Lehrbuch erklärt, der Ansicht, dass es Kriterien der Wahrheit gibt: erstens die Geisteskraft, von der das Urteil ausgeht; sie ist die leitende Macht; sodann das Mittel, durch welches die Wirkung erzielt wird, und das ist die denkbar deutlichste Vorstellung. Prinzipien für die Gesamtheit der Dinge seien, meint er, die Masse (Materie) und das Bewirkende, die Qualität und der Raum. Denn sie stellen das Woraus dar und das Wodurch und das Wie und das Worin. Endzweck aber, auf den alles sich bezieht, sei ein in jeder Beziehung vollendet tugendhaftes Leben, nicht ohne die Ausstattung mit den naturgemäßen körperlichen sowie äußeren Gütern. Nunmehr aber soll die Rede sein von den Männern selbst, und zwar zuerst von Thales.
Erstes Kapitel. Thales. 640—562 v. Chr.
Des Thales Vater war, wie Herodot, Duris und Demokrit berichten, Examyos, seine Mutter Kleobulina aus dem Hause der Theliden, eines phönizischen Geschlechtes von höchstem Ansehen, das von Kadmos und Agenor abstammte. Er gehörte zu den sieben Weisen, wie auch Platon bezeugt. Er war der erste, dem man den Namen eines Weisen gab zur Zeit des athenischen Archonten Damasias. Während dessen Archontats (582 v. Chr.) kam es auch zur Feststellung der Siebenzahl der sogenannten Weisen, wie Demetrios, der Phalereer, in seinem Verzeichnis der Archonten berichtet. In die Bürgerliste von Milet ward er eingetragen, als er dort in Begleitung des aus Phönizien verbannten Neileos (Neleus, vgl. III 1) eintraf, doch behaupten die meisten, er sei geborener Milesier gewesen aus vornehmem Hause. Zunächst politisch tätig, wandte er sich dann der Naturbetrachtung zu, hinterließ aber einigen zufolge nichts Schriftliches. Denn die ihm zugeschriebene Sternkunde für Seefahrer soll ein Werk des Samiers Phokos sein. Kallimachos aber kennt ihn ab Entdecker des kleinen Bärengestirns, worauf er mit folgenden Jamben hinweist:
Man sagt, des Wagens Sternchen hat er auch entdeckt.
Die Führer auf der See für die Phönizier,
Nach einigen hat er zwei Schriften verfasst und nicht mehr, nämlich über die Sonnenwenden und über die Tag- und Nachtgleichen, überzeugt, dass das Übrige für den Verstand unfassbar sei. Nach einigen ist er der erste, der sich mit Sternkunde befasst und Sonnenfinsternisse und Wendezeiten vorausgesagt habe, wie Eudemos in seiner Geschichte der Astronomie berichtet, weshalb ihn denn auch Xenophanes und Herodot (I 74) bewundern. Es bezeugen dies auch Heraklit (Frg. 38 Diels) und Demokrit (Frg. 115a).
Einige bezeichnen ihn auch als ersten Vertreter der Ansicht, dass die Seele unsterblich sei. Zu diesen gehört der Dichter Choirilos. Thales war es, der zuerst den Sonnenlauf von Wendekreis zu Wendekreis feststellte, wie er denn nach einigen auch das Größenverhältnis der Sonne zum Sonnenkreise und so auch das Verhältnis des Mondes zum Mondkreise dahin bestimmte, dass es das von 1:720 sei. Er war es auch, der zuerst den letzten Tag des Monats den dreißigsten nannte. Nach einigen legte er auch den Grund zur Naturphilosophie.
Aristoteles und Hippias berichten, er denke sich auch das Leblose beseelt, eine Ansicht, zu der ihn die Beobachtung des Magnetsteines und des Bernsteines führte. In der Geometrie ein Schüler der Ägypter hat er, wie Pamphile berichtet, zuerst das rechtwinklige Dreieck in den Kreis (Halbkreis) eingetragen und daraufhin einen Stier geopfert. Andere schreiben dies dem Pythagoras zu; zu ihnen gehört der Mathematiker (der rechenkundige) Apollodor. Er (Thales) förderte sehr erheblich die Entdeckungen, die, wie Kallimachos m seinem jambischen Gedicht sagt, der Phryger Euphorbos gemacht hatte, wie z. B. die sogenannten Skalen (ungleichseitige rechtwinklige Dreiecke) und die Dreiecke überhaupt und was zur Theorie der Linien gehört.
Auch auf staatsmännischem Gebiet scheint er trefflich beschlagen gewesen zu sein. So wusste er es zu verhindern, dass das Bündnis zustande kam, um das sich Kroisos durch eine Gesandtschaft an die Milesier bemühte. Das rettete später, nach dem Siege des Kyros, den Staat. Und er selbst behauptet, wie Herakleides berichtet, er sei menschenscheu und ein Sonderling gewesen. Einige lassen ihn auch verheiratet und Vater eines Sohnes namens Kybisthos sein. Nach anderen dagegen ist er unverheiratet geblieben und hat den Sohn seiner Schwester adoptiert. Auf die Frage, warum er auf den Kindersegen verzichte, soll er erwidert haben: "Aus Liebe zu den Kindern." Gegen das Drängen auf Verheiratung von Seiten seiner Mutter soll er sich zur Wehr gesetzt haben mit den Worten: "Noch ist es nicht Zeit dazu," und als sie ihn bei vorgeschrittenem Alter heftiger bestürmte, soll er entgegnet haben: "Nun ist die Zeit dazu vorüber." Ferner berichtet der Rhodier Hieronymos in dem 2. Buch seiner vermischten Denkwürdigkeiten, er habe, um den Beweis zu liefern, dass es gar kein Kunststück sei reich zu werden, in Voraussicht einer reichen Ölfruchternte alle Ölpressen gemietet und dadurch ein enormes Vermögen gewonnen.
Für den Urgrund aller Dinge erklärte er das Wasser. Die Welt hielt er für beseelt und für erfüllt i von göttlichen Wesen. Er soll zuerst die genaue Scheidung der Jahreszeiten aufgebracht und das Jahr in 365 Tage eingeteilt haben. Und zwar war er im | Grunde Autodidakt, nur dass er eine Reise nach Ägypten machte, wo er in engen Verkehr mit den Priestern trat. Auch berichtet Hieronymos, er habe die Höhe der Pyramiden gemessen vermittelst ihres Schattens, den er genau in dem Zeitpunkt abmaß, wo unser Schatten und unser Leib die gleiche Länge haben. In Milet stand er in engem Verkehr mit Thrasybul, dem Herrscher von Milet, wie Minyes berichtet. Allbekannt ist ferner die Geschichte von dem Dreifuß, der, von Fischern aus dem Meer gezogen, von dem Volke der Milesier an die (sieben) Weisen überwiesen ward. Man erzählt nämlich, einige ionische Jünglinge hätten milesischen Fischern einen Fischzug abgekauft. Als dabei der Dreifuß zu Tage kam, erhob sich ein Streit darüber, der erst geschlichtet ward, als die Milesier darüber das Orakel zu Delphi befragten. Die Antwort des Gottes lautete folgendermaßen:
Bürger Milets, du befragst den Phoibos über den Dreifuß?
Wer der Weiseste ist, dem gebührt, so sag' ich, der Dreifuß.
So wird er denn dem Thales überreicht. Dieser übergibt ihn einem andern der sieben Weisen, und dieser wieder einem andern bis auf Solon. Dieser aber erklärte für den Weisesten den Gott und sandte den Dreifuß nach Delphi. Kallimachos stellt die Sache in seinen Jamben anders dar und zwar so, wie er sie bei dem Milesier Maiandrios geschildert fand. Danach hat ein gewisser Bathykles, ein Arkadier, eine Schale hinterlassen mit der Anweisung, sie dem Trefflichsten unter den Weisen zu überreichen. So ward sie dem Thales überwiesen; aus dessen Hand wanderte sie reihum von einem Weisen zum andern und kam so wieder zurück an Thales. Dieser aber sandte sie an den didymäischen Apollon mit folgenden Begleitversen nach Kallimachos:
Als Ehrenpreis empfing mich Thales schon zweimal;
Jetzt soll ich an das hehre Haupt Athens kommen.
In Prosa lautet es so: "Der Milesier Thales, des Examyos Sohn, weiht dem delphinischen Apollon dies Ehrengeschenk der Hellenen, das er zweimal empfangen hat." Der Überbringer der Schale, der Sohn des Bathykles, hieß Thyrion, wie Eleusis in seinem Buch über Achilles sagt und Alexander, der Myndier im 9. Buch seiner mythischen Erzählungen. Eudoxos aber, der Knidier, und Euanthes, der Milesier berichten, einer von den Freunden des Kroisos habe von dem Konig ein goldenes Trinkgefäß erhalten um es dem Weisesten unter den Griechen zu überreichen, dieser aber habe es dem Thales überreicht; durch diesen sei es weiterhin an Chilon gelangt, der den pythischen Gott befragt habe, wer weiser sei als er. Die Antwort habe gelautet: "Myson." Über ihn soll seines Orts gehandelt werden. (Diesen setzt Eudoxos an die Stelle des Kleobulos, Platon [Prot. 343 A] an die Stelle des Periander.) Über ihn gab denn der Pythier folgende Auskunft:
Myson in Chen am Oeta ist besser als du, so behaupt' ich,
Ausgerüstet mit 5 Geist zu hohem Flug der Gedanken.
Zum Fragen beauftragt war Anacharsis. Dagegen berichten der Platoniker Daimachos und Klearchos, die Schale sei von Kroisos an Pittakos gesandt und so in Umlauf gesetzt worden. Andron wiederum behauptet in seinem Buch "Der Dreifuß", die Argiver hätten dem Weisesten der Hellenen einen Dreifuß als Tugendpreis bestimmt, und als solcher sei Aristodemos in Sparta anerkannt worden; dieser habe ihn an Chilon abgetreten. Es gedenkt des Aristodemos auch Alkaios in folgenden Versen [Fr. 50 Bergk]:
So hat denn, wie es heißt, Aristodamos
In Sparta einst ein treffend' Wort gesprochen:
Geld macht den Mann, vergebens
Sucht man nach einem armen Ehrenmann.
Einige erzählen, es sei von Periander an den milesischen Tyrannen Thrasybul ein reich beladenes Lastschiff gesandt worden. Dies habe bei Kos Schiffbruch gelitten und einige Zeit darauf sei von einigen Fischern der Dreifuß hervorgezogen worden. Phanodikos dagegen behauptet, er sei in der Nähe von Athen im Meer gefunden, in die Stadt gebracht und auf Beschluss der Volksversammlung dem Bias übersandt worden. Den Grund werden wir in dem Abschnitt über Bias mitteilen. Wieder andere behaupten, der Dreifuß sei ein Werk des Hephaistos und vom Gott dem Pelops als Hochzeitsgeschenk dargereicht worden; darauf sei er an den Menelaos gekommen, sei dann mitsamt der Helena von Paris geraubt und von der Lakonerin in das koische Meer geworfen worden mit den Worten: "Das wird der Grund zu vielem Streite werden." Als späterhin Leute aus Lebedos den Fischern dort einen Fang abkauften, sei auch der Dreifuß mit in ihre Hände gekommen. Darüber seien sie mit den Fischern in Streit geraten, bis sie nach Kos gekommen; und da sie es hier zu keiner Entscheidung brachten, erstatteten sie Meldung an ihre Mutterstadt Milet. Die Milesier schickten nun eine Gesandtschaft nach Kos, wurden abgewiesen und überzogen die Koer mit Krieg. Nach starkem Verlust an Menschenleben auf beiden Seiten verkündete ihnen ein Orakelspruch, sie sollten den Dreifuß dem Weisesten überreichen. Beide Parteien einigten sich auf Thales, dieser aber weihte ihn nach vollzogenem Umlauf (bei den Sieben) dem didymäischen Apollon. Der Spruch an die Koer lautete so:
Nicht wird enden der Streit der Meroper und der Ioner,
Bis das Werk des Hephäst, der Dreifuß von Gold, der versenkte
Euerer Stadt entzogen ins Haus des Mannes gelangt ist,
Der mit Schärfe erkennt was ist, was kommt, was gewesen.
Der Spruch an die Milesier aber lautete:
Bürger Milets, du befrägst den Phoibos über den Dreifuß?
Die Fortsetzung ist oben schon mitgeteilt (I 28). Darüber soviel.
Hermippos in seinen Lebensbeschreibungen überträgt einen von manchen dem Sokrates zugeschriebenen Ausspruch auf den Thales. Er legt ihm nämlich das Wort bei: Drei Dinge sind es, die mich dem Schicksal zu Dank verpflichten: erstens, dass ich als Mensch zur Welt kam und nicht als Tier; zweitens, dass ich ein Mann ward und nicht ein Weib; drittens, dass ich ein Hellene bin und nicht ein Barbar. Ferner läuft folgende Erzählung von ihm um: Als er einst, um die Sterne zu beobachten, begleitet von einem alten Weib seine Wohnung verließ, fiel er in eine Grube. Da rief dem Aufschreienden das Weib die Worte zu: "Du kannst nicht sehen, Thales, was dir vor Füßen liegt, und wähnst zu erkennen, was am Himmel ist?" Von seinen astronomischen Forschungen übrigens hat auch Timon Kenntnis, und er lobt ihn darob mit folgenden Worten [Frg. 23 Diels]:
Zu den Weisen, den Sieben, zählt Thales, als kundig der Sterne.
Was Thales schriftlich hinterlassen hat, beläuft sich nach Lobon von Arges auf zweihundert Verse. Sein Bildnis soll folgende Inschrift getragen haben:
Ihn, den Thales, erwies als ältesten Kenner der Sternwelt
Seine Mutter Milet, diese ionische Stadt.
Zu seinen poetischen Sprüchen sollen folgende gehören:
Schwatzhafter Rede entstammt niemals verständige Meinung,
Eines, was weise ist, suche;
Eines, was trefflich ist, wähle.
Gar mancher geschwätzigen Menschen lose Zungen wirst du verstopfen.
Als Aussprüche von ihm sind folgende bekannt: Das älteste der Wesen ist Gott, der unerzeugte; das schönste die Welt, das Werk Gottes, das größte der Raum, der allumfassende, das schnellste der Geist, der alles durchdringende; das stärkste die Notwendigkeit, die alles beherrschende, das weiseste die Zeit, die alles erfindende. Der Tod, sagte er, unterscheide sich nicht vom Leben. "Warum also," erwiderte ihm einer, "stirbst du nicht?" Darauf er: "Eben weil es keinen Unterschied macht." Auf die Frage, die einer an ihn richtete, was früher entstanden sei, die Nacht oder der Tag, erwiderte er: "Die Nacht um einen Tag früher." Es fragte ihn jemand, ob der Mensch sich bei frevelhafter Tat dem Auge Gottes entziehen könne. "Nein," erwiderte er, "selbst nicht bei bloßer Absicht dazu." Einem Ehebrecher, der fragte, ob er seine Unschuld beschwören dürfe, antwortete er: "Meineid ist nicht schlimmer als Ehebruch." Weitere Fragen und Antworten: Was ist schwer? "Sich selbst erkennen." Was leicht? "Einem andern einen Rat erteilen." Was das Willkommenste? "Sein Ziel erreichen." Was das Göttliche? "Was weder Anfang noch Ende hat." Was hast du Erstaunliches gesehen? "Einen greisen Tyrannen." Wie kann man ein Missgeschick am leichtesten tragen? "Wenn man die Feinde in schlimmer Lage sieht." Wie kann man am besten und gerechtesten leben? "Wenn wir, was wir an andern tadeln, selber nicht tun." Wer ist glücklich? "Wer gesunden Leibes, vom Schicksal begünstigt und mit trefflicher Seelenbildung ausgerüstet ist." Ferner: Sei eingedenk der Freunde, der anwesenden wie der abwesenden. Suche nicht äußerlich zu glänzen, sondern durch Streben und Tat Wohlgefallen zu erwecken. Suche nicht auf verwerfliche Weise reich zu werden. Mache dich keines Vertrauensbruches schuldig gegen solche, die dir in Treue verbunden waren. Was du an Unterstützungen deinen Eltern hast zuteil werden lassen, das darfst du auch von deinen Kindern erwarten. — Das Anschwellen des Nils erklärte er als Wirkung der Passatwinde, die, in ihrer Richtung der Strömung entgegengesetzt, diese zurückdrängen.
Apollodor setzt in seinen Chronika die Geburt des Thales in das erste Jahr der 35. Olympiade (640 v. Chr.). Er starb in einem Alter von 78 Jahren oder, wie Sosikrates sagt, von 90 Jahren. Denn er sei gestorben in der 58. Olympiade (548/545 v. Chr.) und sei ein Zeitgenosse des Kroisos, dem er auch den Übergang über den Halys ohne Drücke zu ermöglichen versprochen habe durch Ablenkung des Stromes.
Es hat auch noch andere Männer des Namens Thales gegeben, wie der Magnesier Demetrius in seinen Homonymen (Ruch über gleichnamige Dichter und Schriftsteller) sagt, und zwar sind es fünf: erstens ein kallatinischer Rhetor, eitel und gefallsüchtig; sodann ein Maler aus Sikyon, ein geistvoller Mann; drittens ein Mann der ältesten Zeit, Zeitgenosse des Hesiod, Homer und Lykurg; viertens der, dessen Duris in seinem Werk über Malerei gedenkt; fünftens ein jüngerer und wenig bekannter, den auch Dionysios in seinen "Kritika" erwähnt.