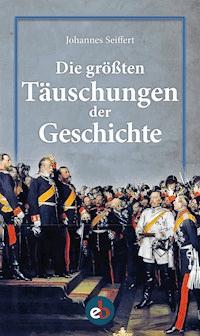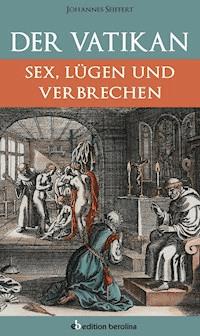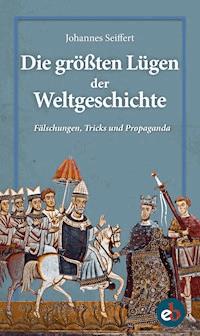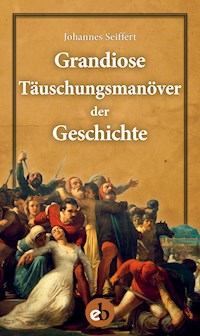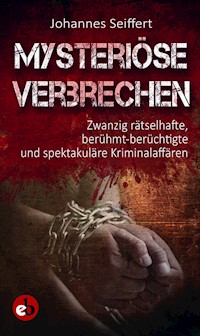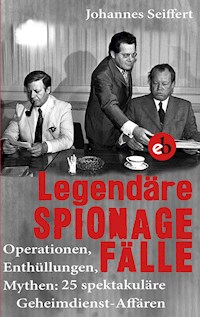
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition berolina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Johannes Seiffert entführt seine Leser in die geheimnisumwobene Welt der Spione und Agenten. Anhand von 25 spektakulären, aber auch bislang unbekannten Spionagefällen des 20. und 21. Jahrhunderts entschlüsselt der Autor Mythen und Mythologien um das "zweitälteste Gewerbe der Welt" und seiner Protagonisten. Dabei spannt er einen weiten Bogen: von Oberst Redl bis Edward Snowden, von Mata Hari bis Katrina Leung, von Richard Sorge bis Julian Assange. Einen besonderen Fokus legt er auf die deutsch-deutsche Spionagegeschichte, wofür die Namen Reinhard Gehlen, Otto John und Heinz Felfe, aber auch Gabriele Gast, Günter Guillaume und Werner Stiller stehen. Auch US-amerikanische "Maulwürfe" nimmt er in Augenschein, wie die Doppelagenten Aldrich Ames und Robert Hanssen. Dass der einstige Regierungschef Schwedens, Olof Palme, vermutlich ein CIA-Agent war, thematisiert er ebenso wie die Affäre Boursicot um einen liebeskranken Angestellten der französischen Botschaft in Peking. Und er erzählt die Geschichte zweier veritabler Ost-James-Bonds, die weithin unbekannten Fälle von Horst Hesse und Hans Wax. Zudem präsentiert er neue Erkenntnisse zu Ruth Werner alias "Sonja", die angeblich Stalins wichtigste Agentin im Zweiten Weltkrieg war. Über all das und vieles mehr bringt der Autor Unwahrheiten, Halbwahrheiten und Täuschungen zum Vorschein und analysiert, wie es wirklich gewesen ist. Ein populär aufbereiteter zeitgeschichtlicher Band um Lügen, Intrigen und Verrat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johannes Seiffert
Legendäre Spionagefälle
Operationen, Enthüllungen, Mythen:
25 spektakuläre Geheimdienst-Affären
edition berolina
eISBN 978-3-95841-567-6
1. Auflage
© ٢٠٢٠ by BEBUG mbH / edition berolina, Berlin
Umschlaggestaltung: BEBUG mbH, Berlin
Umschlagabbildung: picture alliance / AP Photo | Edwin Reichert
Alexanderstraße 1
10178 Berlin
Tel. 030 / 206 109 – 0
www.buchredaktion.de
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Markus »Mischa« Wolf, über Jahrzehnte Chef der DDR-Auslandsspionage, pflegte im privaten Gespräch und später auch in seiner Autobiographie gern die Geschichte wiederzugeben, wie in der Bibel die Anfänge nachrichtendienstlicher Aktivitäten geschildert werden, speziell im Hinblick auf die Verbindung des ältesten (Prostitution) mit dem zweitältesten Gewerbe (Spionage). Im vierten Buch Mose findet sich tatsächlich die Geschichte, wie Mose – im Auftrag des Herrn (!) – zwölf Männer zu Kundschaftern bestimmt. Einem der Männer, Hosea, verleiht er den Decknamen »Joshua«. Als Nachfolger von Moses sendet Joshua später selbst weitere Kundschafter aus, darunter zwei, die in Jericho Kontakt zur Prostituierten Rahab aufnehmen sollen. Als die Polizei sich wenig später dem Bordell Rahabs nähert, versteckt sie die beiden israelischen Agenten auf dem Dach des Hauses und bewahrt sie so vor der Verhaftung. Später revanchieren sich die beiden Kundschafter und retten Rahab das Leben.
Ist somit die Spionage als Profession bereits mehrere Jahrtausende alt, so soll es im vorliegenden Buch um herausragende Spionagefälle der beiden vergangenen Jahrhunderte gehen, die reich an ebensolchen waren, und um Persönlichkeiten, welche die Geschichte der Spionage geprägt haben, erfolgreich oder erfolglos, aber in jedem Falle speziell bis spektakulär. Wenn Sie sich nun fragen, was hat das alles mit heute zu tun, mit dem Hier und Jetzt, dann genügt ein Blick auf die aktuelle Medienberichterstattung zu Vorgängen rund um den Globus, die illustrieren, welche Folgen die Tätigkeit einzelner Spione beziehungsweise einzelner Spionageorganisationen haben kann. Es ist kein Zufall, dass in Hongkong gerade dann 2019 die Unruhen aufflammten, als die Volksrepublik (VR) China vom amerikanischen Präsidenten Trump in einen Handelskrieg mit den USA gezerrt wurde. Seitdem kam Hongkong monatelang nicht zur Ruhe, wurde die VR China an ihrem »weichen Bauch« (wie seinerzeit die So-wjetunion in den islamisch geprägten Landesteilen an ihrer Südgrenze) unter Druck gesetzt, durch gezielt inszenierte Tumulte in Schwierigkeiten gebracht. In Hongkong sind traditionell die britischen, aber eben auch die mit ihnen per UKUSA-Abkommen eng verbündeten amerikanischen Geheimdienste sehr präsent und in der Lage, quasi auf Knopfdruck solche Unruhen auszulösen (oder abzustellen).
Eine weitere solche »Schwachstelle« stellt in Chinas fernem Westen die Uiguren-Provinz Xinjiang dar, die immer wieder von »Unruhen« heimgesucht wird. Hier mischt auch der Bundesnachrichtendienst (BND) mit, der bekanntlich in München eine große Uiguren-Exilgemeinde finanziert und steuert. Und auch in den USA wird dieses »Argument« gern genommen, um die Menschenrechtskeule gegen die VR China zu schwingen – zuletzt sogar unterstützt durch einen einstündigen »Beitrag« des Comedians John Oliver zu bester Sendezeit in den USA. Und kaum waren die Unruhen auf den Straßen Hongkongs abgeklungen, kam mit dem Coronavirus die nächste Plage übers Land. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Mittlerweile wird in chinesischen Medien – zur Belustigung der sich wie immer ahnungslos gebenden Westblockpresse – offen darüber spekuliert, dass genau vier Wochen vor dem Ausbruch des Virus in Wuhan eine große US-Militärdelegation bei den Militärsport-Weltmeisterschaften in Wuhan angetreten war. Nimmt man nun noch hinzu, dass die USA die Nation ist, die am meisten Geld in die Erforschung von ABC-Waffen, also atomaren, biologischen und chemischen Waffen, steckt, muss man auch hier nur eins und eins zusammenzählen, um zu einem beunruhigenden Befund zu kommen.
Ende des Jahres 2019 bekam das staunende Publikum eine weitere Bilderbuchvorstellung über die Wirkungsweise von Spionagetätigkeit gegen ein Land beziehungsweise gegen eine Partei oder eine einzelne Person. In Bolivien wurde der gewählte Präsident Evo Morales zur Flucht außer Landes genötigt, nachdem der bolivianische Heeres- und der Polizeichef ihn zum Rücktritt aufgefordert und »Aufständische« dem Präsidenten und seiner Familie mit dem Tod gedroht hatten. Wie zu vernehmen war, halfen siebenstellige US-Belohnungsangebote per Telefon dabei, die beiden Funktionäre zum Umdenken beziehungsweise zum Seitenwechsel zu bringen. Jeder Mensch hat seinen Preis, eine der ältesten Grundregeln des Spionagegeschäfts. Und wenn es nicht das Geld ist, dann sind es kompromittierende Dinge aus seinem Privatleben, entweder echt oder täuschend echt nachgemacht oder per raffiniert gestellter Falle gezielt produziert, die ausreichenden Druck auszuüben in der Lage sind.
Interessant sind auch die seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten 2016 nicht verstummenden Gerüchte beziehungsweise Behauptungen, Russland habe massiv und manipulativ in die US-Präsidentenwahl eingegriffen und so erst die Wahl Trumps ermöglicht. Stichhaltige, überprüfbare Beweise hierfür wurden zu keinem Zeitpunkt vorgelegt. Dennoch werden diese Behauptungen mantraartig wiederholt und von den US-Medien und ihrer internationalen Gefolgschaft wiedergekäut. Dass die Kriegstreiberin Hillary Clinton wegen massiver Fehler in der Wahlkampfführung trotz aussichtsreicher Position im Rennen 2016 nicht siegte, muss aus Friedenssicht als großer Glücksfall gelten. Zwar wurde stattdessen mit Trump ein korrupter Clown gewählt, der jedoch zumindest außenpolitisch den Säbel weitgehend aus der Hand gelegt und bislang keinen größeren neuen Krieg vom Zaun gebrochen hat (im Gegensatz zu dem, was Frau Clinton schon im Wahlkampf ankündigte), sondern im Gegenteil den Rückzug der US-Truppen aus Syrien und zuletzt sogar – aus persönlicher Kränkung heraus – den teilweisen US-Truppenabzug aus der BRD befahl. Da nach wie vor und ganz bewusst sowohl eine Sicherungstruppe rund um die Ölquellen im kurdischen Stammesgebiet auf syrischem Boden belassen wird als auch noch über 20.000 US-Soldaten auf dem Gebiet der BRD die größte Ansammlung von US-Truppen außerhalb der USA darstellen, wurde damit die eigentliche Interessenlage der USA einmal mehr offenbar gemacht. Nachdem selbst die offiziellen, gerichtlichen und sonstigen Untersuchungen in den USA keine stichhaltigen, gerichtsverwertbaren Beweise für eine ausländische Manipulation der US-Wahlen erbrachte (sondern einmal mehr die Erkenntnis, dass es dem Populisten Trump 2016 gelungen war, die Stimmung im US-Volke besser zu erfassen und für sich zu nutzen als seiner demokratischen Widersacherin), wurde Trump seit Ende 2019 erneut durch den Kakao gezogen und sogar mit einem am Ende erfolglosen Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) bedacht. Grund: Er soll den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Juli 2019 während eines Telefonats um kompromittierendes Material gegen Joe Biden gebeten haben und als Druckmittel dafür 400 Millionen US-Dollar Militärhilfe der USA für die Ukraine (ein neutrales, mit der USA vertraglich nicht verbündetes Land) zurückgehalten haben. Worum geht es, und wer ist dieser Joe Biden? Biden war US-Vizepräsident unter Barack Obama und hat sich gerade in der Ukraine in zweifelhafter Weise betätigt. Zum einen war er 2014 zentral am vom Westen gesteuerten Umsturz, am Putsch gegen den gewählten Präsidenten Janukowitsch beteiligt, der auf illegale Weise zur Flucht gezwungen wurde. Seinerzeit hatten die vom Westblock finanzierten, monatelang in Kiew auf dem Maidan randalierenden Hooligans aus Lwiw (Lemberg) sehr glaubwürdige Todesdrohungen gegen ihn ausgesprochen. Zum anderen erhielt Bidens Sohn Hunter zur Belohnung (hony soit qui mal y pense) direkt nach dem Umsturz ein mit monatlich 50.000 US-Dollar dotiertes Aufsichtsratsmandat der ukrainischen Gasholding Burisma, das dieser erst 2019 aufgab, um seinen Vater im Wahlkampf 2020 von diesem Amtsmissbrauchsvorwurf zu entlasten.
Natürlich ging auch diese angebliche Affäre Trumps wie das Hornberger Schießen aus. Dennoch wird in den US-Medien behauptet, eine solche Manipulation des Wahlkampfs, wie sie Trump vorgehabt habe, sei beispiellos. Dabei muss man nur einige Jahrzehnte in der US-Geschichte zurückgehen (aber so weit reicht das Kurzzeitgedächtnis der Westblockmedien bekanntlich nur, wenn es den eigenen Interessen dient, nicht, wenn es um die Wahrheit geht), um auf einen deutlich massiveren Fall illegaler Absprachen im Rahmen einer US-Präsidentenwahl zu stoßen. 1980 führte Schauspieler Ronald Reagan für die Republikaner einen erbitterten Wahlkampf gegen den Demokraten Jimmy Carter, der zum Ende seiner ersten Wahlperiode vor der in der US-Geschichte eigentlich meist unproblematischen Wiederwahl für die zweite Amtsperiode stand, qua Amtsbonus als Wahlkampfvorteil. Doch die den etwas dümmlichen Reagan steuernden Republikaner konnten dennoch einen überraschenden Sieg erringen. Und zwar dank einer heimlichen Absprache mit den islamischen Revolutionären im Iran, die 1977 den Schah gestürzt und 1979 einige Dutzend Mitarbeiter der US-Botschaft in Teheran als Geiseln genommen hatten.
Carter hatte eine militärische Befreiungsaktion für die US-Geiseln genehmigt, die auf spektakuläre Weise – und möglicherweise absichtlich – scheiterte. Anschließend hielten die Islamisten in Absprache mit dem Wahlkampfteam Reagans für die Dauer des US-Präsidentenwahlkampfs die Geiseln weiter in Haft. Die misslungene Befreiungsaktion Eagle Claw (»Adlerklaue«) und die Tatsache, dass Carter nicht in der Lage war, die Geiseln auf anderem Weg zu befreien, sorgten für den beabsichtigten Stimmungsumschwung im Wahlvolk und sicherten Staatsschauspieler Reagan den Sieg. Die iranischen Islamisten ließen nach seinem Wahlsieg umgehend ihre Geiseln frei. Diese illegale Wahlkampfmanipulation legte im Folgenden die Grundlage für eine weit größere Spionageaffäre, auf die an anderer Stelle ausführlich eingegangen werden soll: die sogenannte Iran-Contra-Affäre. In diesem Zusammenhang wird von Historikern meist die Vorgeschichte übersehen beziehungsweise bewusst ausgeblendet, nämlich dass der vertraute Umgang Reagans mit den Islamisten seit der Geiselnahme und ihrer gezielten Beendigung nach der Wahlniederlage Carters erst das Geschäft Waffen gegen Geiseln möglich machte, das einige Jahre später aufflog und einen weiteren der vielen Schatten auf die Präsidentschaft Reagans warf. Carter wurde so der zehnte US-Präsident, der nach nur einer Wahlperiode sein Amt wieder verlor. Bush senior, George H. W. Bush, war dann der elfte, als er nach zwei Reagan-Amtszeiten und einer ersten eigenen Wahlperiode gegen Teflon-Boy Bill Clinton verlor. Was Bush Senior so wurmte, dass er im Jahr 2000 seinen Sohn in den Wahlkampf schickte, den dieser, George W. Bush, dann 2001 auch gewann.
Möglicherweise haben aber auch Sie sich gewundert, dass Anfang 2020 in der Medizinischen Hochschule Hannover (Universitätsklinik) knapp drei Wochen lang ein Mafiaboss aus Montenegro, dessen Name als Igor K. angegeben wurde, ob seiner bei heimatlichen Auseinandersetzungen erlittenen Schusswunden behandelt und das Krankenhaus während dieser Zeit mit einem massiven Polizeiaufgebot abgeriegelt wurde. Verweigerte die Polizei zunächst jegliche Auskunft über den Einsatz rund um das Krankenhaus, so sickerte anschließend durch, der Mafiaboss samt Ehefrau sei mit einem Privatflugzeug und in Begleitung von Beamten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) nach Hannover gebracht worden. Flug- und Behandlungskosten in Höhe von über 100.000 Euro trug der reiche Mafioso angeblich selbst. Dabei wurde ihm auch ein künstliches Kniegelenk eingesetzt. Die Kosten für das Polizeiaufgebot in Höhe von rund einer Million Euro trug, so die letzte Auskunft, der deutsche Steuerzahler. Alle diese Informationen machen nur Sinn, wenn hier der BND seine Hand im Spiel hatte und somit der Mafiaboss, in welcher Form auch immer, zum lokalen Agentennetzwerk des BRD-Geheimdienstes zählte, was die Sonderbehandlung samt aufwendigster Schutzabschirmung erklären würde. Zwischenzeitlich sollte Igor K. in ein deutsches Gefängnis-Krankenhaus verlegt werden, was aber interessierte BRD-Regierungskreise zu verhindern wussten. Das niedersächsische Innenministerium verfügte Ende Februar 2020 zum großen Ärger des BND, der Mafioso habe die BRD nach erfolgter Behandlung umgehend zu verlassen, sonst werde er abgeschoben. Die Schusswunden soll der Mafioso übrigens im Zuge von Auseinandersetzungen der beiden im örtlichen Drogenhandel konkurrierenden Skaljari- und Kavac-Clans erlitten haben. In Montenegro, einem der Nachfolge-Staaten des vom Westblock erfolgreich desintegrierten Jugoslawiens, sind die westlichen Geheimdienste sehr präsent, um die noch schwankende Bevölkerung von den Vorteilen einer EU- und NATO-Mitgliedschaft und damit der Abkehr von Russland zu »überzeugen«. Und Drogenhandel zählt bekanntlich zu den beliebtesten Neben-Einnahmequellen von Geheimdiensten.
Es gäbe hier noch viel anzuführen, doch belassen wir es bei Obigem und wenden wir uns nun den 25 sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten oder Personengruppen zu, die ich wegen ihrer herausragenden, auf spektakuläre Weise erfolgreichen oder erfolglosen Spionagetätigkeit für dieses Buch ausgewählt habe, um Ihnen einen repräsentativen Eindruck der mit nahezu endlosen Facetten ausgestatteten Spionageprofession zu vermitteln.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!
Schöneck/Vogtland, im Sommer 2020
Johannes Seiffert
1. Alfred Redl Ein »Jahrhundertverräter«?
Überdurchschnittlich intelligent, schneidig, Absolvent der kaiserlichen Kadettenschule, Karriereoffizier, dreisprachig, homosexuell: Alfred Redl (1864–1913) war das, was man im Wien der Jahrhundertwende einen »Feschak« nannte. Ein hübscher Bursche, dem die Herzen zuflogen, der das Leben in vollen Zügen genoss, sein Schwulsein aber wegen der rigiden Gesetze nur illegal im Rotlichtmilieu ausleben konnte. Das alles wäre noch kein Grund, ihn in die Annalen der legendären Spionagefälle aufzunehmen, wäre da nicht seine langjährige Tätigkeit für den Armeegeheimdienst Österreichs und das unrühmliche Ende seiner Karriere. Als hoher Offizier in der Russland-Abteilung des Evidenzbüros stellte Redl mitsamt seinen »menschlichen Schwächen« eine ideale Zielperson für die Anwerber des zaristisch-russischen Geheimdienstes Ochrana in Wien dar. Beschäftigt war Redl mit dem Sammeln und Auswerten von Informationen über den »Feind im Osten«, aber auch mit verdeckten Aktionen Richtung Russland. Die russischen Werber waren bereit, für valide Informationen reichlich Geld zu bezahlen. Und Redl benötigte viel davon für seinen aufwendigen Lebensstil. Die Falle schnappte nur allzu bald zu.
Doch zunächst zur Vorgeschichte. Redl stammte aus Lemberg, der Hauptstadt des österreichischen Kronlands Galizien (Lwiw in der heutigen Ukraine), und war der Sohn eines Berufsoffiziers der k. u. k. Armee. Vater Redl erzog seine Kinder konsequent dreisprachig − polnisch, ukrainisch und deutsch. Redl lernte später noch Tschechisch und Französisch. Mit 17 Jahren trat er in eine kaiserliche Kadettenschule ein. Nach zwei Jahren Ausbildung verließ der 19-jährige Redl die Schule 1883 als Kadett-Offi-ziersstellvertreter mit sehr guten Noten. Im heimatlichen Lemberg avancierte er in den nächsten vier Jahren zum Leutnant. 1887 bewarb er sich 23-jährig in der »Reichshauptstadt« Wien um die Zulassung zur k. u. k. »Kriegsschule« in der Lehárgasse 4 im 6. Gemeindebezirk. Hier wurden Offiziere für den Generalstabsdienst, die Spitze der militärischen Karriereleiter, ausgebildet. Als einer von fünfundzwanzig Offizieren des gesamten k. u. k. Reichs wurde Redl 1894 zum Generalstab versetzt. Zwischendurch musste sich der Lebemann wegen einer syphilitischen Erkrankung ärztlich behandeln lassen. Redl wurde nun zum Eisenbahnbüro des Generalstabs abkommandiert, wo man gegnerische Transport- und Aufmarschplanungen auskundschaftete beziehungsweise aufklärte. Dies war hinsichtlich Russlands von besonderer Bedeutung, unterlagen Landkarten im Zarenreich doch strikter Geheimhaltung, so dass man den Verlauf von Bahnstrecken vielfach nur durch persönliches Bereisen feststellen konnte. 1899 wurde der 35-jährige Redl zu einem »Sprachkurs« nach Russland geschickt. Üblicherweise waren solche Aufenthalte auch mit Aufklärungs- beziehungsweise Spionageaufträgen verbunden. Im ostrussischen Kasan konnte sich Redl während des einjährigen Aufenthalts (Mai 1899 bis Mai 1900) auf diese Weise eine sechste Sprache aneignen.
Solche Aufenthalte in einem Zielland waren und sind nicht ungefährlich, sowohl für den Betreffenden als auch für sein Heimatland. Denn es besteht die Gefahr, dass eine aufmerksame Spionageabwehr beziehungsweise Gegenspionage des Gastlands ihrerseits »Reisende« umzudrehen und anzuwerben versucht. Ob Redl möglicherweise schon hier für den russischen Geheimdienst tätig wurde, konnte bisher nicht mit letzter Sicherheit festgestellt werden. Seine frisch erworbenen Russischkenntnisse waren jedenfalls der Schlüssel zu seiner nächsten Karrierestufe, dem im Jahr 1900 erfolgten Dienstantritt in der »russischen Gruppe« des Wiener Evidenzbüros im k. u. k. Generalstab. Der 36-jährige Redl war damit Teil eines Teams von nur zwanzig Offizieren – der deutsche und der russische Generalstab hatten ein Vielfaches an Personal für die jeweiligen Feindbelange zur Verfügung.
Redl avancierte weiter. Wenige Monate später rückte er ins übergeordnete Kundschaftsbüro auf, welches die eintreffenden nachrichtendienstlichen Informationen aller Regional- und Ländergruppen des Evidenzbüros sammelte. 1907 übernahm er 43-jährig die Leitung des Kundschaftsbüros. Doch damit nicht genug. Wenige Monate später stieg er erneut auf und wurde nun Oberstleutnant im Generalstab (i.G.). Nach seiner Beförderung zum Oberst im Mai 1912 war der 48-jährige Redl nunmehr »kommandoberechtigt« und wurde am 18. Oktober desselben Jahres Generalstabs-chef des VIII. Armeekorps in der k. u. k. Metropole Prag.
Gegenspieler auf russischer Seite war einesteils die zaristische Geheimpolizei Ochrana, die für die zivile Auslandsspionage zuständig war, sowie anderenteils die Abteilung für Kundschafterwesen im russischen Generalstab. Die Österreich-Abteilung der Ochrana residierte im damals noch russischen Warschau, fünfzig Angestellte arbeiteten hier an der Informationsbeschaffung aus Österreich, unterstützt von weiteren hundertfünfzig Spionen vor Ort.
Der Chef des Kundschafterwesens im Generalstab hatte 1901 einen gutaussehenden, perfekt deutschsprechenden Balten-Baron als »Urlauber« nach Wien geschickt. Dessen Aufgabe war es gewesen, einen möglichst hochrangigen Zuträger des Evidenzbüros anzuwerben. Auf seiner Suche nach Offizieren mit Schwachstellen war er angeblich 1903 auf Redl gestoßen – einen idealen Zuträger. Laut einer verbreiteten Legende soll der russische Agent seine Zielperson Redl mit dem Wissen um dessen homosexuelle Umtriebe im Rotlichtmilieu erpresst und zur Spionage für die Ochrana genötigt haben. Neuerliche Recherchen in Wiener und Moskauer Archiven ergaben jedoch keinerlei Hinweise auf eine solche Erpressung beziehungsweise eine solche Anwerbeoperation. Wahrscheinlicher ist, dass die wachsame russische Gegenspionage schon 1900 auf den »Sprachurlauber« Redl in Kasan aufmerksam geworden war und einen langfristig angelegten Anwerbeversuch unternommen hatte, verbunden mit hohen Geldversprechungen bei entsprechend attraktiven Lieferungen an Material. Nicht ausgeschlossen ist sogar, dass die Initiative zur Zusammenarbeit von Redl selbst ausgegangen war. Redl hatte hohen Geldbedarf, um seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren – mit Villa, Automobilen, zahlreichen Bediensteten und regelmäßigen Besuchen exklusivster Restaurants.
Zu den von Redl verkauften Informationen gehörten Mobilmachungspläne, Truppenstärken, Inspektionsberichte und Festungspläne sowie die Operationsplanungen gegen Russland, Serbien und Italien. Redl fotografierte die Unterlagen und entwickelte die Aufnahmen selbst. Als Mitglied der Russlandgruppe bekam Redl auch alle Zusammenarbeitsangebote von russischen Überläufern und Verrätern vorgelegt und leitete deren Namen prompt nach Moskau weiter. Natürlich blieb es nicht aus, dass die seit dem Aufstieg Redls gehäuften Rückschläge bei der gegen Russland gerichteten österreichischen Spionagetätigkeit auffielen. Redl und seine russischen Führungsoffiziere verstanden es allerdings, diese Rückschläge durch vermeintlich »erfolgreiche Aktionen« zu kompensieren. Dazu wurden angeblich streng geheime (falsche) russische Dokumente zur Verfügung gestellt und russische Agenten »enttarnt«, die ohnehin geopfert werden sollten. Redls ungeniert zur Schau gestellter Reichtum wurde niemals ernsthaft untersucht, kein Ruhmesblatt für die österreichische Spionageabwehr. Selbst handfeste Hinweise auf einen »Maulwurf« im Evidenzbüro konnten Redl nicht schaden. So etwa, als der österreichische Militärattaché in St. Petersburg, Major Lelio Graf Spannocchi, von dem mit ihm befreundeten britischen Militärattaché 1909 erfuhr, ein hoher österreichischer Generalstabsoffizier verkaufe Russland streng geheime militärische Unterlagen. Spannocchi telegrafierte das umgehend an den Chef des Evidenzbüros, Oberst Hrdlicka, der Spannocchi bat, sich an Oberst Redl, den Russland-Experten des Evidenzbüros, zu wenden. Redl gelang es in der Folge, Spannocchis Abberufung aus Moskau zu erreichen.
Material- und Geldübermittlungen erfolgten seit Redls Versetzung nach Prag 1912 meist per Post. Der in Prag dienstlich länger als vorgesehen festgehaltene Generalstabschef versäumte es im selben Jahr jedoch, eine solche postlagernde Geldsendung, gerichtet an seinen Tarnnamen »Nikon Nizetas«, auf dem Hauptpostamt in Wien rechtzeitig abzuholen. Daher wurde der Brief nach Ende der Abholfrist als unzustellbar an das Herkunftspostamt im ostpreußischen Grenz-ort Eydtkuhnen (heute: Tschernyschewskoje, Oblast Kaliningrad, Russland) zurückgesendet. Interessant ist, dass die russische Seite das am Grenzübergang zu Russland gelegene Eydtkuhnen als Postamt zur Absendung solcher Nachrichten ausgewählt hatte. Man wollte damit wohl die Postkontrolle umgehen, die alle direkt aus Russland ins deutsche Kaiserreich beziehungsweise nach Österreich-Ungarn geschickten Brief- und Paketsendungen betraf.
Als man 1913 in Eydtkuhnen die Postsendung auf der Suche nach Hinweisen auf den Absender öffnete, kamen ein hoher Bargeldbetrag und mehrere Adressenlisten zum Vorschein. Das Postamt leitete den Brief sicherheitshalber an den deutschen Militärgeheimdienst weiter. Dessen Chef, der im Zusammenhang mit der Russischen Revolution 1917 bedeutsam werdende Major Walter Nicolai (zuständig für die Finanzierung der Bolschewiki vor 1917 – vgl.: Johannes Seiffert: Die größten Täuschungen der Geschichte, 2. Aufl., Berlin 2019, S. 173–217), fand im Brief bekannte russische Spionage-Tarnadressen. Er informierte umgehend das Wiener Evidenzbüro. Der Brief wurde erneut verschlossen und nach Wien transportiert und, dort angekommen, abermals im Hauptpostamt hinterlegt. Die österreichische Staatspolizei ließ das Postamt sechs Wochen lang überwachen, dann schnappte die Falle zu. Als Redl am 24. Mai 1913 das Schreiben am Schalter abholte, wurde er anschließend beschattet und anhand der Abhol- und Aufgabescheine, die er weggeworfen hatte, als Adressat identifiziert. Neben dem Geheimnisverrat an sich drohte nun bei einer öffentlichen Untersuchung, dass Versäumnisse des Generalstabs hinsichtlich der Sicherheitsüberprüfung von Offizieren in Schlüsselpositionen bekannt würden. Daher wurde eine umfassende Nachrichtensperre zum »Fall Redl« verhängt. Eine Offiziersdelegation erhielt den Auftrag, Redl in seinem Wiener Domizil, dem luxuriösen Hotel Klomser (Palais Batthyány) in der Herrengasse, festzunehmen. Die Delegation traf Redl in seinem Hotelzimmer an. Redl wusste sofort, was die Stunde geschlagen hatte. Er gestand (allerdings nur einen verkürzten Zeitraum angebend), dass er 1910 und 1911 Geheimnisse an fremde Staaten verraten habe, dabei aber stets und ausnahmslos ohne Komplizen vorgegangen sei. Einer der Offiziere übergab Redl eine Pistole und ein Päckchen Gift und ließ Redl dann allein, um ihm die Möglichkeit zu geben, seinem Leben selbst ein Ende zu bereiten. Bei der Rückkehr eine Stunde später fand man dann Redls Leiche mit einer Schusswunde im Kopf. Franz Conrad von Hötzendorf, Chef des k. u. k. Generalstabs, berichtete seinem Vorgesetzten, dem Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand, Generalinspektor der k. u. k. Armee, Redl habe sich »aus bisher unbekannter Ursache« erschossen. Der Kaiser wurde in ähnlicher Form informiert. Eine Mitteilung identischen Inhalts ging einen Tag später an die Presse.
Redls Prager Wohnung wurde zeitgleich durchsucht. Davon bekam der »rasende Reporter«, Egon Erwin Kisch, Wind. Er erfuhr von dem Schlosser, der in staatlichem Auftrag die Tür zu Redls Wohnung geöffnet hatte, dass Spio-nage und Homosexualität im Spiel gewesen seien. Kisch verfiel auf einen genialen Ausweg, wie er diese Sensationsmeldung trotz der in Österreich-Ungarn herrschenden Militärzensur publizieren könne: Er druckte die Meldung in Form eines Dementis: Von hoher Stelle werden wir um Widerlegung der speziell in Militärkreisen aufgetauchten Gerüchte ersucht, dass der Generalstabschef des Prager Korps, Oberst Alfred Redl, der vorgestern in Wien Selbstmord verübte, einen Verrat militärischer Geheimnisse begangen und für Russland Spionage getrieben habe. Dieses »Dementi« sorgte für großes Aufsehen; auch Kaiser und Thronfolger erfuhren auf diese Weise von Redls Verrat. Das Kriegsministerium reagierte erst drei Tage später. Nun musste man zugeben, dass Redl sich das Leben genommen habe, weil man im Begriffe war, ihn wegen homosexueller Verfehlungen und Geheimnisverrat an fremde Mächte zu überführen. Die österreichische Spionageabwehr überprüfte nun Redls Konto, das seit 1905 Einzahlungen von insgesamt mehr als 100.000 Kronen aufwies. Es stand somit fest, dass Redls Verrat deutlich früher begonnen hatte.
Redls Leiche wurde heimlich auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 79, Reihe 27, Nummer 38) beigesetzt. Einen später aufgestellten Grabstein ließen die nationalsozialistischen Behörden kurz vor Kriegsende im April 1945 zerstören. Heute ist das Grab neu belegt, Redls Gebeine ruhen jedoch immer noch dort. Von einigen Historikern wird Redl bis heute für die verheerenden Niederlagen Österreich-Ungarns zu Beginn des Ersten Weltkriegs verantwortlich gemacht. Dank Redl habe Österreich-Ungarn sich falsche Vorstellungen von den Kräfteverhältnissen gemacht und die russische Armee als viel schwächer angenommen, als sie eigentlich war. Vereinzelt wurde sogar behauptet, dass die österreichische Kriegserklärung nicht erfolgt wäre, wenn die realen Informationen vorgelegen und Redl nicht für deren Verschleierung gesorgt hätte – mithin sei er also für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verantwortlich. Selbst CIA-Chef Allen Dulles bezeichnete Redl Jahrzehnte später noch als »Erzverräter«. Allerdings stehen dem die österreichischen Siege von Kraśnik und Komarów zu Beginn des Ersten Weltkriegs entgegen, die es demzufolge nicht hätte geben dürfen. Bis heute ungeklärt ist, wie auch nach dem Tod Redls weiterhin »Informationsabflüsse« aus dem Evidenzbüro Richtung Russland erfolgen konnten. Es muss also noch weitere, bis heute unbekannte »Redls« dort gegeben haben.
2. Mata Hari Tänzerin und Amateur-Agentin
Am Montag, dem 15. Oktober 1917, wird in den frühen Morgenstunden dieses kühlen, nebligen Herbsttages eine etwas verlebt aussehende Frau mittleren Alters in den Hof des französischen Forts Vincennes, unweit von Paris, geführt. Vor einer Mauer ist ein Pfahl in den Boden gerammt, an den sie gefesselt wird. Ein Peloton Soldaten marschiert auf und lädt die Gewehre. Auf den Befehl eines Offiziers hin legen die Soldaten an, zielen auf die Frau und drücken ab. Von vielen Kugeln getroffen, sackt sie zusammen. Auf diese Weise endet das Leben einer der schillerndsten Frauengestalten der Spionagegeschichte, das Leben der Mata Hari, die in Wirklichkeit Margaretha »Grietje« Geertruida Zelle hieß.
Zelle wird 1876 als einzige Tochter und erstes Kind eines Hutmachers und seiner Frau im niederländischen Leeuwarden (Provinz Friesland) geboren. Ihre Mutter stammt von exotischen Vorfahren ab, deren Wurzeln in der damals niederländischen Kolonie Java liegen. Zwei Jahre nach Margaretha wird ihr Bruder Johannes geboren, und 1881 kommen ihre Zwillingsbrüder Ari und Cornelis zur Welt. Grietje besucht zunächst die Volksschule und ab 1890 – mit 14 Jahren – die Mittelschule. Sie lernt dort Englisch, Französisch und Deutsch. Ihr Vater ist als Aufschneider bekannt, der sich gern »Baron« nennen lässt, trotz fehlender Adelsahnen. 1890 lässt sich Grietjes Mutter von ihrem Hallodri-Gatten scheiden, stirbt aber schon ein Jahr später an Tuberkulose. Der bald neu verheiratete Vater nimmt nur zwei seiner Kinder zu sich, Grietje und einer ihrer Brüder kommen zu anderen Verwandten. Grietje beginnt nun gemäß dem Willen ihres Patenonkels, der sie aufnahm, eine Ausbildung zur Kindergärtnerin, bricht sie jedoch bald ab. Erst Jahrzehnte später kommt heraus, dass die 15-Jährige offenbar vom Direktor der Ausbildungsschule missbraucht wurde. Grietje, die sich standhaft weigerte, die Schule weiterhin zu besuchen, wurde innerhalb der Verwandtschaft weitergereicht, diesmal an einen Onkel in Den Haag.
1895 entdeckt die 19-Jährige eine Zeitungsanzeige, in der ein aus England stammender Offizier der niederländischen Kolonialarmee eine Ehefrau sucht. Rudolph MacLeod ist zwanzig Jahre älter als Grietje, ein Griesgram, der an Rheuma und Diabetes leidet. Grietje ist das egal. Die Eheschließung bietet ihr die Chance, aus der holländischen Provinz herauszukommen, da MacLeod in Niederländisch-Indien stationiert ist und nach seinem Heimaturlaub dorthin wieder zurückzukehren beabsichtigt. Die 19-Jährige heiratet den 39-Jährigen im Sommer 1895, Ende Januar 1896 bringt sie einen Sohn zur Welt. Die Ehe steht unter keinem guten Stern, ihr Ehemann stellt sich als Alkoholiker heraus, der sie oft schlägt.
Im Frühjahr 1897 geht die Reise endlich los, die Reise ans andere Ende der Welt, zum Stationierungsort Batavia (heute: Jakarta, Indonesien). Ein Jahr später kommt dort Töchterchen Jeanne Louise »Non« (malaiisch für »Mädchen«) zur Welt. Grietje blüht auf, beteiligt sich am kulturellen Leben der Garnison, beschäftigt sich mit indonesischer Folklore und wird Mitglied einer Tanzgruppe der Offiziersfrauen. Offenbar legt sie sich, wie Briefe von ihr belegen, schon damals den Künstlernamen »Mata Hari« (indonesisch für »Auge des Tages«, also der »Sonne«) zu. Die schleichende Entfremdung des Ehepaars ist jedoch nicht mehr aufzuhalten. MacLeod will seinen Lebensabend in Indonesien verbringen. Die 24-jährige Grietje jedoch zieht es wieder zurück nach Europa. Man reist zwar noch gemeinsam zurück nach Amsterdam, dort wird jedoch im Sommer 1902 die Trennung vereinbart. Eigentlich soll MacLeod Grietje Alimente zahlen, was er jedoch nie tut. Sie ist daher gezwungen, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen.
1903 zieht die 27-Jährige nach Paris – ihre Kinder lässt sie bei ihrem Ex-Mann – und arbeitet dort als Zirkusreiterin unter dem Künstlernamen »Lady MacLeod«. Um ihr Einkommen aufzubessern, steht sie verschiedenen Malern nackt Modell. 1904 beginnt sie, angeregt vom Erfolg von Isadora Duncan (1877–1927), als leichtbekleidete Tänzerin aufzutreten, mit einem Repertoire selbst erfundener »Tempeltänze«, die angeblich indischen Ursprungs seien. Sie wird von einem Impresario namens Gabriel Astruc (1864–1938) unter Vertrag genommen, der für einige Jahre ihr Manager bleibt. 1905 zündet sie die nächste Stufe ihres Erfolgsrezepts, der »gewagten«, nur mit wenig Bekleidung vorgeführten exotischen Tänze, als sie am 13. März im Asia-tica-Museum des greisen Millionärs und Sammlers Émile Guimet (1836–1918) erstmals vor großem Publikum ihre ebenso exotischen wie erotischen Tänze vorführt. Sie bleibt für längere Zeit die Mätresse des vier Jahrzehnte älteren Millionärs. Sie gilt als authentische indische Sensation des Erotik-Tanzes. Ihre selbst zusammengestellte Nachempfindung vermeintlich indischer »Tempeltänze« führen immer bis zum sehnlichst erwarteten Ende, bis sie nahezu unbekleidet auf der Bühne steht. Das Jahr 1905 ist ihr Jahr, die 29-jährige Grietje ist die Sensation in Paris, ihre Auftritte sind Stadtgespräch, man redet von nichts anderem. Sie gibt über dreißig Vorstellungen, verdient pro Abend 10.000 Francs und bezieht eine prachtvolle Wohnung in der Rue Balzac, im Haus Nummer 3, im vornehmen 8. Pariser Arrondissement.
Die Gesetze des Kapitalismus hat sie schnell verinnerlicht: a) any news is good news, b) wenn die erste Welle durch ist, das Angebot verknappen und auf eine zweite Welle des Erfolgs hoffen. Folgerichtig kündigt sie Ende 1905 an, sie werde das Tanzen ganz aufgeben und einen osteuropäischen Hochadligen heiraten. Das Interesse an ihrer Person wachzuhalten, ist umso notwendiger, da ihre Erfolgsmasche schnell und vielfach kopiert wird. Eine Tänzerin der Folies Bergère führt nun ebenfalls »Tempeltänze« auf, bald gefolgt von weiteren »Tempeldienerinnen«, unter ihnen die Stripteasetänzerin Gabrielle, später berühmt geworden als Modeschöpferin Coco Chanel. Mata Hari, das Original, bleibt nachgefragt, sie ist eine veritable Werbeikone, ungeachtet der entstandenen Konkurrenz. Die großen Varietés buchen sie weiterhin, auf ein Engagement folgt das nächste, Bilder von ihr gibt es auf Postkarten, Zigarettenschachteln, Keksdosen und in »pikanten« Sammelalben.
In Monte Carlo verkörpert sie in Jules Massenets Oper Le Roi de Lahore die Salomé, Seite an Seite mit der gefeierten Ballerina Carlotta Zambelli (1875–1968). Grietje reist weiter nach Wien, wo sie erneut große Erfolge feiern kann. Die Zeitungen überbieten sich mit begeisterten Kritiken, erklären sie gar zur Nachfolgerin von Isadora Duncan. Zumal sie deutlich mehr zeige als ihre vermeintliche Vorgängerin, die »exotische Schönheit ersten Ranges«. Auf ihre Spezialität wird extra hingewiesen: »Unter dem Schleier trägt die schöne Tänzerin auf dem Oberkörper einen Brustschmuck und einen Goldgürtel, sonst nichts. Die Kühnheit des Kostüms bildet eine kleine Sensation.« Berlin bekommt sie 1907 erstmals zu sehen, im Varieté Wintergarten an der Friedrichstraße. Sie darf auch vor den allerhöchsten Majestäten, Kaiser Wilhelm II. und Familie, ihre »Tempeltänze« vorführen. Angeblich kommt es sogar zu einer kurzen Liaison mit dem Sohn des Kaisers. Dass sie dieses Gerücht nie dementierte, wird ihr während ihres Hochverratsprozesses angekreidet. Anfang 1907 kehrt sie nach Paris zurück, zieht es aber vor, zunächst von der Bildfläche zu verschwinden.
Am 30. März 1907 erkundigt sie sich von Rom aus bei ihrem Manager Astruc, ob inzwischen neue Engagements für sie vorlägen. Gleichzeitig bietet sie Richard Strauss (1864–1949) an, die Rolle der Salome bei der Uraufführung seiner neuen gleichnamigen Oper zu übernehmen. Sie erhält keine Antwort und reist verdrossen nach Paris zurück. Dort ist mittlerweile eine veritable »exotische« Tanzszene entstanden, die Mata Hari mittlerweile als Kunstprodukt fast schon vergessen gemacht hat. Sie lässt beleidigt verlautbaren, angesichts dieser inflationären Vermehrung angeblicher Exotik-Tänzerinnen ziehe sie sich aus dem Betätigungsfeld zurück. 1910 nimmt die Kritik an ihrer angeblichen Authentizität zu, man wirft ihr (zu Recht) vor, sich das meiste ihrer Geschichten ausgedacht zu haben und dass ihre Tänze nur wenig mit wirklichen asiatischen Tempeltänzen zu tun hätten, dafür sehr viel mehr mit dem bereits gängigen Genre des Striptease, wie er in einer Vielzahl von Nachtlokalen in den unterschiedlichsten Variationen dargeboten wird. Weitere Engagements bleiben aus.
Doch dann kommt der Auftritt, der als Höhepunkt ihrer Karriere gilt: Am 7. Dezember 1911 tanzt sie in der Mailänder Scala, bei einer Aufführung der Oper Armide von Christoph Willibald Gluck (1714–1787). Weitere Auftritte in den Salons der italienischen Oberschicht folgen. Doch das ist ihr nicht genug. Erfolgreichster Newcomer in diesem Segment in Europa ist der russische Kulturunternehmer Sergei Djagilew (1872–1929), der schon mehrfach märchenhafte Triumphe in Europa zu feiern vermochte. So kurz zuvor auch mit dem 1909 gegründeten Ensemble Ballets Russes, den von ihm ausgewählten besten Tänzerinnen und Tänzern des Landes. Daher liegt es für Grietje nahe, diesen vom Erfolg verwöhnten Impresario zu kontaktieren. Als sie im März 1912 in Monte Carlo auftritt, spricht sie bei ihm vor. Djagilew, der ausschließlich mit professionell ausgebildeten Tänzerinnen und Tänzern arbeitet, fordert Grietje auf, sich auszuziehen und auf der Bühne eine Kostprobe ihres tänzerischen Könnens abzuliefern. War Grietje mit ihren mittlerweile 36 Jahren wirklich davon überzeugt, ohne jede tänzerische Ausbildung, ohne irgendwelche Erfahrung im klassischen Ballett mit der seinerzeit führenden Ballett-Truppe Europas auftreten zu können? Sie verzichtet auf dieses »Angebot« und reist empört ab.
1913 neigt sich ihre Karriere dem Ende zu. Zum einen ist sie mit 37 Jahren mittlerweile dem besten Alter für Nackt-auftritte entwachsen, zum anderen hat sie nichts Neues mehr anzubieten als ewige Variationen ihres ursprünglichen Erfolgsrezepts, das nun aber mangels Exklusivität bei einer Fülle deutlich jüngerer und attraktiverer Konkurrentinnen nicht mehr zieht. Anfang 1914 reist sie nochmals nach Berlin, unterschreibt dort einen Vertrag mit dem Metropol-Theater. Sie soll ab September sechs Monate lang in einer Bühnenshow auftreten und beginnt mit den Vorbereitungen. Damit wären ihre drängendsten Geldsorgen vorerst überwunden. Doch als am 1. August 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, wird das Engagement abgesagt. Anfang August 1914 verlässt sie daher Deutschland. Sie reist in ihre holländische Heimat zurück – die Niederlande waren im gesamten Ersten Weltkrieg neutral und somit keine Kriegspartei. Als Bürgerin eines neutralen Staates ist es Grietje generell erlaubt, die Grenzen zu den benachbarten, miteinander Krieg führenden Staaten zu überqueren. Wegen akuter Geldsorgen reist sie Ende 1915 über England und Dieppe nach Paris, um ihren dortigen Hausstand – eine Villa in Neuilly – aufzulösen, also zu Geld zu machen. Sie geht jetzt sogar anschaffen, verdingt sich also in einigen Pariser Bordellen als Prostituierte. Im März 1916 kehrt sie mit den Resten ihres Pariser Hausstands nach Den Haag zurück und lernt dort einen achtzehn Jahre jüngeren russischen Offizier kennen, dessen Geliebte sie wird. Der Russe gehört zu dem vom Zarenreich entsandten, 50.000 Mann starken Expeditionskorps, das die französischen Verbündeten gegen den gemeinsamen Feind Deutschland militärisch unterstützen soll.
Seit Mitte 1915 hat das Deuxième Bureau, der französische militärische Auslandsnachrichtendienst, ein Auge auf Grietje. Diese reist im Frühjahr 1916 von Paris nach Ma-drid. Sie arbeitet weiterhin als Prostituierte, will sich aber zusätzliche Einnahmequellen im einträglichen Spionagebetrieb sichern. Und das von allen Seiten. Die Franzosen bieten eine Million Francs, falls es ihr gelinge, sich Zugang zum deutschen Oberkommando der Westfront in Antwerpen zu verschaffen. In Madrid kontaktiert sie auftragsgemäß den deutschen Militärattaché in Spanien und bittet ihn um die Herstellung eines Kontakts zum Oberkommando. Der Militärattaché leitet die Information nach Antwerpen weiter, wo auch die für Frankreich zuständige Kriegsnachrichtenstelle West sitzt, eine Abteilung des deutschen Militärgeheimdienstes Abteilung III b. Grietje beginnt eine sexuelle Liaison mit dem deutschen Militärattaché Arnold Kalle (1873–1952) und nimmt nach eigener Darstellung Geld für den Sex (und nicht als Agentenlohn). Grietje erhält von Kalle angeblich brisante Informationen über die Auftankung deutscher U-Boote in spanischen Häfen und die Einschleusung deutscher Agenten nach Monaco. Diese Informationen sind jedoch veraltetes »Spielmaterial«. Im April 1916 ist Grietje nachweisbar in Antwerpen und Köln, wo sie von der Chefin der deutschen Militärspionage gegen die Entente an der Westfront, Dr. Elisabeth Schragmüller (1887–1940), in Spionagedingen unterrichtet und auf ihren Einsatz gegen Frankreich vorbereitet wird. Wieder in Paris, beantragt sie im Sommer 1916 einen Passierschein für die frontnahe Stadt Vittel in den Vogesen, wo ihr mittlerweile kriegsverletzter russischer Offiziersgeliebter im Lazarett liegt. Vittel ist eine Garnisonsstadt mit vielen französischen Offizieren und Mannschaften. Aus Geldmangel ist sie gezwungen, vor Ort ihre Arbeit als Sexdienstleisterin wieder aufzunehmen. Sie wird nun auf Schritt und Tritt vom französischen Geheimdienst überwacht. Eine verdächtige Tätigkeit kann dort nicht festgestellt werden.
Das Deuxième Bureau stellt Grietje daher im Dezember 1916 eine Falle. Sie erhält die Namen von sechs belgischen Agenten, die mit Frankreich zusammenarbeiten und die sie nun aufsuchen soll. Fünf von ihnen scheinen – offenbar in deutschem Auftrag – irreführende Meldungen nach Frankreich zu liefern, vom sechsten ist den Franzosen bekannt, dass er als Doppelagent für Frankreich und Deutschland arbeitet. Grietje reist von Paris ab nach Spanien. Zwei Wochen später wird der Doppelagent von den Deutschen erschossen, während die übrigen fünf unbehelligt bleiben. Das ist dem französischen militärischen Auslandsnachrichtendienst Beweis genug, dass sie die Namen der sechs Agenten den deutschen Militärbehörden verraten hatte.
Am 13. Februar 1917 wird sie in Paris festgenommen. Ihre Ankunft hat der damals als Passbeamter arbeitende Schriftsteller Louis-Ferdinand Céline (1894–1961) seinen übergeordneten Behörden gemeldet. Nach anfänglichem Leugnen gibt sie schließlich zu, der deutsche Konsul in Amsterdam habe ihr im Mai 1916 insgesamt 20.000 Francs ausgehändigt, für sexuelle Dienstleistungen, so Grietje, für Spionageinformationen, so der französische Militärstaatsanwalt. Am 24. Juli 1917 beginnt ihr Prozess im Pariser Justizpalast, der nur eineinhalb Tage dauert. Ob Mata Hari überhaupt Gelegenheit hatte, tatsächlich bedeutsame Informationen an den deutschen Geheimdienst weiterzuleiten, ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt – auch nicht nach Freigabe ihrer Prozessakten im Jahre 2017. Wichtig für Termin und Verlauf des Prozesses ist, dass 1917 ein Jahr war, in dem Frankreich Desertionen in großem Umfang und Aufstände in der Armee gegen das massenhafte Sterben an der Front erlebt. Durch eine Verurteilung Grietjes kann man ihr alle Fehlschläge an der Front in die Schuhe schieben. Am 25. Juli 1917 wird sie zum Tode verurteilt. Ein von ihr verfasstes Gnadengesuch lehnt der französische Staatspräsident ab. Zweieinhalb Monate später, am 15. Oktober 1917, um 6.15 Uhr morgens, wird Grietje in der Nähe von Schloss Vincennes bei Paris erschossen. Die bei Erschießungen obligatorische Augenbinde verweigert sie. Nach der Salve des Pelotons gibt ihr ein Unteroffizier aus kurzer Distanz einen Gnadenschuss in den Kopf.
In Deutschland gilt sie seitdem als unschuldiges Opfer der französischen Militärjustiz. Dem widersprechen zwei offizielle deutsche Dokumente. Einmal der Sammelband Was wir vom Weltkrieg nicht wissen aus dem Jahr 1929, in dem die deutsche Spionagechefin an der Westfront, Elsbeth Schragmüller, einige Details ihrer Arbeit in der Kriegsnachrichtenstelle West in Antwerpen (Rue de la Pépinière) beschreibt. Zum anderen der in den 1920er Jahren verfasste sogenannte Gempp-Bericht, eine umfangreiche Darstellung nachrichtendienstlicher Geschehnisse für interne Zwecke unter dem Titel Geheimer Nachrichtendienst und Spionageabwehr des Heeres für die Zeit von 1866 bis 1917 (15 Bände) aus der Hand des Leiters des neuaufgebauten militärischen Nachrichtendienstes als Nachfolgeorganisation der ehemaligen Abteilung III b, Friedrich Gempp (1873–1947), die leider bis heute weder umfassend bearbeitet noch entsprechend publiziert wurde. Der französischen Spionageabwehr war vermutlich klar, dass Grietje den Deutschen keine wichtigen Hinweise übermittelt hatte. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens mit dem Ziel, Grietjes Unschuld feststellen zu lassen, hat die französische Justiz in den letzten Jahrzehnten mehrfach abgelehnt.
Übrigens haben die deutschen Besatzungsbehörden in Belgien während des Ersten Weltkriegs nicht weniger als fünfzig feindliche »Agenten« und fünf »Agentinnen« hinrichten lassen. Wie die Deutschen ansonsten 1914 bis 1918 in Belgien hausten, dazu entwirft der in Buchform erschienene Augenzeugenbericht von Heinrich Wandt (1890–1965) ein erschreckendes Bild. Leider ist davon in den BRD-Geschichtsbüchern nur selten oder nie die Rede. Ebenso wenig von den unzähligen deutsch-österreichischen Kriegsverbrechen an der Ostfront des Ersten Weltkriegs – einschließlich Hungerlager und der massenweisen Erschießung von Geiseln. Hier werfen die Gräuel der deutschen Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs schon ihre Schatten voraus – und das ohne NS-Terror als »Entschuldigung«. Das führt zu beunruhigenden Fragen, mit denen sich bisher leider noch kein namhafter BRD-Historiker beschäftigt hat. Denn dies bedürfte aufwendiger Recherchen in vielen verstreuten Archiven Ost- und Westeuropas.
3. Sidney Reilly Saboteur, Mörder, Spion
Sidney Reilly – kennen Sie nicht? Dann sollten wir diese Wissenslücke schleunigst schließen. Denn Reilly ist ein ideales Beispiel für jene Entwicklungen vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg, die zum heutigen System des internationalen Spionage-Zirkus führten. Reilly steht dabei für die düstere, gewalttätige Seite der Spionage, mit Sabotage, Anschlägen, Fälschungen, Mord. Seine biographischen Details liegen im Dunkeln, allein zu seinem Namen und dem Geburtsdatum gibt es Dutzende Variationen. Vermutlich wurde er am 24. März 1873 als Salomon Rosenblum in Odessa geboren. Anfang der 1890er Jahre, also um sein zwanzigstes Lebensjahr herum, soll sich der junge Rosenblum als Kurier für eine revolutionäre Gruppe in Russland betätigt haben und deswegen von der zaristischen Geheimpolizei Ochrana verhaftet worden sein. Angesichts seines späteren Lebenslaufs ist jedoch wahrscheinlicher, dass Reilly ein Agent Provocateur der Ochrana war. Dafür spricht auch, dass er damals ohne Prozess wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Nach seiner Freilassung ging er – vermutlich aus Angst vor der Rache der Revolutionäre, die er an die Ochrana verraten hatte – als Sigmund Rosenblum nach Südamerika, wo er den Vornamen Pedro annahm. Dort verdiente er sich als Hafenarbeiter, Plantagenarbeiter und Koch seinen Lebensunterhalt. Unter anderem bekochte er eine britische »Reisegruppe«, die den Amazonas erkundete und sich als eine Schar britischer Agenten herausstellte. Damit war der Kontakt zum britischen Geheimdienst geknüpft, dem er zeitlebens die Treue halten sollte.
Dass er vor drastischen Mitteln nicht zurückschreckte, zeigte sich, als er im Dezember 1895 während einer Zugfahrt zwei italienische Genossen, die als Geldboten einer anarchistischen Organisation unterwegs waren, kurzerhand ermordete, um an das von ihnen mitgeführte Vermögen zu kommen. Dokumentarisch nachweisbar ist, dass er sich ab Ende 1895 in London aufhielt, wo er nun unter dem Namen Sidney Rosenblum auftrat. Dort lernte er die junge Ethel Boole kennen, eine angehende Schriftstellerin, die sich in russischen Emigrantenkreisen herumtrieb. Bald entwickelte sich eine sexuelle Beziehung zwischen den beiden. Sie blieben auch nach dem Ende der Affäre befreundet, und Boole beschreibt in einem ihrer Bücher einen Charakter, der Rosenblum sehr ähnelt. Möglicherweise führte er auch diese Beziehung nur aufgrund eines Auftrags der britischen Geheimpolizei als deren bezahlter Informant.
Zu Tarnzwecken gründete er mit Hilfe der britischen Polizei die Ozone Preparations Company, die sich dem Handel mit »Wundermitteln« widmete. Denn zu diesem Zeitpunkt war sein Haupttätigkeitsgebiet, als Informant für William Melville, den Leiter der Special Branch (Sonderabteilung) von Scotland Yard (Londoner Kriminalpolizei), in London lebende osteuropäische Emigranten zu bespitzeln. Melville wechselte später zum britischen Geheimdienst Secret Service Bureau, dem Vorläufer der heutigen Geheimdienste Security Service (MI5 – Inland) und Secret Intelligence Service (SIS, MI6 – Ausland), und nahm seinen Topagenten Sidney mit zu seiner neuen Organisation.
1897 lernte Rosenblum einen schwerkranken Priester kennen, dessen Ehefrau seine Geliebte wurde. Ein Jahr später war der vermögende Priester tot, und Rosenblum heiratete die Witwe. Den Tod des Priesters umgibt eine Reihe von Ungereimtheiten, so dass in der Fachliteratur wiederholt vermutet wurde, dabei sei nachgeholfen worden. Die Witwe des Priesters war als Haupterbin in den Besitz eines atemberaubenden Vermögens von rund 800.000 Pfund gekommen. Die anschließende Heirat mit der Priesterwitwe machte Rosenblum zu einem reichen Mann. Mit Hilfe von William Melville legte er sich nun eine neue Identität zu. Fortan hörte er auf den Namen Sidney George Reilly. Dass er seinen neuen Ausweis und die britische Staatsangehörigkeit ohne weitere offizielle Verwaltungsakte bekam, verdeutlicht, dass er mittlerweile über mächtige Freunde in Großbritannien verfügte.
Im Juni 1899 trat Sidney unter seiner neuen Identität zusammen mit seiner Frau eine Reise ins zaristische Russland an – vermutlich im Auftrag des britischen Geheimdienstes. Er unternahm eine Erkundungsreise in den Kaukasus und sammelte Informationen über die dortigen Ölvorkommen, die er anschließend der britischen Regierung übergab. Dort kam es auch zu einem Treffen mit dem japanischen Geheimdienstgeneral Akashi Motojirō. Dieser beauftragte Reilly, Kontakt mit den russischen Revolutionären aufzunehmen und diesen hohe Geldspenden zukommen zu lassen – Japan wollte das zaristische Russland, einen potentiellen Kriegsgegner, nach Kräften schwächen. Außerdem wünschte er detaillierte Aufstellungen zu den in Fernost dislozierten russischen Heeres- und Marinekräften. Für beides versprach er Reilly hohes Honorar und steckte ihm eine üppige Anzahlung in die Tasche.
Drei Jahre später tauchte Reilly unter falschem Namen in der damals unter russischer Verwaltung stehenden chinesischen Hafenstadt Port Arthur/Lüshun (heute: Bezirk Lüshunkou der Stadt Dalian) auf, als Agent sowohl der Briten als auch der Japaner. Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und Japan kaufte er in großem Umfang Lebensmittel, Rohstoffe, Medikamente und Kohle auf, die er während des nun folgenden Krieges dann mit erheblichen Gewinnen an den Mann brachte. Im Januar 1904 gelang es ihm, die Pläne der russischen Verteidigungsstellungen und Minenfelder rund um Port Arthur zu stehlen und sie – mit Billigung beziehungsweise auf Weisung des britischen Geheimdienstes – der japanischen Marine zukommen zu lassen. Den Briten lag im Rahmen des Great Game, der Auseinandersetzung mit dem expandierenden Russland um die Vorherrschaft in Zentralasien, ebenfalls daran, Russland möglichst nachhaltig zu schwächen. Die Japaner waren durch die von Reilly überlassenen Pläne in der Lage, bei ihrem Überraschungsangriff auf den Hafen Anfang Februar 1904 einen umfassenden Sieg zu erringen. Da sich nun die russische Spionageabwehr für den merkwürdigen »Sägewerksbesitzer« zu interessieren begann, packte Reilly seine Sachen und floh.