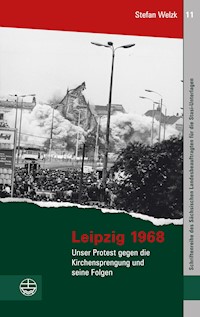
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Schriftenreihe des Sächsischen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen
- Sprache: Deutsch
Drei Wochen nach Sprengung der Leipziger Universitätskirche 1968 entrollt sich in der Kongresshalle vor Ministern und Westmedien ein Transparent mit dem Umriss der Kirche und den Worten "WIR FORDERN WIEDERAUFBAU!". Zwei der Akteure flüchten kurz darauf mit dem Faltboot übers Schwarze Meer. Erst 1970 gerät ein Beteiligter der Aktion durch Verrat ins Fadenkreuz der Stasi, die ein DDR-weites Netzwerk des Widerstandes vermutet. Es folgen mehrjährige Ermittlungen, neue Verhaftungen und Zuchthausstrafen von bis zu sechs Jahren. Der Maler des Transparentes bleibt bis zu seiner Flucht 1978 unentdeckt. Stefan Welzk blickt auf die Protestaktion und ihre Geschichte zurück. Er erzählt von der Entstehung einer "subversiven" Subkultur unter Leipziger Studenten, von Idee und Ablauf dieser Aktion und vom Schicksal der Verhafteten und Geflüchteten. Stefan Welzk zeigt auf eindrückliche Weise, welch unterschiedlichen Verlauf die Lebenswege in Ost und West genommen haben. Ernüchternd sind seine Erfahrungen im politischen Establishment der Nachwendezeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Welzk
Leipzig 1968
Unser Protest gegen die Kirchensprengung und seine Folgen
Schriftenreihe des Sächsischen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen
Band11
Folgende Bände sind erschienen:
Band1 Achim Beyer: 130 Jahre Zuchthaus. Jugendwiderstand in der DDR und der Prozess gegen die »Werdauer Oberschüler« 1951, 2003, 3. Auflage 2008, 112 Seiten, ISBN: 978-3-374-02070-6
Band2 Regine Möbius: Panzer gegen die Freiheit. Zeitzeugen des 17. Juni 1953 berichten, 2003, 176 Seiten, ISBN: 978-3-374-02084-3
Band3 Lenore Lobeck: Die Schwarzenberg-Utopie. Geschichte und Legende im »Niemandsland«, 2004, 3. Auflage 2005, 192 Seiten, ISBN: 978-3-374-02231-1
Band4 Jens Niederhut: Die Reisekader. Auswahl und Disziplinierung einer privilegierten Minderheit in der DDR, 2005, 152 Seiten, ISBN: 978-3-374-02339-4
Band5 Jürgen Gottschalk: Druckstellen. Die Zerstörung einer Künstler-Biographie durch die Stasi, 2006, 120 Seiten, ISBN: 978-3-374-02361-5
Band6 Jörg Rudolph, Frank Drauschke und Alexander Sachse: Hingerichtet in Moskau. Opfer des Stalinismus aus Sachsen 1950–1953, 2007, 192 Seiten, ISBN: 978-3-374-02450-6
Band7 Martin Jankowski: Der Tag, der Deutschland veränderte. 9. Oktober 1989, 2007, 2. Auflage 2009, 176 Seiten, ISBN: 978-3-374-02506-0
Band8 Jens Schöne: Das sozialistische Dorf. Bodenreform und Kollektivierung in der Sowjetzone und DDR, 2008, 2. Auflage 2011, 176 Seiten, ISBN: 978-3-374-02595-4
Band9 Hrg. von Sebastian Pflugbeil: Aufrecht im Gegenwind, Kinder von 89ern erinnern sich, 2010, 2. Auflage 2011400 Seiten, ISBN 978-3-374-02802-3
Band10 Thomas Mayer, Helden der Friedlichen Revolution. 18 Porträts von Wegbereitern aus Sachsen, 2009, 2. Auflage 2009, 160 Seiten, ISBN: 978-3-374-02712-5
Der Sächsische Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
Die Deutsche Bibliothek – Bibliographische Informationen
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.ddb.de› abrufbar
2., korrigierte Auflage 2011
© 2011 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Gesamtgestaltung: behnelux gestaltung, Halle/Saale
Umschlagfoto: Arich: Gudrun Vogel/Foto: Ullrich
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
ISBN 978-3-374-04993-6
www.eva-leipzig.de
www.lstu-sachsen.de
Für Annerose, Günter und Charly,
die in der Haft schlimm gelitten haben.
Inhalt
Cover
Titel
Schriftenreihe des Sächsischen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen
Impressum
Widmung
Gedenktafel zur Erinnerung an die Sprengung
Vorwort
Ausbruch
Kinder, Kader, Kommandeure – Wirrungen eines politisch Frühreifen
Die Romantik der Resistance
Bitterfelder Impressionen
Die wunderbaren Jahre
Die Sprengung
Der Protest
Verfemt und überwacht – Kontaktaufnahme zu einem Poeten
Kongresshalle tobt. Stasi im Jagdfieber
Navigare necesse est. Die Flucht
Türkische Sicherheit. Istanbuler Episoden
Drüben
Startversuche
APO
Traumzeit in der Denkfabrik
Fluchthunger
Zugriff. IM Boris Buch
Operativ-Vorgang Atom – »CIA-Agent von Weizsäcker«
Katastrophe
Honeckers staatsgefährdender Menschenhandel
»Alle Oppositionellen in die SED!« – Stasi-Neurosen und Ermittlungsblockaden
Die Tragödie eskaliert
Vollzug
Verzweiflung
Entlassen
Forschungsversuche
Exkurs: Peter Huchel – das Wiedersehen
Sozialistischer Realfeudalismus – paradoxe Modernisierungsfalle
Überlebt die Wohlstandsdemokratie?
»Am Grunde der Moldau wandern die Steine …«
Wendeschauer
Tiefschlag
Bilanz
Zum Autor
Weitere Bücher
Fußnoten
Gedenktafel zur Erinnerung an die Sprengung
Vorwort
»Ich habe […] auch Steine geworfen. Allerdings auf sowjetische Panzer, die 1968, Richtung Prag, durch Zwickau rollten. Aber das hat im Westen keiner mitbekommen. Wir kannten die Bilder aus dem Westen, zum Beispiel dieses berühmte Spruchband ›Unter den Talaren Mief von tausend Jahren‹. Aber das Transparent, das im Juni 1968 in Leipzigs Kongresshalle runtergelassen wurde, das kennt im Westen niemand. […] Was meinen Sie, was da los war, wie das provoziert hat. Aber die Bilder unseres Protestes landeten in den Archiven der Stasi, nicht in Zeitungsredaktionen.« So blickte der Bürgerrechtler und spätere Bundestagsabgeordnete Werner Schulz 2001 in einem Spiegel-Interview unter dem Titel »Ohne ’68 kein ’89« auf den Protest gegen die Kirchensprengung im Jahr 1968 zurück.
Das Jahr 1968, das in der Bundesrepublik gemeinhin mit den Studentenprotesten assoziiert wird, bedeutet für jene, die diese Zeit in der DDR erlebt haben, oft etwas ganz anderes. Neben dem Prager Frühling, der für viele ein Hoffnungszeichen war und vieles in Gang setzte, war der Protest gegen die Kirchensprengung, Jahre nach dem Mauerbau, in einer Zeit, in der sich die Machtstrukturen verfestigt hatten, in der es kaum öffentlich wahrnehmbaren Protest gab, ein Hoffnungszeichen, dass sich auch in der DDR Widerspruch und Gegenwehr gegen das übermächtig scheinende System regte. Die Plakataktion hatte Strahlkraft, gleichzeitig war sie nur die Spitze des Eisbergs. Die oppositionelle Protestkultur, die sich vielerorts in der DDR in alternativen Lesezirkeln, in Gesprächskreisen und Künstlergruppen auslebte, blieb meist im Verborgenen. Nur wenig davon drang an die Öffentlichkeit. Das Protestplakat blieb eine Ausnahme. Wollen wir heute etwas über jene politische Subkultur erfahren, bleiben die Erinnerungen der Beteiligten, oft nur die Stasi-Akten. Stefan Welzk, einer der Hauptakteure des Kirchenprotestes, hat sich auf Spurensuche begeben und die damaligen Geschehnisse – ihre Vorboten und Folgen in die Gegenwart zurückgeholt. Er hat mit Beteiligten gesprochen, Akten studiert und die eigenen Erinnerungen zu Papier gebracht. Ihm ist es zu verdanken, dass wir in der vorliegenden Publikation einen atmosphärisch dichten Einblick in die 1950er und 1960er Jahre erhalten, dass wir einen Eindruck von der massiven politisch-ideologischen Umformung der Gesellschaft bekommen. Dank seiner Schilderungen erfahren wir von den vielfältigen Verweigerungstaktiken der aufmüpfigen Jugendlichen, vom Witz und Esprit ihrer Lebenshaltung, die schließlich auch in der mutigen Plakataktion Niederschlag fand. Wir werden hineingezogen in die Protestaktion, in die Vorbereitung und deren Geheimhaltung. Wir begeben uns mit dem Autor auf die Flucht in die Türkei übers Schwarze Meer und erfahren davon, wie der Neuanfang im Westen verlief. Stefan Welzk erzählt aber nicht nur von sich, sondern vor allem von denen, die später in den Fokus der Staatssicherheit gerieten und jahrelang unter Repressionen zu leiden hatten. Es wirkt beinahe wie eine makabere Kehrseite der erfolgreichen Aktion, dass die Hauptakteure des Protestes nie von der Staatssicherheit gefasst wurden, währenddessen dafür Freunde und Bekannte unter fadenscheinigen Vorwürfen stellvertretend zur Verantwortung gezogen wurden. Hätten die späteren Stasi-Ermittlungen nicht so fatale Folgen gehabt, so könnte man die Berichte über Stefan Welzk als Zentrum eines CIA-Schleusernetzwerkes heute als überzeichnete, nicht ernstzunehmende Phantastereien belustigt zur Seite legen. Bedauerlicherweise waren die Konsequenzen, die aus den Ermittlungen gezogen wurden, andere und die Folgen für die Betroffenen überaus schwerwiegend. Letztlich waren es inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit, die die entscheidenden Hinweise lieferten und die Verfolgungsmaschinerie in Gang setzten. Stefan Welzk zeigt minutiös, wie aus unbedachten Äußerungen und falschen Vertraulichkeiten Freunde belastet wurden und die Spur schließlich zu den Protagonisten des Protestes führte.
Das vorliegende Buch bietet einen Blick auf verschiedene Biografien, die sich im Jugendalter im subkulturellen Milieu überschnitten. Auch wenn die einzelnen Lebensgeschichten sich später in ganz unterschiedliche Richtungen entwickelten, entwickeln mussten, so ist ihnen allen die Sehnsucht nach Freiheit und ein wacher, widerständiger Geist eigen. Wie diese Lebenshaltung und die DDR-Prägung sich später im bundesdeutschen Alltag niederschlugen, welche Möglichkeiten und Grenzen es gab, zeigt Stefan Welzk auf spannende Weise. Dabei führt seine Betrachtung bis in die Gegenwart.
Nicht zuletzt ist die vorliegende Publikation auch ein Beitrag zu einem behutsamen Umgang mit Vergangenheit und eine Reflexion über die Deutungshoheit von Geschichte. Stefan Welzk zeigt auf eindrückliche Weise, dass sich nur in Verbindung von Aktenstudium und den persönlichen Erfahrungen der Beteiligten ein realitätsnahes Bild der Vergangenheit zeichnen lässt. Geschichte lässt sich nicht gegen, sondern nur mit den Hauptakteuren schreiben. Sobald bewusst verschiedene Komponenten ausgeklammert werden, entstehen Schieflagen, die für Beteiligte und Betroffene gravierende Folgen haben.
Es ist dem Autor zu danken, dass er sich dieser Herausforderung gestellt hat. Den Betroffenen ist zu danken, dass sie für Gespräche Zeit und Kraft gefunden haben, dass sie Dokumente und Fotos zur Verfügung gestellt haben. Ebenso ist der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, dem Universitätsarchiv Leipzig und dem Paulinerverein für die Unterstützung bei der Recherche zu danken.
Möge dieses Buch dazu beitragen, das Wissen über den Widerstand in der DDR facettenreicher zu machen. Fern jeder öffentlichen Wahrnehmung gab es Menschen, die widerstanden haben, die sich dem Mitmachen verweigert haben, die mit viel Lebenslust und Humor alternative Wege gegangen sind.
Widerstehen war möglich, doch oft war der Preis dafür sehr hoch!
Dr.Nancy Aris
Stellvertretende Sächsische Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen
Ausbruch
Da raus? Mit einem schon halb ramponierten Faltboot? In diese Wellen? Schwärzer konnte auch das Schwarze Meer nicht sein. Erst kurz vorm Strand brachen die hohen Schaumkronen seltsam hell aus dem Dunkel. Da draußen, Hunderte von Kilometern weg, die Türkei. Hinter uns die Stasi. Fingerabdrücke gab es zur Genüge. Es konnte nur eine Frage von Wochen sein. Es war mein Geburtstag. Tschornoje Morje – ein launiges, unberechenbares Teufelsmeer sei das, hatten mir Bulgaren gesagt. Morgen Abend also. Da war Neumond. Das versprach Unsichtbarkeit.
Das Faltboot war offenbar nicht fürs Meer gebaut, nicht für dieses Wetter. Bei Probefahrten hatten die kurzen, halbmeterhohen stoßartigen Wellen Nieten aus dem Holz des Gestänges gedrückt, Scharniere zerrissen. In einer Tankstelle hinterm Campingplatz hatten Harald und ich das Ganze mit viel Draht wieder zusammengeflickt. Es sah hanebüchen aus, doch die nächsten Probefahrten hielt das Konstrukt. Offenbar war es flexibler geworden gegen die Wellenstöße.
Ich hatte mich verquatscht. Kollegen im Akademie-Institut für Geomagnetismus in Potsdam hatten von einer unglaublichen Protestaktion gegen die Sprengung der gotischen Universitätskirche in der Woche zuvor in Leipzig erzählt. Ein Tuch mit Protestspruch und Kirchenbild habe sich in einem Konzertsaal oder einer Kirche beim Bedienen der Orgel gesenkt. Ich präzisierte: Das sei in der Kongresshalle gewesen, und nicht von der Orgel, sondern auf offener Bühne, vor den Augen von Ministern und Westjournalisten, vor deren Kameras, etwa zwei mal drei Meter, ein gelbes Tuch, mit schwarzen Strichen. Darauf die vor drei Wochen gesprengte, im Krieg unversehrt gebliebene Kirche, neben dem Dachreiter die Jahreszahl »1968« und ein Kreuz, darüber 1240*, und unten in balkengroßen Lettern die Schrift »Wir FORDERN WIEDERAUFBAU!«. Einer der Kollegen bei dieser Unterhaltung hatte das »Bonbon« am Revers, das ovale Parteiabzeichen, freilich ein schlichter, gutmütiger Typ, so schien es mir damals. Doch beflissen hat er als IM Omega seine Spitzelberichte geschrieben. Auch Treumann war im Raum, Rudolf Treumann. Sein Gesicht wurde aschfahl. Er hatte das Transparent gemalt, auf dem Fußboden meines Zimmers in Potsdam, nach einer Postkarte. Harald hatte den Zeitauslöser konstruiert und ich das Ganze dann über der Bühne der Kongresshalle in Leipzig angebracht. Nichts, so glaubte ich, war jetzt eben von mir gesagt worden, was nicht einer aus dem Publikum im Saal hätte sehen können. Und schließlich war ich Leipziger. Doch die Zahl 1240 war gar nicht zu sehen gewesen. War sie hinter der Bühnenumrandung geblieben? Oder hatte Rudolf sie entgegen unserer gemeinsamen Erinnerung gar nicht aufgemalt auf das Tuch? Und an dem Tag hatte ich gefehlt am Institut. Auch meine Erzählweise war irgendwie auffallend gewesen, zu begeistert vielleicht und zugleich zu genau. Rudolf hatte zwei kleine Kinder. Ein Fluchtversuch kam für ihn damals nicht infrage. Niemand außer mir wusste von seiner Beteiligung. Und ich war mir sicher, zu sicher, im Ernstfall ihn nicht preiszugeben, zu behaupten, ich selbst hätte das Transparent gemalt. Wenn man so was machte in der DDR, hatte man irgendwie abgeschlossen. Folter in der Tradition von Stalins NKWD hielt ich für unwahrscheinlich in dieser Zeit und hoffte – sollte ich mich irren – auf eine Chance zum Ausstieg. Doch keiner kann wissen, was er letztlich im Stasi-Verhör preisgibt, bei noch so felsenfester Entschlossenheit zur heroischen Selbstaufgabe.
Gut, dass eine Flucht bereits angedacht war, seit langem schon, noch vor dem Aufkommen der Kongresshallenidee. Reisegenehmigungen, »Anlagen zum Visa-freien Reiseverkehr«, wie das DDR-amtlich hieß, hatte ich für Ungarn und Bulgarien seit Monaten schon im Schreibtisch. Diese Zettel vergab man anstelle in einen Pass zu stempelnder Ausreisevisa. Denn Pässe pflegte die DDR ihren Insassen im Normalfall nicht auszuhändigen, wegen »Missbrauchsgefahr«. Beantragt hatte ich diese Genehmigungen mit getürkten Einladungsbriefen von nichtexistenten Freunden aus diesen Ländern, selbst von dort aus geschrieben im Jahr zuvor.
Reiseanlage für den angeblichen Sommerurlaub in der Volksrepublik Bulgarien
Quelle: Privatarchiv Welzk
Wie ich war Harald Doktorand der Akademie in Potsdam, am Institut für Gravitationsforschung. Wir kannten uns schon vom Physikstudium und von unseren subversiv-subkulturellen Abenden in Leipzig. Er war mit der Faltboot-Idee gekommen, ein paar Wochen vorher. Seit Jahren schon besaß er das Boot, mit aufsetzbarem Mini-Motor, Besegelung und Seitenschwertern, hatte lange Fahrten auf der Weichsel und auf Binnenseen hinter sich. Aufs Meer, auf die Ostsee, durfte man nicht mit einem Faltboot. Das galt schon in unmittelbarer Strandnähe als versuchte Republikflucht. Und wie eine ferne Straßenbeleuchtung sah man nachts auf Rügen und dem Darß vom Strand die Lichterkette der Wachboote.
Ursprünglich hatte ich über die Ostsee schwimmen wollen, zumindest die 17 Kilometer zum Feuerschiff Gedser. Das war dänisch. Einen Schwimmer würden sie nachts nicht entdecken. Wenn Hochtrainierte den Kanal zwischen Calais und Dover schaffen, warum sollte ich nicht die halbe Entfernung in der milderen Ostsee bewältigen können? Voraussetzung war freilich ein Wärmeschutzanzug aus dem Westen. Den hatte ich noch nicht. Doch fast jeden Abend hatte ich trainiert, hatte im Seddiner See südlich von Potsdam meine Runden gezogen, im milden Dämmerlicht bis zur tiefen Dunkelheit. Die Fischer kannten mich schon alle, sprachen mich an aus ihren Booten. »Ich trainiere für eine Wette«, hatte ich sie beschieden. Doch ein Schulfreund, Seemann, Hochseefischer der DDR-Flotte, warnte eindringlich: Mehrere Zwangsschifffahrtswege kreuzten sich am Feuerschiff. Ich würde untergepflügt werden, ohne dass irgendjemand etwas bemerke. Die Schifffahrtsdichte dort sei zu hoch. Ausweichen wäre chancenlos, die Schiffe seien viel zu schnell. Ich hatte auch keine Ahnung, ob dieses Feuerschiff überhaupt bemannt war, und wenn, ob ich eine Chance hätte, hochzukommen aus dem Wasser, ob es da ständig eine erreichbare Leiter gab oder ob sie einen Schwimmer bemerken würden. Die Vorstellung, bis zum bitteren Ende ungesehen das Feuerschiff schwimmend zu umkreisen, war nicht erbaulich. Noch ein Gegenargument kam hinzu. Wer wegen versuchter Republikflucht verurteilt worden war, bekam keine Reisegenehmigung mehr in die sozialistischen Bruderländer. Also war es sinnvoll, zunächst einen Versuch über deren Grenzen zu wagen. Wenn das schiefginge, bliebe nach der Haft noch immer die Ostsee.
So war ich dankbar, als Harald vorschlug, es übers Schwarze Meer zu versuchen. In meiner Zeit als Hilfsassistent am mathematischen Institut der Universität Leipzig war er mir beim Korrigieren von Übungen als Hochbegabung aufgefallen und ich hatte Professoren auf ihn hingewiesen. Die Kongresshallen-Aktion hat uns dann zusammengeschweißt. Eng befreundet war ich lange schon mit seinem Cousin Günter Fritzsch, einem meiner Kommilitonen. Er hatte mich, den Atheisten, immer wieder mitgeschleppt zu Abenden der Studentengemeinde, wenn kulturelle und ideologische Konterbande geboten wurde. Unser eigener Kreis, 20 bis 30 ideologisch abtrünnige Gestalten, zunächst nur Physikstudenten, dann quer durch die Fakultäten, angewidert und gedemütigt von einer primitiv verlogenen Propaganda, traf sich seit langem in lockerer Regelmäßigkeit in wechselnden Wohnungen zu Lesungen gemeinhin nicht verfügbaren Schrifttums und zu Diskussionen: Milovan Djilas, Leszek Kołakowski, Robert Havemann, Pasternak und Solschenizyn, Camus, Sartre und Popper und die »Gruppe 47«. Kurzum, alles, was gebannt war, unerwünscht oder verboten, faszinierte. Wir lebten in provokanter Leichtfertigkeit. Wir verstanden uns klar als Gegenkultur. Der Kreis uferte aus. Politisch exponierte Pfarrer wurden zu Vorträgen eingeladen und Dozenten diverser Fakultäten. Am Rande waren die Abende zugleich Umschlagplätze für »Spiegel« und »Zeit« und was immer an verfemten Druck-Erzeugnissen so kursierte. Wenn um die 20 Personen gen Mitternacht sich die Treppen von Mietshäusern behutsam, doch unüberhörbar herunterbewegten, das musste doch längst aufgefallen sein, so dachten wir. Auch in meinem Fünfetagenhaus wohnten nicht wenige Regimetreue, die zu den einschlägigen Feiertagen flaggten. Doch in den Stasi-Akten fand sich später nicht der geringste Hinweis auf diese Abende. Die politisch brisanteren Gespräche beschränkten wir freilich auf einen engeren Kreis.
Kinder, Kader, Kommandeure –Wirrungen eines politisch Frühreifen
Dann, 1968 die Kirchensprengung. Mit Kirche hatte ich zunächst wenig am Hut. Ich bin weder konfirmiert noch getauft. Früh ab sechs hatte meine Mutter an ihrem Volljährigkeitsgeburtstag einst am Standesamt angestanden, um auszutreten aus der Kirche. Noch immer erzählte sie von den Misshandlungen durch den Pfarrer im Religionsunterricht. Ihre erstaunten Fragen zu den Wundern in der Bibel wurden mit Schlägen des Lineals auf die ausgestreckt darzubietenden Finger bestraft. In redlicher Überzeugung hatte ich mich der sozialistischen Jugendweihe unterzogen. Mein Grundschulzeugnis fiel freilich derart dürftig aus, dass die Bewerbung auf einen Platz an der Oberschule gar nicht erst infrage kam. Unserer Mutter war ihr heißer Wunsch auf ein Studium versperrt geblieben. Aufgewachsen bei einer krankhaft geizigen Großmutter – Besitzerin von drei Mietshäusern im proletarischen Leipziger Osten, den Schrank halbvoll mit kleinen Säckchen gefüllt mit Goldmünzen – war sie dort fast verhungert und grausam misshandelt worden. Trotz eindringlicher Hausbesuche des Schulleiters hatte ihr diese Großmutter das Lyzeum verboten: »Die soll Strümpfe stopfen lernen!« Nun drohte ihr Traum, wenigstens ihre Kinder würden studieren können, an meinen miserablen Noten zu scheitern. Und so schrieb sie schließlich an Wilhelm Pieck, den Staatspräsidenten, kurz vor Beginn des Schuljahres. Mein Vergnügungsleben bei den Jungen Pionieren wurde zum politischen Engagement umgelogen. Bitterlich beklagte sie, dass sie selbst vorm Krieg als Arbeiterkind trotz Einsatz des Schuldirektors nicht hatte studieren dürfen und nun, in der neuen Ordnung, erleben müsse, dass ihr Sohn außen vor blieb. Die Aufnahmekommission habe meine frühe politische Reife nicht hinreichend gewürdigt, so befand bald die Präsidialkanzlei. Der Präsident setze hohe Erwartungen in meine politische Entwicklung. Ich denke, ich bin dem gerecht geworden.
Ich durfte antreten an der »Karl-Marx-Oberschule«, einer Art Kaderschmiede fast. Sofort wurde ich, wohl dank der Zuweisung aus der Präsidialkanzlei, zum »Klassenkommandeur« ernannt und scheiterte kläglich. Es wurde mir bereits zum Ekel, zu jedem Stundenbeginn zu bellen: »Klasse 9b3 mit 26 Schülern zum Unterricht angetreten!« Vor Dimitrij Kalinskij, einem Ex-Militär, dann auch noch in Russisch, das wurde zur unüberwindbaren Barriere. Ich überredete eine Mitschülerin, zumindest für den Russisch-Unterricht diesen Part zu übernehmen. Diese Anstalt war durchzogen von einem »Kommandeursystem«. In jeder Klasse gab es einen Sportkommandeur, einen Schulspeisungskommandeur, einen Kulturkommandeur, vier wöchentlich rotierende Kommandeure fürs Allgemeine, die jeden Morgen vor Direktor und FDJ-Sekretär zum Befehlsempfang anzutreten hatten, und dann eben den Klassenkommandeur schlechthin.
»Heimat im sonnigen Kleide,
wagt es die feindliche Gier,
werden wir sieghaft dich hüten.
Heimat, das schwören wir Dir!«
grölten wir verdrossen zu den wöchentlichen Fahnenappellen vor uns hin. Und so schworen wir uns durch die Schuljahre, oder taten zum Appell dem Karl Marx huldigen, dem dergleichen wohl ein Gräuel gewesen wäre:
»Sein rotes Banner vor uns her
erstürmen wir den Sieg.
Der Friede schultert sein Gewehr
und schützt die Republik.«
Immerhin, das Gewehr mussten wir nicht schultern in diesen Schuljahren. Meinen Bruder Frank, fünf Jahre vor mir in die nämliche Anstalt geraten und dort alsbald Schulsprecher der FDJ, hatte ich noch sechzehnjährig mit Knarre über der Schulter beim Marschieren bewundern dürfen. Wir, in den späten 1950er Jahren, wurden nur noch mit Gleichschrittübungen und eben mit Kampfliedergegröle malträtiert. Vom jährlichen Kampfliederwettbewerb der Schulklassen wurde ich freilich bald freigestellt. Die schrille Falschheit meiner Tonlagen brachte jeden Chor zum Scheitern. Das war keineswegs gewollt. Ich konnte einfach nicht singen. Eine Zeit lang musste ich noch dabeistehen und schweigend das Maul öffnen und schließen. Als sänge ich mit. Meinem Bruder war das Militärische, überhaupt eine straff geführte Gemeinschaft mit klarer Ideologie, weniger zuwider als mir. Und so blieb die Erinnerung an diesen vielversprechenden Kader, der sich nach dem Abi zur Offizierslaufbahn bei der Luftwaffe hatte gewinnen lassen, das Vorbild, mit dem ich von der Schulobrigkeit verachtungsvoll verglichen wurde.
Schon im zehnten Schuljahr wäre meine Oberschulzeit fast wieder zu Ende gewesen. Ich hatte mich mit dem Fahrrad nach West-Berlin aufgemacht, der Internationalen Bauausstellung im Tiergarten wegen. Den Stalinbarock in den Stadtzentren empfand ich als beleidigend und atmete bei Mies van der Rohe, Le Corbusier und all den lichtvollen Glas- und Stahlkonstrukten der wirklichen Moderne ein Lebensgefühl, das Weite und Raum verhieß. Ich schlief im Tiergarten im Gebüsch, dann in einer Turnhalle, und machte mich nach zwei Tagen auf den Rückweg. Leider fiel die linke Pedale ab, so dass ich die 178 Kilometer mit der einen verbliebenen Pedale runtertreten musste und einen Tag zu spät wieder in Leipzig auftauchte. Mein Vater hatte in der Schule irgendeine Entschuldigung zusammengelogen und wurde bei dieser Gelegenheit eindringlich gebeten, mich von dieser Anstalt zu entfernen. Ich sei nur an Clownerien interessiert und an Provokationen, würde penetrant und permanent stören, zöge jedwede Disziplin ins Lächerliche und das bei ziemlich dürftigen Leistungen. Vater war fast soweit, tieftraurig nachzugeben. Doch Mutter stellte sich empört und störrisch quer und sah die Probleme eher in der Lehrerschaft. Ich blieb. Entscheidend für die Bewerbung auf den gewünschten Studienplatz war schließlich erst das Zeugnis des elften Schuljahres.
Eine seltsame Gestalt schlurfte durch die Korridore dieser Schule, hinkend mit beiden Beinen, mit herabhängendem runden Glatzengesicht, formlosem Anzug und einer stets offenen schmuddeligen Aktentasche. Ich glaubte zunächst, ein Penner habe sich ins Gebäude verirrt, erfuhr aber bald, dass der Mann der Parteisekretär war und zudem in seinen Klassen beliebt, da verständnisvoll, milde und mit treffsicherem Sarkasmus. Gestapo-Verhöre hatten sein Nervensystem und seine Gesundheit ruiniert. Ganz anders der Direktor. Kerniges klares Auftreten. Mitglied der SED-Kreisleitung. Er hatte im spanischen Bürgerkrieg gekämpft, bei der Legion Kondor freilich, auf Seiten Francos. Ihm zur Seite die Vize-Direktorin, einst engagierte BDM-Führerin und dies hin und wieder unaufgefordert und reuevoll bekennend. Jetzt wollte sie das wiedergut- und alles richtig machen und tat im Grunde das Gleiche wie früher auch. Das Verhältnis zwischen diesen beiden und den Altkommunisten aus dem Widerstand war frostig.
Bei allem Angewidertsein von der Realität dieser »Republik« war die reine Lehre von der Selbstbefreiung der Arbeiterklasse und sonstiger Unterdrückter als historisches Gesetz doch von großer Faszination. Mit Fünfzehn hatte ich mich zum zwiespältigen Erstaunen von Lehrern durch das Kommunistische Manifest gegraben, ja dieses Papier gar von Seite eins an auswendig zu lernen versucht, dann einen »Zirkel Junger Sozialisten« in der Klasse gegründet, der sich die grandiosen Gedankengebäude des dialektischen und historischen Materialismus vornehmen sollte, die faszinierende Entwicklungslogik von Natur und Gesellschaft, von der Urgemeinschaft bis zum Kommunismus, vom Einzeller über den Australopithecus bis zum Parteisekretär, der kraft seiner Einsicht in die historischen Gesetzmäßigkeiten zum Subjekt der Geschichte wird, statt deren Spielball zu bleiben. Mit gequältem Opportunismus hatten sich die Mitschüler diesem Jungsozialistenzirkel allesamt angeschlossen, der politischen Beurteilung für einen Studienplatz wegen. Der Klassenlehrer dozierte dort und beauftragte mich mit dem Führen einer Anwesenheitsliste. Dieser Lehrer, Karl-Heinz Dost, ursprünglich Drucker, war eine redliche Haut. In der Nazizeit hatte er wegen kommunistischer Widerstandsarbeit, Flugblättern und dergleichen, im Zuchthaus Waldheim eingesessen, gemeinsam mit dem 1945 hingerichteten Georg Schumann, einer der eindrucksvollsten Gestalten des Widerstandes. Er war dann ins berüchtigte Strafbataillon 999 geschickt worden und in amerikanische Gefangenschaft geraten. Nach dem Krieg wurde er Schulleiter, wurde jedoch gefeuert, weil er sich weigerte, Zensuren von Arbeiterkindern willkürlich heraufzusetzen. Nach Stalins Tod versuchte man, ihn mit der Würdigung als »Verdienter Lehrer des Volkes« und mit der Versetzung in die Oberschule für die erlittene Schmach zu entschädigen.
Zum Eklat zwischen ihm und mir kam es, als ich mich weigerte, die Anwesenheitsliste dieses Jungsozialistenzirkels für seine politischen Willfährigkeitsbenotungen rauszurücken, als die Bewerbungen um Studienplätze anstanden. Politischer Opportunismus der Karriere wegen verdiene keine Belohnung, befand ich. Nach lautstarker Auseinandersetzung hatte er diese Weigerung schließlich geschluckt, vielleicht auch eingesehen, und auf die Anwesenheitsliste verzichtet. Ein konformer Durchschnittsgenosse war Dost weiß Gott nicht. So hielt er der Klasse an einem Abend einen ausführlichen, ziemlich konkreten sexuellen Aufklärungsvortrag. In der DDR der 1950er Jahre war dergleichen schier unvorstellbar.
In fast lustvoll ausgetragene Kontroversen mit diesem »Verdienten Lehrer des Volkes« geriet ich nicht selten. So wurde damals in der DDR Zahlenlotto eingeführt. Ich empörte mich, dass damit die Erziehung zum sozialistischen Bewusstsein sabotiert würde. Deren entscheidendes Moment sei es doch gerade, nicht auf Gewinn aus zu sein, weder an der Börse noch im Glücksspiel, sondern auf redlichen Lohn für redliche Arbeit. Dost hielt entgegen, es würden doch nur sehr wenige so viel gewinnen, dass sie nicht mehr arbeiten müssten. Ja, hielt ich dagegen, aber bei Millionen werde der Wunsch erzeugt, Geld ohne Arbeit zu erlangen, Ansprüche ohne Gegenleistung. Und das sei das Gegenteil einer sozialistischen Erziehung. In Dosts Notizbuch, er hatte es einmal auf dem Pult vergessen, fand ich unter meinem Namen die Worte »verschroben, eigenbrötlerisch, leicht trottelig«. Immerhin war er nach dem Abitur bereit, für meinen Eintritt in die Partei zu bürgen, schließlich musste jeder Kandidat für die SED zwei Parteimitglieder als Bürgen vorweisen. Zu diesem Aufnahmeantrag kam es dann schließlich doch nicht. Gut ein Jahrzehnt später habe ich ihm dann eine Postkarte aus London geschickt, mit dem Bild des Grabes von Karl Marx.
Die Romantik der Resistance
Ungeachtet meiner frühen Umtriebigkeit mit marxistischen Sichtweisen hatte ich so im Alter von 16 Jahren eine illegale Gruppe gebildet, mit Freunden aus der Grundschulzeit und deren Freunden. OED, »Organisation Einheitliches Deutschland«, nannten wir uns bescheiden. So rund ein Dutzend waren wir. Ich war fasziniert vom Heldentum und der Romantik kommunistischer Resistance in der Nazizeit, wie sie in Filmen und Geschichtsunterricht nachzuerleben waren. Die Versuchung, dem nachzueifern, wurde unwiderstehlich. In einer Diktatur lebten wir schließlich auch und im Unterschied zur Nazizeit war die der überwältigenden Mehrheit im Volke verhasst. So etwas wie ein Programm, auch nur eine klare politische Absicht, das gab es freilich nicht. Immerhin, zu einer brisanten Aktion war es dann doch gekommen. Das war wohl 1959, Berlin war noch offen. Es gab neue, scharfe Einschränkungen für Reisen nach Westdeutschland. Mit Farbeimer und Pinsel zogen wir zu dritt am spätdunklen Abend in den Pausenhof meiner Karl-Marx-Oberschule. »WEG MIT DEM VERBOT VON WESTREISEN!« pinselten wir an das backsteinrote Gemäuer. Ich hörte durch das Turnhallentor hindurch das Gebell des Sportlehrers, der mit irgendwelchen Trainingsgruppen zu Gange war, die Knie zitterten und mir wurde flau im Magen. Das Absurde war, dass ich überhaupt niemanden kannte in Westdeutschland und keinerlei Absicht hatte, dorthin zu reisen. Wir wollten halt Resistance spielen. Wir versuchten in der gleichen Nacht noch die Mauern zweier anderer Oberschulen zu beschriften, kamen aber unserer wachsenden Angst wegen über einige unleserliche Krakel nicht hinaus, zogen kälteklamm nach Hause und versenkten unterwegs in Mülleimern Handschuhe, Farbe und Pinsel.
Am nächsten Tag in der großen Pause prozessierte die gesamte Schülerschaft an unserer Losung vorbei und unser urkommunistischer Klassenlehrer posierte davor wie ein verbissener Wachtposten. »Das ward doch ihr und Dost hält Wache!«, kam Arnd Ballin grinsend auf mich zu, ein Klassengefährte, doch weit älter als wir. Seine Tuberkulose hatte ihn für zwei Jahre in eine Mottenburg verbannt. Er war ein belesener Kenner der »bürgerlichen Dekadenz« und vor allem der West-Berliner Kino- und Theaterwelt. »Halt um Himmels Willen die Schnauze!«, raunzte ich ihn an. Am Abend zuvor, als wir die Schule verließen, war uns auf dem Korridor der FDJ-Sekretär der Schule entgegengekommen, ultralinientreu und späterer Topkader. Doch gedankenverloren hatte er uns wohl nicht wahrgenommen. Acht Verdächtige wurden von Stasi und Lehrerkollegium aufgelistet und dieser Kreis dann auf neun erweitert, erzählte mir die Kunstlehrerin. Ich war nicht darunter. Die Ermittlungen liefen ins Leere. Doch unsere »OED« vergaßen wir dann bald. Denn über die Konsequenzen für unsere Lebenschancen und für unsere Eltern, sollten die Staatsorgane fündig werden, waren wir uns völlig im Klaren.
Nach dem Ableben des Vaters aller Werktätigen und weisen Führers der Arbeiterklasse hatte sich das Regime zu einer Art Stalinismus mit fast menschlichem Antlitz entschärft. 1958 war wieder eine »Wahl« zur »Volkskammer« fällig. Diesem Wahlkrampf ging jeweils eine Art Wahlkampf voraus, freilich ohne Opposition. Über nicht wenige Wochen wurde das Land zugekleistert mit Transparenten und Plakaten und Tag für Tag wuchs in den Zeitungen die Zahl von Deklarationen, in denen Hausgemeinschaften oder Brigaden gelobten, gemeinsam bis zehn Uhr morgens zur Wahl zu gehen und offen für die Kandidaten der Nationalen Front zu stimmen. Doch offen abgestimmt werden musste ja sowieso. Im Volk kochte ob dieser Demütigung die gleißende Wut und das Regime scheute nicht Aufwand noch Kosten, um die ansonsten leidlich resignierten Massen zur Weißglut zu bringen.
Als diesmal der Wahltag nahte, organisierte ich in der Klasse eine Wette über den Wahlausgang. Jeder zahlte eine Mark und trug in einer Liste ein, welches Resultat von ihm erwartet wurde. Wer dem offiziellen Ergebnis am nächsten kam, erhielt die gesamte Knete. 99,83%, 99,915%, 99,94% wurden gelistet. Die gesamte Schule genoss mit Häme diese Verhöhnung des Wahlspektakels. Einen hatten wir in der Klasse, der wegen seines hochgestellten Vaters schon vor dem vorgeschriebenen Mindestalter von 18 Jahren in die Partei aufgenommen worden war. Doch seinen Hang zum Sarkasmus konnte er nicht bändigen. Und so wettete er auf ein Ergebnis von 100,14%. Dafür wäre er um ein Haar wieder aus der SED rausgeflogen. Diese Wahlwette war unübersehbar auch für jeden aus der Lehrerschaft eine Unverfrorenheit. Die Farce dieser Volkskammerwahl wurde öffentlich vorgeführt. Unter Stalin wäre man dafür einfach abgeholt worden und für ein paar Jahre oder für immer verschwunden, ohne genaue Begründung, vielleicht wegen Hetze oder einfach so. Ein Anruf hätte genügt. Das ging nicht mehr. Um gegen mich vorzugehen, hätte man einräumen müssen, dass dies keine richtige Wahl war. Und genau das war unmöglich. Zu einer karriereschädlichen Notiz in der Kaderakte freilich kann es schon gekommen sein.
Mit Pauken und Trompeten zur Volkskammerwahl 1958
Quelle: Hans-Joachim Helwig-Wilson
Bitterfelder Impressionen
Nach dem Abi als Chemiearbeiter in Bitterfeld oder zwei Jahre Dienst im »schmucken Waffenrock« der Nationalen Volksarmee? Das war Bedingung, wollte man Chemie studieren, Wehrpflicht gab es noch nicht, die kam aus guten Gründen erst nach dem Mauerbau. Deshalb ließ man sich Einiges einfallen, um diese Armee zu füllen. Ich entschied mich für die erste Variante. Bitterfeld: zahllose backsteinerne Bauten, mit einer Patina von Schäbigkeit, vielfach verbunden mit Kabeln, Leitungen und Rohren, manche meterdick, fast alles offenbar Erbmasse aus vorsozialistischen Zeiten. Das Terrain durchzogen von Bahngleisen, verdreckten Straßen, zwischen Haufen von Abfall, Schrott, Gerümpel, Kohle, Kalk und sonstigen Rohstoffen. Daneben Tagebau und Aluminiumfabrik. Nördlich davon Film- und Farbenfabrik Agfa Wolfen. Die Felder ringsum hatte das Kombinat aufgekauft, denn Brauchbares wuchs da nicht mehr. Und gelbbraun hing über dem riesigen Gelände die Wolke aus Stickstoffdioxyd, das ungefiltert aus den Schloten quoll und über den gesamten Himmel eine giftige, nihilistische Atmosphäre breitete. Eine Industrielandschaft wie aus einem Albtraum, ein Panorama von Tristesse und Lebensfeindlichkeit.
Im Titanweißbetrieb: Überall Lachen von Salzsäure, grüngelb, auf den Böden neben den schweren, frühindustriell anmutenden Filterpressen, auf den eisernen Treppenstufen. Und von denen tropfte oder rieselte sie herunter ins Erdgeschoss. Säurefeste Kleidung aus Asbest, säurefeste Kappe. Der tägliche Ekel, sich mit drecksteifen Fußlappen in die Gummistiefel zu zwängen. Überall Salzsäurenebel. Ein Atemschwamm vor dem Mund sollte schützen. Doch in dem schlug sich die Atemfeuchtigkeit nieder und darin löste sich der Säurenebel. Ständig schmierte man sich deshalb Salzsäure ums Maul. Viele der Fensterscheiben waren zerbrochen. Deshalb zog zumindest einiges vom Säurenebel ab nach draußen.
Bitterfeld Ende der 1950er Jahre
Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-50647-0001/Erich Zühlsdorf
Schichtbetrieb, werktags drei, sonntags zwei Schichten, die zu zwölf Stunden, dafür jeden dritten Sonntag frei. Jede Woche Schichtwechsel. Frauen im Dreischichtbetrieb sahen etwa zehn Jahre älter aus als sie waren. Früh um drei klingelte Zu Hause in Leipzig der Wecker. Vier Uhr dreizehn fuhr vom Hauptbahnhof der Doppelstockzug nach Bitterfeld, rappelvoll stets. Den musste ich nehmen, um den Schichtwechsel um fünf Uhr dreißig zu schaffen. Wie von einem Sog erfasst, zogen in Dunkelheit oder Morgengrauen die Kolonnen vom Bahnhof zum einen Kilometer entfernten Werktor und verloren sich dahinter im grauen Gelände. Nach drei Monaten kapitulierte ich vor diesem Tagesrhythmus, verlegte meinen Schlafplatz nach Bitterfeld und bezog ein ansonsten leeres Vierbettzimmer im »Haus des Friedens«, in der »Straße der Technik«, Querstraße der »Straße der Nationen«, einem Barackenlager, Pullenkloster genannt. Sonntagabends lag man in den Fenstern und erbaute sich daran, wie die Polizei die Besoffenen angeschleppt brachte, auf dass sie am nächsten Morgen wieder an die Produktionsfront wanken konnten.
Die Arbeit war hart. Die Belegschaft, jede Schicht rund ein Dutzend Leute, bestand zum Teil aus Ex-Häftlingen auf Bewährung. Es war ihnen vorzeitige Entlassung angeboten worden, wenn sie einwilligten, einige Jahre in diesem Betrieb zu arbeiten. Sie durften die Fabrik nicht sehen, bevor sie unterschrieben hatten. Andere Kollegen waren wegen Fehlverhaltens für ein oder zwei Jahre zur Bewährung in die Produktion geschickt worden, darunter ein Lehrer, Alkoholiker. Ich verdanke ihm gute Gespräche über Kunst und Literatur des Nachts, wenn wir mit kundigem Griff den Fahrstuhl lahmgelegt und Ruhe hatten. Denn ohne den schweren, uralten Fahrstuhl konnte der Rohstoff, eine schwarze, humusartige, schwere Masse, nicht zu den Kesseln gebracht werden und die Produktion stand. Wir labten uns an Rilke, Benn und Georg Heym. »Verfall, Verflammen, Verfehlen in toxischen Sphären kalt« kommentierten wir mit Gottfried Benn die Industrieruine im Salzsäurenebel, in der wir zu klägen hatten. »Klägen« war im Anhaltinischen der abfällige Ausdruck für Schuften. Die Arbeit hieß »die Mistkläge«. Der Lehrer versah mich mit Kunst- und Kulturtheorie aus seinem Bücherschrank. Er schien mir nicht so unglücklich zu sein wie vordem in seinem Lehrerdasein; er musste sich hier seelisch





























