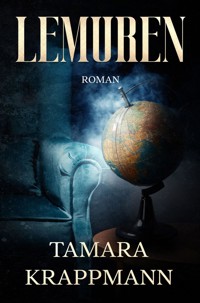
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Familienfeier im Winter: Geschlossene Räume, geschlossene Gesellschaft. Ungelöste Konflikte drängen sich auf, dunkle Geheimnisse inklusive. Wie starb Karl? Was wurde aus Lily? Stella und Gregor müssen durchhalten. Aber vielleicht können sie einander auch helfen, die Schatten der Vergangenheit abzustreifen. Ein Roman, eine Reise, eine ungewöhnliche Beziehung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lemuren
Über die Autorin
Tamara Krappmann, 1982 in Darmstadt geboren, ist studierte Literaturwissenschaftlerin und hat über die Namen in Uwe Johnsons »Jahrestagen« promoviert. Nach eineinhalb Jahrzehnten als Journalistin arbeitet sie nun für die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation. 2021 und 2023 zählte sie zu den Preisträgern der Riedbuchmesse Stockstadt.
Lemuren
Roman
Tamara Krappmann
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar.
© 2025 -Verlag, Altheim
Buchcover: Germancreative
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Mephistopheles
(Als Aufseher voran)
Herbei, herbei! Herein, herein!
Ihr schlotternden Lemuren,
Aus Bändern, Sehnen und Gebein
Geflickte Halbnaturen.
Lemuren
(Im Chor)
Wir treten dir sogleich zur Hand,
Und wie wir halb vernommen,
Es gilt wohl gar ein weites Land,
Das sollen wir bekommen.
Gespitzte Pfähle, die sind da,
Die Kette lang zum Messen;
Warum an uns den Ruf geschah,
Das haben wir vergessen.
Johann Wolfgang von Goethe: Faust II, 5 Akt., Großer Vorhof des Palasts
An die Korinther
Oma Marie war Stellas erste Leiche.
Marie sah kein bisschen so aus, als ob sie nur schlafen würde, aber trotzdem friedlich. Ihre Hände lagen bequem über dem Bauch gefaltet. Nicht wegen dieses toten Körpers fühlte Stella sich unwohl. Unter den Tränen, die ungefragt strömten, schielte sie nach der Familie.
Ihre Eltern und ihr Bruder weinten ebenfalls, mit gesenkten Köpfen: Als ob es falsch wäre, den Leichnam zu betrachten. Die Lippen ihrer Mutter bewegten sich stumm. Alle sahen etwas mitgenommen aus.
Nur Opa war an der Tür geblieben.
Stella musste den Kopf heben, um ihn zu betrachten. Opa stand hohlwangig da. Als er ihren Blick bemerkte, drehte er sich um und ging hinaus. Er floh in den kleinen Flur, in dem der Bestatter darauf wartete, dass die Familie den Besuch beenden würde.
Die Eltern zuckten beim Geräusch der Tür im Schloss zusammen, schauten, was es verursacht hatte, und wechselten, als sie es begriffen, einen Blick.
»Lasst uns gehen«, sagte Stellas Mutter.
Ihr Vater und Bruder bewegten sich folgsam. Stella machte auch einen Schritt. Aber nur zögernd. Ihr war gesagt worden, sie seien hergekommen, um sich von Oma Marie zu verabschieden. Sie fand nicht, dass sie das getan hatte.
Im letzten Moment, als alle anderen sich schon weggedreht hatten, strich sie mit der Hand über Maries gefaltete Finger. Sie wusste nicht recht, was sie erwartet hatte von der Berührung einer Leiche. Aber das Gefühl war das vertraute von Haut, eine menschliche Hand unter ihrer. Oma Maries Hand, nur eben kalt, als sei sie im Winter im Garten gewesen.
Vollkommen unerwartet war das eine Erleichterung. Stella begriff nicht wirklich, warum. Doch dank der flüchtigen Berührung war ihr der Abschied noch geglückt.
Dass Oma etwas Ähnliches gelungen war, erfuhr sie ein paar Wochen später, an ihrem dreizehnten Geburtstag. Marie hatte genau gewusst, dass sie bald sterben würde, und ihre Angelegenheiten geregelt. So kam es, dass ihre Enkelin noch einmal ein Geschenk erhielt, Maries allerletztes Geschenk an sie. Dazu gehörten eine kleine Schachtel und ein zartgrüner Briefumschlag, den Stella zuerst öffnete. Im Umschlag steckte eine Glückwunschkarte mit der vertrauten Handschrift. Links stand eine Widmung, rechts eine Nachricht.
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe höret niemals auf.
Mein liebes Sternchen,
ich wünsche Dir alles Gute und Schöne zu Deinem Geburtstag. Die Kette haben mir meine Großeltern geschenkt, als ich in Deinem Alter war. Vielleicht erinnert sie Dich an mich, wenn ich nicht mehr bin.
In nie endender Liebe,
Deine Oma Marie.
Stella konnte nicht behaupten, dass sie jedes Wort verstand. Beim Drehen der Karte fand sie auf der Rückseite dafür noch einen Nachsatz.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die Größte unter ihnen.
In der kleinen Schachtel ruhte auf Watte eine Kette. Drei winzige Figuren teilten sich am Anhänger die eine Öse, wurden von Stellas Fingern in die Höhe gehoben und legten sich ein wenig kühl auf die Haut zwischen ihren Schlüsselbeinen. Anfangs hatte sie Mühe mit dem Verschluss, aber das machte nichts. Ein zweites Mal musste sie ihn nicht mehr schließen.
Wiedersehen
Beinahe hätte Gregor seinen Bahnhof verpasst, weil es im Waggon so warm war. Fast wäre er eingeschlafen, den Kopf an die Scheibe gelehnt. In der vorigen Nacht hatte er außerdem vor Aufregung lange wach gelegen. Er wusste, dass das Unsinn war. Aber was half das Wissen, wenn man trotzdem nicht einschlafen konnte?
Erst, als der Zug mit einem Ruck ganz anhielt, schreckte er auf, erkannte den Namen des Bahnhofs und rappelte sich hoch. Dabei bestand kein Grund zur Eile, denn viele Passagiere wollten aussteigen. Im Korridor standen sie Schlange. Daher blieb Gregor Zeit, um zuerst sich und dann auch sein Gepäck zu sammeln: den Rucksack mit den Schlafsachen und den Kleidersack mit dem hellen Anzug, den er beruflich nie trug.
Als letzter in der Reihe trat er auf den Bahnsteig. Zeitgleich mit dem Schritt von drinnen nach draußen überfielen ihn zwei Eindrücke: die widerliche, nasse Kälte, mit Regen, der gerade so dick fiel, dass man nicht mehr von Nebel sprechen konnte. Und die Nervosität. Höchstens noch ein paar Minuten, bevor er Katharina treffen würde.
Er zögerte und schluckte.
Dann folgte er den anderen Passagieren aber doch zur Treppe, die auf die Galerie über den Gleisen führte. Zeit zu schinden änderte ja nichts.
Tatsächlich hatte er etwas Angst.
Dabei freute er sich sogar, Katharina bald zu sehen. Das war das Absurde daran: wie Angst und Freude sich vermischten. Die Freude galt Katharina, die Angst hingegen den Umständen. Die Umstände waren einfach schrecklich, wenn man die Vorgeschichte kannte. Wobei das vielleicht eine Frage der Perspektive war. Seiner Perspektive. Für Katharina konnte nichts Schreckliches dabei sein, ihn in ihrem Zuhause einzuquartieren. Nicht einmal am Vorabend ihrer Hochzeit. Schließlich hatte sie ihn dazu eingeladen.
Noch etwas abwesend nach seinem Nickerchen im Zug stieg Gregor hinauf zur Galerie. Oben war ebenso viel los wie vorher unten. Reisende strömten an ihm vorüber, gleichviele zu beiden Seiten. Als ob egal wäre, wohin man eilte. Weil Gregor zum ersten Mal an diesem Bahnhof war, wusste er nicht, wohin er gehen sollte. Die Masse gab ihm keine Richtung vor. Also blieb er dicht am Geländer stehen und wartete.
Eigentlich hatte er diese Reise schon absagen wollen. Weil allen Ernstes sein Hotel abgebrannt war. Die knappe E-Mail, der er das entnommen hatte, kam ihm so unglaubwürdig vor, dass er sofort nach den lokalen Nachrichten gegoogelt hatte. Tatsächlich fand er Fotos von Löschzügen und Rauch, der schwarz aus Fenstern quoll. Das hatte er als Zeichen genommen, obwohl er sich sonst nicht für abergläubisch hielt. Aber wenn ihm am Tag vor seiner Abreise die Unterkunft verloren ging, und das bei einem Anlass, den er lieber vermieden hätte … es fühlt sich wie ein Ausweg an. Und dann musste er eben anrufen: den Menschen, der ihn eingeladen hatte. Also Katharina. Die ihm sofort einen Schlafplatz anbot.
Mama ist aber auch da, hatte sie gesagt. Du musst auf der Isomatte schlafen. Das wäre vollkommen in Ordnung, erklärte er überrumpelt.
Tatsächlich war Gregor heilfroh darüber, dass seine Tante Lena ebenfalls im Haus sein würde. Durch ihre Anwesenheit erschien ihm seine eigene weniger seltsam. Lena öffnete den Rahmen für ihn. Und vielleicht würde sie ihn sogar vom Bahnhof abholen. Vielleicht würde er sie gleich in der Menge entdecken.
Um mehr zu sehen, hob er sich etwas auf die Zehenspitzen. Eigentlich war er nicht besonders klein, aber hier waren viele größer. Und alle liefen durcheinander, seltsamerweise ohne sich gegenseitig umzurennen.
Dann fand er sie: nicht Lena. Sondern Katharina. Wenn er nun dachte, sein Herz mache einen Sprung, dann kam ihm das klischeehaft vor, und furchtbar abgenutzt. Aber sein Herz machte einen Sprung. Katharina hatte einen Arm gehoben, damit er sie inmitten all der Menschen auch entdeckte. Ihre kupferroten Locken quollen unter einer weißen Mütze hervor. Vermutlich leuchtete sie nicht wirklich in der Menge. Nur für Gregor sah das so aus.
Sein Mund versuchte ein Lächeln, das sich ungeschickt anfühlte.
Gleich darauf war Katharina bei ihm und fiel ihm unbekümmert um den Hals. »Mein Lieblingscousin!«, rief sie in den Lärm. Dann hauchte sie ihm Küsschen auf die Wangen, eines links und eines rechts.
Das bedeutete nichts. So begrüßte Katharina beinahe jeden.
Trotzdem wurde Gregor warm. »Ich bin dein einziger Cousin«, erwiderte er lahm, weil das die notwendige Antwort war. Jeder hätte sie geben. Katharinas Gesicht war so dicht an seinem, dass er ihre Kontaktlinsen sehen konnte, das dünne Schimmern an den Kanten. Die meisten Mitglieder seiner Familie waren kurzsichtig.
»Das bist du«, gab sie lachend zu.
»Danke, dass du mich abholst.«
»Ist doch selbstverständlich.«
»Das finde ich eigentlich nicht.«
»Ach.« Katharina schwenkte eine Hand, um das Gespräch so zu beenden, hakte sich dann bei ihm unter und zog ihn in die Richtung fort, aus der sie gerade gekommen war. Sie verließen die Galerie und die Menge, verließen dann den Bahnhof, während Gregor all die Fragen beantwortete, die ankommenden Reisenden gestellt werden: wie seine Fahrt war, ob er müde sei und ob er schon gegessen habe. In der Zeit, die er dafür brauchte, überquerten sie eine Straße, über der der Regen dichter fiel, und betraten ein düsteres Parkhaus, in das Katharina unbekümmert hineinspazierte. Sie lachte ihn freundlich aus, als er das Parkticket bezahlen wollte.
»Die erste halbe Stunde ist doch kostenlos!«
Also konnte er ihr nur beim Entwerten ihres Tickets zusehen, mit zunehmend schlechtem Gewissen, weil er ihr für den Abholdienst nun nicht einmal die Parkgebühr erstatten durfte. Etwas benommen folgte er ihr zu einem weißen Berg von Auto.
»Ein SUV?«
»Da sieht man als Fahrer viel mehr«, behauptete Katharina. Neben dem Auto wirkte sie winzig. Sie war auch winzig, aber so fiel das noch mehr ins Auge. Gregor kniff ein Lächeln weg, und machte sich eine neue Vorstellung von Katharinas Leben. Einem Leben mit einem teuren Auto.
Nicht, dass es ihn überrascht hätte.
»Wie läuft euer Umbau?«, fragte er, nachdem sie beide eingestiegen waren.
Katharina schaltete das Radio ein und warf dann reih-um Blicke in alle Spiegel und auf das Bild der Rückfahrkamera. Erst dann fuhr sie sehr langsam aus der Parklücke.
Und erst danach gab sie Antwort. »Geht voran. In der Substanz sind wir fertig, mit den Leitungen und Fenstern und so. Aber die Zimmer oben darfst du dir noch nicht so genau ansehen. Nackte Kabel, die von der Decke hängen, solches Zeug.«
»Es gibt Schlimmeres«, sagte er tröstend.
»Bestimmt. Trotzdem wollten wir eigentlich vor der Hochzeit fertig werden.«
»Wann werdet ihr nun fertig?«
»Im Sommer«, sagte sie ohne Überzeugung. Dann öffnete sie ihr Fenster, streckte sich weit und stopfte mit Mühe das Ticket in den Automatenschlitz, damit sich vor ihnen die Schranke hob. Gleich darauf sprühte Regen auf die Karosserie. Draußen brannten die Straßenlampen und warfen weiche Schatten. Die Schatten der Tropfen auf der Scheibe sprenkelten Katharinas Gesicht, mit jeder Sekunde ein wenig mehr. Gregor sah zu und hielt den Atem an. Dann scharrten vor ihm die Scheibenwischer und strichen die Sprenkel weg. Nur Katharinas Sommersprossen blieben.
Da atmete Gregor aus. Bemerkte, dass er überhaupt den Atem angehalten hatte, und wurde rot. Zum Glück schluckte das tieforange Straßenlampenlicht alle anderen Farben, sodass Katharina nichts bemerken konnte.
Außerdem war sie beschäftigt. Scheinbar mussten nun all die Menschen, die eben noch den Bahnhof bevölkert hatten, dringend mit dem Auto fahren. Die Straßen waren mehr als voll. Gleich nach dem Parkhaus standen sie im Stau, die nächste Ampel noch ein gutes Stück voraus. Katharina hatte wohl nichts Anderes erwartet, denn sie lehnte aufgeräumt in ihrem Sitz und summte mit dem Radio. Ihre Finger schlugen den Takt aufs Lenkrad, ganz sacht, nur mit den Kuppen.
»Viel Verkehr hier«, bemerkte Gregor, nur um etwas zu sagen: weil er es nicht ertragen konnte, schweigend neben ihr zu sitzen. Würde er das versuchen, müsste er bald erneut die Luft anhalten. Und irgendwann müsste sie das doch merken. Oder nicht? Er wollte es nur ungern darauf ankommen lassen.
»Ach«, machte sie leichthin. »Ist immer so. Um die Zeit noch etwas mehr. Aber eigentlich: immer.«
Die Ampel schaltete auf grün. Sie schlichen ein paar armselige Meter vorwärts. Dann hieß es erneut warten. Der Motor des großen Autos zitterte. Er hätte ganz anders gekonnt, war hier, im Innenstadtverkehr, so schrecklich fehl am Platz. Beinahe tat er Gregor leid.
»Du musst mal schauen, wie du am Sonntag wieder herkommst«, fiel Katharina plötzlich ein. »Zum Bahnhof, meine ich. Ben und ich sind dann ja schon im Flugzeug. Vielleicht kannst du Lena überreden, dass sie dich bringt. Allerdings fährt sie den hier nicht gerne.«
»Zu groß?«
»Viel zu groß. Du weißt ja, was für Autos sie früher immer hatte.«
Gregor erinnerte sich deutlich an Lenas zweisitzige Cabrios und nickte. Auch unvernünftige Autos, auf ihre Weise. Aber jedenfalls viel kompakter. Nicht, dass er selbst mehr Platz benötigt hätte. Sein Gepäck verschwand auf dem Rücksitz. Selbst der Kleidersack ging völlig unter.
»Ich kann mit dem Bus fahren«, schlug er vor. Jenseits der Ampel querte eine Straßenbahn, die Fenster eine leuchtende Schlange. »Oder mit der da«, fügte er hinzu.
»Da wirst du schon den Bus nehmen müssen. Zu uns fährt keine Straßenbahn.«
»Okay. Dann den Bus.«
»Ich weiß aber die Zeiten nicht«, wandte Katharina ein. »Ich fahre nie Bus.«
»Wieso nicht?«
»Zu voll.«
Zweifelnd betrachtete Gregor den traurigen Verkehrskollaps rund um das SUV. Natürlich waren die anderen Fahrer weit fort, durch zwei Schichten Metall von ihnen getrennt. Das konnte man als Vorteil empfinden, die angenehmere Version von Immobilität.
Zum dritten Mal schaltete die Ampel vor ihnen um, und dank einer großzügigen Interpretation der Farbe Grün schaffte Katharina es diesmal über die Kreuzung mit den Straßenbahngleisen. Gleich darauf standen sie im nächsten Stau, vor der nächsten weit entfernten Ampel. Gregor hätte sich jedenfalls viel lieber den vollen Bus gequetscht, als in diesem Chaos selbst steuern zu müssen.
»Vielleicht kann ich auch Stella bitten, dich zu fahren«, nahm Katharina ihre Überlegung wieder auf. »Bestimmt macht sie das. Morgen fährt sie uns auch.«
»Uns?«
»Mama und dich und mich.«
»Wohin?«
»Na, zum Standesamt«, sagte Katharina lachend. »Wegen der Hochzeit?« Weil ihre Hände unbeschäftigt waren, hörte sie kurz auf, zum Radio zu trommeln und stieß Gregor locker in die Seite.
»Und was ist mit deinem Mann?«
»Der fährt mit seinen Eltern. Weil er mich doch nicht sehen darf.«
»Wenn du meinst.«
»Genau genommen übernachtet er schon bei ihnen«, fuhr Katharina fort. »Du triffst ihn also erst morgen.«
»Ach. Schade«, behauptete Gregor und hoffte inständig, dass er viel weniger erleichtert klang als er sich fühlte.
»Dafür schläft Stella bei uns. Sonst müsste sie total früh raus. Wohnt in der Stadt.« Das erklärte Katharina in einem Ton, als ob es überhaupt nur eine Stadt gäbe, in der man wohnen konnte.
»Und wer ist nun Stella?«, erkundigte sich Gregor.
»Na, Bens Schwester. Kennst du sie etwa noch gar nicht?«
»Nein«, gab Gregor zu. In Gedanken fügte er an, dass er nicht einmal Katharinas Ben kannte, außer von gestern, am Telefon. Da hatte Ben zuerst den Anruf angenommen Aber ein kurzer Wortwechsel: das war noch längst kein Kennen. Und erst recht nicht das von Angehörigen.
»So was«, sagte Katharina versonnen. »Du warst ja wirklich lange nicht mehr zu Besuch.«
»Stimmt«, bestätigte Gregor knapp. Mehr traute er sich nicht zu sagen, aus Angst, dass seine Stimme ihn verriet. Ahnte sie wirklich überhaupt nicht, dass er ihr aus dem Weg gegangen war? Und aus welchem Grund? Musste sie das nicht wissen?
Andererseits war Katharina nie eine gute Lügnerin gewesen. Sie war nicht berechnend und auch nie grausam gewesen, jedenfalls nicht mit Absicht. Und so, wie sie ihn von der Seite ansah, harmlos und einfach froh, ihn hier zu haben, konnte er auch nicht unterstellen, dass sich daran etwas geändert hatte. Also erinnerte sie sich an das, was zwischen ihnen geschehen war, wohl anders als er selbst. Oder zumindest bewerten sie ihre Erinnerungen unterschiedlich.
Gregor seufzte, so leise wie möglich. War das ein Grund zur Erleichterung? Das hätte es nämlich eindeutig sein sollen.
Stattdessen verspürte er vages Bedauern.
»Ab jetzt musst du uns häufiger besuchen«, forderte Katharina.
»Ja«, gab er zu. Wollte aber nichts versprechen, falls die Sache doch schiefging. Noch immer war das Arrangement ihm unheimlich. Wäre er Benjamin Greve, hätte er sich, also Gregor Lenz, jedenfalls nicht unter seinem Dach haben wollen. Erst recht nicht, wenn er selbst, also Ben Greve, sich zeitgleich unter einem anderen Dach aufhielt.
Wobei Ben Greve sicher auch nichts Böses ahnte.
»Wie gesagt, musst du nachher leider mit einer Isomatte Vorlieb nehmen«, erinnerte Katharina. »Das Haus ist ja nicht so groß, und wir sind sozusagen ausgebucht.«
»Das ist völlig in Ordnung«, versicherte Gregor rasch. Gleichzeitig hoffte er, dass sie weitersprach, damit er nicht mehr über ihren Freund nachdenken musste. Der, ab dem Folgetag, ihr Mann sein würde.
Und Katharina tat ihm den Gefallen. »Mama wohnt schon im Gästezimmer«, zählte sie auf, »weil sie anschließend für zwei Wochen bleibt. Sie hütet den Hund, während Ben und ich auf Hochzeitsreise sind. Und Stella schläft auf dem Sofa. Also gibt es nur noch die Isomatte. Ben hat aber die rausgesucht, die nicht immer Luft verliert.«
»Danke.«
»Und das Kinderzimmer ist auch noch total kahl. Noch nicht mal der Boden ist drin, nur Estrich. Aber ich habe dir eine Lampe reingestellt.«
»Das Kinderzimmer?«, hakte Gregor nach.
»Ah … mein altes Kinderzimmer«, sagte Katharina schnell. »Weißt du?« Dann hörte er einen tiefen Atemzug von ihr. »Ach, was soll’s. Du kannst das ruhig wissen. Im August habe ich meinen Termin.«
»Ihr bekommt ein Kind?«
»Aber sag’s keinem«, bat Katharina. »Außer Ben und Mama weiß das noch niemand.«
»Warum verrätst du es dann ausgerechnet mir?«
»Weil du mein Lieblingscousin bist. Habe ich das nicht vorhin schon gesagt?«
»Hast du. Und ich habe geantwortet ...«
»Klar, der einzige auch. Aber trotzdem: Lieblingscousin.«
»Ich verrate es keinem«, versprach Gregor schnell und versuchte, sich zu sortieren. Nun war er gerührt, wegen ihres Vertrauens. Und getroffen, von einer Information, die schwerer wog als eine anstehende Ehe. Noch etwas schwerer. Was sehr schwer war.
Inzwischen hatte der Wagen Fahrt aufgenommen. Der Verkehr wurde nicht gerade dünn, aber flüssiger. Offenbar verließen sie die Innenstadt. Gregor schaute nach draußen und sah Lichter hinter fremden Fenstern, ließ alles vor seinen Augen verwischen. Während er noch nach etwas Klugem suchte, was er zu seiner schwangeren Verwandten sagen konnte, einen Glück- oder Segenswunsch, hatte sie wieder das Thema gewechselt.
»Ich dachte echt, du würdest Stella kennen«, überlegte Katharina müßig. »Mit der war ich befreundet, bevor Ben und ich ein Paar wurden. Lange vorher. Tatsächlich war sie meine erste Freundin nach dem Umzug.«
»Dann wart ihr zusammen in der Schule?«
»Ja. In der Mittelstufe. Genau genommen hat sie deinen Job übernommen.«
»Welchen Job denn?«
»Mir die Hausaufgaben zu erklären.« Ohne hinzusehen, wusste Gregor, dass Katharina grinste. Er hörte es aus ihrer Stimme.
»Hat deine Stella das besser hinbekommen als ich?«
»Nö. Lag aber an mir.« Katharina lachte herzlich, was ihn schaudern ließ: ein Lachen wie eine Brise vom Meer, willkommen, trotz der Gänsehaut. »Mama war damals gleich begeistert von Stella«, fuhr sie dann fort. »Manchmal ist sie ein bisschen kühl, aber super schlau. Und super vernünftig. Mama dachte wohl, das könnte auf mich abfärben.« Noch ein Lachen. »Hat es aber nicht.«
»Dafür hast du einen Bruder von ihr abgestaubt.«
»Stimmt. Den auch«, gab Katharina zu.
»Was denn noch?«, erkundigte sich Gregor.
»Allerhand. Was glaubst du, was sie uns zur Hochzeit schenkt?«
»Deine Schwägerin? Keine Ahnung.«
»Was Teures.«
»Tafelsilber?«
»Nee.« Nun verzog Katharina den Mund, als hätte sie in etwas Saures gebissen. Auch das konnte er in ihrer Stimme hören. »Keine Großmutter-Geschenke.«
»Okay. Dann – ein Wochenende im Wellness-Hotel?«
»Wieder falsch. Lass gut sein, du kommst nicht darauf.«
»Ein Kaffee-Vollautomat.«
»Haben wir schon. Das Dach.«
»Hä?«, fragte Gregor wenig intelligent.
»Unser Haus. Sie hat das neue Dach bezahlt.«
»Ein Dach?«, wiederholte Gregor entgeistert und dachte dabei an den schmalen Umschlag in seinem Gepäck, der am nächsten Tag ein Geschenk werden wollte: eine Karte mit zwei Scheinen darin. »Wer verschenkt denn ein Dach?«
»Ben wollte das Geld dafür nur ausleihen. Sie hat es nämlich ziemlich dicke. Macht so eine Consulting-Sache. Und dann sagt sie: nö, geschenkt. Einfach so.«
»Wenn sie es so dicke hat ...«
Katharina lachte fröhlich und gab gleich darauf Gas. Sie konnte das, denn die Stadt hörte eben auf. Nach einer weiteren Kreuzung blieben die Häuser einfach zurück und wurden durch schwarzen Wald ersetzt. Sie fuhren vierspurig, wie auf der Autobahn, mit Blendschutz in der Mitte. Durch die höhere Geschwindigkeit schlug auch mehr Wasser auf die Scheibe, sodass die Scheibenwischer ebenfalls beschleunigten. Regensensor, dachte Gregor unzusammenhängend. Ein sehr teures Auto. Ein Dach. Sein Teil der Familie warf nicht so mit Geld.
»Ist halt ein spinniges Huhn«, fuhr Katharina freundlich fort. »Früher, in der Schule, hat sie immer gesagt, sie wollte eine Weltreise machen. Auf den Spuren von … ah, ich habe den Namen vergessen. Ein Engländer jedenfalls. Dafür hat sie gespart, wie verrückt. Meine einzige Freundin, mit der ich nie im Kino war. Weil sie die Karten zu teuer fand.«
»Ist doch okay, ein Ziel zu haben«, wand Gregor vorsichtig ein.
»Klar. Nur dass sie es dann nie gemacht hat. Und am Geld liegt das inzwischen nicht mehr.«
»Vielleicht doch, wenn sie anderen Leuten ihre Dächer bezahlt.«
Dieser Einwand brachte Katharina erneut zum Lachen. »Das wäre natürlich möglich.«
Ein paar Minuten lang fuhren sie schweigend. Die Situation wirkte nun gar nicht mehr gefährlich. Eher herzlich. Eigentlich fühlte Gregor sich sogar sehr wohl im Auto. Die Sitzheizung wärmte angenehm. Und Katharinas Gegenwart kam ihm natürlich vor. Vage besorgt stellte er sich die Frage, ob genau das die Falle sein konnte: dass er sich zu sicher fühlte. Dann schob er den Gedanken beiseite. Nun war er hier, und für die nächsten achtundvierzig Stunden würde das auch so bleiben.
Außerdem musste er, wenn es wirklich schiefging, ja nie wiederkommen.
Jenseits der Windschutzscheibe schalteten die Scheibenwischer noch ein bisschen hoch. »Scheißwetter«, fluchte Katharina. »Wer will denn bei dem Regen heiraten?«
»Warum macht ihr das überhaupt im Winter?«, gab Gregor prompt zurück: eine Frage, die er sich ohnehin gestellt hatte. »Warum nicht im Mai oder Juni?«
»Na, wegen dem Datum«, sagte Katharina ungeduldig, und ergänzte dann, als er verständnislos schwieg: »Valentinstag?«
»Trotzdem haben wir Februar.«
»Dann soll es schneien und nicht regnen« forderte Katharina trotzig.
»Lena kennt bestimmt ein Sprichwort dazu.«
»Das tut sie. Willst du es hören?«
»Na klar.«
»Regen auf dem Hochzeitskranz bringt Eheglück und Elternglanz.«
»Allerliebst.«
»Macht euch nur alle lustig«, murrte Katharina.
»Morgen wird es bestimmt besser«, versprach Gregor tröstend, und ohne jede Möglichkeit, dieses Versprechen einzuhalten. Trotzdem schien seine Cousine froh darüber, denn gleich darauf landete ihre rechte Hand auf seiner linken Schulter.
»Ist lieb von dir«, sagte sie zärtlich.
Von der Schulter her breitete sich Wärme aus, stärker als die der Sitzheizung. Über seinen Arm, den Rücken, die Brust. Zum zweiten Mal auf dieser Fahrt war Gregor froh und dankbar, dass niemand sehen konnte, wie er rot wurde. Weil Katharina ihm die Schulter tätschelte! Was, objektiv betrachtet, ziemlich albern war.
Nur: Wie, bitteschön, sollte er das objektiv betrachten können?
Vor ihnen endete der schwarze Wald und begann neue Ortsbeleuchtung. Sie fuhren unter Brücken, von denen eine Leitungsmasten für die Bahn trug, und Gregor überlegte, ob das wohl seine Strecke von vorhin sein konnte. Aber die musste nördlich liegen. Dann begann die Kleinstadt, die Katharina Heimat nannte. Nun seit wie vielen Jahren? Trotzdem dachte er immer noch an ihr neues Zuhause. Als ob sie gestern fortgezogen wäre.
Obwohl er früher manchmal zu Besuch gewesen war, erkannte er nichts wieder. Die Häuser kamen ihm beliebig vor, genauso wie die Supermärkte, die sich einen Parkplatz teilten. Gegenüber lag eine Brauerei. An die erinnerte er sich ebenfalls nicht, obwohl sie sicher schon lange dort stand. Mietsblocks folgten, dann Mehr-, dann Einfamilienhäuser. Längs ihrer Strecke wurde alles kleiner und enger. Außer den Vorgärten, die wuchsen: Erst gab es gar keine, dann dünne Streifen, dann echte Gärten mit Zäunen davor. Dann bog Katharina in eine Einfahrt, hielt unter einem Carport an und sagte vergnügt: »Da sind wir.«
Das Haus erschien ihm völlig fremd. Nie hätte er alleine hergefunden.
Auf dem kurzen Weg zur Tür versuchte er, im Schein der Hofbeleuchtung möglichst viel zu erkennen. Da stand ein einstöckiges Häuschen, weiß, mit dunklen Fensterrahmen. Schlicht, elegant und langweilig, so wie es der Mode entsprach. Erwartet hatte er ein buntes Haus, Lenas rote Fassade mit altmodischen Klappläden vor allen Fenstern.
Nur war das nicht mehr Lenas Haus.
Nachdenklich neigte Gregor den Kopf. Vielleicht kannte er Katharina nicht mehr richtig. Das war gut möglich, nach all den Jahren.
Im Inneren des Hauses kam Unruhe auf. Hinter dem Milchglaseinsatz der Haustür zeichnete sich ein Schemen ab, auf Kniehöhe und goldgelb. Dann blaffte es einmal kurz.
»Gawain!«, mahnte Katharina durch die Tür, während sie nach dem Schlüssel suchte. »Aus!«
An ihrer Seite zog Gregor die Brauen zusammen. »Ich dachte, euer Hund heißt Lancelot?«
»Ach, du!«, rief Katharina amüsiert. »So lange leben Hunde doch nicht! Lancelot ist schon ewig tot. Im Garten liegt er, unterm Flieder.«
»Und nun habt ihr einen anderen Tafelritter. Der nächste heißt dann wohl Galahad?«
»Was?«
Katharina guckte so verwirrt, dass Gregor für einen Moment vermutete, sie wüsste wirklich nicht, wovon der redete. Was möglich war, bei Katharina. Aber dann bekam sie die Kurve und lachte. »Nein, das ist Zufall. Die hießen beide schon so.«
»Was für ein Züchter macht denn sowas?«
»Du wirst es kaum glauben, aber das waren zwei verschiedene Züchter.«
Sobald sie die Tür öffnete, drängte sich der Hund begeistert gegen Katharinas Beine. Weil seine Brille sofort beschlug, sah Gregor von ihm kaum mehr einen gelben Fleck. Ergeben nahm er die Brille ab und schwenkt sie ein bisschen, damit die Gläser schneller wieder klar wurden. Solange das dauerte, betrachtet er den Flur, der für ihn in Unschärfe verschwand. Eigentlich ein netter Effekt, wie Weichzeichner auf einem Foto. Jedenfalls sah der Flur nicht aus, als sei er noch im Bau befindlich. Keine nackten Kabel, die von der Decke hingen. Und er sah bestimmt nicht aus wie Lenas alter Korridor mit den grasgrünen Wänden.
Bei Lena war immer alles knallbunt gewesen. Abgestimmt, mit System und Geschmack, aber leuchtend. Hier leuchteten nur noch die Lampen, und zwar indirekt, gegen die Decke. Auch das mit System und Geschmack. Aber vollkommen anders. Gregor sah Grau und Anthrazit und Weiß, letzteres an der Decke. Außerdem Bilder mit roten Akzenten, die er für Kunstdrucke hielt. Der Flur hätte zu einem Büro führen können, oder zu einer Kanzlei. Vielleicht empfing Ben Greve manchmal Klienten in seinem Haus? Wahrscheinlich war das aber nicht der Fall. Viel eher gefielen diese Nicht-Farben ihm und Katharina wirklich. Der aktuelle Trend zum Reduzierten. Das dezente Grau.
»Wie findest du’s?«, fragte Katharina wie aufs Stichwort.
»Elegant«, antwortete Gregor, und verschluckte die beiden Adjektive, die seinen ersten Eindruck komplettiert hätten. Wozu sollte er seine Cousine ärgern? Trotzdem beschloss er insgeheim, dass Lenas Version des Hauses ihm besser gefallen hatte. Dann setzte er die beinahe klare Brille wieder auf, hängte den Kleidersack an die Garderobe und ging anschließend in die Knie, um sich vom Tafelritter beschnuppern zu lassen.
»Katha? Seid ihr das?«, fragte Tante Lenas Stimme aus der Richtung, in der sich Gregor an eine Küche erinnerte.
»Ja«, rief Katharina zurück.
»Essen ist fertig!«, verkündete Lena. »Ihr habt hoffentlich Hunger.«
»Natürlich!«, behauptete Katharina, und erklärte dann ihrem Cousin mit gesenkter Stimme: »Mama kocht jetzt nämlich.«
»Wirklich? Seit wann das denn?«
»Seit sie ihre Praxis aufgegeben hat. Rentner-Hobby.« Katharina grinste frech. »Und natürlich kocht sie sensationell. Jetzt, wo ihr danach ist.«
»Na, dann«, sagte Gregor und dachte unwillkürlich an die Konserven und Mikrowellengerichte, von denen seine Tante und Cousine sich jahrelang ernährt hatten. Oder von Rohkost. Dazwischen: nichts.
»Dann komm mal mit«, sagte Katharina, und erst da bemerkte Gregor, dass er noch immer in Mantel und Schuhen ganz vorne in der Diele hockte. Und zwar alleine, denn der Hund hatte beschlossen, zurück in die Küche zu trotten. Also stand Gregor auf und legte ab. Katharina wartete geduldig auf ihn.
Auch die Küche war vollkommen anders als die, an die er sich erinnerte. Keine orangen Wände, sondern auch hier Stufen von Grau. Außerdem rote Hochglanzfronten. Der Raum war deutlich größer als zuvor, weil nun die Wand zum Wohnzimmer fehlte. Dafür gab es einen Kaminofen, vor dem Gawain auf einer behaarten Hundedecke lümmelte. Und eine Fläche Außenwand war auch verschwunden: dort, wo er die Terrassentür erinnerte. An ihrer Stelle drückt sich Schwärze großflächig gegen Glas. Vermutlich war das eine Form von Wintergarten, dachte Gregor, und wäre es Sommer und hell, dann würde dahinter der Garten blühen, mit all seinen Sträuchern und Stauden und dem großen Baum in der Mitte. Vermutlich sähe das sehr hübsch aus und als ob man beim Essen im Freien säße. Denn vor der Scheibe stand ein Tisch aus rotglänzendem Holz, fertig gedeckt für Vier. Die Spiegelung im Fensterglas zeigte alles noch einmal: den Tisch, von dem Lena gerade aufstand, um ihn zu begrüßen, Katharina und ihn selbst, mitten im Raum.
Und Lily, die bewegungslos vor ihrem Gedeck saß.
Liska und Jóska
Liska erwacht stets früh. Obwohl sie derzeit kein Kind hat, das nachts Milch von ihr fordert, fällt es ihr schwer, durchzuschlafen. Sie hat es mit dem zweiten oder dritten Kind verlernt. Nie hätte sie erwartet, einmal Mutter zu sein. Mit Kindern konnte Liska früher gar nichts anfangen. Nun hat sie vier davon. Und sie liebt ihre Kinder, jedes einzelne: nicht als Kinder, sondern als andere Menschen. Menschen mit wenig Lebenserfahrung. Aber das gibt sich von selbst, mit der Zeit.
Sie hält es für möglich, dass weitere Kinder dazukommen werden. Liska braucht keine weiteren Kinder. Allerdings kann sie Jóska keinen Wunsch abschlagen, denn sie liebt Jóska nun einmal von ganzem Herzen. Und Jóska wünscht sich viele Kinder, eine große, große Familie. Jóska war der Erste, der sie Liska nannte. Sie war sofort davon begeistert. Denn Liska und Jóska – das klingt für sie so, als seien sie für einander gemacht.
Irgendwann, nach dem fünften oder sechsten Erwachen, gibt Liska nach, steht auf und geht hinaus. Gut möglich, dass Jóska dann ebenfalls wach ist. Liska geht hinaus und füttert die Tiere. Oft ist es noch dunkel, wenn sie das tut. Sie füttert die Hühner und füttert die Schweine. An den Geruch der Schweine musste sie sich erst gewöhnen, er war ihr anfangs unangenehm. Nun verbindet sie ihn mit Heimat. Vor allem füttert sie die Kühe, denn davon besitzen sie viele. Die Kühe müssen außerdem gemolken werden. Liska und Jóska betreiben eine Milchwirtschaft.
Anfangs wusste Liska gar nicht, wie man es anstellt, eine Kuh zu melken. Sie hatte keine Ahnung, wie die Melkmaschine funktioniert. Anna musste ihr erst alles zeigen. Anna ist Jóskas Mutter, und sie hatte mit Liska viel Geduld. Anfangs hat Liska lange gebraucht, bei jeder noch so einfachen Arbeit. Inzwischen geht ihr das Melken leicht von der Hand, ebenso wie das Misten. Ihre Hände wissen selbst, was sie dazu tun müssen. Inzwischen ist es Liska, die den Großteil der Arbeit in den Ställen erledigt, denn Anna muss immer mehr Pausen einlegen. Langsam ist sie geworden, und irgendwann wird sie gar nicht mehr mithelfen. Das macht aber nichts. Liska ist ihr nicht böse. Sie liebt ihre Anna für alles, was sie getan hat.
Außerdem machen die Kinder mit. Und zumindest die Großen sind schon eine Hilfe, können selbstständig füttern und melken. Die beiden Kleinen geben ihr Bestes, es ist eben noch wenig. Sie streuen Körner für die Hühner und freuen sich über ihr Picken. Alle helfen morgens im Stall. Alle, außer Jóska. Im Winter hilft er vielleicht mit. Sonst ist er aber für die Felder zuständig, und zwar alleine, seit sein Vater Jakub tot ist. Manchmal, wenn es zu viel wird, springt Liska ein und geht ihm dort zur Hand. Sie kann die großen Landwirtschaftsmaschinen fahren, so wie er. Aber die Tage werden lang, wenn sie auch auf die Felder muss. Sie tut es dennoch, denn die Tiere brauchen Heu und Futtermais. Irgendwann, wenn die beiden Großen alt genug sind, dann werden sie an Liskas Stelle Jóska auf den Feldern helfen. Liska wird dann in den Ställen ohne ihre Hilfe auskommen müssen. Aber bis dahin werden ihre Kleinen alt genug sein, um bei den Tieren zu nützen. Und vielleicht wird es sogar neue Kleine geben, die für die Hühner Körner ausstreuen und sich darüber freuen, wie sie picken.
Erst dann, wenn jedes Tier gefüttert und jede Kuh gemolken ist, geht die Familie in die Küche, und Anna macht für alle Frühstück. Liska hilft ihr nur dabei. Nach wie vor ist es Annas Küche, aber Liska gefällt genau das. Eigentlich liegt ihr wenig am Kochen. Trotzdem hat sie alle Rezepte gelernt, die Anna von ihrer Mutter kennt. Denn Jóska liebt Annas deftige Küche, und Liska liebt nun einmal Jóska.
Beim Frühstück fragt Anna sie nach den Wörtern, von denen sie denkt, dass sie Liska noch fehlen. Inzwischen kennt Liska aber die meisten und kann die richtigen Antworten geben. Anfangs war das vollkommen anders. Als Jóska sie damals nach Hause brachte, sprach und verstand sie kein Wort Ungarisch. Alles Ungarisch, das sie nun kennt, hat Anna ihr geduldig beigebracht. Anna ist sehr zufrieden mit ihr, und manchmal sagt sie, dass Liska klingt wie eine echte Ungarin. Das ist eine freundliche Lüge, Liska weiß es genau. Aber sie freut sich doch darüber. Außerdem hält sie selbst ihr Ungarisch für ziemlich gut. Längst hat sie keine Scheu mehr, ans Telefon zu gehen. Liska ist von Natur aus alles andere als scheu, aber das Telefon war lange schwierig: die fremde Sprache nur gehört, ohne den Sprecher sehen zu können.
Als Liska Jóska zum ersten Mal getroffen hat, mussten sie miteinander Englisch reden, das beide schlecht beherrschten. Beide waren zudem unglaublich jung, Jóska aber immerhin alt genug für seinen Führerschein: sodass er bremsen konnte und an die Seite fahren und anhalten für das Mädchen mit dem erhobenen Daumen. Liska hatte damals nicht mehr als ein paar Münzen in der Hosentasche und einen trotzigen Blick im Gesicht. Weil sich ihr erstes Treffen außerhalb Ungarns abspielte, sprach er sie gleich auf Englisch an.
»This is a very bad idea, girl.«
»Will you take me with you?«
Sie erinnert sich an die steile Falte, die sich bei dieser Frage zwischen ihren Augenbrauen bildete, das Gefühl der angespannten Muskeln in der Stirn. Sie erinnert sich auch an die Gefühle von Entschlossenheit und Unsicherheit zugleich: das eine über ihre Absichten, das andere über ihn. Sie muss ihn also böse angesehen haben. Er aber fand es lustig. Er mochte sie gleich gerne.
Und sie ihn ebenso.
Manchmal, wenn sie ein paar Minuten übrig hat, betrachtet Liska ihren Jóska und fragt sich, wie so viel Glück nur sein kann. Dann denkt sie sich in der Zeit zurück und tastet mit ihren Gedanken entlang der Bruchkante ihrer Vergangenheit. Ein Mensch, aber zwei Leben. Wie leicht ihr der Wechsel vom einen ins andere gefallen ist! Manchmal erinnert sie sich an das frühere, verwaiste Leben zurück und fragt sich, was daraus geworden sein mag. Aus den Menschen darin, ihrer alten Familie.
Jóska, Anna und Jakub haben natürlich auch gefragt: woher sie kam, wohin sie wollte. Die erste Frage hat sie nie beantwortet, die zweite aber sofort: »Zu euch!« Da haben Jóskas Eltern gelacht, und Jóska hat sie auf den Scheitel geküsst. Er kann das, so groß ist er nämlich. Danach haben die drei Liska nicht mehr gefragt, und wenn Anna sie ab und an nachdenklich ansieht, ist das in Ordnung, denn sie behält ihre Fragen für sich.
Manchmal, wenn Liska zum fünften Mal aufwacht, obwohl keines der Kinder Milch will, und es ihr schwerfällt, wieder einzuschlafen, dann steht sie auf und schreibt an einem Brief. Im Lauf der Zeit hat Liska schon viele Briefe geschrieben, die eigentlich immer neue Versionen desselben Briefes sind. Gleich nach ihrer Hochzeit mit Jóska. Nachdem Jakub gestorben war. Nach ihrem ersten Kind, dem zweiten. Nach jedem Kind. Einen ganzen Stapel Briefe hat sie geschrieben, aber nie einen davon abgeschickt. Sie weiß nicht, ob die Adresse noch stimmt oder ob ihre Eltern fortgezogen sind. Aber es ist nicht das, was sie abhält.
Was sie sicher weiß, ist, dass ihr Bruder nun unter neuer Adresse lebt. Sie kennt sie nicht, er fehlt im Telefonbuch. Aber sie hat im Internet einen Eintrag zu seiner Arbeit gefunden, die Adresse des Unternehmens, bei dem er angestellt ist. Es ist zu weit fort von daheim, um zu pendeln.
Durch seinen Arbeitgeber besitzt sie eine gültige E-Mail-Adresse. Sie könnte ihm also jederzeit schreiben. Oder ihn anrufen. Das ginge auch. Sie hat die Nummer sogar aufgeschrieben. Aber sie hat sie nie gewählt. Der Zeitpunkt, sie zu wählen, ist noch nie gekommen. Und auch die Zeit, um einen Brief zu schicken, nicht.
Aber sie könnte kommen. Irgendwann. Vielleicht. Vielleicht mit dem nächsten Kind.
So stellte sich ihr Bruder Lilys Leben manchmal vor.
So könnte Lily vielleicht leben.
Schnee
Als Stella aufwachte, wusste sie gar nicht recht, warum. Also blieb sie reglos liegen und erinnerte sich daran, wo sie war und weshalb sie nicht in ihrem eigenen Bett schlief, auf ihrer eigenen Matratze. Bens Sofa war besser, gut gepolstert und neu. Darauf hätte sie Ruhe finden können.
Dann waren es vielleicht die Geräusche im Haus. Sie lauschte mit geschlossenen Augen. Ihre Mietwohnung war ein Altbau, wie dieses Haus, aber viel schlechter isoliert. Dort würden nachts die Heizungsrohre knacken, gleich neben ihrem Kopf. Längst empfand sie das als beruhigend, als Ausdruck von Wärme, obwohl es einen Mangel bezeichnete. In der Küche würde regelmäßig die Zündflamme in der Gastherme knacken. Etagenheizung, auch nicht mehr modern. Und durch die Scheiben, Doppelglas, aber aus der Geburtsstunde des Doppelglases, drängten die Laute der Stadt herein. Da wären also Martinshörner, wegen der beiden Kliniken in Hörweite. Dann generell Motoren. Und, wenn ein Auto vor dem Haus vorüberfuhr, das Rumpeln der Reifen auf Kopfsteinpflaster. Sonst gab es kaum Geräusche, wenigstens im Winter. Im Sommer konnten gegenüber beim Café abends noch Gäste sitzen und sich unterhalten. Morgens dann gleich wieder. Geöffnet wurde um acht, und obwohl vor allem Studenten kamen, zählten auch ein paar Alte zum festen Stamm: die Witwen und die Einzelgänger aus der Nachbarschaft, die wenigstens ihr Frühstück in Gesellschaft nehmen wollten.
Manchmal gehörte sie auch dazu.
Die Geräusche hier waren vollkommen anders. Keine entfernten Martinshörner, und Knacken nur vom abkühlenden Kaminofen. Dafür Atemgeräusche von Gawain, manchmal mit schmatzendem Schnaufen vermischt. Möglich, dass der Hund träumte. Während Stella ihm zuhörte, versucht sie, sich zu erinnern, wann sie zuletzt in einem Raum mit fremden Atemzügen geschlafen hatte. Das musste eine Weile her sein; ihr wollte nicht einfallen, wie lange.
Aber der Hund hatte sie nicht geweckt.
Stella seufzte und drehte sich, vom Rücken auf die Seite. Suchte Schlaf. Der schien wie fortgewischt. Sie war hellwach, ohne den Grund zu kennen. Blind tastete sie nach ihrem Smartphone, öffnete die Wimpern weit genug, um überhaupt etwas zu sehen und warf, derart geschützt, einen raschen Blick auf die Zeitanzeige. Die Ziffern blendeten sie trotzdem und zeigten kurz nach fünf.
Das war zu früh.
Aber sie war so wach! Und nicht wegen der Hochzeit. Der Tag würde lang werden und anstrengend, möglicherweise sogar schön. Dafür wie dagegen konnte sie nichts tun, nur warten, bis es eintrat.
Nachher würde sie Katharina unterhalten, wenn die Friseurin ihr die Haare machte, und ihr an ihrem Spitzenkleid die vielen kleinen Knöpfe schließen, die überm Rückgrat abwärts liefen. Sie würde ihr eigenes Kleid anziehen, das einzige Stück ihrer Garderobe, das weder schwarz noch weiß war, extra für diesen Tag gekauft und für den Februar zu dünn, und die zu schmalen Schuhe, die dazu gehörten. Sie würde freundlich für Fotos lächeln und sich mit Kuchen vom Buffet vollstopfen. Sie würde ihrem Bruder und ihrer Freundin das Allerbeste für die Zukunft wünschen und das vollkommen ehrlich meinen. Sie würde alle chauffieren, hin und her. Und dann würde sie heimgehen und weitermachen wie zuvor.
Davon lag sie nicht wach.
Vielleicht war der Grund also doch der Cousin, der nun ein Stockwerk höher schlief. Dort hatte Katharina ihn einquartiert, in ihrem alten Zimmer, das derzeit eine Baustelle war. Stella kannte den aktuellen Stand genau, denn gemeinsam mit Ben hatte sie dort erst vorgestern die Wände gestrichen. In drei Wochen, nach dem Honeymoon, wollten sie dann den neuen Boden legen. Jetzt aber lag dort nur ein Schlafsack auf einer dünnen Luftmatratze, und darauf Gregor Lenz. Der sie so seltsam angesehen hatte: wie ein Gespenst. Also entsetzt. Und dann, beim Abendessen, vorzugsweise gar nicht mehr, oder, wenn doch, mit kurzen, scheuen Blicken. Als ob sie ihm etwas getan hätte. Normalerweise hätte sie geradeheraus nach dem Grund gefragt. Nur wegen Katharina hatte sie es dann gelassen, denn ihr lag offensichtlich viel an dem Verwandten.
Trotzdem.
Gereizt drehte Stella sich nochmals um, von der Seite auf den Rücken. Dann öffnete sie die Augen und schaute zur Decke, die im Moment für Gregor Lenz den Boden darstellte. Die Decke war weiß und eigentlich leer. Nur in ihrer Mitte hing eine Lampe, und die warf einen langen Schatten, wegen der Straßenlaterne draußen. Das war so wie bei ihr zuhause.
Außerdem gab es graue Schemen, die langsam übers Weiße glitten. Weiche, unscharfe Schatten, kaum dunkler als das Weiß, erkennbar nur durch die Bewegung. Das begriff Stella nicht gleich und starrte daher reglos, in dem Versuch, das Schauspiel zu enträtseln. Ein Stück entfernt, am kalten Ofen, japste Gawain im Schlaf, und da holte sie Luft und setzte sich gerade auf. Sitzend blickte sie auf die Fenster, die nach vorne zur Straße gingen.
Jenseits der Scheiben schneite es. Schnee schwebte in schnurgeraden Bahnen abwärts, wie in Zeitlupe. Kein Wind ließ ihn trudeln. Die Flocken fielen groß und dicht, ein Effekt aus einem Film. Es musste wirklich einer sein, denn hier schneite es nicht. Das dachte sie in Worten: Hier schneit es doch nicht! Nicht in dieser geschützten Tallage. Und wenn doch, dann nur dünn, in einer Puderschicht. Solange sie sich erinnern konnte, durch ihre ganze Kindheit, gab es in jedem Winter immer nur ein paar Tage Schnee, gerade genug, um ihn wegzufegen.
Ungläubig stand Stella vom Sofa auf und ging hinüber zum Fenster. Wie magisch angezogen: Wenn sie das jemals sagen durfte, dann jetzt, in diesem Moment. Der Schnee zog sie an, magisch oder magnetisch. Jedenfalls konnte sie sich ihm nicht widersetzen, ging auf Socken bis zum Fenster und öffnete es in derselben Bewegung.
Draußen stand die Luft so still, dass sie zuerst gar keine Kälte spürte. Dabei war die Temperatur stark gefallen, die Luft roch scharf nach Eis. Längst waren Vorgarten und Straße weiß. In tiefen Zügen atmete Stella den ganz besonderen Geruch des Schnees, lauschte auf das feine Zischen, mit dem die Eiskristalle aufeinander aufsetzte. Streckte eine Hand aus und fing ein paar Flocken, die sie von ihrer Handfläche aufleckte. Schmeckte Schnee. Und wusste mit einem Mal vollkommen sicher, dass er sie aufgeweckt hatte.
Solange blieb sie stehen, bis sie fror, gebannt von all der absichtslosen Schönheit. Und dann noch eine Weile länger. Und noch einmal für ein paar Atemzüge: bis sie tatsächlich Angst bekam, sich zu erkälten, und das Fenster sachte zurück in den Rahmen drückte. Im Zimmer hatte Katharinas Hund den dicken Kopf gehoben und schaute sie staunend an. Der fragte sich, warum sie Kälte an seinen warmen Schlafplatz ließ.
»Sorry, Gawain«, entschuldigte sie sich und erntete dafür ein einzelnes Klopfen, ein müdes Schwanzwedeln, bevor er wieder einnickte.
Stella dagegen war noch wacher als vorher. Hellwach und durchgefroren, sodass nun wirklich keine Aussicht mehr auf Schlaf bestand. Außerdem ging es auf halb sechs zu. Also schlich sie hinüber in die Küche, was keine Kunst mehr war, seitdem die Wand fehlte, und musterte die versammelten Geräte. Der sündhaft teure Kaffeeautomat glänzte silbrig im Dämmerdunkel. Schaltete sie ihn ein, dann würden daran blaue Lichter blinken. Aber das Mahlwerk verursachte Höllenlärm. Und außerdem fühlte der Tag sich noch zu früh an für Kaffee. Vor sieben Uhr war, wenn überhaupt, die passende Zeit für Tee.
Während sie Katharinas Küchenschränke untersuchte, halb tastend, weil sie kein Licht machen wollte, warf Stella immer wieder schnelle Blicke aus den Fenstern. Auf dieser Seite des Hauses war es dunkler als nach vorne zur Straße. Dennoch blieb genügend Licht, und der Schnee verstärkte es. Daher hatte sie freien Blick in den Garten. Nach wie vor fielen die dicken Flocken, als würden sie das ewig tun. Stella wusste, dass das nicht stimmen konnte, dass der Schnee bald dünner fallen und dann ganz damit aufhören müsste. Und am Boden schmutzig werden und allmählich tauen.
Aber vielleicht, mit sehr viel Glück, lag er vorher lange genug: bis zum Mittag oder zum Nachmittag. Immerhin wäre das möglich. Beinahe kam es ihr so vor, als würde das Schneien davon abhängen, dass jemand ihm aufmerksam zusah, um es angemessen zu würdigen. Dass sie das tat. Denn schließlich war sie dafür aufgewacht.
»Du spinnst«, flüsterte sie sich selbst zu. Flüsterte tatsächlich. Daheim tat sie das nicht. Da redete sie auch laut mit sich. In diesem Haus dagegen mochte sie nicht stören. Schließlich hielt sie sich hier als Gast auf.
Noch immer erschreckte sie dieser Gedanke.
Mit ihrem frisch gebrühten Tee setzte sie sich an den großen Esstisch, von wo aus sie den besten Blick ins Freie genoss. Ihre Decke um die Schultern, beide Hände um die Tasse, schaute sie in den großen Garten, der nun ein Scherenschnitt aus Schwarz und Weiß war. In seiner Mitte hielt der Kirschbaum Winterruhe, groß, wie er es in ihrer Erinnerung immer war, gebrochen, wie er es nach all den Jahren dennoch nicht sein sollte. Jedes Mal, wenn sie in diesem Haus war, musste sie den Baum betrachten. Sie sah dabei gar nicht die Äste, die tatsächlich da waren, sondern den starken Ast, der fehlte. Sah ihn vor sich, samt der verschwundenen Kinderschaukel.
Der Schnee ließ den Baum gar nicht freundlicher scheinen.
Nachdenklich nippte Stella am Tee. Der schmeckte herb und wurde langsam kühler, während hinter dem Haus das Schneien nachließ. Und während unendlich langsam Licht herankroch, zuerst grau und dann taubenblau, abkippend in ein intensives Violett. Also würde die Sonne aufgehen: wirklich die Sonne. Sonne über Schnee. Was Tauwetter bedeuten konnte, oder Postkartenidylle. Vielleicht auch erst das eine, dann das andere, überlegte sie. Nur in der umgekehrten Reihenfolge.
Irgendwann, nach sehr langer Zeit, als ihr der Küchenstuhl schon unbequem wurde, ließ ein Geräusch sie aufhorchen. Genau genommen war es anders: Ein Geräusch ließ Gawain aufhorchen, und dadurch, dass er seinen Kopf hob und in der Kehle brummte, bemerkte Stella eine Bewegung und wandte sich der Küchentür zu.
»Guten Morgen«, grüßte Lena. »Auch schon wach?«
»Siehst du ja. Guten Morgen.«
»Willst du dir gar kein Licht anmachen?«
»Doch, mach ruhig Licht.« Stella lehnte sich zurück und streckte die Schultern. Dann muss der Schnee eben ohne sie auskommen. Und sie musste ohne den Schnee auskommen. Oder, vielmehr: Sie musste ihn teilen. Denn natürlich ging Lena als erstes zur Scheibe.
»Wunderschön, nicht?«
»Das ist er.«
»Und wie bestellt.«
»Hast du ihn bestellt?«
»Natürlich!« Lena lachte lustig. Das konnte sie gut. Wenn sie lachte, freute sich alles mit ihr: das Zimmer, die Möbel, der Hund Gawain. Der wedelte sogar mit dem Schwanz, diesmal mit viel Elan. Lena wirkte grundsätzlich ansteckend.
»Möchtest du auch einen Tee?«, fragte Stella und zeigte auf ihre leere Tasse.
»Was für einer ist das?«
»English Breakfast.«
»Gerne.«
Also streifte Stella die Decke ab und kochte noch einmal Wasser für zwei, während Lena sich eine eigene Tasse und dazu zwei neue Teebeutel holte. Dann saßen beide am Küchentisch und schauten dem Morgen beim Anbrechen zu.
»Glaubst du, er bleibt liegen?«, fragte Lena. Ihr Blick verweilte auf dem Flieder, der gleich jenseits der Scheibe wuchs und nun Schneekappen trug.
»Bestimmt nicht lange.«
»Mein Mädchen wird begeistert sein. Stell dir die Fotos vor!«
»Ich weiß nicht. Sieht man eine Braut auf weißem Grund denn überhaupt?«
Lena kicherte albern. »Die roten Haare wird man schon sehen!«
»Stimmt«, gab Stella grinsend zu. Sie konnte gar nicht sagen, wie gerne sie Lena hatte. Was ihr selbst ein wenig merkwürdig vorkam, weil Lena doch die Mutter einer Freundin war. Genauso gut hätte sie aber eine Tante sein können, oder auch einfach eine Freundin mehr.
Die Augen dieser Freundin warfen einen skeptischen Blick auf die Küchenuhr. »Nun müssen die beiden da oben aber auch langsam aufstehen«, mäkelte Lena. Offenbar war sie nicht geneigt, Tochter und Neffen persönlich zu wecken.
»Die kommen schon«, tröstete Stella. Ihrerseits hatte sie keine Eile, dem seltsamen Herrn Lenz schon wieder zu begegnen.
»Ich habe eine Bitte«, sagte Lena wie aufs Stichwort. »Kannst du dich nachher auf der Feier ein bisschen um Gregor kümmern? Er kennt hier ja gar niemanden.«
Stella verzog das Gesicht. Sie wollte das überhaupt nicht; es geschah einfach. Und Lena sah es natürlich.
»Was?«, fragt sie.
Ein bisschen wand sich Stella, aber sie musste ja antworten. »Ich denke nicht … dass wir besonders harmonieren.«
»Harmonieren?«, hakte Lena nach und klang nun doch sehr mütterlich, auf inquisitorische Weise.
»Er hat mich gestern so schräg angesehen«, verteidigte sich Stella. Dabei hörte sie selbst, wie dumm das klang. Als wären sie beide Grundschüler.
»Stella«, erwiderte Lena tadelnd. »Das liegt doch wohl nicht am Beruf?«
»An welchem Beruf denn?«
»An seinem.«
»Ich weiß gar nicht, was er arbeitet.«
»Er ist Bestatter«, erklärte Lena.
»Na und?«, fragte Stella verwirrt.





























