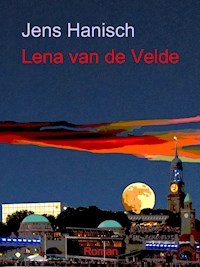
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lena zeichnete mit ruhiger Hand. Schweigsam beobachtete ich sie, folgte den Bewegungen ihrer Hand, dem Kohlestift, wie dieser über das leere Blatt Papier glitt und die offenbare Gleichgültigkeit dieses Moments der Gegenwart aus der Hand nahm und der Zukunft, der Geschichte übereignete. Es schien, als sei sie aus der Wirklichkeit gestiegen in eine Parallelwelt, eine vierte Dimension, jenseits der Gewöhnlichkeit, abseits allgemein geltender Normen, und sprach kein Wort. Hamburg. Mit dem Rüstzeug seiner Eltern ausgestattet, begegnet Jan während seiner ersten Schritte in Unabhängigkeit Lena, der Tochter eines wohlhabenden hanseatischen Kaufmanns. Eine einzige Nacht mit ihr genügt, sein Selbstvertrauen auf mysteriöse Weise zu erschüttern. Schutzlos wähnt er sich seiner Besucherin gegenüber ausgeliefert. Rückblickend sucht er nach einer Erklärung und beschreibt die unterschiedliche Wahl von drei jungen Menschen und ihrem Aufbruch in die Eigenständigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Lena van de Velde
Der RomanDer AutorLena van de VeldeImpressumDer Roman
Hamburg. Mit dem Rüstzeug seiner Eltern ausgestattet, begegnet Jan während seiner ersten Schritte in Unabhängigkeit Lena, der Tochter eines wohlhabenden hanseatischen Kaufmanns. Eine einzige Nacht mit ihr genügt, sein Selbstvertrauen auf mysteriöse Weise zu erschüttern. Schutzlos wähnt er sich seiner Besucherin gegenüber ausgeliefert. Rückblickend sucht er nach einer Erklärung und beschreibt die unterschiedliche Wahl von drei jungen Menschen und ihrem Aufbruch in die Eigenständigkeit.
Der Autor
Jens Hanisch, 1970 in Dortmund geboren, wuchs in Lüneburg auf. Er wohnte zwanzig Jahre lang in Hamburg und lebt seit 2013 in Norderstedt. Mit "Mondsee Philomela" veröffentlichte er seinen ersten Roman im August 2013. 2017 folgte "Lena van de Velde".
Lena van de Velde
Das Eine ist Alles
Alles in Einem
Dies begriffen
Wozu sich um Vollendung
sorgen? (Seng-Ts'an)
Mein Irrtum: Die Überzeugung, ich, meiner selbst gewiss, sei nicht zu erschüttern. Die Begegnung mit einem Besucher, einer Hüterin, lehrte mich eines anderen. Das Rüstzeug, das meine Mutter mir mit auf meinen Weg gegeben hatte, noch mein Wille vermochten mich zu schützen. Bis auf eine Skizze hinterließ Lena keine weitere Spur, mit der ich mir ihre Gegenwart hätte erklären können.
Beinahe unheimlich: Wie aus dem Nichts tauchte sie in mein Leben, verweilte kurz gleich einer Rast und verabschiedete sich wenig später den Boden verseuchend, den ich die folgenden Tage und Wochen zu betreten haben würde. Dies war zumindest das Gefühl, das sich meiner bemächtigte. Die Skizze: ein Akt, in der einen Nacht mit Kohle gezeichnet, während ich auf meinem Bett lag und schlief. Das Blatt, sorgsam aus einem Skizzenbuch herausgetrennt, lag auf meinem Tisch. Für mich blieb nur Raum für Mutmaßungen, warum sie gegangen war, ohne sich von mir zu verabschieden. Tage später erhielt ich eine Karte aus New York: eine Ansicht auf die Freiheitsstatue. Sie schrieb, gut angekommen zu sein.Verzeih mir, Abschiede aber zählen nicht zu meinen Stärken. Kein Absender, keine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, nichts. Für die Zeichnung kaufte ich einen Rahmen. Sie steht schräg links vor mir auf dem Tisch, an dem ich sitze und diese Zeilen schreibe, mit dem Eindruck, einem Besucher, besser einer Besucherin aufgesessen zu sein.
Die Begegnung mit einer Hüterin birgt Gefahr. Ehe derjenige sich versieht, steht ihm eine solche zur Seite. Und ohne die Gefahr zu wittern, verführen sie einen, wogegen sich kein Gegenmittel findet, ganz als würde ein Zaubertrank gereicht. Wenige Menschen behaupten, es handle sich um Nomaden, Erdnomaden, Schattengeister, einst der Unterwelt entstiegen, heimatlos, getrieben, inzwischen über die gesamte Welt verstreut, mit dem Auftrag, Veränderungen, eine Wende in Gang zu setzen. Ihr Sitz: New York, Hauptstadt des Okzidents. Wer ihnen begegne, der verkaufe seine Seele für nur eine gemeinsame Nacht.
Glaube ich einer alten Legende der Pikten aus dem schottischen Hochland – nicht in Stein gemeißelt, sondern mündlich überliefert von Generation zu Generation –, steigen die Hüterinnen zum Totenreich einmal im Jahr zu Vollmond vor der Sommersonnenwende auf die Erde hinab. Tief in der Nacht, wusste die Großmutter ihrer Enkeltochter zu berichten – sie war schottischer Abstammung –, gleiten ihre Barken aus dem Jenseits lautlos über die dunkle See. Mit dem Morgentau stoßen sie aus dem dichten Nebel. Vorn am Bug sitzen die Hüterinnen in ihre bunten Gewänder gehüllt, geschmückt mit Gold und Edelsteinen. Zur Sommersonnenwende, während Sonne und Mond sich nahestehen, beschwören sie zu Ehren derGroßenGöttin, der Muttergöttin, die Erdgöttin Ura, den Sonnengott Ut sowie die Mondgöttin Nan. Einzig während dieser Nacht reichen sie Tieropfer zur Besänftigung ihrer Götter, damit in der Welt Einigkeit herrsche, Einigkeit zwischen Himmel und Erde. Das Feuer teilen sie mit den Seelen ihrer Ahnen, deren Vermächtnis sie hüten, die ihnen auf die weite Fahrt aus dem Reich der Toten gefolgt waren. Steht der Mond der Erde wieder nahe, räumen die Hüterinnen ihre Lager und kehren heim in ihr Reich jenseits der See.
Lenas Erzählung erinnert mich an meine Mutter. Als Kind sah ich sie regelmäßig in der Vollmondnacht im Garten hinter unserem Haus sitzen, aufrecht, tief versunken in ihre Meditation. Kurz bevor ich mein Elternhaus verließ, erklärte sie mir, sich den Toten während einer Vollmondnacht besonders nahe zu fühlen. Ihre Seelen, die verweilen auf dem Mond.
Im vergangenen Jahr – lese ich Tage später – gelang einem französischen Forscherteam ein sensationeller Fund auf einer Insel der Orkneys. Verborgen, unter fünf Meter tief in den Erdboden versenkten Steinplatten, legten sie eine fünfzehn Meter lange Kammer frei. In der Kammer entdeckten sie die üblichen Beigaben: Keramik, Speer, Pfeile und Bogen, ein Langmesser. Ein Kriegergrab. Eine Einmaligkeit war eine unversehrte Barke. Anstatt eines Fürsten oder Kriegers bargen die Forscher das Skelett einer Frau. Auf die letzte lange Fahrt begleiteten die Tote Gewänder, Goldschmuck und Edelsteine. Die Sensation aber waren eine Tontafel in Keilschrift und ein Bronzeamulett, versehen mit einem nach unten gerichteten Dreieck, in diesem ein Hakenkreuz aus vor-indoeuropäischer Zeit.
Der Fund stützt die Vermutung, dass etwa Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. ein weibliches Kriegervolk vom Nordmeer her in unregelmäßigen Abständen während der Sommerzeit die schottische Küste heimsuchte. In kleinen Gruppen verteilten sie sich auf das Land, wohl mit der Absicht, ihren weiblichen Nachwuchs zu sichern. Die Vermutung liegt nahe, dass sie die Männer, ob verheiratet oder nicht, mit der Hilfe eines Aphrodisiakums betörten und verführten. Ein Urmutter- und Ahnenkult, gewidmet der Fruchtbarkeit und Wiedergeburt. Er diente der Erinnerung an die Unsterblichkeit und mahnte zur Erhaltung der weisen Seele.
Lena begegnete ich auf einem meiner Streifzüge durch die Stadt. An einem freien Tag Mitte Juni entschied ich mich für einen Besuch in die Kunsthalle. In der Abteilung der Alten Meister sah ich sie vor dem Grabower Altar von Meister Bertram aus dem 14. Jahrhundert sitzen. Sie fertigte eine Skizze von dem Altar in ihre schwarz gebundene Zeichenkladde. Ich scheute mich nicht, mich zu ihr zu setzen. Und als sie wenig später kurz aufsah und mich anlächelte, zögerte ich nicht, sie zu fragen, welchen Zweck sie mit der Skizze verfolge. Sie nehme Abschied, erklärte sie. Den Altar wolle sie in Erinnerung behalten. Den aber, entgegnete ich, könne sie doch jederzeit im Internet betrachten. Sie antwortete, das Internet nicht zu nutzen. Wozu? Vielleicht ein wenig altmodisch, darüber hinaus – so erfuhr ich später – besaß sie weder ein Mobiltelefon noch einen Fernseher. Aus meinem Alltag nicht wegzudenken, ihr jedoch genügte ein Anrufbeantworter. Der Umstand, als stets erreichbar zu gelten, war ihr ein Graus, beraubte sie ihrer kostbaren Momente in Selbstvergessenheit, so wie das Fernsehen sie um ihr unerwartetes Erstaunen beim Anblick einer Besonderheit brachte. Als sie sich dem Abhandenkommen ihres Gespürs für die Außergewöhnlichkeit mancher Ereignisse bewusst wurde, entschied sie, ihre konsumierende Haltung aufzugeben, die ihr die Sehenswürdigkeiten der Welt in ihr Wohnzimmer lieferte. Sie bevorzugte das Reisen, den Besuch von einem Museum oder einem Konzert. Auf diese Weise eroberte sie sich die Momente der Freude an der Einzigartigkeit zurück.
Lena erklärte, Hamburg für eine unbestimmte Zeit zu verlassen. Aus diesem Grund suchte sie die Stationen auf, die während ihrer Zeit in der Stadt von Bedeutung gewesen waren. Die Kunsthalle etwa hatte ihr stets die Möglichkeit geboten, für sich sein zu können. Ihr Ort der Besinnung, ihr Rückzugsort, ihr Möglichsein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort jemand gefunden hätte, wäre äußerst gering gewesen. Malerin war sie nicht, das Zeichnen diente ihr einzig der Sammlung, der Kontemplation. Ich bemerkte den Instrumentenkoffer, den sie rechts neben sich auf dem Boden abgestellt hatte. „Eine Laute“, erklärte sie. „Bis vor wenigen Tagen studierte ich an der Musikhochschule.“
Der Altar von Meister Bertram stand ursprünglich in St. Petri, erzählte Lena. Mein Ururururur-Großvater, Jacob van de Velde, erwähnte in seinem Tagebuch aus dem 19. Jahrhundert, dass der Altar ins Mecklenburgische nach Grabow geschafft wurde. Wegen dieses Umstandes wurde der Altar kein Opfer vom Großen Brand in Hamburg im Jahre 1842. Den Altar könnte Jacob demnach gekannt und – ebenso wie ich – vor ihm gedankenverloren verweilt haben. – Lena lächelte mich an. Ich stockte: ein bezauberndes Lächeln. Sie hatte dunkelblondes, über die Schultern reichendes welliges Haar, trug eine blaue Jeanshose und eine blauweiß gestreifte Bluse. Ich blieb neben ihr sitzen und beobachtete sie einige Minuten aus dem Augenwinkel heraus. Und während ich sie so beim Zeichnen beobachtete, zogen mich ihre innere Ruhe und Anmut, ihr offenbares Einssein in ihren Bann. Ohne eine Erwartung meinte ich mich, in ihrer Gesellschaft wie angekommen zu fühlen, fand mich in der Stimmung, als kehrte ich heim. – „Du zeichnest nicht?“ fragte Lena. „Nein“, entgegnete ich und hatte mir einzugestehen, nicht über ihre Fertigkeiten zu verfügen. „Hast du es versucht?“ fragte sie weiter. „Ich fürchte“, antwortete ich, „dass mir der kleinste Versuch bereits misslingen wird“, und lachte.
Ich blieb noch einige Minuten neben Lena sitzen, bevor ich meine Besichtigung fortsetzte. Ihre Arbeit unterbrach sie wegen mir nicht. – „Bis später“, verabschiedete ich mich mit einem knappen Nicken. Lena lächelte und hob kurz ihre Hand zum Gruß.
Ich saß bei den Künstlern der Romantik, als Lena plötzlich neben mir stand. Sie stellte ihr Instrument neben die Bank und setze sich zu mir. – „Caspar David Friedrich“, sagte sie, „ein ganz Großer seiner Zeit. Das Eismeer. Der Wanderer über dem Nebelmeer. Großartige Bilder. Einsamkeit, die Erhabenheit der Natur, das Schicksal und das notwendige Scheitern des Einzelnen. – Ich möchte heute noch an die Elbe, zum Hafen. Das Wetter ist phantastisch. Begleitest du mich? Ich müsste nur kurz meine Tasche und das Instrument nach Hause bringen. Wir könnten dann gleich starten.“ – Erwartungsvoll sah sie mich an. Zu überlegen brauchte ich nicht.
Wenig später überquerten wir die Kennedybrücke. Plaudernd gingen wir den Fußweg an der Außenalster entlang, vorbei am amerikanischen Generalkonsulat, dem Gelände der Musikhochschule, sahen in die Schaufenster im Mittelweg, bis sie schließlich die Gartenpforte zu einer Stadtvilla in der Heimhuder Straße öffnete. Ich zeigte mich überrascht. Von der Diele aus warf ich einen schüchternen Blick in das helle Wohnzimmer, während Lena ihr Instrument wegstellte. Hohe Fenster gewährten mir die Aussicht in einen gepflegten Garten hinter dem Haus. In dem geräumigen Zimmer hingen ein Gemälde, Kohlezeichnungen sowie ein Kupferstich. Gegenüber einer hellen, niedrigen Sofalandschaft stand neben einem Flügel ein Cembalo, ein ziemlich altes, historisches Instrument, wie ich vermutete. – „Das Haus gehörte ursprünglich meinen Großeltern“, erklärte Lena wenig später, als wir unseren Weg fortsetzten. „Heute gehört es meinen Eltern. Die aber wohnen in Nienstedten. Aus diesem Grund wohne ich allein in dem Haus.“ – Ich zeigte mich etwas schockiert, war überwältigt. Wer erwartet, eine 25jährige wohne unter solch Bedingungen? Bis heute vermag ich kein Urteil darüber zu fällen, geschweige, sie aufgrund ihrer Herkunft zu ächten, wuchs ich selbst in einem großen Haus mit einem weitläufigen Garten auf.
Lena: eine Tochter aus gutem Hause. Ich schnupperte hanseatische Luft. – Um die Vertrautheit nicht zu stören, die von Beginn an zwischen uns herrschte, sagte ich nichts. Lena war im Begriff, Abschied zu nehmen. Und ich? Ich beabsichtigte nicht, mit Rücksicht auf meine Neugier wie sich der Tag entwickeln würde, der abenteuerlichen Unternehmung ihren Reiz zu stehlen. Ich blieb gespannt, ich amüsierte mich.
Auf dem Weg zur Elbe entwickelte sich zwischen uns recht schnell ein offenes Gespräch, ganz als kennten wir uns von jeher. Am Dammtor stiegen wir in die S-Bahn und fuhren über Altona nach Blankenese. Dort stiegen wir durch das Treppenviertel zum Elbstrand hinab und liefen den Strandweg entlang bis zum Fähranleger Teufelsbrück. Lena erzählte mir von ihrem Studium, Geschichten aus ihrer Schulzeit, berichtete von ihrem Bruder, der in London studiert hatte, dort wohnt und für das Auktionshaus ihres Onkels tätig ist. Sie berichtete von ihrer Mutter, die ihre freie Zeit gern in Paris verbringt, und ihrem Vater, der seine Filialen als Juwelier in New York, Singapur und Peking verwaltet, der die vergangenen Jahre mehr auf Geschäftsreise als in Hamburg gewesen war. Ich gewann den Eindruck, als lebe die gesamte Familie auf die Erde verteilt und fühle sich überall sesshaft, als seien sie Vertreter einer Art Weltbürgertums.
Seit mehr als zwei Jahren, bald drei Jahre, lebe ich in Hamburg. Im Sommer nach meinem Abitur brach ich in die Großstadt auf, um meine dreijährige Lehre zum Tischler zu beginnen. Ich bereue nicht einen Tag, in die Stadt, in den Norden gezogen zu sein. Die Begegnung mit Lena, einer Fremden, ist von besonderer Art, die ich festhalten will.
Erhaben war der Moment, als der Zug aus Richtung Süden langsam über die Elbbrücken rollte, nach Hamburg hinein. Zum ersten Mal blickte ich auf die Türme der Stadt: St. Katharinen, St. Jacobi, St. Petri, das Rathaus, der Michel, das Wahrzeichen der Freien und Hansestadt, der Fernsehturm. Ein Kindheitswunsch erfüllte sich. Ein Kribbeln lief meinen Rücken hinab, ich fühlte mich am Ziel. Freiheit: begriffen als das Freisein von. Das Tor zur Welt stand weit geöffnet, dahinter wähnte ich den Raum zu meinem Möglichsein. Und auch später, sobald ich in die Stadt zurückkehrte, suchte mich das Gefühl heim. Es handelt sich um das Freifühlen von nicht gewollten Übereinkünften, stillschweigend akzeptierten Bedingungen und Regeln, denen ich nicht fraglos zustimmen mag, aber auch die Freude, Einfluss auf meine eigene Zukunft auszuüben, meine Entscheidungen aus eigener Überzeugung treffen zu können und meine Gegenwart meinen Wünschen entsprechend zu gestalten. Hamburg in seiner Vielfalt bietet all jenen Aussätzigen eine Heimstatt, die sich als geächtet empfunden in ihre Subkultur flüchten. Sie tauchen ab, um ihresgleichen aufzuspüren und um zu einem späteren Zeitpunkt ihre Gegenwart für gut befinden zu können.
Über die Elbe verlassen die Schiffe gen Westen den Hafen auf ihrem Weg in die gesamte Welt. Ich fühlte mich als Reisender, auf dem Weg, auf Durchreise, ein Wanderer. Einen Rucksack und eine Sporttasche, gefüllt mit wenigen persönlichen Erinnerungen, überwiegend mit Kleidung und Kosmetika vollgestopft, meine Ersparnisse jederzeit verfügbar auf der Bank, mehr hatte ich für meine Zukunft nicht für notwendig erachtet. Dinge, die ich nicht benötigte, Erinnerungen an meine Kindheit und mein Aufwachsen, verstaute ich in Kisten und lagerte diese mit dem Einverständnis meiner Eltern auf dem Dachboden. Ein erstes Mal fuhr ich mit der U-Bahn über den Viadukt der Hochbahn. Die Strecke führte vom Rödingsmarkt zu den St. Pauli Landungsbrücken ein Stück am Hafenrand entlang. Begeistert blickte ich auf die Fähren, die Kräne und Lagerhallen, die zahlreichen Boote und Barkassen, das bunte Treiben auf dem Strom. Ich war froh, endlich in der Stadt angekommen zu sein. Am Nachmittag bereits saß ich zum ersten Mal als Gast im Café Comunità, einem kleinen Café am Eck, wenige Schritte von der Hafenstraße und dem Elbhang entfernt.





























