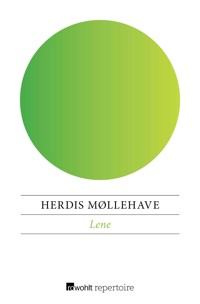
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lene ist eine berufstätige Frau – eine, für die es keinen persönlichen Freiraum gibt, denn die Probleme, mit denen sie sich als Sozialarbeiterin herumschlägt, folgen ihr, oft in Form von Schuldgefühlen, bis in die eigene Ehe und Familie. Gelegentlich scheinen Beruf und privates Leben ihr geradezu vertauscht: wo sie nur sachlich funktionieren brauchte, sieht sie ihre eigenen Entwicklungschancen, ist sie mit Herz und Seele engagiert, während das Familienleben Züge einer beruflichen Aufgabe annimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Herdis Møllehave
Lene
Aus dem Dänischen von Astrid Arz
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Lene ist eine berufstätige Frau – eine, für die es keinen persönlichen Freiraum gibt, denn die Probleme, mit denen sie sich als Sozialarbeiterin herumschlägt, folgen ihr, oft in Form von Schuldgefühlen, bis in die eigene Ehe und Familie. Gelegentlich scheinen Beruf und privates Leben ihr geradezu vertauscht: wo sie nur sachlich funktionieren brauchte, sieht sie ihre eigenen Entwicklungschancen, ist sie mit Herz und Seele engagiert, während das Familienleben Züge einer beruflichen Aufgabe annimmt.
Über Herdis Møllehave
Herdis Møllehave (1936–2001) war eine dänische Sozialarbeiterin und Autorin.
Inhaltsübersicht
Niemand bindet sich, niemand ist frei Wohin kann ich gehn, wenn ich weine? – Sieh mich an – bald ist alles vorbei, dann sind wir wieder alleine.
– Benny Andersen: Mørkets sang(Lied der Dunkelheit)
Ein Todesfall
«Sie ist tot», schrie Birgit.
Lene beugte sich über das Balkongeländer. «Unverantwortlich niedrig», registrierte sie zerstreut.
«Ich rufe den Rettungsdienst an», rief sie zurück.
Sie wählte ooo, nannte Birgits Namen und Adresse. Sagte, daß deren zweijährige Tochter vom Balkon heruntergefallen sei. Vom 7. Stock. Sie sei wahrscheinlich tot.
Erklärte, wer sie selbst war. Spürte, wie sich eine Lähmung in ihr ausbreitete. Dachte: ‹Ich habe Susan einfach nicht angesehen.›
«Einen Augenblick», sagte eine ruhige Stimme. Sie hörte ihn jemandem etwas zurufen, ohne einzelne Wörter verstehen zu können.
«Bleiben Sie, wo Sie sind», sagte er in den Hörer. «Der Krankenwagen fährt in diesem Moment los.»
«Meinen Sie, am Telefon?» fragte sie.
«Ja», antwortete der Mann. «Falls es zu Mißverständnissen kommt.»
«Wie lange dauert es, bis Sie da sind?»
«Ach, so sieben, acht Minuten. Es ist Hauptverkehrszeit.»
Sie legte langsam den Hörer auf.
Lene nahm sich noch eine Zigarette und merkte, daß sie sie kaum anzünden konnte. Ihre Hände zitterten. Sie wühlte in ihrer Tasche nach dem Tablettenröhrchen, nahm ein paar Valium.
Sie ging auf den Balkon, lehnte sich hinunter und rief Birgit zu:
«Bleib, wo du bist; ich muß aufs Telefon aufpassen. Sie kommen in ein paar Minuten. Leg sie in Erste-Hilfe-Stellung.»
«Hilfe» – sie spürte die Absurdität dieses Wortes, als sie sich zwingen mußte, den blutigen Klumpen anzusehen. Von da oben sah es fast harmlos aus, aber man brauchte nicht viel Phantasie, um sich die Wirklichkeit unten vorzustellen.
Sie sah ein paar Nachbarn näherkommen, griff nach einer Decke und warf sie hinunter. «Deckt sie zu!»
Sie betrachtete das Geländer. Ein ausgezeichnetes Klettergerüst. Hatten Architekten keine Kinder oder keine Phantasie?
Sie wartete.
Sieben Minuten
Lene ließ sich in einen Sessel fallen. Sah sich haltsuchend in der Wohnung um.
Auf einem Regal standen ein großes Farbfoto von Susan als Säugling und ein paar kleinere Bilder von ihr, später aufgenommen.
Lene suchte weiter. Konnte, bis auf eine Aufnahme von Birgit, keine weiteren Familienbilder im Zimmer entdecken.
Ein unglaublich schmächtiges, fast mageres Mädchen; langbeinig, blaß, mit langen, weißblonden Haaren. Eine sehr aparte Schönheit, besonders, wenn man sich den zynischen Zug um den Mund wegdachte.
‹Ich bin Zeugin eines Mordes›, dachte Lene, ‹und habe sieben Minuten zum Überlegen. Und keine Ahnung, ob sieben Minuten viel oder wenig Zeit sind.›
Als sie sich an der Zigarette verbrannte, mußte sie an ihren Vater denken, der in brisanten Situationen immer erst seine Pfeife anzündete, bevor er die Sache in die Hand nahm.
In Gedanken redete sie ihn an: ‹Du bist nie Zeuge eines Mordes gewesen. Aber wenn deine Pfeife gebrannt hat, hattest du eine einzigartige Fähigkeit, Herr der Lage zu sein; du wurdest geradezu auffällig gelassen. Du hast die Lage sachlich überblickt, und man konnte mit dir rechnen. Du wußtest immer, wo es langging, auch, wenn ein Zusammenbruch kurz bevorstand.›
Als sie seine kleine, leicht gekrümmte, über Pfeife und Streichhölzer gebeugte Gestalt vor sich sah, spürte sie plötzlich, daß sie ihn vermißte.
‹Aber du warst nie Zeuge eines Mordes. Was würdest du an meiner Stelle tun, außer Pfeife rauchen? – Du kannst nicht antworten, und es ist auch egal, denn das hier ist mein ganz persönliches Problem, in das ich niemanden hineinziehen kann; ich muß ganz alleine zu einem Schluß kommen. In knapp sieben Minuten.›
Ein Schock. Plötzlich ging ihr auf, daß sich ihr Leben von diesem Augenblick an änderte, ganz gleich, was sie tat, wie immer sie sich auch entschied.
Außerdem – hatte sie sich nicht bereits festgelegt?
Oder, anders ausgedrückt: Blieb ihr überhaupt noch die Wahl, an die sie glaubte? Wieviel Einfluß hatte sie noch auf den Gang der Dinge?
‹Ich möchte am liebsten schreien. Und muß den hoffnungslosen Versuch machen, Ordnung in ein Gedankenwirrwarr zu bringen. Die Folgen des Geschehens überdenken.›
«Alles auf dem richtigen Platz» stand auf den Heften und dem Klassenbuch in der Schule, die sie besucht hatte. Der Direktor, der auf die Idee gekommen war, mußte verrückt gewesen sein.
Alles auf dem richtigen Platz, und Susan zerschmettert auf einer Steinplatte. Wo war der richtige Platz? Sie hatte viel Zeit darauf verwendet, sich gegen diesen Satz aufzulehnen.
Plötzlich erinnerte sie sich an diesen Direktor, vor allem, weil er einmal beim Morgengebet im Vaterunser steckengeblieben war. Er hatte ein paarmal angesetzt und war rot geworden, denn an diesem Tag waren Gäste in der Schule. Das laute Vorsagen seiner Frau hatte er nicht gehört. Zu groß war sein Schreck darüber gewesen, daß er, moralisch einwandfrei und mit Besuch in der Schule, sein Vaterunser nicht mehr konnte. Das hatte ihn ein wenig menschlicher erscheinen lassen.
Was um Himmels willen hatte ihr alter Schuldirektor mit ihrer Lage zu tun? Und die Zeit lief. Alles auf dem richtigen Platz. «Ordnung muß sein, das macht das Suchen leicht.»
Und Susan ein blutiger Klumpen auf einer Steinplatte, sieben Stockwerke tiefer.
‹Ich kann da keine Ordnung reinbringen. Und Susan ist nicht auf dem richtigen Platz. Und die Zeit läuft. Ich muß mich entscheiden. An was kann ich mich halten? Sechs Minuten noch.›
Sie zündete noch eine Zigarette an und fühlte sich auf einmal völlig nüchtern. ‹Herr Direktor›, dachte sie, ‹Sie und Ihre Frau, die unglücklicherweise meine Klassenlehrerin war; klein, kräftig und fromm. Mit einer Vorliebe dafür, die Schwächsten der Klasse mit schlechten Witzen und unangebrachter Ironie einzudecken; Sie und Ihre Frau wüßten genau, was zu tun ist. Und das trägt wohl dazu bei, daß ich es nicht weiß. Sie hätten sich korrekt und in Übereinstimmung mit dem geltenden Gesetz verhalten. Deshalb bin ich im Zweifel. Oder doch nicht?›
Sie rekonstruierte das Geschehen. Oder machte den Versuch, denn sie wurde ständig von Gedanken abgelenkt, die nichts oder vielleicht gerade etwas damit zu tun hatten.
‹Die Haupthandlung – das klingt wie ein Theaterstück›, dachte sie und sah sich plötzlich als unbeteiligte Beobachterin – ‹ist ganz einfach die: ich, die Sachbearbeiterin, statte der Klientin einen Besuch ab. Die Klientin ist kürzlich von ihrem Partner verlassen worden, deshalb in finanziellen Schwierigkeiten, über die diskutiert werden soll.›
Der Entwurf eines Haushaltsplanes steht an. Aber das ist nicht das Entscheidende. Die knapp zweijährige Tochter des Paares ist taub, bzw. ihr Gehörrest auf einem Ohr ist so unbedeutend, daß man ihn nicht aktivieren kann.
Der Vater hat die Familie hauptsächlich deswegen verlassen, weil er die laute Tochter nicht ertragen konnte. Als sie wie andere Säuglinge nicht mehr vor sich hin babbelte oder still und leise war, steigerten sich ihre Kontaktversuche ins Extreme. Sie stieß irritierende, unartikulierte Schreie aus.
Das störte ihn außerordentlich, besonders in der Öffentlichkeit; im Bus schämte er sich. Er versuchte, ihr das Schreien durch Strafen abzugewöhnen, aber damit machte er alles nur noch schlimmer.
Die Mutter hat sich an die Kinderklinik in der Kristianiagade gewandt; aber was sie da alles unternehmen muß, um das Kind nur einigermaßen angemessen zu fördern, scheint ihr dermaßen überwältigend, daß sie jeden Gedanken an eine Therapie aufgegeben hat.
Im Gespräch entschuldigt sie sich mit Übermüdung und Trauer darüber, daß sie im Stich gelassen wurde.
Als die Sozialarbeiterin kommt, spielt Susan im Zimmer. Auf dem Balkon steht der gedeckte Teetisch. Man kann ein paar Baumwipfel sehen. Das nächste Haus ist ziemlich weit entfernt.
Die Sozialarbeiterin lehnt sich über das Geländer und läßt sich darüber aus, daß es viel zu niedrig ist und die querlaufenden Eisenstangen Kinder geradezu zum Klettern auffordern. Sie sagt, daß die Mutter etwas tun muß; das Geländer sei viel zu gefährlich.
Die Mutter antwortet «ja». Sie trinken Tee. Aus dem Zimmer dringt der Lärm eines heftigen Spiels und zwischendurch dieses schrille, nervenaufreibende Schreien und Kreischen. Die müde Sozialarbeiterin kann den Vater für einen Moment verstehen. – Nein, denkt Lene, aus so einer tragischen Situation kann man nicht einfach fortgehen. Aber das Zusammenleben mit Birgit ist wohl auch nicht gerade einfach.
Sie sprechen über Susans Gehörlosigkeit. Lene weiß, wie schwer Birgit zu überreden sein wird, sich wirklich um Susans Therapie zu kümmern. Sie hat sich erklären lassen, was für eine langwierige Arbeit das ist.
«Vererbung», sagt Birgit mit bitterer Stimme. «Meine Mutter war sehr schwerhörig, mein Bruder stocktaub. Das hat unsere Familie kaputtgemacht, verstehst du.»
Susan ist zu ihnen herausgekommen. Birgit nimmt sie auf den Schoß.
«Meine Mutter hatte ein schlechtes Gewissen; also hat Kurt die ganze Liebe abbekommen.»
Ihre Stimme klingt immer haßerfüllter und beißender. «Mein Vater war schwach, und ich war gesund und unerwünscht. Kurt hockt total isoliert in einem Heim; eigentlich müßte ich ihn bedauern, aber ich hasse ihn. Er hat mir meine Mutter weggenommen. Und als sie gestorben ist, war er so unselbständig, daß alles zu spät war. Mein Vater säuft. – Noch etwas Tee?»
Sie steht auf; ihre Stimme überschlägt sich. Sie hat Susan auf dem einen Arm, die Teekanne in der anderen Hand.
Lene sieht oder ahnt, aber zu spät, daß Birgit Susan mit der Bemerkung: «Es soll ihr nicht so gehen wie Kurt» über das Geländer schubst und die Teekanne fallenläßt.
Lene ist aufgesprungen, will etwas sagen, streckt die Arme aus, wie um etwas zu verhindern, das unwiderruflich geschehen ist.
Aus den Augenwinkeln sieht sie die Teekanne in Scherben; der Tee fließt über das Tischtuch, und sie bemerkt als erstes, daß die Kanne zu einem teuren Service gehört.
Will etwas sagen, aber ihre Stimme versagt.
Birgit sagt trocken und unkenntlich, zischend beinahe: «Du hast gesehen, sie hat sich losgemacht und ist heruntergefallen.»
Lene will etwas sagen. Widersprechen? Aber sie hat ihre Stimme immer noch nicht in der Gewalt.
«Halt jetzt verdammt noch mal zu mir. Das eine Mal! Du mit deinen tollen Ideen, offene Akten und der ganze andere Schwachsinn aus deinem Programm.»
Sie schweigt, fährt dann aber fort: «Hörst du, nicht so wie Kurt. Und ich bin nicht meine Mutter.»
«Nein, dazu ist es auch zu spät», flüstert Lene. «Geh runter zu ihr, ich ruf den Rettungsdienst an.»
«Kann ich mich auf dich verlassen?» Birgit sieht sie haßerfüllt an.
«Geh schon runter zu ihr», hört Lene sich schreien. Sie weiß, daß auch in ihrem Blick Abscheu liegt.
«Du mußt für mich aussagen. Sonst kannst du dir nie mehr selbst in die Augen sehen. Das weißt du.» Birgits Tonfall ist eine Mischung aus Haß, Angst und Triumph.
Sie dachte an die Fahrt zu Birgit, an den großen Unterschied zwischen der Zeit vor und nach einer Katastrophe.
Sie hatte sich überlegt, daß man beim Autofahren so gut nachdenken konnte. Und, mit einem lakonischen Lächeln, daß sie schon nicht mehr wußte, worüber sie nachgedacht hatte. Diese Vergeßlichkeit störte und bekümmerte sie.
Bevor sie mit Antabus, Tabletten gegen Alkoholmißbrauch, angefangen hatte, hatte sie dem Wein die Schuld gegeben. Aber als sie mit dem Trinken aufgehört hatte, war ihr Gedächtnis nicht besser geworden.
Das Alter? Sie war sich nicht sicher. Sie kannte viele, jüngere und ältere Leute, die über dasselbe Phänomen klagten.
Und so alt war sie schließlich auch nicht, Anfang Vierzig; aber ihre Gedächtnisschwierigkeiten hatten vor vielen Jahren angefangen.
Sie war auf ein Wort gestoßen, daß dieses Problem zu erklären schien. Informationsflut; das hatte sie bei einem Psychologen gelesen.
Sie war automatisch, aber mit sicheren Reaktionen gefahren, obwohl sie müde war. Ihr letzter Besuch für heute. Aber weil sie ahnte, daß er sich in die Länge ziehen würde, hatte sie zu Hause angerufen und sich vergewissert, daß eins der Kinder an das Abendessen gedacht hatte. Jonas war an der Reihe, aber er hatte mit Maria getauscht; also wußte sie, es würde Spaghetti mit Würstchen geben. Sie dachte an das nette Gespräch mit Jonas, seine liebevoll-ironische Redeweise.
Es war ein anstrengender Tag gewesen. Zuerst die Mitarbeiterversammlung, auf der sie in anderthalb Stunden eine Menge verwaltungstechnischer Probleme zu besprechen hatten. Sie hatten auch erörtert, wer an einem von der Gemeindeverwaltung organisierten Seminar über die neuen Erlasse teilnehmen sollte.
Sie waren sich einig gewesen, daß sie sich nie ernsthaft mit einem Erlaß befassen konnten, bevor ein neuer eintraf. Für die einzelnen Fälle war ihnen nicht mehr genug Zeit geblieben. Sie hatte sich darüber geärgert, weil sie das Gefühl hatte, daß sie wegen Birgit einen Rat brauchte.
Andererseits war es doch besser, den Fall am nächsten Tag zur Sprache zu bringen, wenn sie mehr wußte.
Sie hatte Birgit einen Besuch versprochen, um die Situation gründlich zu besprechen.
An diesem Tag hatte sie viele Menschen zu betreuen gehabt, die meisten mit ökonomischen Problemen. Die schlechten Zeiten machten sich immer deutlicher bemerkbar. Frauen, die sich nicht rechtzeitig beim Arbeitsamt gemeldet hatten; bei anderen Leuten war die Arbeitslosenunterstützung abgelaufen.
Und dabei zu wissen, daß finanzielle Probleme in der Regel andere nach sich zogen. Das Bedürfnis nach Beratung war deutlich spürbar, aber die Zeit war so knapp. Und machte man nicht alles noch schlimmer, wenn man ein Problem aufdeckte, das doch unlösbar war?
An ihrer Pinnwand hing eine Warnung, ein Zitat aus einem Vortrag, den eine Mutter von zwei gehörlosen Kindern gehalten hatte: «Es ist die größte Katastrophe abzuwarten und die Zeit verstreichen zu lassen.»
Dabei riet sie den Klienten oft genug ausgerechnet dazu! Und Birgit mit der kleinen, tauben Susan. Da mußte jedenfalls sofort etwas geschehen.
Aber was? Sie hatte sich in der Kinderklinik informiert. Man hatte ihr gesagt, daß es sich gelinde gesagt um eine Rund-um-die-Uhr-Aufgabe handelte. Und Birgit? War sie darauf gefaßt?
Darüber hätten sie reden sollen.
‹Aber jetzt›, dachte sie, ‹ist das Problem gelöst.›
Sieben Minuten. Sie hatte automatisch auf die Uhr gesehen, als sie den Rettungsdienst anrief.
‹Ich habe noch etwa fünf Minuten zum Überlegen. Fünf Minuten für eine Entscheidung, die mein ganzes Leben beeinflussen wird, egal, zu welchem Schluß ich komme. Wie viele Sozialarbeiter – oder andere Leute – sind in einer vergleichbaren Lage gewesen? Darüber gibt es keine Statistik, weil keiner was erzählt. Ich muß mich jetzt entscheiden und kann niemand um Rat fragen.› – Noch nie hatte sie sich so einsam gefühlt. Plötzlich sehnte sie sich nach ihrer Freundin Le, die Selbstmord begangen hatte. Sie hatte niemanden um Rat gefragt, sondern ihren Entschluß alleine gefaßt.
Lene stellte zwei Tatsachen fest: Sie hatte sich entschieden. Und sie wußte, Le hätte denselben Beschluß gefaßt; es gab keinen Zweifel, wozu Le geraten hätte, wenn sie noch gefragt werden könnte.
‹Okay, Le, wir nehmen die Sache in die Hand.› Und weiter: ‹Hört meine Sehnsucht nach Le als körperlicher Schmerz nie auf?› Zugleich: ‹Werde ich nicht ärmer sein, wenn ich eines Tages nur noch eine schwache Erinnerung an sie habe?›
Nach Les Tod war ihr aufgefallen, daß sie oft überlegte, was Le gesagt oder getan hätte. Häufig stimmte es mit ihren eigenen Entscheidungen überein. In manchen Situationen hatte sie das Gefühl, Le sei ein Teil von ihr geworden.
Sie sah auf die Uhr: noch vier Minuten. Birgit wurde ihr Schicksal. Sie dachte voller Angst: Lebenslänglich wegen einer Personennummer an einen anderen Menschen gebunden.
Die Versuchung eines Augenblicks: ‹Ich könnte die Wahrheit sagen.›
Sie sah sich als Zeugin in einem Gerichtssaal. Verteidiger, Staatsanwalt und zwölf Geschworene. Sie als einziger Zeuge. Birgit leugnet, das psychologische Gutachten wird verlesen. Kein Zweifel, daß Birgit normal intelligent ist, schlechte soziale Verhältnisse, vom Partner verlassen, unglückliche Kindheit; ja, unglücklich, und dafür trägt sie, Lene, durch die absurde Ironie des Schicksals einen Teil der Verantwortung. Ironie? Das ist nicht das richtige Wort. Aber wie sollte man es sonst nennen?
Zwölf Geschworene, unberechenbare Menschen, deren Hintergrund man nicht kannte. Mit völlig unterschiedlichen Gedanken- und Gefühlswelten.
Die Anklage würde auf geplanten Mord lauten. Oder, weil Lene anwesend war, auf Mord im Affekt. Ob das mildernde Umstände gäbe?
Der Verteidiger würde von einem Totschlag aus Mitleid reden.
Und die Geschworenen? Das hinge vom Verteidiger ab. Vielleicht auch vom Staatsanwalt, aber vor allem vom Verteidiger.
Totschlag aus Mitleid. Und zwölf Menschen mußten eine Frau beurteilen, die sie zum erstenmal sahen. Die sie nur aus zufälligen, im Gerichtssaal verlesenen Papieren kannten.
Und alles würde davon abhängen, was für einen Eindruck Birgit auf sie machte. Man konnte ihr natürlich Anweisungen geben; aber wenn sie aus Angst – oder weil sie provoziert wurde – aus der Rolle fiel?
Dann wären die Geschworenen bestimmt gegen sie.
Und was sollten die Geschworenen beurteilen? Daß Birgit die jahrelange, beschwerliche Therapie eines tauben Kindes nicht ertragen würde? Daß sie in erster Linie an sich dachte, vielleicht etwas zynisch war? Oder: daß das Kind sich nie normal entwickeln, nie eine gewöhnliche Erziehung, ein normales, erträgliches Leben haben würde?
Es war ein Spiel mit dem Zufall. Es konnte von einem einzigen oder zwei Geschworenen abhängen, die sich gegen die anderen durchsetzten.
Und Birgit wäre ausgerechnet von deren Einstellung abhängig.
Lene sah wieder auf die Uhr. Noch drei Minuten.
Sie hatte sich immer vor Selbstjustiz gefürchtet; aber Birgit im Gefängnis – wozu sollte das gut sein? Sie kannte keinen, dem es geholfen hatte, wenn nicht irgendeine begleitende Therapie durchgeführt wurde.
Aber gegen was sollte man Birgit schon behandeln? Gegen eine unglückliche Kindheit? Man konnte Menschen nicht in die Wiege zurücklegen und von vorne anfangen.
Birgit mit einem Urteil auf Bewährung, unter Aufsicht und Bedingungen. Was für welchen?
Birgit freigesprochen. Die Zeitungsberichte davor und danach. Das Untersuchungsgefängnis, in dem man nur wartete; die psychologische Untersuchung, für die sich alle viel Zeit ließen; und bei der Entlassung wäre Birgit angeschlagener als vorher. Lene wollte ja gerne auf das dänische Rechtswesen vertrauen, es respektieren, aber …
Sie dachte: ‹Ich habe keine andere Wahl.
Ich weiß, daß ich das Gesetz selbst in die Hand nehme; das Gericht ist versammelt, ich bin die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung, ich habe das Gutachten geschrieben, ich bin die zwölf Geschworenen – ich spreche sie frei.
Und verurteile mich selbst lebenslänglich. Zufällig an einen Menschen gekettet. An einen Menschen, den ich nicht verstehe und auf den ich mich nicht verlassen kann.
Aber sie könnte meine Tochter sein!›
Sie dachte an Maria, dieses warmherzige, von allen geliebte Mädchen. Zehn Jahre alt, begabt und schöpferisch, zuverlässig und rücksichtsvoll. Sie liebte alte Menschen, besuchte sie und war ihnen eine Freude; sie nahm sich Zeit und hatte einen netten, freundlichen Umgangston. Lene sah die Zeichnung vor sich, die eines Tages an ihrer Wand gehangen hatte; starke, fröhliche Farben und gute, feste Buchstaben: «I LOVE YOU»; ein Herz mit MAMA und MARIA, und noch etwas, worauf noch kein Künstler oder Designer gekommen war: der Kreis des Männer- und Frauenzeichens in Herzform.
Sie sehnte sich auf einmal heftig nach ihr, danach, ihren Körper an sich zu drücken, die Arme um ihren Hals zu spüren und ihre verklebten Spaghetti und angebrannten oder geplatzten Würstchen zu essen. Würde irgend etwas so wie früher sein?
Sie wußte, daß Birgit psychisch labil war. Was für einen Einfluß würde das auf ihr eigenes Leben haben? Es war nicht absehbar.
Wenn man die Zeit zurückdrehen könnte; wenn ihr alter Renault unterwegs liegengeblieben wäre!
Sie sah auf die Uhr. Sie hörte die Sirenen, sah den Krankenwagen auf die Steinfliesen fahren.
Verhör
Lene verließ die Wohnung, dachte daran, die Tür aufzulassen, und fuhr mit dem Lift zu Birgit hinunter, die sie mit angsterfüllten Augen fragend anstarrte. Lene umarmte sie, während die Sanitäter das blutige Bündel auf eine Bahre legten und in den Wagen schoben.
«Komm, Birgit, wir warten oben auf die Polizei. Wir holen auch einen Arzt, der gibt dir etwas zur Beruhigung. Dann kommst du mit zu mir nach Hause.»
Sie stützte Birgit auf dem Weg zum Eingang. Der Krankenwagen fuhr ohne Sirenengeheul fort.
Im Aufzug sagte sie: «Du kannst mit mir rechnen. Aber ich muß mich auch auf dich verlassen können.»
Birgit nickte; sie schien unter Schockwirkung zu stehen.
Als sie in der Wohnung waren, sagte Lene: «Die Polizei kann jeden Augenblick kommen. Halt dich fest an folgende Aussage: Du hast Susan, die sehr zappelig ist, auf dem linken Arm, nahe am Geländer. Du stehst auf, um Tee nachzuschenken. Susan macht eine plötzliche Bewegung, reißt sich von deinem Arm los und fällt über das Geländer. Das ist die einzige Erklärung.»
Birgit nickte; ihr Blick war nicht mehr so verschreckt.
«Du hast einen Schock», sagte Lene und versuchte, überzeugend zu klingen, «deshalb bist du nicht weinend zusammengebrochen. Was hast du den Leuten gesagt, die sich um Susan und dich versammelt haben?»
«Ich hab sie angeschrien, sie sollten verschwinden. Und gestöhnt. Mach dir keine Sorgen», ihre Stimme klang jetzt hart, «ich falle nicht aus der Rolle. Du hast keine Ewigkeit neben einem blutigen Fleischklumpen gesessen, den du einmal auf die Welt gebracht hast und von dem du geglaubt hast, du liebst ihn. Ich hatte bloß Angst, daß ich mich nicht auf dich verlassen kann. Ich hatte doch keine Ahnung, was du dir inzwischen ausdenkst.»
Sie begann zu weinen. Schrie plötzlich: «Du kannst selbst entscheiden, ob ich aus Erleichterung oder über Susan heule!»
Es läutete. Lene machte den Polizisten auf. Als sie hereinkamen, lag Birgit auf dem Sofa, halb schreiend, halb weinend. Hin und wieder konnte man den Namen «Susan» heraushören.
«Ich kann eine Aussage machen, aber wir müssen zuerst den Arzt anrufen», wandte Lene sich an die Beamten. «Ich glaube nicht, daß die Mutter verhört werden kann, bevor sie ein Beruhigungsmittel bekommen hat.»
Die Polizisten nickten und setzten sich.
Lene rief Anders an, einen gemeinsamen Freund von Andreas und ihr. Sie erklärte ihm kurz die Situation und gab ihm die Adresse. Er wollte sofort kommen.
Dann rief sie zu Hause an. Andreas war am Apparat.
«Ich bringe Birgit mit nach Hause. Ihre Tochter ist tot. Wir warten auf einen Arzt. Anders ist unterwegs. Die Polizei ist hier. Wir müssen eine Aussage machen. Könnt ihr das Gästezimmer in Ordnung bringen?»
Sie mußte weinen.
«Soll ich kommen?» fragte Andreas. «Es hört sich so an, als ob du Hilfe brauchst.»
«Nein, danke», sagte sie, «es kann nicht mehr lange dauern, bis wir kommen.»
«Ja, aber kannst du denn Auto fahren? Du klingst völlig fix und fertig.» Andreas’ Stimme war bekümmert.
«Ja, ja, mach dir keine Sorgen. Wir kommen bald.» Sie legte den Hörer auf.
Und dachte verzweifelt:‹Jetzt muß das Valium aber bald wirken.›
Sie drehte sich zu den Polizisten um. «Entschuldigen Sie, aber das ist alles so fürchterlich.»
Sie nickten verständnisvoll. Der eine hatte einen Notizblock auf dem Schoß.
Als Lene mit ihrer Aussage anfing – sie merkte selbst, daß ihre Stimme ungewöhnlich langsam und leise klang –, wurde Birgits jammerndes Weinen lauter.
«Können wir nicht auf den Arzt warten?» fragte sie die Polizeibeamten. Beide nickten, waren offensichtlich betroffen, und der eine legte seinen Block erleichtert beiseite.
Lene setzte sich zu Birgit, legte die Arme um sie und flüsterte: «Jetzt kommt bald der Arzt, dann kriegst du etwas zur Beruhigung und kommst mit zu mir.»
Kurz darauf kam Anders. Er stellte die Arzttasche ab und sah sie an.
«Kannst du ihr nicht etwas geben? Ich möchte sie mit nach Hause nehmen.»
Birgits Jammern zerrte an ihren Nerven; sie merkte, wie ihre eigene innere Unruhe wuchs, und fürchtete, einen Punkt zu erreichen, an dem sie sich nicht mehr beherrschen konnte. Aber in «offiziellen» Situationen hatte sie sich gewöhnlich unter Kontrolle.
«Wenn ich ihr jetzt ein Beruhigungsmittel gebe, schläft sie ein. Dann muß sie im Krankenwagen transportiert werden. Wenn ich sie zuerst zu dir nach Hause fahre, können wir sie ins Bett legen und ihr ein Schlafmittel geben.» An Lene gewandt, fragte Anders: «Geht es bei dir zu Hause? Soll ich ihren Schock nicht lieber im Krankenhaus behandeln lassen?»
Lene schüttelte den Kopf. «Nicht wenn es nicht unbedingt sein muß. Ich kann mich wirklich um sie kümmern. Die anderen sind auch im Haus.»
Zu den Polizisten sagte Anders: «Jetzt können Sie sie nicht verhören. Frühestens morgen, und das ist auch noch nicht sicher.»
«Ich kann eine vorläufige Aussage machen. Ich war ja die ganze Zeit hier», sagte Lene.
Die Polizisten gingen darauf ein. Anders fragte Lene:
«Was ist mit dir? Hast du eine Tablette genommen? Soll ich dich nicht auch heimfahren?»
«Nein», log Lene. Die Tabletten hatten ja nicht gewirkt. «Wenn du ein paar Stesolid hast, gib sie mir. Dann kann ich hinterher selbst nach Hause fahren. Ohne Auto ist es so umständlich. Ich muß auch Birgits Ausweise finden, die brauchen wir in den nächsten Tagen.»
Ein Beamter half ihnen, Birgit aufzurichten und ihr einen Mantel umzulegen.
«Der Wohnungsschlüssel?» fragte Lene.
«In meiner Tasche.»
Sie fanden ihn und gaben ihn Lene.
Birgit ging gebeugt, schluchzend und auf die beiden Männer gestützt zu Anders’ Wagen hinunter.
Lene nahm die beiden Stesolid, die Anders ihr gegeben hatte. Wieso machte das einen «anderen Eindruck», als wenn sie eigene Tabletten genommen hätte? Sie sah, daß der Polizist ihre zitternde Hand bemerkte.
«Das ist in ein paar Minuten vorbei, wenn die Tabletten wirken», sagte sie schwach lächelnd. Sie zündete eine Zigarette an, mußte das Feuerzeug mit beiden Händen festhalten; aber ihre Stimme hatte sie fast ganz in der Gewalt, als sie sagte: «Wollen wir mit dem Protokoll warten, bis Ihr Kollege zurückkommt?»
Er nickte.
«Ich möchte Ihnen nur eben das Balkongeländer zeigen. Sehen Sie, wir haben viele Klienten mit Kindern in diesen Hochhäusern; hier wohnen vor allem Familien mit Kindern.»
Sie standen auf und gingen auf den Balkon. Draußen bereute Lene bereits ihren Vorschlag. Ihr wurde schwindelig; der Anblick des verschütteten Tees und der zerbrochenen Kanne machte es nicht besser. Sie stellte sich ans Geländer, vermied es aber hinunterzusehen.
«Wie Sie sehen, reicht mir die Mauer bis zur Hüfte, die Eisenstangen gehen bis zur Brust. Und abgesehen von der Höhe des Geländers sind die Stangen ein ausgezeichnetes Klettergerüst.»
Ihr fiel ein, daß sie diesen Ausdruck auch Birgit gegenüber gebraucht hatte.
Laut fuhr sie fort: «Viele Familien wagen gar nicht, den Balkon zu benutzen; andere haben teure Sicherheitsvorkehrungen angebracht. Aber die meisten sind trotzdem besorgt. Die Wohnungsbaugesellschaft kümmert sich nicht darum; seltsam, daß noch keine gemeinsame Klage eingereicht wurde. Aber das ist vielleicht das erste Unglück. Vielleicht wird jetzt etwas unternommen.»
Sie verstummte, als ihr bewußt wurde, daß sie zu schnell und gehetzt redete. Inzwischen war der andere Polizist zurückgekommen. Er nickte. «Das geht in Ordnung, ich habe mit dem Arzt vereinbart, daß er anruft, wenn sie vernehmungsfähig ist.»
Und zu Lene: «Können Sie versuchen zu erklären, wie das Unglück passiert ist?»
Lene nickte. Sie erzählte, daß Susan herauskam, als sie sich unterhielten, und sehr unruhig war. Birgit nahm sie auf den Schoß. Als sie aufstand, um Tee nachzuschenken, hatte sie das Kind auf dem Arm, nahe am Geländer. Susan machte eine heftige Bewegung und fiel über das Geländer.
«Sie können sich jetzt auch weigern; aber würden Sie, wenn es geht, gleich einmal den Hergang demonstrieren? Sie haben gesagt, daß Ihnen das Geländer bis zur Brust reicht!» Der eine Polizist sah sie fragend an.
Lene nickte. Sie nahm ein Kissen von einem Balkonstuhl, legte es sich wie ein Kind in den Arm, ging ganz nahe an die Brüstung und sagte: «Aus mehreren Gründen ist diese Demonstration nicht sinnvoll. Erstens geht es um ein äußerst unruhiges Kind, nicht um ein Sofakissen. Zweitens hatte Birgit die Teekanne in der anderen Hand, um einzuschenken, und war vielleicht ein wenig abgelenkt. Drittens, und das gibt wohl den Ausschlag, ist Birgit zehn bis fünfzehn Zentimeter größer als ich; das Geländer reicht ihr also nur bis zur Hüfte.»
Sie warf das Kissen weg und ging ins Zimmer zurück.
Die Polizisten meinten, sie hätten vorläufig genug Material, halfen ihr, Birgits Papiere zu suchen, notierten die wichtigsten Angaben und sagten, sie würden am nächsten Tag anrufen. Ließen sich ihre Adresse und Telefonnummer geben – und ob sie glaube, Auto fahren zu können?
Ja, das könne sie, antwortete sie ruhig. «Als Sozialarbeiterin muß man eine Menge mitmachen und trotzdem die Ruhe bewahren. Obwohl das hier das Schlimmste ist, was ich je erlebt habe.»
Sie zündete sich eine Zigarette an und sah, daß der Polizist unauffällig ihre Hand beobachtete. Sie zitterte nicht mehr, und das schien ihn zu überzeugen.
Sie gingen zusammen hinunter, durch die langen grauen Korridore mit Neonlicht, die an ein Krankenhaus erinnerten. Sie wollte eine Bemerkung über Wohlstandsslums machen, hielt sich aber zurück; sie konnte ja nicht wissen, wie die beiden wohnten.
Hoffentlich waren sie nicht so klaustrophobisch wie sie, dachte sie, als sie mit dem Aufzug in Sekundenschnelle zum Ausgang gelangt waren.
Immer wenn sie in so einem Lift fuhr, mußte sie daran denken, wie sie zum erstenmal eine Familie mit kleinen Kindern im achten Stock besucht hatte.
Sie hatte sich hingekniet, um herauszubekommen, wie viele Stockwerkknöpfe ein kleines Kind erreichen konnte. Sie kannte Untersuchungen, nach denen die Höhe der Wohnung die Spielzeit der Kinder draußen verkürzte. Manchmal lag das an diesen Liftknöpfen. Es war komisch, sich selbst da hineinzuversetzen. Sie hatte sich albern und überrumpelt gefühlt, als der Aufzug im vierten Stock anhielt und ein älterer Herr hereinkam. Sie war schnell aufgestanden, aber bevor sie etwas erklären konnte, waren sie im achten Stock angekommen. Als sie ausstieg, mußte sie lachen. Zum Teil über seinen Gesichtsausdruck, darüber, daß alles so schnell ging, daß sie nichts erklären konnte; und dann, weil sie darüber lachte. Was er wohl gedacht hatte?
Im Zusammenhang mit diesem Erlebnis dachte sie manchmal, daß man sicher oft, wenn einem etwas unverständlich, verrückt oder merkwürdig vorkam, falsche Schlüsse zog, weil einem die richtige Erklärung oder Teile davon fehlten.
Sie verabschiedete sich ruhig von den Polizisten, ging zu ihrem Auto und fuhr nach Hause.
Zu Hause
Andreas kam aus dem Haus, als sie das Auto in die Garage fuhr. Er gab ihr einen Kuß, nahm ihr die Tasche ab und legte den Arm um sie. Langsam gingen sie auf den Eingang zu.
«Birgit schläft; Anders meint, auf jeden Fall die nächsten sechzehn Stunden. Wenn sie aufwacht, sollen wir ihn anrufen. Die Kinder und ich haben schon gegessen. Hast du Hunger?»
Sie schüttelte den Kopf.
«Jetzt möchte ich mit einer Tasse Kaffee ins Bett, deine Hand halten und ein wenig mit dir reden.»
Sie lächelten sich zu. Die Kinder warteten im Eingang auf sie. Tobias ging in die Küche, um Kaffee zu machen, Jonas hatte ihre Lieblingsschokolade gekauft und Maria umarmte und küßte sie und flüsterte: «Es tut mir leid für dich, Mama.» Sie drückte Maria an sich, vergrub ihr Gesicht in ihrem blonden Haar und weinte.
Sie sah zu Andreas hinüber. «Außerdem möchte ich weinen», sie versuchte ein Lächeln. «Die ganze Zeit mußte ich so gefaßt und beherrscht sein.»
Er nickte und ging mit ihr ins Schlafzimmer. Während sie sich auszog und ins Bett legte, befiel sie ein heftiges Gefühl der Einsamkeit.
Andreas saß neben ihr und wollte ihr helfen. Aber sie konnte das nicht mit ihm teilen. Darüber durfte sie nicht reden. Wegen ihrer Schweigepflicht, die sie immer sehr ernst nahm.
Aber auch noch aus einem anderen Grund, der sie befremdete und ihr manchmal das Gefühl gab, isoliert zu sein.
Sie wußte, daß Andreas ihr recht geben würde; er hätte so gehandelt wie sie, aber er würde ihr ohne weiteres recht geben.
Sie fühlte, daß die Ereignisse dieses Tages sie sehr einsam machen würden.
«Anders hat dir ein paar Schlaftabletten dagelassen. Er hat gemeint, daß du sicher sehr angegriffen bist.»
«Ich will jetzt nicht schlafen. Kaffee und Schlaftabletten vertragen sich wohl auch nicht besonders. Ich fürchte mich ein wenig vor dem Einschlafen. Aber vielleicht später. Erst mal muß ich jemand aus meiner Gruppe anrufen, damit sie morgen früh Bescheid wissen.»
Als Andreas hinunterging, um das Telefon zu holen, nahm sie ein paar Valium. Sie spürte den Anfang einer Hysterie. Das mußte sie unterdrücken. ‹Ich kann mir nicht erlauben durchzudrehen›, dachte sie, ‹denn ich kann die Folgen einfach noch nicht übersehen. Ob meine Erklärung die Polizisten überzeugt hat?
Natürlich›, beruhigte sie sich selbst, ‹du bist nur etwas durcheinander, weil du mehr weißt als sie, weil du die Wahrheit kennst. Und Birgit kann morgen Anweisungen erhalten, bevor sie kommen, so daß die Aussagen übereinstimmen.» Aber sie hatte immer noch das Gefühl, etwas übersehen zu haben. Sie wiederholte sich noch einmal ihre ganze Aussage. Alles wirkte schlüssig. Und sie war der einzige Zeuge.
Woher konnte sie das übrigens so genau wissen?
Tobias brachte den Kaffee, lächelte aufmunternd und küßte sie aufs Haar.
«In solchen Situationen kann man nicht wirklich helfen, oder? Du fühlst dich jetzt sicher sehr einsam, nicht wahr? Sag mir Bescheid, wenn ich etwas tun kann.»
«Tobias», sagte sie erstaunt, «wo hast du bloß dieses Verständnis her? Aber du hast nicht ganz recht. Denn obwohl man mit so einem Erlebnis furchtbar allein ist, bedeutet es mir auch sehr viel, daß ihr da seid. Stell dir vor, wenn man niemand hat, zu dem man nach Hause kommen kann!»
«Wie Birgit?»
«Ja». Sie nickte.
Andreas brachte das Telefon. Sie rief Per an. Seine Nummer wußte sie auswendig, weil sie über einen längeren Zeitraum hinweg versucht hatte, ihm zu helfen.
Sie erklärte ihm kurz die Situation. «Sag den anderen gleich morgen auf der Versammlung Bescheid. Vielleicht komme ich im Laufe des Tages; wenn nicht, rufe ich noch mal an.»
Als er ein wenig neugierig nach Einzelheiten fragte, sagte sie: «Nein, weißt du, jetzt nicht; ich bin, ehrlich gesagt, etwas erschüttert.» Und legte auf.
Andreas gab ihr Feuer. Er strich ihr über die Haare und drückte ihre Hand.
«Mit der Post ist heute nichts Besonderes gekommen. Ein paar Uberweisungsformulare, die ich dir hingelegt habe. Aber jemand namens Tor hat angerufen. Ich glaube, er möchte, daß du ein paar Unterrichtsstunden über die Sozialgesetze hältst. Er wollte zurückrufen. Sonst ist nichts gewesen, glaube ich.»
Lene dachte: ‹Was unsere Ehe so glücklich macht, ist auch die unglaubliche Intuition, die er für mich hat. Und von der er sagt, daß ich sie auch für ihn habe.›
«Andreas, ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte.»
«Über was?»
«Über einen Mann und eine Frau, die seit vielen Jahren verheiratet sind und sich immer noch lieben. Erzähl mir warum.»
«Das wird ein langes Märchen», lächelte er.
«Es ist kein Märchen.»
«Märchen ist Umschreibung der Wirklichkeit, aber wenn ich nicht umschreiben darf, wird es noch länger.»
«Ich möchte nur etwas Sicheres und Unerschütterliches hören.»
Er merkte, daß ihr Blick unruhig und ängstlich war.
Sicher und unerschütterlich. So sahen sie beide ihre Ehe. Das lag nicht zuletzt an ihrem Zusammengehörigkeitsgefühl; eine Gemeinschaft, die sie verband, ohne sie zu fesseln, ohne ihre persönliche Entfaltung und Freiheit zu hemmen. Wesentlich dafür war, daß sie im Lauf der Jahre ihre «Gemeinschaftssprache», wie sie es nannten, entwickelt hatten.
Es hatte auch viel mit dem fünfzehnjährigen Tobias, dem dreizehnjährigen Jonas und der zehnjährigen Maria zu tun. Drei Kinder, die sich geborgen fühlten; unter anderem deswegen, weil Lene und Andreas offen und ehrlich zu ihnen waren.
«Andreas, heute wolltest du doch zu Jette?»
«Ja», antwortete er, «aber ich bleibe zu Hause bei dir. Ich habe versucht, sie anzurufen, aber sie ist noch nicht da.»
Jette war Andreas’ Freundin. Lene mochte sie gerne, obwohl sie sehr verschieden waren. Maria verstand sich auch gut mit ihr.
«Nein, Andreas, sag ihr nicht ab. Ich kann sowieso nicht darüber reden, was heute geschehen ist. Das geht erst später. Bald nehme ich die Tabletten von Anders, und dann schlafe ich bis morgen.»
Andreas wirkte unschlüssig. Aber Lene dachte daran, daß Jette enttäuscht sein würde. Und sie selbst hatte das Bedürfnis, allein zu sein und gründlich über alles nachzudenken.
Außerdem hatte sie Angst einzuschlafen. Davor, daß Birgit vor ihr aufwachte und Andreas gegenüber Andeutungen machte.
Am meisten fürchtete sie sich wohl vor ihrer eigenen Reaktion, die immer sehr spät kam.
Abgesehen von realen Ängsten, weil sie eine falsche Aussage gemacht hatte, deren Folgen unabsehbar waren, sowohl auf «offizieller» als auch auf persönlicher Ebene, zum Beispiel in ihrem Verhältnis zu Birgit – abgesehen davon hatte sie Angst, daß ihre Depressionen und Angstanfälle, die sich seit langem nicht mehr gemeldet hatten, zurückkehren könnten.
Sie wußte ja, daß sie sie nie ganz überwinden würde, und hatte sich oft gefragt, welche Umstände oder Probleme sie wieder hervorrufen würden; das Alter, das Klimakterium – oder ein Erlebnis wie dieses?
Über diese Angst konnte sie mit Andreas an diesem Abend oder in dieser Nacht nicht reden. Deshalb war es am besten, wenn er nicht zu Hause war.
Jonas brauchte Hilfe bei seinen Hausaufgaben. Und Lene überredete Andreas, danach zu Jette zu fahren.
Er bestand darauf, nicht eher zu gehen, als bis sie die Schlaftabletten genommen hatte. Sie ärgerte sich, weil er ihr Vorschriften machen wollte, folgte aber, weil sie glaubte, bestimmt zu aufgeregt zu sein, um eine Wirkung zu spüren. Sie verabredeten, daß er entweder anrufen oder um sieben Uhr wiederkommen würde, damit die Kinder rechtzeitig zur Schule gingen. Dann küßte er sie, machte das Licht aus und verließ das Zimmer.
Die Tabletten waren stärker, als sie gedacht hatte. Sie döste vor sich hin, in einem merkwürdigen Zustand zwischen Schlaf und Halbwachsein. Sie überlegte sich, wie weit Recht und Gerechtigkeit doch auseinanderklafften; oft waren es geradezu Gegensätze. Sie dachte an den Unterschied zwischen Jura und Justitia; wie konnte man gerecht sein, wenn man nichts sehen konnte?
Als sie einschlief, hatte sie einen Alptraum. Sie träumte, daß sie aufwachte und mit Justitia redete. Als sie wirklich aufwachte, war sie schweißgebadet. Noch nie hatte sie einen so deutlichen Traum gehabt. Andreas sagte immer, sie solle ihre Träume aufschreiben. Diesmal tat sie es:
«Ich hatte einen Alptraum», sagte sie zu der Gestalt an ihrem Bett.
«Du bist in einem Alptraum», antwortete eine Frauenstimme.
Sie machte das Licht an und erkannte Justitia. Mit der Augenbinde und der Waage in der Hand.
«Justitia, die Gerechtigkeit. Warum bist du eine Frau?»
Sie lachte spöttisch: «Sie haben sich nicht selbst getraut. Nicht einmal, die Verantwortung zu teilen.»
«Warum trägst du eine Augenbinde?» fragte Lene.
«Damit ich nicht beeinflußt werde.» Ihre Stimme klang nachsichtig.
«Beeinflußt zu was?» wollte Lene wissen.
«Mitgefühl, Verständnis, Mitleid.»
«Und die Waage?» fragte Lene. «Wie kannst du Recht gegen Unrecht abwägen?»
«Frag den amtierenden Richter. Lies das Strafgesetzbuch. Und die Prozeßordnung. Vergiß nicht: die neueste Ausgabe. Frag den Staatsanwalt. Die Zeugen.» Ihre Stimme klang hart.
«Justitia, hast du jemals geliebt?» fragte sie.
«Wer liebt schon eine, die Recht gegen Unrecht abwägt, Schuld gegen Unschuld? Wie liebt man mit einer Waage in der Hand?» Das hörte sich verbittert an.
Lene nahm ihr die Waage aus der Hand. Bot ihr einen Platz an. Nahm ihr die Augenbinde ab.
Sie war blind.
«Sie sind kein Risiko eingegangen. Sie haben mich geblendet. Was schließt du daraus?»
«Die Gerechtigkeit läßt sich nicht abwägen, nicht sehen? Die Gerechtigkeit ist blind?» fragte Lene.
Justitia schüttelte nachsichtig den Kopf mit den leeren Augenhöhlen.
«Nein, das Urteil. Die Gerechtigkeit hat oft nichts mit dem Urteil zu tun.»
Sie richtete die leeren Augen auf Lene und sagte: «Gib mir die Binde zurück. Ich bin eitel.»
Lene saß hellwach im Bett. ‹Ich verhalte mich richtig›, dachte sie. Sie ging ins Badezimmer, wusch sich, putzte sich die Zähne, zog ein sauberes Nachthemd an, holte Mineralwasser aus dem Kühlschrank, zündete sich eine Zigarette an und ließ ihren Gedanken freien Lauf.
Lene
Bilanz. Oder: seine eigene Identität suchen und finden. Wer bin ich? Und in welchem Ausmaß bin ich das, was die anderen aus mir machen? Dann war die Frage am wichtigsten, wie man das eine von dem anderen trennen konnte. Oder ob das Ich nicht mit der Zeit zum Produkt der fremden Erwartungen wurde.
Aber obwohl diese Frage nie einfach und umfassend beantwortet werden konnte, war es jedem möglich, seinen Ausgangspunkt in gewissen Grundzügen, Möglichkeiten und Grenzen zu finden und daran weiterzuarbeiten.
Es kam immer darauf an, wenigstens zu Teilen seines Ichs vorzustoßen, an sich selbst zu arbeiten und seine Reaktionen zu analysieren.
Taten Frauen das häufiger als Männer? Einiges deutete darauf hin. Hatten Männer nicht dasselbe Bedürfnis, und wenn nicht, woher rührte dann dieser Unterschied?
Daß Frauen auf vielen Gebieten weniger selbstsicher waren, genügte jedenfalls nicht als Antwort.
Immer mehr Frauen erkannten, wie wichtig es war, sich selbst zu verstehen. Und daß es notwendig war, seine Widersprüche und Ungereimtheiten begreifen zu lernen.
Lene war sich darüber im klaren, daß sie auf die meisten Leute stark und sicher wirkte. Und in vielen Situationen verhielt sie sich so, wie die anderen es von ihr erwarteten. Viele äußerten ein Bedürfnis nach ihrer Stärke.
Es konnte vorkommen, daß sie Angst bekam; vielleicht, weil sie sich plötzlich auf eine Rolle festgelegt fühlte. Wenn sie sich den Erwartungen ihrer Umwelt anpaßte oder ihnen zu entsprechen suchte. Fürchtete sie, daß dieses «Verständnis» ebensogut fehlende Ichstärke sein oder als solche ausgelegt werden konnte?
Andererseits war sie auch – außer so vielem anderen – sehr realistisch, in vielen Situationen mußte sie so sein, das wurde ihr beinahe abverlangt. Und dann sollte sie in anderen Situationen diese realistische, etwas nüchterne Haltung zurücknehmen, um nicht zu dominant und abgeklärt zu wirken.
Aber manchmal belastete es sie ungeheuer, immer für stark gehalten zu werden. Für jemand, dem man sich immer anvertrauen, von dem man immer einen guten Rat und Hilfe erwarten konnte. Die wenigsten dachten daran, welche psychische Energie sie das kostete. Ab und zu fühlte Lene sich sehr versucht, sich zu verweigern und zu zeigen, daß sie auch schwach war. Sie fühlte sich oft unsicher und hilflos. Aber sie wußte, in vielen Situationen wirkte das abschreckend. Deshalb kannten nur wenige, Andreas und ein paar wirkliche Freunde, ihre Schwächen und Ängste.
Es lag auch daran, daß sie, wenn sie ängstlich wurde – und das kam ziemlich oft vor –, einen besonders sicheren Eindruck erweckte, eben um ihre Angst zu überspielen.
Birgit hatte einen ausgezeichneten Spürsinn für ihre Unsicherheit und Schwäche. Vor allem für ihre Schuldgefühle.
Die sie natürlich mit fast allen Frauen gemein hatte. Frauen ohne Schuldgefühle traf man so gut wie nie, noch seltener als Männer, die von Grund auf wußten, worum es dabei ging. Und wie sie einen belasten konnten. Dahinter mußten tiefe erziehungsbedingte Unterschiede stecken, die mit der Zeit verstärkt worden waren. Daran konnte die Gleichberechtigungskommission wohl auch nichts ändern. Immer noch half dagegen nur individuelle Arbeit; allerdings hatten einige Frauen gelernt, sich dabei gegenseitig zu unterstützen. Aber die Analyse des eigenen Verhaltens und der Gründe, warum man sich mit diesen Schuldgefühlen herumschlug, war und blieb vordringlich.
Als sie jünger war, hatte sie ihre positiven und negativen Gefühle, ihre Hemmungen und Minderwertigkeitskomplexe oft genug mit irgendwelchen Ereignissen in ihrer Kindheit erklärt – ziemlich normal verlaufenen Kindheit übrigens.
Wenn sie oder jemand, den sie wirklich liebte, gekränkt wurde, konnte sie so heftig und gnadenlos unversöhnlich reagieren, daß sie vor sich selbst erschrak; das hatte sie auf ihre Kindheit zurückgeführt, ebenso die Kleinlichkeit, die sie Leuten entgegenbringen konnte, die sie beleidigt, ihr Schlechtes nachgesagt oder sie einfach übersehen hatten.
Und irgendwann hatte sie es aufgegeben, die Schuld für ihr Verhalten auf die Kindheit zu schieben. Dafür gab es zwei Gründe: Was nützte ihr eine Erklärung, mit der sie doch nichts weiter anfangen konnte?
Außerdem weigerte sie sich, ihr Leben von Ereignissen aus einer so kurzen Phase ihres Lebens, die sie nie eindeutig festmachen konnte, gesteuert zu wissen.
Hier und jetzt mußte etwas geschehen. Die Probleme mußten von den momentanen Voraussetzungen aus gelöst werden. Alles andere grenzte an Verantwortungslosigkeit; man «konnte ja nichts dafür». Und sie wollte die Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Für ihre Ansichten und ihr Verhalten.
Dieser Entschluß hatte sie ein wenig weitergebracht.
Jahrelang hatte sie unter täglichen Depressions- und Angstanfällen gelitten. Dazu kam, daß ihr Alkoholkonsum sich so weit steigerte, daß ihr auch das angst machte. Sie trank meistens allein und versuchte, es geschickt zu verbergen. Sie trank mit schlechtem Gewissen, um sich die Depressionen vom Leib zu halten.
Sie hatte so ihre Theorie, daß mehreres zusammenkam: Marias Geburt. Sie hatte wegen einem Liebhaber mit der Pille angefangen. Dem ersten. Der sie wegen einer sehr jungen, geschiedenen Frau verließ.
Ohne Erklärung; bis sie nach langem Warten eine gefordert hatte. Er hatte sich eine unbeholfene Geschichte abgerungen, von einem Freund, mit dessen Frau er ein Verhältnis gehabt hatte. Der Freund hatte versucht, sich mit seiner Frau umzubringen; der Versuch war aber so dilettantisch, daß man ihn höchstens als demonstrativ bezeichnen konnte. Meinte Lene.
Ein Kind. Die Pille. Ein Liebhaber. Ein unbarmherziger Tritt. Die erste Depression.
Aber wenn sie es sich genau überlegte, stimmte etwas mit der Zeit nicht. Das Ganze hatte jedenfalls über ein Jahr gedauert; die Depressionen und Angstzustände meldeten sich in immer kürzeren Abständen; zugleich trank sie immer mehr.
Vor einigen Jahren war etwas Entscheidendes passiert. Sie hatten ein paar Freunde zu Besuch gehabt, mit denen sie fast die ganze Nacht durchgesoffen hatte. Andreas trank sehr wenig. Bis dahin hatte er nie zu ihrem Alkoholverbrauch Stellung bezogen. Keine Bemerkungen, keine Vorwürfe; sie hatte ihre Freiheit.
Mitten in der Nacht hatte sie einen Zusammenbruch gehabt. Sie hatte nicht aufhören können zu weinen; betrunken und untröstlich. Ohne zu wissen warum.
Am nächsten Morgen entdeckte sie diese unangenehmen Löcher im Gedächtnis; sie hatte keine Ahnung, was außer ihrem Weinkrampf geschehen war, von dem auch ihre roten, geschwollenen Augen zeugten. Sie hatte es Andreas gegenüber mit einer lächerlichen Erklärung versucht, in der Angst, im Laufe der Nacht irgend etwas Verletzendes gesagt zu haben.
Seine Antwort hatte sie erschreckt. Zum erstenmal hatte sie Härte und Verurteilung in seiner Stimme gehört. Und die Worte!
«Du führst dich auf, als ob du immer im Ausnahmezustand lebst.»
Eine ihrer Gäste hatte sie davon überzeugt, daß ihre Rettung in der Psychoanalyse bestand. Sie fühlte sich eingekeilt. Sie glaubte nicht an die Psychoanalyse, aber sie fürchtete auch, es allein nicht mehr zu schaffen. Sie wollte nicht, daß ihre Kinder eine Alkoholikerin zur Mutter hatten. Und dann das: «Ausnahmezustand»! Auf sie traf das nicht zu, das wußte sie genau.
Sie hatte einen Brief an einen Psychoanalytiker verfaßt, der ihr empfohlen worden war:
Ich wende mich an Sie, weil Sie mir von vielen Seiten empfohlen worden sind. Dies als Kompliment in der Hoffnung, Sie davon zu überzeugen, daß ich ein interessanter Fall bin.
Ich weiß, daß Sie sehr beschäftigt und abgeneigt sind, neue Fälle anzunehmen. Trotzdem hoffe ich, daß Sie Zeit finden werden, mich anzuhören und vielleicht «in Behandlung» zu nehmen.
Wenn Sie sich dazu bereit erklären, werde ich in mancher Hinsicht kein einfacher Patient sein; zum Beispiel was Ihre und meine Arbeitszeit betrifft. Andererseits habe ich mich selbst mittlerweile so satt, daß ich vielleicht nicht so viele Umstände machen werde.
Ich weiß nicht, ob es in psychoanalytischer Sicht von Vor- oder Nachteil ist, daß ich selbst gewisse Überlegungen angestellt und sogar zu einigen richtigen oder falschen Resultaten gekommen bin.
Es geht zunächst ganz einfach darum, daß ich mit einem ziemlich anspruchsvollen Arbeitsverhältnis befriedigend, mit meiner Familie einigermaßen und mit mir selbst furchtbar schlecht zurechtkomme.
Wenn ich mich selbst charakterisieren sollte, dann bin ich wohl so etwas wie eine Frau aus der oberen Mittelschicht mit «Oberschichtproblemen». Ich habe ein glückliches Familienleben und drei unkomplizierte und selbständige Kinder. Eine seit vielen Jahren immer glücklichere Ehe dank eines ungewöhnlich guten Verständnisses zwischen uns – wir kennen keine Krisen; die existieren leider nur bei mir, und zwar meist wegen fiktiver Probleme, unerklärlicher Ängste und Depressionen.
Menschlich und materiell bin ich in einer sehr beneidenswerten Lage. Aber es klappt leider nicht ganz. Bei mir. Deswegen wende ich mich mit der Bitte um Hilfe an Sie.
Ich bin fünfunddreißig, Sozialarbeiterin und von meiner Arbeit sehr in Anspruch genommen. Mein Mann ist Dozent für Theologie an einer pädagogischen Hochschule und ein paar Jahre älter.
Ich hatte eine durchschnittlich glückliche und unauffällige Kindheit, abgesehen vom Tod meiner Mutter, als ich dreizehn war. Ich selbst habe es aufgegeben, die Ursache für meine Probleme dort zu suchen.
Ich wende mich hilfesuchend an Sie. Sie haben wenig Zeit, ich auch, aber ich glaube, ich brauche Ihre Zeit. Ich schreibe, weil ich mich nicht mit einem abschlägigen Bescheid am Telefon zufriedengeben wollte.
Bleibt mir nur noch zu berichten, daß ich zuviel trinke und mit mir selbst unwahrscheinliche Schwierigkeiten habe. Was ich zu verbergen versuche. Ich trinke nicht während meiner Arbeitszeit, aber ich habe Angst, daß meine Kinder es merken.
Es ist schwierig, meine psychische Verfassung zu schildern, weil so viele Faktoren mitwirken. Meine intellektuelle ist einfacher zu umschreiben.
Mein Mann deutet manchmal an; daß ich mich zu «maskulin» verhalte, also meine Existenzberechtigung durch Äußerlichkeiten zu beweisen suche, durch Erfolg in der Arbeit. Er versteht nicht, daß es mir nicht genügt, wenn er mich so liebt, wie ich bin. (Ich kann oftmals nicht verstehen, wie Andreas mich überhaupt aushalten kann.)
Ich weiß, daß ich mich eigentlich glücklich schätzen müßte, und das trägt zu meinem schlechten Gewissen bei.
Bleibt nur noch eine Frage: Wollen Sie mich als Klientin/Patientin annehmen? Vielleicht bin ich gar nicht so kompliziert, wie es jetzt den Anschein hat. Ich weiß nur allein überhaupt nicht mehr weiter. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich die Hoffnung aufgegeben habe, es allein zu schaffen. Jetzt habe ich auch den Glauben an meine Charakterstärke aufgeben müssen.
Ich weiß nicht, was ich noch schreiben soll; ich hoffe nur, daß ich sie überredet habe. Wenigstens zu einem einzigen Gespräch oder einem guten Rat, wenn nicht mehr. Nein, letzteres würde mich wohl eher kränken; gute Ratschläge habe ich schon zu oft bekommen.
Ich finde es ein wenig komisch, daß ich mich noch nie mit dem Engagement um eine Stelle beworben habe, mit dem ich mich jetzt um eine vielleicht monate-, hoffentlich nicht jahrelange Abhängigkeit bemühe; aber auch um eine eventuelle Klärung.
Ihre
Lene Vœrbro
Sie hatte sich beeilt, den Brief wegzuschicken, den ein unterlegener Teil von ihr geschrieben hatte. Dabei versuchte sie, sich ständig einzureden, daß Psychoanalyse ein Privileg sei, ein Vorrecht der wenigen, die es sich leisten konnten. Sie versuchte, sich selbst davon zu überzeugen, daß sie nur aus sozialpolitischen Gründen dagegen mißtrauisch war.
Zehn Tage später erhielt sie eine Antwort und einen ersten Termin.
Er hatte ein paarmal mit ihr gesprochen. Sie hatte nicht auf der Couch gelegen, sondern ihm gegenüber gesessen und allzu schnell gesprochen. Er mußte ihr helfen, sie wollte es in den Griff bekommen.
Im zweiten Gespräch hatte er ihr mitgeteilt, daß er niemand in die Analyse aufnahm, der nicht eine gründliche Voruntersuchung bei einem Psychiater hinter sich hatte. Er hatte ihr einen seiner Freunde empfohlen, dem er Bescheid geben wollte. Sie würde dann erfahren, wann er Zeit für ein Gespräch hatte.
Als sie den Namen hörte, stutzte sie, weil er ihr von irgendwoher bekannt vorkam, aber sie wußte nicht mehr, ob in positivem oder negativem Zusammenhang.
Sie bekam einen Termin. Am Abend davor rief sie Anders an. Sie machte sich Sorgen. Was sollte sie dem Mann eigentlich erzählen? Daß es ihr gut und mies zugleich ging, daß sie zuviel trank – na und?
Anders hatte sie beruhigt.
«Du brauchst überhaupt nichts zu sagen. Er stellt die Fragen. Du brauchst nur zu antworten.»
Sie kam zu früh und schlenderte ein wenig durch die Straßen mit den großen Altbauhäusern. Sie war nervös und zugleich merkwürdig beschämt. Das schlimmste ihrer psychischen Probleme war wirklich ihr schlechtes Gewissen.
Sie wurde davon geplagt, wenn sie Klienten gegenübersaß, die in persönlichen oder ökonomischen Problemen zu ertrinken drohten. Sie spürte es, wenn sie mit den Kindern zusammen war, um den Eßtisch saß; wenn sie Spaß miteinander hatten und wenn sie liebevoll zu ihr waren.
Sie spürte es, wenn Andreas davon redete, wie sehr er sie bewundere, wie sensibel sie sei, wie sehr er sie liebe.
Sie hatte oft das Gefühl, ihnen etwas vorzumachen, ganz anders zu sein, als die anderen glaubten.
Sie ging ins Haus und klingelte. Der Psychiater empfing sie in einem vornehmen Flur und führte sie in ein vornehmes Arbeitszimmer.
Antiquitäten, Mahagoni, blankgeputztes Messing. Sie nahmen zu beiden Seiten des auf Hochglanz polierten Schreibtisches Platz; sie mußte einen Messingleuchter wegstellen, um ihm ins Gesicht sehen zu können. Er paßte völlig zu diesem Raum, aber das war ja bei den meisten Leuten so. Liebevoll dachte sie an ihr eigenes unaufgeräumtes Zuhause, in dem Stille und Schweigen schon beinahe Fremdwörter waren. Hier herrschten sie vor.
Sie sah den vornehmen, distinguierten Herrn an, der sie wiederum still betrachtete. Sie zündete sich eine Zigarette an, nachdem sie vorher gefragt hatte, ob Rauch ihn belästige. Er hatte den Kopf geschüttelt und ihr einen Aschenbecher hingestellt. Sie dachte: «Anders hat gesagt, er stellt die Fragen», als er endlich fragte:
«Warum sind Sie eigentlich zu mir gekommen?»
«Mein Psychoanalytiker hat mich geschickt.»
Lange Pause.
«Ja, er hat mich telefonisch ein wenig über Sie informiert.»
Lange Pause.
«Erzählen Sie mir etwas über sich.»
Sie erzählte, fast eine Wiederholung des Briefes, und sagte: «Außerdem leide ich an Schuldgefühlen, weil meine familiären und auch meine sonstigen Verhältnisse so außergewöhnlich gut sind. Ich bin privilegiert.»
«Das ist doch wohl ein Klischee»; er deutete ein ironisches Lächeln an.
«So war es nicht gemeint», antwortete sie. Und dachte: ‹Du kannst jedenfalls nicht wissen, ob es wirklich zu einem Klischee wird. Wieso soll es ein Klischee sein, bloß weil ich der Meinung bin und es oft sage?›
Genau zehn Minuten später stellte er fest, daß sie sich ruhig darauf einstellen könne, lebenslänglich depressiv zu bleiben, und daß sie deshalb lebenslänglich mit einem Antidepressivum behandelt werden müsse.
Des weiteren stellte er fest, daß sie eine gebildete Frau und klug genug sei einzusehen, daß er mit seiner Diagnose recht habe. Aber andererseits sei es ihr sicher lästig, ihr Leben lang von Tabletten abhängig zu sein; sie sei ja keine schwache Frau.
Aber er zähle auf ihre Intelligenz und Einsicht.
Das Gespräch wurde überhaupt immer feiner und gebildeter. Man redete vornehm und leise. Sie wunderte sich, wie sehr er, das Zimmer und seine Worte sie beeinflußten.
Er redete von gewissen – nicht sehr schwerwiegenden – Nebenwirkungen der Tabletten.
Sie könnten die Nierenfunktion beeinflussen, deshalb solle sie sich in der ersten Zeit ärztlich kontrollieren lassen. Und sie müsse mit einer gewissen Gewichtszunahme rechnen. Das Trinken müsse sie absolut einschränken, denn es sei mit den Tabletten nicht zu vereinbaren.
‹Leicht gesagt›, konnte sie noch eben denken. ‹Und Gewichtszunahme. Ich wiege schon zehn, fünfzehn Kilo zuviel.› Er fragte: «Wann können Sie mit der Behandlung anfangen?»
Sie erzählte, daß sie in drei Wochen mit Andreas für sieben Tage nach Rom fahren wollte.
«Rom ist ja so faszinierend um diese Jahreszeit. Das müssen Sie auskosten. Wir können dann mit der Behandlung anfangen, wenn Sie zurückkommen.»
Dann redeten sie ein wenig über Rom; oder vielmehr, er redete. Sie fühlte sich merkwürdig lahmgelegt, aber das merkte er nicht, denn sie lächelte und nickte an den richtigen Stellen und konnte wohl auch ein paar passende Bemerkungen beisteuern.
Dann war die Audienz beendet.
«Melden Sie sich, wenn Sie zurückkommen. Und gute Reise.»





























