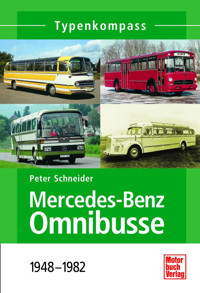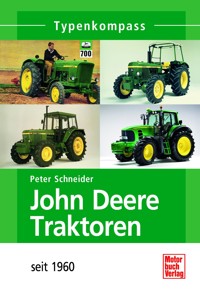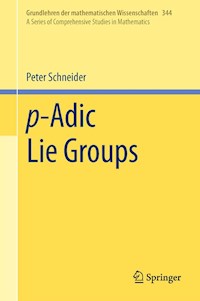8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Schneiders Lenz ist ein Meisterwerk – huckepack sehen wir mit seinen Augen die Risse im Beton der Nachkriegszeit.« Julia Franck Fünf Jahre nach Ausbruch der Studentenrevolte macht ein schmaler Band literarisch Furore: Peter Schneiders Neuerzählung von Büchners Novelle avanciert binnen kürzester Zeit zum Kultbuch einer ganzen Generation. Lenz, Student in einer Großstadt, irrt durch sein Leben: Seine Beziehung scheitert, politische Aktivitäten erschöpfen sich in fruchtlosen Diskussionen, der Versuch, sie durch die Arbeit in einer Fabrik endlich lebendig werden zu lassen, bleibt ergebnislos. Um der drückenden Stagnation zu entkommen, löst er eine Fahrkarte nach Italien. In Rom begeistern ihn die Farben, das Miteinander der Menschen, die Lebenskunst. Aber rasch gerät er an die Kulturschickeria, in der das Politisieren längst dem Psychologisieren Platz gemacht hat. Ein Angebot, sich selbst einem Analytiker anzuvertrauen, lehnt er ab; eine Affäre mit einer Italienerin endet schnell. Wieder bricht er auf – diesmal nach Norditalien. In Trento trifft er auf eine Gruppe linker Studenten und Arbeiter, die ihn brüderlich aufnehmen. Dieses andere Italien wird für Lenz zur Befreiung. Peter Schneider erzählt eine beeindruckende Geschichte über den Mut zur Veränderung und die Suche nach einem authentischen Leben. Sie hat bis heute nicht an Kraft und Brisanz verloren. Lenz ist zu einem modernen Klassiker geworden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Peter Schneider
Lenz
Eine Erzählung
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Peter Schneider
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Peter Schneider
Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er sein Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie aufnahm. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Zu seinen wichtigsten Werken zählen »Lenz« (1973), »Rebellion und Wahn« (2008), »Der Mauerspringer« (1982), »Die Lieben meiner Mutter« (2013) und »Club der Unentwegten« (2017). Seit 1985 unterrichtet Peter Schneider als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton, Georgetown und Harvard. Er lebt in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Schneiders Lenz ist ein Meisterwerk – huckepack sehen wir mit seinen Augen die Risse im Beton der Nachkriegszeit.« Julia Franck
Fünf Jahre nach Ausbruch der Studentenrevolte macht ein schmaler Band literarisch Furore: Peter Schneiders Neuerzählung von Büchners Novelle avanciert binnen kürzester Zeit zum Kultbuch einer ganzen Generation. Lenz, Student in einer Großstadt, irrt durch sein Leben: Seine Beziehung scheitert, politische Aktivitäten erschöpfen sich in fruchtlosen Diskussionen, der Versuch, sie durch die Arbeit in einer Fabrik endlich lebendig werden zu lassen, bleibt ergebnislos. Um der drückenden Stagnation zu entkommen, löst er eine Fahrkarte nach Italien. In Rom begeistern ihn die Farben, das Miteinander der Menschen, die Lebenskunst. Aber rasch gerät er an die Kulturschickeria, in der das Politisieren längst dem Psychologisieren Platz gemacht hat. Ein Angebot, sich selbst einem Analytiker anzuvertrauen, lehnt er ab; eine Affäre mit einer Italienerin endet schnell. Wieder bricht er auf – diesmal nach Norditalien. In Trento trifft er auf eine Gruppe linker Studenten und Arbeiter, die ihn brüderlich aufnehmen. Dieses andere Italien wird für Lenz zur Befreiung.
Peter Schneider erzählt eine beeindruckende Geschichte über den Mut zur Veränderung und die Suche nach einem authentischen Leben. Sie hat bis heute nicht an Kraft und Brisanz verloren. Lenz ist zu einem modernen Klassiker geworden.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1973 by Rotbuch Verlag, Berlin
© 2008, 2019, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Getty Images / Ryan McVay
ISBN978-3-462-32068-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Lenz
»Das muss man gelesen haben …«
1. »Lenz« als Spiegel neuer Mentalitätsstrukturen: das »Kultbuch« und seine Leser
2. Literarische Traditionen
3. »Vom politischen zum poetischen Menschen« – zu Peter Schneider
4. Zur Aktualität von Schneiders »Lenz«
»Er ging gleichgültig weiter, es lag ihm nichts am Weg, bald auf-, bald abwärts, Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, daß er nicht auf dem Kopf gehen konnte.«
Georg Büchner, Lenz
Morgens wachte Lenz aus einem seiner üblichen Träume auf. Er war mit L. kilometerlang in einem Förderkorb durch ein Gebäude ohne Türen und Fenster gefahren. Um sie herum nichts als Wände. Dann war er einen dunklen Schacht hinuntergefallen, viele hundert Meter tief, ohne aufzuschlagen. Ein Fließband hatte ihn aufgenommen, das seinen Sturz in einen waagrechten Flug nach vorn verwandelte. Am Ende des Fließbandes wurde er aufgefangen. Er war erwartet worden: Frauen mit riesigen Brüsten, Zauberer, Clowns, saltoschlagende Kinder, die ganze kaputte Fellinitruppe. Ein Mann in einem flimmernden Kostüm drückte ihm einen Kuß auf den Mund. Lenz wurde wütend. Er sprang aus dem Bett.
Schon seit einiger Zeit konnte er das weise Marxgesicht über seinem Bett nicht mehr ausstehen. Er hatte es schon einmal verkehrt herum aufgehängt. Um den Verstand abtropfen zu lassen, hatte er einem Freund erklärt. Er sah Marx in die Augen: »Was waren deine Träume, alter Besserwisser, nachts, meine ich? Warst du eigentlich glücklich?«
Während er Wasser für den Kaffee in den Kessel laufen ließ, überfiel ihn der Wunsch, L. anzurufen. Es ist noch zu früh, dachte Lenz. Sie wird mit dieser verschlafenen Kinderstimme »Hallo« sagen und mich dann fertigmachen, daß ich schon wieder anrufe. Er vergaß, den Kessel auf die Flamme zu setzen, und ging zum Telefon. Er hob den Hörer ab, hörte lange, ohne zu wählen, das Tuten und legte wieder auf. Er verließ das Haus. Es war noch früh, die Vögel brüllten. Er kaufte sich eine Zeitung und sah die Leute in den S-Bahnhof strömen. Männer mit großen Schritten und Aktentaschen, Frauen auf flachen Schuhen, immer etwas hastiger als die Männer. Sie gehen zur Arbeit, dachte Lenz. Er verband mit dem Satz keine Vorstellung.
Er ging zum Fahrkartenschalter, holte sich eine Karte und rollte mit den anderen die Treppe zum Bahnsteig hinauf. Auf halber Höhe drehte er sich um und drängte unter dem Schimpfen der hinter ihm Stehenden die Treppe wieder hinab. »So einem gehört was aufs Ohr gepatscht, daß er aufwacht.« »Halt’s Maul«, rief Lenz nach hinten. Es fiel ihm nichts Besseres ein. Er ging in eine Telefonzelle und wählte die Nummer von L. Keine Antwort. Wieder hinauf auf den Bahnsteig, der sich inzwischen geleert hatte. Er nahm den nächsten Zug und fuhr in den Westen der Stadt. Eine Zeitlang stellte er sich vor, daß die Häuser und Straßen auf Schienen an ihm vorübe rrollten. Er wunderte sich über die Helligkeit, die jeden Gegenstand besonders hervorhob. Die Fenster der oberen Stockwerke, die Baumkronen, die von hier oben wie Büsche aussahen, die Autobahnen unter dem Zug, alles, als sähe er es zum ersten Mal. Ganz kurz war ein Lied von den Doors in seinem Kopf, erst die Melodie, später der Text: people are strange, when you’re a stranger, faces look ugly, when you’re alone. Als er die Zeitung aufschlug, sah er die Zähne des Reißverschlusses an seinem Mantel. Sie kamen ihm zu groß vor. Er las eine Überschrift, die über die ganze Seite ging: Sittenstrolch verhaftet, Türke missbraucht 13jährige. Neben ihm eine etwa 60jährige Frau mit einer großen Nase, die sie zum Mitlesen über seine Schulter hing. Lenz hatte keine Lust weiterzulesen, er wartete, bis sie fertig war, und blätterte ihr dann um. Er schaute in die verarbeiteten Gesichter seiner Nachbarn, die dieselbe Überschrift lasen. Dann wieder die alte kindische Vorstellung: das Hochhaus des Verlegers sackt brennend in sich zusammen.
Nach ein paar Stationen stieg Lenz um. Der Bahnhof war alt, fast eine Ruine. Zwischen Gleisen, die nicht mehr befahren wurden, wucherte Gras. Büsche wuchsen an abgestellten Waggons hoch, das Laub hing über Dächer und Fenster, in der Luft ein schwerer Geruch. Wie von Kastanienbäumen im Frühling, dachte Lenz, sah dann, daß da tatsächlich Kastanienbäume waren. Er sah eine abschüssige Straße vor sich, es war die Stadt, in der er aufgewachsen war. Mit dem Rad fuhr er unter den Kastanienbäumen hindurch. Die Äste bildeten ein Dach über die Straße, und der verbotene Samengeruch, den er sich morgens nach dem Aufstehen von den Händen wusch, strömte von den Blättern herab und verfolgte ihn bis vor das Schultor. Der einfahrende Zug riß ihn aus der Vorstellung, jemand habe seinen Namen gerufen.
Er fuhr lange, er wußte nicht, wohin, dann stieg er aus und verließ den Bahnhof. Als er zurückschaute, sah er den Zug auf einer Brücke davonfahren, es war ihm, als führe er ihm davon. Dann ließ er sich von dem Menschenstrom, der aus dem Bahnhof drängte, wegtragen. Er war mitten in der Stadt, es waren andere Leute um ihn herum. Das schnelle Anfahren der Autos, wenn die Ampel auf Grün schaltete, störte ihn. Es war einer der ersten warmen Tage im Jahr, und wie auf einen Gongschlag, der durch die ganze Stadt dröhnte, kamen die Frauen zum ersten Mal ohne Strümpfe und in leichten Pullovern auf die Straße. Überall neben ihm, vor ihm, hinter ihm trippelte und stöckelte es, die Beine der Frauen waren unglaublich weiß, und ein paar von den jungen Männern hatten schon etwas von dieser Art zu gehen an sich, in der man so über die Fußspitzen federt. Zum ersten Mal wippte und ruckte es wieder unter den Pullovern, Lenz spürte ein unruhiges Gefühl, das irgendwo im Magen beginnt und bis in die Fingerspitzen geht, aber dort nicht aufhört. Zuerst wehrte er sich. Er kniff die Brauen zusammen, als dächte er nach. Aber es war so ein Tag, an dem jeder jeden mit der Tatsache bekannt machte, daß er unter anderem ein Geschlechtsteil besaß.
Aus einer offenen Tür kam ziemlich schnelle Musik, im Vorbeigehen zog sie ihn fast zurück. Er blieb stehen und drückte seine Nase an ein Schaufenster, hinter dem ein schönes großes Mädchen gerade ein paar Sachen zurechtlegte. Das Mädchen schnippte mit den Fingern gegen das Fenster, genau dahin, wo Lenz seine Nase hatte. Lenz zuckte zurück, das Mädchen lachte, und weil er zurückgezuckt war, schaute sie nochmal hin und machte so eine Geste, als könne er ruhig mal reinkommen. Lenz freute sich so darüber, daß er einfach weiterging.
An einem anderen Tag kam der Student Dieter, der seit ein paar Monaten mit Lenz in einer Betriebsgruppe arbeitete. Als Lenz seinen strahlenden Blick sah, der eine Dauereinrichtung bei ihm war, bekam er gleich schlechte Laune. »Weißt du schon, wo unsere Gruppe sich morgen trifft, vor der Demonstration?« »Ich geh nicht hin«, erwiderte Lenz. Dieter sah ihn ungläubig an. »Flugblätter hast du mitgeschrieben, hast sie mitverteilt und jetzt willst du nicht mitgehen?« »Stimmt«, sagte Lenz, »in den Reihen der Arbeiterklasse, die ja durch uns gebildet werden, lasse ich diesmal ein gähnendes Loch.« Dieter setzte ihm zu, was in ihn gefahren sei, er erkenne Lenz nicht mehr wieder, schon seit einiger Zeit sei ihm aufgefallen, daß Lenz sich absondere. »Es ist nur, daß ich diesmal nicht mitgehe, das ist alles.« Er müsse seinen Standpunkt erläutern, schon etwas mehr sagen, so könne er das den anderen nicht vermitteln. »Vermitteln, vermitteln«, rief Lenz, »ich träume zu schlecht.« Dieter wurde wütend, Lenz solle sich erklären, seine Kritik wenigstens äußern, Lenz wollte nicht darauf eingehen.
Am nächsten Morgen klingelte Lenz bei einem Mädchen, das er einige Tage zuvor auf einem Fest kennengelernt hatte. Er wußte von ihr nur, wie sie sich beim Tanzen bewegte und daß sie Marina hieß. Als sie die Tür aufmachte, war sie erstaunt, daß Lenz davor stand. Lenz fragte, ob er einen Tee bei ihr trinken könne. Sie war ziemlich verwirrt, sie lehnte nicht ab. Sie ging sofort in die Küche und setzte das Wasser auf. Während sie sich in der Küche zu schaffen machte, spürte Lenz, wie die Luft im Zimmer zentnerschwer wurde. Er machte das Fenster auf und schaute sich die fetten grünen Blätter an den Bäumen an, dann suchte er nach einem Möbelstück, auf das er die Beine legen könnte. Marina stellte den Tee auf den Tisch und setzte sich Lenz gegenüber. Weil ihm nichts einfiel, was er sagen könnte, griff er gleich nach der Teekanne. Sie nahm ihm die Kanne wieder weg, der Tee müsse erst ziehen. Wie Lenz auf die Idee gekommen wäre, sie zu besuchen. Lenz gab zur Antwort, die Idee wäre ihm heute morgen gekommen, gleich nach dem Aufstehen. Er habe sie einmal besuchen, mit ihr reden wollen und so fort. Er vermied es gerade noch, sie nach einem Buch zu fragen, von dem sie auf dem Fest gesprochen hatte und das ihm im Moment völlig gleichgültig war.
Sie stellte dann das übliche Verhör mit ihm an, was er mache, in welcher Gruppe er arbeite, was er von den anderen Gruppen hielte, in denen er nicht arbeite. Bei irgendeinem Satz über das Verhältnis von politischer Arbeit und persönlichen Schwierigkeiten fiel Lenz ein, daß er genau denselben Satz schon vor ein paar Tagen gesagt hatte, ohne daß er damit je auf Widerspruch gestoßen war. Er unterbrach sich, er rede lauter Blabla, lauter braves, vorgekautes Zeug. Er habe Lust auf sie, genau deswegen sei er gekommen. Er ging zu ihr hin und faßte sie an. Sie kenne ihn noch gar nicht, sagte sie. Durch diese Fragen und Antworten lernt man sich nicht kennen, erwiderte Lenz. Es gibt nur ein paar Arten, sich kennenzulernen, wenn man miteinander arbeitet, wenn man zusammen spinnt, wenn man sich anfaßt. Sie wehrte sich erst, dann nicht mehr. Es störte Lenz, daß jetzt alles so schnell ging. Sie rissen sich die Kleider vom Leib, ohne recht hinzuschauen. Es war dann sehr schön, es gibt nichts weiter dazu zu sagen. Später, als sie nebeneinanderlagen, tat Lenz ihre Zärtlichkeit körperlich weh. »Erzähl mir, was du machst«, sagte er.
An einem anderen Tag stellte sich Lenz im Büro einer großen Elektrofirma vor. Vor dem Zimmer des Personalchefs warteten mehrere Männer, die Lenz misstrauisch ansahen. Lenz unterschied griechische und türkische Satzfetzen. Griechisch hatte er einmal in den Ferien gelernt, er verstand ein paar Wörter. Einer der Wartenden erzählte, daß er schon zum dritten Mal herkomme und nun schon seit zwei Stunden warte. Wenn er keine Arbeit finde, werde er aus dem Wohnheim geworfen. Lenz verstand nicht genau, was er über die Miete sagte, die er bezahlte. Der Personalchef öffnete die Tür und warf einen kurzen Blick auf die Wartenden. Er bat Lenz hereinzukommen. Lenz zögerte, die anderen blickten ihn an, als hätte er sich mit dem Personalchef gegen sie verschworen. Der Personalchef wiederholte seine Aufforderung. Lenz gehorchte, um nicht aufzufallen, merkte dann, daß er damit nur dem Personalchef nicht auffiel. Der bot Lenz eine Stelle an einer automatischen Rechenmaschine an. Lenz lehnte ab, er wolle lieber am Band arbeiten. Der Personalchef machte ihn darauf aufmerksam, daß er dann wesentlich weniger verdienen würde. Außerdem sei es nicht üblich, daß Männer am Band arbeiten. Allenfalls käme eine Arbeit im Einzelakkord in Betracht. Seiner Frage, welchen Beruf Lenz denn vorher ausgeübt habe, er sähe doch, daß er in ihm einen intelligenten Menschen vor sich habe, wich Lenz aus. Er bestand darauf, als Hilfsarbeiter eingestellt zu werden. Der Personalchef händigte ihm einen Vertrag aus, den Lenz soweit wie möglich falsch ausfüllte. Lenz wurde für 4,20 DM pro Stunde eingestellt.
Beim Hinausgehen wurde Lenz von einem türkischen Arbeiter angesprochen, der ihn nach dem Ergebnis seiner Verhandlung mit dem Personalchef fragte. Der Türke erzählte ihm, wie er in einem Zug, in dem nicht einmal Platz zum Sitzen war, drei Tage lang nach Deutschland gefahren war. Vorher, bei der Untersuchung durch die deutschen Ärzte, hatte er einen Arm, den er sich gerade gebrochen hatte, bewegt, als sei er gesund. »Du hast dich gesund gestellt, um arbeiten zu können?« fragte Lenz. Er mußte sich gegen den Gedanken wehren, daß er dem Türken den Arbeitsplatz weggenommen hatte. Der Türke erzählte dann von einem kleinen Unfall, den er mit dem Auto eines Freundes gehabt hatte. Bei der Blutprobe wurde ein zu hoher Alkoholspiegel festgestellt. Er wurde zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Da er so seinen Arbeitsplatz verlor, erlosch seine Aufenthaltsgenehmigung, und er mußte fürchten, in die Türkei abgeschoben zu werden. Seit einer Woche bemühe er sich vergeblich um Arbeit. Die Personalchefs verlangten alle eine genaue Rechenschaft darüber, was er in der Zeit, die er in Deutschland sei, gemacht habe. Lenz gelang es kaum zuzuhören. Am meisten achtete er auf die Augen des Türken und auf seine kraftvollen, boxerhaften Armbewegungen. Er hatte den heftigen Wunsch, die Welt durch seine Augen zu sehen. Für einen Augenblick war es ihm, als müßte er ihm um den Hals fallen, ihn sich zum Freund machen. Lenz ließ sich von dem Türken in dessen Zimmer mitnehmen. Sie setzten sich auf das Bett und fingen sofort an zu trinken. Ein zweites ungemachtes Bett stand leer. Sein Kollege sei auf Arbeit, erklärte der Türke, wenn er zurückkomme, werde er ihn mit einem Essen empfangen. Ob Lenz kochen könne. Später nahm Lenz die Gitarre, die an der Wand hing, und griff ein Lied, zu dem er die Worte vergessen hatte. Der Türke fragte, was für ein Lied er da spiele. Lenz erwiderte, es sei ein Lied über einen Mann, der zum ersten Mal nach Amerika kommt und denkt, das sprengt ihm den Kopf auseinander. Lenz verabschiedete sich hastig, er versprach wiederzukommen.
Mitten in der Nacht wachte Lenz auf. Er hatte das Gefühl, nicht allein im Zimmer zu sein. Ihm war, als läge L. neben ihm und beugte sich mit ihren Haaren über sein Gesicht. Als er ihre Berührung zu spüren glaubte, machte er Licht. Er machte sich klar, daß er seit drei Monaten allein wohnte. Dann schien es ihm wieder ganz unglaublich, allein in diesem Zimmer zu schlafen. Er meinte, L.s Geruch im Zimmer zu spüren. Sein Glied stand groß und lästig unter der Bettdecke. Er begann es zu streicheln, ließ aber davon ab, als er merkte, daß sich alle seine Phantasien auf weit zurückliegende Erlebnisse bezogen. Er fühlte eine unangenehme Kraft in sich hochsteigen, die seinen Körper starr machte. Er schlug mit dem Kopf und den Fäusten gegen die Wand. Gleichzeitig erschien es ihm blödsinnig, wie er sich benahm. Er wollte sich mit Gewalt von den Bildern befreien. Er begann zu brüllen, merkte dann, daß er es sich nur vorstellte.
Er kleidete sich an und ging aus dem Haus. Es wurde gerade hell, in dem Licht sah die Stadt aus, als ob sie gerade aus dem Meer aufgetaucht wäre. Die Straßen waren leer und glatt, wie von blauem Eis überzogen, ein paar Zeitungsblätter lagen regungslos in den Rinnsteinen, wenige Autos standen da, totes Ungeziefer, das von den Wänden gefallen ist. Als Lenz die Häuserwände hinaufschaute, bewegte sich nichts, kein Vorhang wurde zurückgezogen, kein Fenster geöffnet, nirgends ein Licht. Anfangs lief er mit großen schweren Schritten, seine Glieder zogen an ihm, es war, als hätte er Blei in den Fingern und Zehen. Dann fing er an zu rennen, erst langsam mit gleichmäßigem Atem, dann schneller, in einem Hauseingang löste sich ein Paar erschreckt aus einer Umarmung, der Mann sprang auf die Straße und schaute nach, ob er vielleicht einem Verfolger behilflich sein könnte. Lenz rannte, ein Zeitungsblatt verfing sich an seinem Schuh und flog zerfetzt auf die Straße, die Häuserwände und Schaufenster sprangen vor ihm zurück. Einmal, als er die Straße hinaufschaute, war ihm, als sei dort die Stadt zu Ende, als öffnete sich dahinter eine bekannte Landschaft, aber er konnte nicht mehr, er blieb keuchend stehen. Irgendwo ein Wecker, Fenster wurden geöffnet, Radiomusik kam heraus, in einem Hinterhof wurde ein Motor angelassen. Als Lenz zurückging, war die Angst weg, er fühlte sich leicht.
Am Morgen um halb sieben begann Lenz mit der Arbeit in der Fabrik. Der Meister zeigte ihm seinen Arbeitsplatz und erklärte ihm kurz, was er zu tun hätte. Er begrüßte Lenz freundlich, als würde er ihn schon kennen. Er hatte nur drei Haare auf dem Kopf, die er sich ständig aus der Stirn strich. Lenz’ Aufgabe bestand darin, elektrische Röhren zusammenzuschweißen. Als der Meister ihn allein gelassen hatte, beobachtete Lenz seine Nachbarin, um seine Arbeit schneller zu lernen. Die Frau neben ihm breitete beide Arme aus wie im Flug, zog sie ein und nahm beim Einwinkeln der Arme, als würde sie es nur zufällig berühren, das zu schweißende Material in beide Hände, wippte, während sie es aufnahm, mit dem Körper nach vorn, um drei-, viermal auf das Fußpedal zu treten – das erste Teil war angeschweißt. Dann wieder Ausbreiten der Arme, Schwungholen, der gleiche Ablauf, bis der zweite Schweißvorgang beendet war. Dann die fertig geschweißten Röhren in den Raster stecken und von vorn beginnen. Am Anfang stürzte sich Lenz auf die Teile und nahm sie so schnell auf, wie er nur konnte. Dann merkte er, daß er so eher langsamer arbeitete, als wenn er die Bewegungen gliederte und einen bestimmten Rhythmus einhielt. Das Tempo hing vollkommen von der Maschine ab, seine Aufgabe bestand nur darin, seinen Körper in denselben Rhythmus zu bringen. Je weniger er sich gegen den vorgegebenen Rhythmus der Maschine wehrte, desto schneller füllte sich das Raster mit fertigen Röhren. Als er anfing, den Arbeitsvorgang zu beherrschen, genoß er es, eine Zeitlang jeden Augenblick zu spüren, der verstrich.
Aus den Augenwinkeln sah er neben seinen Ellbogen das rhythmische Auf und Ab der Arme an den benachbarten Maschinen, er hörte die kurzen telegrammartigen Botschaften, die zwischen den Maschinen hin- und herflogen, es waren knappe genaue Mitteilungen über das Mittagessen, den Friseur, den Einkauf, die Kinder. Alle Bewegungen und Geräusche fügten sich in eine Grundbewegung und ein Grundgeräusch ein, das die ganze Halle beherrschte und dessen Zwecke Lenz gleichgültig waren. Er spürte keinen Zwang, irgend etwas, das er jetzt wahrnahm, mit etwas anderem, das er früher wahrgenommen hatte, zu vergleichen. Er hatte nur einen unwiderstehlichen Drang nach Verzögerung. Er hätte die ganze Welt mit einem Hebelgriff an der Maschine anhalten mögen, nur um zuzusehen, wie sie sich wieder in Gang setzte. Nach acht Stunden, als das Klingelzeichen ertönte, ging er müde und zufrieden nach Hause.