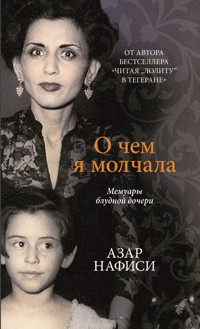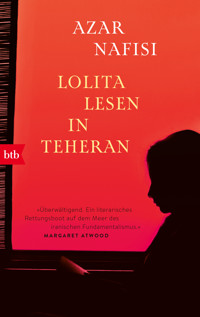10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein kämpferischer Appell für Literatur als Mittel des Widerstands und Empowerment: New-York-Times-Bestsellerautorin Azar Nafisi (»Lolita lesen in Teheran«) mit einem aufrüttelnden Text über die Macht der Bücher.
In Form von Briefen an ihren verstorbenen Vater (früherer Bürgermeister von Teheran und politischer Gefangener des Schah-Regimes), der ihr in ihrer Kindheit die Augen dafür öffnete, wie Literatur uns in Zeiten der Krise retten kann, stellt Nafisi die brennenden Fragen unserer Zeit – mit ihrer Lektüreliste bewaffnet Nafisi die Leser*Innen für den Widerstand. Sie greift dabei auf ihre persönlichen Erfahrungen als Frau, als Leser*in und Lehrende in Teheran zurück, die von der Universität verwiesen wurde, als sie sich weigerte, den Schleier zu tragen, und schließlich in die USA emigrierte, wo sie als Professorin Literatur unterrichtete. Nafisi ist überzeugt: Für das Überleben der Demokratie weltweit ist das Lesen unabdingbar. Ob James Baldwin oder Margret Atwood, ob Platon oder Salman Rushdie, Lektüre ist immer ein Weg in Richtung Freiheit: persönlich und politisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch
Ein kämpferischer Appell für Literatur als Mittel des Widerstands und Empowerment: New York Times-Bestsellerautorin Azar Nafisi (Lolita lesen in Teheran) mit einem aufrüttelnden Text über die Macht der Bücher in turbulenten Zeiten.
In Form von Briefen an ihren verstorbenen Vater (früherer Bürgermeister von Teheran und politischer Gefangener des Schah-Regimes), der ihr in ihrer Kindheit die Augen dafür öffnete, wie Literatur uns in Zeiten der Krise retten kann, stellt Nafisi die brennenden Fragen unserer Zeit – mit ihrer Lektüreliste bewaffnet Nafisi die Leser*innen für den Widerstand. Sie greift dabei auf ihre persönlichen Erfahrungen als Frau, als Leserin und Lehrende in Teheran zurück, die von der Universität verwiesen wurde, als sie sich weigerte, den Schleier zu tragen, und schließlich in die USA emigrierte, wo sie als Professorin Literatur unterrichtete. Nafisi ist überzeugt: Für das Überleben der Demokratie weltweit ist das Lesen unabdingbar. Ob James Baldwin oder Margaret Atwood, ob Platon oder Salman Rushdie, Lektüre ist immer ein Weg in Richtung Freiheit: persönlich und politisch.
Zur Autorin
Azar Nafisi unterrichtete im Iran an verschiedenen Universitäten Literatur. Weil sie sich weigerte, den Schleier zu tragen, erhielt sie 1981 Lehrverbot an der Universität von Teheran. 1997 verließ sie den Iran und wanderte in die USA aus. Sie war Fellow am Foreign Policy Institute der Johns Hopkins University in Baltimore. Mit Lolita lesen in Teheran landete sie einen internationalen Bestseller. Azar Nafisi lebt heute in Washington, D. C.
Azar Nafisi
Lesegefährlich
Die subversive Kraft von Literatur in unruhigen Zeiten
Aus dem Englischenvon Cornelius Reiber
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Read Dangerously« bei Dey St.,an Imprint of William Morrow, Inc.,HarperCollins Publishers, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt undenthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2023
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
© 2022 by Azar Nafisi
All Rights Reserved
© der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by btb VerlagCovergestaltung: semper smile, München,nach einem Entwurf und unter Verwendungeiner Illustration von Nathan Burton
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
MK · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-29838-8V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Inhalt
Vorbemerkung der Autorin
Einführung
Der erste Brief:
RUSHDIE, PLATON, BRADBURY
Der zweite Brief:
HURSTON, MORRISON
Der dritte Brief:
GROSSMAN, ACKERMAN, KHOURY
Der vierte Brief:
ATWOOD
Der fünfte Brief:
BALDWIN, COATES
Fazit
Dank
Anhang
Bibliografie
Für meine Familie, Bijan, Negar und Dara Naderi.
Für meine Enkelkinder, Cyrus Colman Naderi und Iliana Nafisi Guedenis. Und in Erinnerung an Bryce Nafisi Naderi.
»Gefährlich schreiben für Menschen, die gefährlich lesen. Das, dachte ich immer, bedeutet es, Schriftstellerin zu sein. Zu schreiben und dabei zu wissen, dass eines Tages irgendwo irgendjemand sein Leben riskieren wird, um diese Worte zu lesen, wie trivial sie auch sein mögen.«
Edwidge Danticat, Create dangerously: The Immigrant Artist at Work
Vorbemerkung der Autorin
Das vorliegende Buch stellt in vielerlei Hinsicht das letzte eines Quartetts dar, dessen erste drei Teile die Bände That Other World, Lolita lesen in Teheran und The Republic of Imagination bilden, nachdem dazwischen noch meine Memoiren Die schönen Lügen meiner Mutter erschienen sind.
Wie in den vorausgegangenen Titeln greife ich auch in Lese gefährlich immer wieder auf Erfahrungen aus meinem Leben im Iran und in den Vereinigten Staaten zurück. Wer mit meinen anderen Büchern vertraut ist, wird daher einige biografische Konturen wiedererkennen, auch wenn ihnen in diesem Band eine andere Bedeutung zukommt.
Einführung
»Verliebt man sich in ein Buch, hinterlässt es seine Essenz wie radioaktiver Fallout in einem Acker, sodass gewisse Früchte dann nicht mehr im Leser gedeihen, doch gelegentlich entstehen andere Gewächse, merkwürdigere, fantastischere.«
Salman Rushdie
Am 8. Oktober 2016 schrieb ich einen Brief an meinen Vater, der bereits seit zwölf Jahren tot war. Ich weiß das Datum noch, weil ich in dem Brief erwähnte, dass am Vortag die Washington Post über das sexistische Gespräch zwischen Billy Bush und Donald Trump berichtet hatte, in dem Trump mit sexuellen Übergriffen auf Frauen prahlte.
Zu Lebzeiten meines Vaters schrieben wir uns oft Briefe. Das erste Mal schrieb er mir, als ich vier Jahre alt war, in einem Tagebuch, das nur an mich gerichtet war und das ich nach seinem Tod unter seinen Papieren und anderen Tagebüchern fand. Ich selbst schrieb ihm meinen ersten Brief, als ich sechs war und er in Amerika studierte. Ich kritzelte ein paar Worte an ihn auf Papierschnipsel, benutzte dabei die Anrede Baba jan, was auf Persisch »liebster Papa« bedeutet, und unterschrieb mit »Babas Tochter«. Wir schrieben uns, wenn einer von uns auf Reisen war, aber auch, während wir im selben Land lebten – und sogar im selben Haus.
Wir schrieben uns lange Briefe zu wichtigen Anlässen: als ich mit dreizehn Jahren nach England geschickt wurde, um dort zur Schule zu gehen, oder als mein Vater, damals Bürgermeister von Teheran, 1963 aus politischen Gründen ins Gefängnis kam – weil er die Befehle seiner Erzfeinde, des Premiers und des Innenministers, nicht befolgt hatte. Wir schrieben uns Briefe, als er nach vier Jahren Haft in einem sogenannten Übergangsgefängnis schließlich in allen Anklagepunkten freigesprochen wurde. Wir schrieben uns Briefe, als ich mit achtzehn zum ersten Mal heiratete und er nicht zur Hochzeit kommen konnte, weil er im Gefängnis saß, und ich schrieb ihm, als ich an der University of Oklahoma studierte, zusammen mit meinem ersten Mann. Mein Vater war der Erste, dem ich von meiner unglücklichen Ehe und meiner Entscheidung schrieb, mich scheiden zu lassen, und einige Jahre später von meinem zweiten Mann, Bijan, und meiner Entscheidung, ihn zu heiraten.
Ich machte meinen Collegeabschluss und blieb für die Promotion, die ich kurz nach der Islamischen Revolution 1979 abschloss. Ich kehrte in den Iran zurück und arbeitete als Dozentin, wurde aber von der Universität verwiesen, weil ich mich weigerte, den vorgeschriebenen Schleier zu tragen. Natürlich ging es in unseren Briefen auch um diese Ereignisse. Wir schrieben uns, als meine Tochter Negar und mein Sohn Dara geboren wurden. Als ich im Juli 1997 wieder nach Amerika zog, schickten wir uns lange Faxe, in denen wir uns über verschiedenste Themen austauschten, persönliche, politische und intellektuelle – darüber, wie glücklich ich mich schätzen konnte, dass ich mit meinem Mann und unseren Kindern in Washington, D. C., lebte, derselben Stadt, in der auch einige meiner engsten Freunde und meine lieben und großzügigen Schwägerinnen mit ihren Familien lebten; wie toll es war, unzensierte Filme zu sehen und unzensierte Bücher zu lesen; wie sehr ich ihn vermisste. Ich schrieb darüber, wie interessant meine neue Arbeit war, und wir tauschten uns über die Bücher aus, die wir gerade lasen, darüber, was man von Gandhi, Dr. Martin Luther King jr. und Montaigne lernen kann. Er erstellte eine Liste mit großen Werken der iranischen Literatur, die ich meinen Kindern zu lesen geben solle, »damit sie sich an den Iran erinnern«, wie er sagte. Wir sprachen über die Bücher, die ich in meinen Seminaren unterrichtete, über Amerikas Flucht vor der Realität und seine zunehmende Vereinnahmung durch Komfort und Unterhaltung. Ich schrieb ihm, wenn ich glücklich war, und schrieb ihm, wenn ich unglücklich war, ich schrieb ihm, wenn ich mich freute und wenn ich wütend oder frustriert war.
An jenem Tag im Oktober schrieb ich ihm, weil ich frustriert war von den beiden Ländern, in denen ich zu Hause war und bin. Im Iran herrschte weiterhin die Theokratie; trotz der enormen Unzufriedenheit der Menschen und der anhaltenden Proteste hatte sich nichts geändert. Die Ayatollahs schikanierten, inhaftierten, folterten und töteten nach wie vor unschuldige Bürgerinnen und Bürger. In Amerika kam es dagegen zu einer rasant fortschreitenden Polarisierung der Gesellschaft, bedingt durch zu viel Ideologie und zu wenig Diskussion – und so drastisch sich das Land in vielem von der Islamischen Republik unterschied, gab es doch auch immer wieder Ähnlichkeiten. Mein Vater und ich tauschten uns oft darüber aus, wie wir mit unseren Unterdrückern umgehen sollten, mit Menschen, die wir nicht nur als Gegner, sondern als Feinde bezeichnen. Viele unserer Briefe drehten sich im Laufe der Jahre um seine Haft und die dafür Verantwortlichen, und durch die Revolution und den Krieg wurde die Frage nach dem Umgang mit dem Feind später zu einem fast täglichen Thema.
Und jetzt, in Amerika, komme ich auf dieselbe Frage zurück, weil ich sie als zentral für den Erhalt der Demokratie betrachte. Ich schrieb meinem Vater, dass mir die Worte fehlten angesichts der Kandidatur Trumps, nicht nur wegen Trump als Mensch, sondern auch wegen allem, wofür er steht, und was das über uns als Land aussagt. Ich schrieb ihm, dass wir uns in der Ära Trump nur mit unseren Feinden beschäftigten, seien sie real oder erfunden, dass unser Handeln vor allem in Reaktionen auf diese realen oder erfundenen Feinde bestand. Ich schrieb meinem Vater auch, dass ich ihn vermisste: »Wie wir auf Persisch sagen: Dein Platz ist leer.« Noch nie war sein Platz so leer gewesen.
Ich schrieb ihm, dass ich mich zeitlebens als seine größte Verteidigerin, Vertraute, Freundin und Mitverschwörerin gefühlt hätte, trotz der Zeiten, in denen wir verärgert waren über den anderen oder uns von ihm verlassen fühlten und enttäuscht waren. Ich schrieb: »Manchmal war ich hart zu dir, mit derselben Konsequenz, mit der ich dich geliebt habe. Doch dein Tod und die Distanz haben nun andere Gefühle zum Vorschein gebracht, die in mir aufsteigen, wenn ich an die glücklichsten Momente meiner Kindheit zurückdenke: an das Geschichtenerzählen.«
Wie alle liebevollen und engen Beziehungen hatte auch unsere ihre Höhen und Tiefen, aber es gab etwas zwischen uns, das davon vollkommen unberührt blieb: die Geschichten, die er mir in meiner Kindheit jeden Abend erzählte. Wenn mein Vater sich zu mir setzte, um mir meine Lieblingsgeschichten zu erzählen, traf mich die freudige Überraschung wie ein elektrischer Schlag. Bereits in meiner frühen Kindheit wusste ich intuitiv, dass es ein heiliger Moment war, dass mir etwas sehr Kostbares und Seltenes geschenkt wurde: der Schlüssel zu einer geheimen Welt.
Er wählte die Geschichten nach einem demokratischen Prinzip aus. An einem Abend erzählte er aus dem Königsbuch Schāhnāme unseres Epikers Ferdausi; am nächsten Abend reisten wir mit dem Kleinen Prinzen nach Frankreich; am übernächsten Abend mit Alice nach England. Dann nach Dänemark mit dem Mädchen mit den Schwefelhölzern, in die Türkei mit Hodscha Nasreddin, nach Amerika mit Charlotte und Wilbur oder nach Italien mit Pinocchio. Er brachte mir die große, weite Welt in mein kleines Zimmer. Als Jugendliche und später als Studentin, Dozentin, Schriftstellerin, Aktivistin und Mutter bin ich immer wieder in das Zimmer zurückgekehrt, um Kraft aus diesen Geschichten zu schöpfen.
Ich habe den Iran zum ersten Mal im Alter von dreizehn Jahren verlassen, um in England zur Schule zu gehen, und seitdem waren Bücher und Geschichten meine Talismane, meine tragbare Heimat, die einzige Heimat, auf die ich mich verlassen konnte, von der ich wusste, dass sie mich nie enttäuschen würde; die einzige Heimat, aus der man mich niemals vertreiben konnte. Lesen und Schreiben haben mir in den schlimmsten Momenten meines Lebens Schutz geboten, in Zeiten der Einsamkeit, des Grauens, der Ängste und Zweifel. Und sie haben meine Sicht auf mein Heimatland und meine Wahlheimat geprägt.
Im Iran schenkt das Regime, wie in allen totalitären Staaten, den Dichtern und Schriftstellern zu viel Aufmerksamkeit, schikaniert, inhaftiert und tötet sie sogar. In Amerika ist das Problem dagegen, dass ihnen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Sie werden nicht durch Folter und Gefängnis zum Schweigen gebracht, sondern durch Gleichgültigkeit und Desinteresse. Ich muss an James Baldwin denken, der in seinem Roman Beale Street Blues schrieb: »Weder Liebe noch Grauen macht blind: Gleichgültigkeit macht blind.« In den Vereinigten Staaten sind das Problem vor allem wir, das Volk; wir, die wir es für selbstverständlich halten, dass es literarische Werke gibt, die uns herausfordern, oder auch wir, die wir uns vom Lesen Behaglichkeit und Trost erwarten und daher nur Texte lesen, die die eigenen Überzeugungen und Vorurteile bestätigen. Vielleicht empfinden wir die bloße Vorstellung von Veränderung als gefährlich und vermeiden es daher, gefährlich zu lesen.
Autoren sind nicht unfehlbar. Auch die Großen unter ihnen sind Kinder ihrer Zeit. Das Wunderbare an großen Büchern aber ist ihre Fähigkeit, die Vorurteile sowohl des Autors als auch seiner Zeit und seines Umfeldes zu reflektieren und zu überwinden. Aufgrund genau dieser Eigenschaft ist es möglich, dass eine junge Frau im Iran des 20. Jahrhunderts einen Griechen namens Aischylos liest, der Tausende von Jahren vor ihr gelebt hat, und sich in ihn einzufühlen vermag. Lesen führt nicht unbedingt zu politischem Handeln, aber es fördert ein Denken, das hinterfragt und zweifelt; das sich nicht mit dem Bestehenden zufriedengibt. Literatur weckt die Neugier, und diese Neugier ist es, die Unruhe, die Wissbegierde, die sowohl das Schreiben als auch das Lesen so gefährlich machen.
Ich habe in der Vergangenheit immer wieder betont, inwiefern die Struktur großer Literatur auf Vielstimmigkeit beruht, auf einem Nebeneinander verschiedener Perspektiven, in dem auch der Böse eine Stimme bekommt, während schlechte Literatur alle Stimmen auf eine einzige reduziert, die des Autors, der wie ein Diktator die verschiedenen Figuren unterdrückt, um eine klare Botschaft zu vermitteln oder eine Agenda durchzusetzen. Große Werke der Literatur – Werke, die wirklich gefährlich sind – hinterfragen und entlarven diesen diktatorischen Drang sowohl auf dem Papier als auch im öffentlichen Raum. Und gefährlich zu lesen erscheint mir noch genauso wichtig wie an jenem Tag im Oktober, als ich mich hinsetzte, um an meinen Vater zu schreiben.
Wir leben in der Ära nach Trump, aber er wird uns noch lange begleiten; wenn nicht physisch, so doch im übertragenen Sinne, als Repräsentant autokratischen Denkens und totalitärer Tendenzen in einer Demokratie. Die Nachbeben seiner Präsidentschaft werden wir in den kommenden Jahren noch zu spüren bekommen. Die Rückkehr zu einer Art Normalität bedeutet nicht, dass der untergründige Hass verschwunden und die Demokratie wieder sicher wäre. Die Zeit, in der wir leben, ist von überbordender Gewalt geprägt, sowohl rhetorischer als auch ganz realer – kommuniziert wird nicht durch Einbeziehung, sondern durch Ausschluss. Gegner und Kontrahenten werden nur noch als Feinde verstanden und definiert. Zudem ist es eine von Lügen beherrschte Zeit. Im Gegensatz zur Literatur, die nach Wahrheit sucht, beruhen Lügen auf Illusionen, die für die Realität gehalten werden. Aber wir leben auch in einer Zeit der Hoffnung und des Übergangs, in der es eine echte Chance auf Veränderungen, auf wirkliche Gleichberechtigung und Demokratie gibt. Es hängt alles davon ab, wofür wir uns entscheiden und wie wir es umsetzen wollen.
Wie gehen wir mit den aktuellen Krisen um? Wie können wir wirklichen Wandel herbeiführen? Die autokratischen Tendenzen machen uns bewusst, dass wir nicht nur politische Positionen oder Programme bekämpfen und verändern müssen, sondern Einstellungen, die Art, wie wir auf die Welt blicken und in ihr handeln. Ironischerweise entdecken wir bei diesem Kampf und dem Versuch, uns anders zu verhalten als die Gegenseite, nicht nur unsere Werte, sondern auch unsere Schwächen und unsere Nachlässigkeit bei der Verteidigung dieser Werte. Denn ganz sicher tragen auch wir eine Mitschuld an den Problemen, vor denen wir derzeit stehen – durch Passivität oder unbewusstes Einverständnis.
Wir haben in diesem Land die Kunst verlernt, uns mit Gegnern und der Opposition auseinanderzusetzen. Und hier kommt das gefährliche Lesen ins Spiel: Es lehrt uns, wie man mit dem Feind umgeht. Wir müssen nicht nur wissen, wie man sich gegenüber Freunden und Verbündeten verhält, sondern auch gegenüber dem Feind. Wer seinen Feind verstehen will, lernt dabei sich selbst kennen. Die Demokratie ist darauf angewiesen, dass wir uns mit Gegenspielern und Kontrahenten auseinandersetzen, uns auf sie einlassen. Sie ist darauf angewiesen, dass wir immer wieder dazu gebracht werden, die eigene Position neu zu überdenken und zu beurteilen, uns den äußeren wie den inneren Feinden zu stellen. Mir gefällt ein Satz von Jonathan Chait aus einem Artikel im New York Magazine von 2021. Darin beschreibt er, wie die Kongressabgeordnete für Wyoming, Liz Cheney, durch ihre eigene Partei, die Republikaner, degradiert wurde, weil sie die »Kühnheit« besessen hatte, von der Parteilinie bezüglich Trumps Verhalten vor und während der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 abzuweichen: »Man schließt Frieden mit seinen Feinden, nicht mit seinen Freunden.«
Wenn mein Vater mir in meiner Kindheit etwas Kompliziertes erklären wollte, hat er es immer durch eine Geschichte verständlich zu machen versucht. Als ich nun meinerseits versuchte, meinem Vater unsere Gegenwart verständlich zu machen, nahm ich mir das zum Vorbild. Immer häufiger schrieb ich ihm von Büchern. Jetzt ist es an mir, ihm meine Geschichten zu erzählen.
Meine Briefe drehen sich um die Ereignisse, die unser Leben in einer wichtigen und turbulenten Zeit der jüngeren Geschichte geprägt haben, angefangen bei den Demonstrationen im »blutigen November« 2019, die die Islamische Republik Iran erschütterten, bis hin zu den Protesten infolge des Mords an George Floyd in Amerika im Sommer 2020. Ich glaube, dass diese Ereignisse nicht nur für das stehen, was jeweils in dem Moment passierte, sondern auch für das, was gegenwärtig und in absehbarer Zukunft geschieht beziehungsweise geschehen wird.
Die vier Jahre der Präsidentschaft Trumps verbrachte ich vor allem mit Lesen. Ich habe literarische Werke über persönliche und politische Traumata gelesen, nochmals gelesen und darüber nachgedacht. Durch die Lektüre dieser Bücher, die das Gerüst der Briefe an meinen Vater bilden sollten, habe ich versucht, unsere Gegenwart besser zu verstehen – um ihm anhand jener Geschichten etwas Kompliziertes über Amerika zu erklären.
Wie so viele amerikanische Texte in den letzten vier Jahren nahm auch ich die Anziehungskraft und drohende Gefahr des Totalitarismus zum Ausgangspunkt und ging literarischen Bearbeitungen dieser Idee in Platons Der Staat, Ray Bradburys Fahrenheit 451 und Salman Rushdies Die satanischen Verse nach. Die Werke beleuchten den Konflikt zwischen dem Dichter und dem Tyrannen – und den gefährlichen Platz, den ein Schriftsteller, und ebenso der Leser, in einer totalitären Gesellschaft einnimmt. Dann wandte ich mich zwei großen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts zu, Zora Neale Hurston und Toni Morrison, deren Romane die großen politischen Themen unserer Zeit – ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Unterdrückung – scharfsinniger kommentieren als die meisten Texte der Gegenwart.
Als Nächstes schrieb ich über den Krieg, denn Kriege gab es so einige in diesem und im letzten Jahrhundert: gegen Länder, gegen Menschen, Menschen gegen Menschen und 2020 gegen eine Pandemie. Dafür zog ich David Grossman, Elliot Ackerman und Elias Khoury zurate; sie stellen in ihren Büchern die Entmenschlichung und den Hass dar, die zum Wesen des Krieges gehören. Als die Vereinigten Staaten durch die ersten Monate des turbulenten Jahres 2020 schlingerten, fühlte sich das Land ein wenig so an wie Margaret Atwoods Republik Gilead, daher nimmt auch diese Autorin einen wichtigen Platz in den Briefen an meinen Vater ein. Im letzten Brief schreibe ich über James Baldwin, der mir für dieses Buch insgesamt als Inspirationsquelle gedient hat. Als ich versuchte, den Mord an George Floyd und die folgenden Proteste nachzuvollziehen, bin ich auch auf den zeitgenössischen Autor Ta-Nehisi Coates gestoßen, dessen Wahrnehmung der Baldwins in manchem ähnelt.
So nahm die Idee für dieses Buch allmählich Gestalt an. Durch das Auge der Fantasie wurden meine Briefe zu einer sowohl persönlichen als auch politischen Reflexion, insbesondere über meine Migrationserfahrung und meine beiden Heimaten, den Iran und die Vereinigten Staaten. Außerdem griff ich Dinge und Ereignisse aus meinen früheren Schriften wieder auf und stellte sie in ein neues Licht und in einen neuen Kontext. Der Schwerpunkt liegt auf einer bestimmten Form von Denken: einer totalitären Denkweise, die keinen Raum für Dialog oder Meinungswechsel lässt und in der jeder Gegner und jeder, der anders ist als man selbst, als Feind gilt. Am ausgeprägtesten ist diese Denkweise in totalitären Systemen, aber man begegnet ihr auch in Demokratien.
Ziel dieses Buches ist es, die Leserinnen und Leser miteinzubeziehen und zum Nachdenken über diese Fragen anzuregen: Wie gehen wir mit Gefühlen wie Frustration und Wut um, die wir angesichts dieser Denkweise empfinden? Wie gehen wir gegen die Lügen vor und ersetzen sie durch Wahrheiten? Wie setzen wir uns gegen Ungerechtigkeiten zur Wehr, ohne uns von Rachefantasien leiten und lähmen zu lassen? Wie können wir uns denen gegenüber gerecht verhalten, die uns ungerecht behandelt haben? Wie gehen wir mit unserem Feind um, ohne ihm ähnlich zu werden oder uns ihm zu ergeben?
Ich wende mich der Literatur zu, weil die Beantwortung dieser Fragen und der Umgang mit unseren Gegnern in erster Linie Verstehen erfordert, und dafür bedarf es der Fantasie, für deren Ausbildung die Literatur so enorm wichtig ist. In der Literatur werden die Handlung und die Herausbildung des Charakters, wie auch im wirklichen Leben, durch Widerstände und Konflikte vorangetrieben. Persönlicher, politischer oder literarischer Widerstand kann immer eine Form finden. Mir geht es in diesem Buch darum, die verschiedenen Formen und Ausprägungen fiktionaler und realer Widerstände zu erkunden, die zu einem Perspektivenwechsel führen können. Denn Veränderungen sind schwer zu bewirken, und Differenzen scheinen oft unüberwindbar, und die Literatur zeigt uns, wie wir zu bestimmten Handlungsweisen genötigt werden, was zu der Frage führt: »Wie verändern wir die Welt?«, und dann: »Wie verändern wir uns selbst?«
Die in diesem Buch thematisierten Autorinnen und Autoren haben mit Traumata und Gefahren gelebt und empfanden Literatur und Fantasie nicht einfach als wichtig, sondern als lebenswichtig. Schreiben war für sie eine Möglichkeit zu überleben – in gewissem Sinne ihre einzige.
Inzwischen dürfte deutlich geworden sein, dass es mir, wenn ich über Bücher spreche, nicht um eine Literatur des Widerstands, sondern um Literatur als Widerstand geht. Mich interessiert, wie Literatur und Kunst Widerstand gegen Macht leisten – nicht nur gegen die von Königen und Tyrannen, sondern auch die des Tyrannen in uns selbst. Politische Veränderungen zu bewirken ist nicht allzu schwer; wesentlich schwieriger ist es, Einstellungen und Denkweisen zu verändern.
Ziel dieses Buches, wie aller meiner Bücher, ist es, die von der Politik aufgerissenen Gräben durch die Kraft der Fantasie zu überwinden und zu schließen.
Gerade jetzt sind Bücher in Gefahr. Man kann noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass die Fantasie und die Ideen in Gefahr sind, und wann immer sie bedroht sind, ist auch die Realität, in der wir leben, in Gefahr. »Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen«, heißt es bekanntlich. Und so will ich an dieser Stelle daran erinnern, was Toni Morrison in einem ihrer Essays geschrieben hat: »… die Kunst nimmt uns mit auf eine Reise, die über Kosten und Nutzen hinausgeht, die uns zur Zeugenschaft aufruft für die Welt, wie sie ist und wie sie sein sollte.«
Der erste Brief:
Rushdie, Platon, Bradbury
22. November bis 24. Dezember 2019
Liebster Baba,
wie sehr wünschte ich, du wärst hier. Insbesondere hier in Washington, D.C., einer Stadt, von der ich zum ersten Mal durch dich gehört habe. Ich frage mich, was sich wohl alles verändert hat und was gleich geblieben ist seit den Fünfzigerjahren, als du mit einem staatlichen Stipendium in D.C. gelebt und an der American University deinen Master gemacht hast. Ich habe deine Fotos gesehen und dich von der schönen Stadt erzählen hören. Das Washington auf deinen Bildern war eine weite grüne Fläche. Man sah dich beim Picknick mit Freunden auf einer grünen Wiese oder im Schatten eines hohen, alten Baumes stehend.
Meine Wohnung liegt in der Nähe des historischen Stadtviertels Foggy Bottom. Wenn ich gefragt werde, wo ich wohne, spreche ich es gerne mit britischem Akzent aus. Ich glaube, dir hätte es hier gefallen. Ich bin umgeben von verschiedenen amerikanischen Wahrzeichen, die für das Beste und das Schlimmste des Landes stehen. Meine Wohnung liegt nur ein paar Minuten vom Kennedy Center entfernt, und wenn ich in der Mitte der Virginia Avenue stehe, kann ich das Washington Monument sehen. Dann ist da noch der berühmt-berüchtigte Watergate-Gebäudekomplex, der uns an Nixon erinnert und an Clintons Affäre mit Lewinsky, die damals hier wohnte. Später lebte dort auch Condoleezza Rice, genau wie meine Lieblingsrichterin am Obersten Gerichtshof, Ruth Bader Ginsburg.
Vor allem aber hättest du, glaube ich, den Fluss gemocht. Durch unsere Wohnzimmerscheiben sieht man den Balkon und in der Tiefe den Potomac, und fast jeden Morgen blicke ich hinaus zu ihm und sende ihm einen Gruß. Der Fluss hat für mich eine ähnliche Funktion wie früher der Damawand in Teheran. Du erinnerst dich, dass man durch unser Wohnzimmerfenster in der Ferne diesen geschichtsträchtigen Berg sah. Schon seit meiner frühen Kindheit habe ich so vieles über den Damawand gehört. Ich erinnere mich, dass du sagtest, er stehe im Zentrum der persischen Mythologie und Kultur und sei ein Symbol unseres Nationalstolzes – ginge man tausend Jahre in der Zeit zurück, begegne man ihm in den Zeilen unseres großen Epikers Ferdausi. Ich hörte vom Damawand in den Geschichten, die du mir aus dem Schāhnāme erzählt hast, dem Nationalepos Ferdausis, das mit der persischen Mythologie und der frühen vorislamischen Geschichte beginnt und mit der islamischen Eroberung Persiens im siebten Jahrhundert endet.
In Ferdausis Geschichten ist der Damawand ein Symbol des Widerstands gegen despotische Herrscher und Fremdherrschaft und des Triumphs über sie. Ich erinnere mich noch gut an die Geschichte von Zahhāk, dem vielleicht verhasstesten dieser Herrscher, der die beiden Schlangen, die ihm aus den Schultern wuchsen, täglich mit den Gehirnen persischer Jünglinge fütterte. Jedes Mal, wenn ich die Geschichte hörte, war ich unsagbar erleichtert, als Zahhāk schließlich von Prinz Feraidun besiegt wurde, der ihn mithilfe des Schmiedes Kaveh in einer Höhle unter dem Damawand in Ketten legte.
In der Schule haben wir gelernt, dass der Damawand der dritthöchste Berg der Welt sei. Kürzlich habe ich über den Berg recherchiert und nirgends eine Bestätigung dafür gefunden. Er scheint vielmehr der zwölfthöchste zu sein, dazu der höchste Berg des Iran und der höchste Vulkan Asiens. Ich hatte gar nicht gewusst, dass der Damawand ein aktiver Vulkan ist. Schwebt deshalb immer diese Nebelwolke über seinem Gipfel?
Auch der Potomac spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte Amerikas. Er wird »Fluss der Nation« genannt, wahrscheinlich weil er während des Bürgerkriegs Schauplatz vieler Gefechte zwischen der Union und der Konföderation war. Die größte Armee der Union wurde sogar nach ihm benannt. George Washington wurde auf einem Anwesen am Ufer des Potomac geboren und verbrachte dort sein Leben. Der Fluss bedeutet mir – wie der Berg – sehr viel. Beide stehen für Schönheit und Beständigkeit, verbinden die Stadt mit der Natur und erinnern uns daran, dass Berge und Flüsse vor uns da waren und auch nach uns noch da sein werden.
Für mich hat diese Verbindung von Geschichte und Natur eine große Bedeutung, so wie sie es auch für dich hatte. Von der Geschichte des Damawand habe ich zuerst durch dich erfahren. Erinnerst du dich an unsere langen Spaziergänge durch die Straßen von Teheran, auf denen du mir Geschichten erzählt und mich mit der Aussicht auf Eis und Buchläden zum Weiterlaufen motiviert hast? Die Stadt, außen umgeben von Bergen und im Innern voller Verheißungen und Geheimnisse, wurde für mich zu etwas Magischem. Noch als Erwachsene bin ich gern durch die Straßen gelaufen, um meine Ängste zu überwinden. Auch Washington hat schöne Straßen und Parks, wie du ja weißt. Wenn ich durch die Stadt streife, frage ich mich manchmal, ob du damals vielleicht dieselben Wege gelaufen bist. Wie sehr ich unsere angeregten Gespräche während dieser lang zurückliegenden Spaziergänge in Teheran vermisse. Ich folge den Windungen des Potomac und denke an den Damawand. Der Fluss und der Berg stehen für das Beste meiner beiden Heimaten.
Wenn du hier wärst, würden wir zum Hafen laufen und uns über Menschen, Projekte und Ideen unterhalten. Du hast es immer genossen, Ideen auszutauschen. Da du nicht da bist, muss ich mir vorstellen, wie du neben mir läufst. Vielleicht würden wir kurz in die National Portrait Gallery gehen, um uns die Persönlichkeiten anzusehen, die dieses Land zu dem gemacht haben, was es ist – darunter einige, die du kennst und über die du geschrieben hast, aber auch manche, von denen ich nicht glaube, dass du je von ihnen gehört hast, wie zum Beispiel ein gewisser Benjamin Lay (1682 – 1759), ein Quäker und Aktivist für die Abschaffung der Sklaverei. Er setzte sich zeit seines Lebens moralisch rigoros für versklavte Menschen ein und war dabei sogar den abolitionistisch gesonnenen Quäkern zu vehement, mit denen er durch seine spektakulären Proteste und flammenden Reden gegen die Sklaverei teilweise in Konflikt geriet. Er versuchte, sie moralisch unter Druck zu setzen, damit sie entschiedener kämpften. Zudem war er Vegetarier und ein Verfechter der Tierrechte – und damit gleich in mehrerlei Hinsicht seiner Zeit voraus.
Jetzt aber möchte ich mit dir über etwas anderes sprechen, etwas, das mich seit fast drei Jahrzehnten beschäftigt. Es geht um ein Buch. Das Buch liest sich schön, überhaupt nicht schön ist aber die Geschichte, die dieses Buches in der Realität erfahren hat – und doch wird man von dem Buch für immer nur in Verbindung mit dieser Realität sprechen.
Du erinnerst dich an die Fatwa von Ajatollah Khomeini gegen den Schriftsteller Salman Rushdie? Sie wurde am 14. Februar 1989 verhängt, vor etwas mehr als dreißig Jahren. Vielleicht erinnerst du dich nicht so gut an sie wie ich, da sie zu einer Obsession von mir wurde, die mich über die Jahre hinweg bis heute immer wieder beschäftigt hat. Als 1988 Die satanischen Verse erschienen, hielten manche Muslime das Buch für blasphemisch. Da ich zu der Zeit im Iran lebte, verfolgte ich die Nachrichten über die Fatwa gegen Rushdie, so genau es nur ging. Du erinnerst dich vielleicht daran, dass Freunde und Verwandte, die im Ausland lebten, darunter auch mein Bruder Mohammad, uns immer über das aktuelle Weltgeschehen auf dem Laufenden hielten. Schon vor der Fatwa hatte das Buch bei Muslimen auf der ganzen Welt Proteste ausgelöst, insbesondere in Indien und Pakistan. Die Fatwa heizte diese Proteste weiter an. Zugleich wandten sich, vor allem in demokratischen Ländern, viele Menschen – allen voran Schriftstellerinnen und Schriftsteller – öffentlich gegen die Verhängung, da sie in ihren Augen eine fatale Bedrohung der Meinungsfreiheit in der Literatur darstellte.
Besonders schmerzlich müssen für Rushdie die vielen Attentatsversuche auf Menschen gewesen sein, die sich hinter ihn stellten, darunter zwei Nobelpreisträger für Literatur – der nigerianische Dramatiker Wole Soyinka und der ägyptische Schriftsteller Naguib Mahfouz –, die Kritik an Khomeini geübt hatten. Soyinka bekam Todesdrohungen, Mahfouz wurde von einem islamischen Fundamentalisten niedergestochen und überlebte nur knapp. William Nygaard, der norwegische Verleger der Satanischen Verse, wurde durch drei Schüsse schwer verletzt. Der türkische Schriftsteller und Übersetzer des Buches Aziz Nesin war vermutlich das Ziel eines Brandanschlags auf ein Hotel in Sivas in der Türkei, bei dem 37 Menschen starben. Der japanische Übersetzer des Buches wurde ermordet. In Bombay starben zwölf Menschen bei einer Demonstration, und in Großbritannien kam es zu Bücherverbrennungen. Rushdie selbst musste untertauchen und stand rund um die Uhr unter Polizeischutz.
Nach Ansicht von Ayatollah Khomeini verdiente Rushdie den Tod, weil sein Buch den Propheten Mohammad und den Islam verhöhne. Ich erinnere mich an einen Abend kurz nach der Verhängung der Fatwa, als wir Freunde zu Besuch hatten und eine hitzige Diskussion über das Thema führten. Du warst gekommen, um die Kinder zu sehen, wurdest dann aber in die Diskussion im Wohnzimmer hineingezogen. Du standest an der Wand und hörtest zu, und dann sagtest du plötzlich: »Euer Mr Rushdie ist ziemlich boshaft! Schon der Titel muss für unseren Ayatollah beleidigend klingen.« Du riefst uns in Erinnerung, dass sich Die satanischen Verse auf eine wenig schmeichelhafte Geschichte über den Propheten beziehen: Darin wird berichtet, dass er, als die neue monotheistische Religion des Islam bei den wichtigsten Kaufleuten Mekkas auf Widerstand stieß, die Anbetung dreier altarabischer Göttinnen erlaubt habe. Später erfuhr ich, dass dieser Bericht, der von den beiden muslimischen Gelehrten al-Wāqidī (747 – 823 n. Chr.) und at-Tabarī (839 – 923 n. Chr.) überliefert wird, von nachfolgenden Korankommentatoren verworfen wurde.
Baba, ich weiß noch, wie du mich in diesen schrecklichen Jahren immer wieder zu beruhigen versuchtest. Natürlich war dir das islamische Regime und alles, was es unserem Land und unserem Volk antat, verhasst. Aber du riefst mir auch all die anderen Katastrophen und Tragödien in Erinnerung, die der Iran in seiner zweieinhalb Jahrtausende währenden Geschichte überstanden hatte. Ich wünschte, ich hätte dir besser zugehört, als du mir klarzumachen versuchtest, dass wir nicht so arrogant sein sollten, unser gegenwärtiges Leid für das größte in der Weltgeschichte oder der Geschichte dieses Landes – unseres Landes – zu halten. Ich wusste, dass du recht hattest, aber das änderte nichts. Egal in welchem anderen Land als meiner Heimat ein solches Urteil über einen Schriftsteller gefällt worden wäre, hätte ich es als furchtbar empfunden und persönlich genommen. Dass es aber von Ayatollah Khomeini im Iran gefällt wurde, machte es für mich noch furchtbarer und persönlicher.
Obwohl ich 1979 nach Abschluss meines Studiums aus den USA in den Iran zurückgekehrt war, hatte ich mich zum Zeitpunkt der Fatwa gegen Rushdie, also zehn Jahre später, noch immer nicht an die Islamische Republik gewöhnt – und konnte es auch danach nie. Nach Jahren fern von meinem Heimatland, in denen ich immer davon geträumt hatte, irgendwann wieder dort zu leben, fiel es mir schwer zu akzeptieren, dass ich in ein Land zurückgekehrt war, in dem solche Grausamkeiten möglich waren. Als Iranerin, die sich der Literatur und der Meinungsfreiheit tief verbunden fühlt, war ich frustriert und empört, dass ich meinen Protest nicht öffentlich äußern durfte. Die repressiven Gesetze des neuen Regimes gegen Frauen und Minderheiten und jede Form von Widerspruch gingen einher mit systematischen Angriffen auf die Meinungsfreiheit und die Kultur. Die Fatwa bestärkte mich in meiner Überzeugung, dass zwischen Fantasie und Realität eine enge Verbindung besteht: Die Unterdrückung der einen führt unweigerlich zu Unterdrückung in der anderen. Ich ließ mich immer stärker von der Ideologie, auf der Ayatollah Khomeinis Denken beruhte, in den Bann ziehen, davon, wie sie jeden Bereich unseres Lebens durchdrang. Die obsessive Beschäftigung mit Khomeini ließ mir kaum geistigen Raum für anderes, wodurch das Leben selbst klaustrophobisch wurde.
Drei Jahrzehnte später sehe ich rückblickend einiges klarer. Ich weiß, dass ich mich damals während der Szene im Wohnzimmer nicht ruhig und gefasst ausdrückte. Ich platzte einfach mit meinen Emotionen heraus, unfähig, meine Empörung zurückzuhalten. Ich sah die Sorge in deinen Augen. Vielleicht hast du dich gefragt, wie ich überhaupt im Iran leben konnte, wenn ich immer kurz vor dem nächsten Wutausbruch stand.
Ich will mich jetzt korrigieren, indem ich dir erläutere, warum ich mich so verhielt. Ich hatte immer das Gefühl, Baba, dass die Schriftsteller und Dichter im Iran, wie in vielleicht keinem anderen Land, wirklich nachempfinden konnten, was Rushdie durchmachte, da das Regime, das die Fatwa gegen ihn erlassen hatte, dasselbe war, das uns zensierte, einsperrte, folterte und sogar tötete. Jetzt, kurz vor dem dreißigsten Jahrestag der Fatwa, möchte ich mit dir noch einmal auf sie zurückkommen. Es mögen drei Jahrzehnte vergangen sein, aber das, was die Fatwa im Kern ausmacht – die Feindseligkeit von Tyrannen gegenüber der Fantasie und Ideen –, ist so aktuell wie eh und je. Und das nicht nur in Diktaturen wie dem Iran, sondern auch in Demokratien wie Amerika.
Ich glaube nicht, dass du Die satanischen Verse je gelesen hast. Ich habe sie zum ersten Mal etwa ein Jahr nach dem Erlass der Fatwa gelesen, im Iran, dank meiner guten und mutigen Freundin in London, Shiva, die das Buch bei einem Besuch nach Teheran schmuggelte. Ich habe es gerne gelesen und mochte besonders Rushdies schelmisches Spiel mit Worten, wie er ihnen Leben einhaucht, einem Kind gleich, das Seifenblasen pustet und dabei zusieht, wie sie in alle Richtungen davonschweben. Ich glaube, das Hauptthema der satanischen Verse wird im Buch selbst durch den Dichter Baal ausgedrückt: »WAS FÜR EINE ART IDEE BIST DU? Gehörst du zu der Art, die Kompromisse eingeht, die Abkommen trifft, sich an die Gesellschaft anpasst, bestrebt ist, eine Nische zu finden, um zu überleben? Oder bist du der sture, verflucht rücksichtslose, stocksteife Typ von Idee, der lieber zerbricht als sich nach dem Wind dreht? Von jener Art, die höchstwahrscheinlich in neunundneunzig von hundert Fällen zerschmettert werden wird, aber im hundertsten Fall die Welt verändert?«
Du, Baba jan, würdest dieses Buch mögen. Es geht nicht um bequeme Klischees, sondern um Ideen, die die Welt hinterfragen, stören und verändern wollen – was nicht nur das Schreiben, sondern auch das Lesen desselben so gefährlich macht. Und genau das lässt ein solches Buch auch so unerträglich für tyrannisches Denken sein. Im Grunde wird auf diese Weise jedes große Werk der Fantasie zu einer Bedrohung. Die Fantasie lässt sich nicht beherrschen und reglementieren; sie ist frei und eigensinnig und verweigert sich den Zwängen einzelner Ideologien.
Und dann sind da noch die phantasmagorischen Figuren, die in jener magisch-realistischen Welt leben und leiden, die Rushdie für sie erschaffen hat. Es muss ihm großen Spaß bereitet haben, die zwei Protagonisten der satanischen Verse zu erfinden, beides indische Schauspieler mit muslimischem Hintergrund: Gibril Farishta, ein Bollywood-Superstar, und Saladin Chamcha, der sich von seinen indischen Wurzeln abgewandt hat und als Synchronsprecher in England arbeitet. Als wir den beiden begegnen, ist ihr entführtes Flugzeug gerade über dem Ärmelkanal explodiert, und wie durch ein Wunder überleben die beiden nicht nur, sondern sind auch von Grund auf verwandelt. Gibril wird zum Erzengel Gabriel, wobei seine Verwandlung (zumindest teilweise) ein Symptom seiner Schizophrenie ist, während Saladin Hufe und Hörner wachsen und er sich in den Teufel verwandelt. Er wird verhaftet und im Polizeigewahrsam von den Beamten misshandelt, die ihn für einen illegalen Einwanderer halten.
Ich wünschte, du hättest das Buch gelesen, da du dann verstanden hättest, was der Ayatollah nicht begriff, als er Rushdies Roman als antiislamisch verurteilte: Die anstößigen Stellen des Romans sind die Halluzinationen und Träume von Gibril, nicht Rushdies eigene Sicht. In Gibrils Traumsequenzen taucht ein Geschäftsmann namens Mahound – eine Anspielung auf Mohammed – auf, und in einem Bordell in einer Stadt namens Jahilia nehmen Prostituierte die Namen der Frauen des Propheten an, um ihr Geschäft anzukurbeln. Jahilia, was auf Arabisch »Unwissenheit« bedeutet, ist auch eine Bezeichnung für die vorislamische Zeit, in der die Menschen noch nichts von der Gnade Gottes und seines Propheten wussten.
Rushdie, lieber Baba, wurde nun also wegen seiner Darstellung des Propheten Mohammad der Blasphemie bezichtigt, wo doch jedem einigermaßen vernünftigen Leser klar sein muss, dass nicht er, Salman Rushdie, Mohammed so sieht, sondern seine Figur, der betrunkene, schizophrene Gibril. Zudem wird Mahound gar nicht als besonders anstößig beschrieben, sieht man einmal davon ab, dass er menschlich und fehlbar ist und – wie einige Kritiker anmerkten – ein wenig an die Christusfigur in Scorseses Film Die letzte Versuchung Christi erinnert.
Mir geht es darum, Baba jan, dass Die satanischen Verse eine von einem Verrückten erdachte Welt und einen Ort darstellen, wo Glaube, Ethik und Erkenntnis nicht existieren; wo niemand der ist, der er vorgibt zu sein, sondern jeder nur eine erfundene Version seiner selbst ist; wo Charakter und Moral nicht von Belang sind; wo sich verkommene Herrscher hinter dem guten Namen anderer verbergen; und wo die Namen der Frauen des Propheten für Geschäftstricks missbraucht werden. Alles in dieser Welt ist eine Parodie und ein böser Schatten der realen Welt. Rushdie hat immer betont, dass es in den satanischen Versen nicht um den Islam gehe, sondern um »Migration, Metamorphose, gespaltene Persönlichkeiten, Liebe, Tod, London und Bombay«. Er stellt klar, dass es sich um einen Roman handelt, »der eigentlich eine Geißelung des westlichen Materialismus darstellt. Und zwar in einem komischen Ton.«
Das Buch übt also weniger Kritik am Islam oder am Propheten als am westlichen Materialismus und Kommerzialismus und ebenso an Klerikern wie Ayatollah Khomeini, die sich in der Nachfolge des Propheten sehen und seine Rolle beanspruchen. In dem Buch gibt es einen Kleriker, der an Ayatollah Khomeini erinnert, »einen bärtigen, beturbanten Imam«, der in London im Exil lebt und auf dem Rücken von Gibril in seine Heimat fliegt, als die Revolution gegen das verwestlichte Regime ausbricht. In einem Zeitungsartikel für The Guardian hatte Rushdie kurz vor der Fatwa geschrieben: »Ein mächtiger Stamm von Klerikern hat den Islam übernommen, das ist die zeitgenössische Gedankenpolizei.«
Es ist jetzt schon etwas später am Vormittag. Nachdem ich dir eine Weile geschrieben hatte, habe ich eine Pause eingelegt, um meine Freundin Shirin, die im Iran lebt, über WhatsApp anzurufen. Du erinnerst dich sicherlich an Shirin. Du hast sie oft gesehen und mit ihr gesprochen, und als ich in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt war, erzählte sie mir, dass du regelmäßig Kontakt mit ihr hattest. Du hast sie in dein Büro eingeladen, um mit ihr Kaffee zu trinken und zu reden. Ich habe jetzt zum dritten Mal vergeblich versucht, sie anzurufen. In den letzten Tagen trieb mich eine alte Angst um: Es gibt eine neue Protestwelle im Iran, auf die das Regime mit brutaler Gewalt reagiert....Ende der Leseprobe