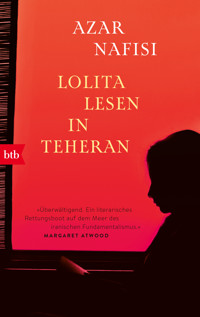
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
• »Überwältigend. Ein literarisches Rettungsboot auf dem Meer des iranischen Fundamentalismus.« Margaret Atwood
Als die iranische Literaturprofessorin Azar Nafisi den Schleier nicht länger tragen will, wird sie von der Universität Teheran verwiesen – und erfüllt sich einen Traum. Zwei Jahre lang kommen sie und sieben ihrer besten Studentinnen jeden Donnerstagmorgen heimlich zusammen, um verbotene Klassiker der westlichen Literatur zu lesen. Mit der Lektüre von Vladimir Nabokov, Jane Austen, Henry James und F. Scott Fitzgerald schaffen sie sich Freiräume in der ihnen aufgezwungenen Enge der Islamischen Republik Iran. Aus verstohlen in ihr Haus huschenden schwarz verschleierten Schatten werden junge Frauen in Jeans und bunten Kleidern. Sie öffnen sich in der Diskussion über die literarischen Werke und beginnen die eigene Realität, der gegenüber sie sich lange sprachlos und ohnmächtig fühlten, zu hinterfragen und zu verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Zum Buch
Als die iranische Literaturprofessorin Azar Nafisi den Schleier nicht länger tragen will, wird sie von der Universität Teheran verwiesen – und erfüllt sich einen Traum. Zwei Jahre lang kommen sie und sieben ihrer besten Studentinnen jeden Donnerstagmorgen heimlich zusammen, um verbotene Klassiker der westlichen Literatur zu lesen. Mit der Lektüre von Vladimir Nabokov, Jane Austen, Henry James und F. Scott Fitzgerald schaffen sie sich Freiräume in der ihnen aufgezwungenen Enge der Islamischen Republik Iran. Aus verstohlen in ihr Haus huschenden schwarz verschleierten Schatten werden junge Frauen in Jeans und bunten Kleidern. Sie öffnen sich in der Diskussion über die literarischen Werke und beginnen die eigene Realität, der gegenüber sie sich lange sprachlos und ohnmächtig fühlten, zu hinterfragen und zu verändern. Bis heute hat Azar Nafisis internationaler Bestseller Lolita lesen in Teheran nichts von seiner Sprengkraft verloren.
Zur Autorin
Azar Nafisi unterrichtete im Iran an verschiedenen Universitäten Literatur. Weil sie sich weigerte, den Schleier zu tragen, erhielt sie 1981 Lehrverbot an der Universität von Teheran. 1997 verließ sie den Iran und wanderte in die USA aus. Sie war Fellow am Foreign Policy Institute der Johns Hopkins University in Baltimore. Mit »Lolita lesen in Teheran« landete sie einen internationalen Bestseller. Azar Nafisi lebt heute in Washington, D.C.
Azar Nafisi
Lolita lesen in Teheran
Aus dem Amerikanischen von Maja Ueberle-Pfaff
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Reading Lolita in Teheran« bei Random House, Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Wiederveröffentlichung Oktober 2023
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2003 by Azar Nafisi
All Rights Reserved
Published by arrangement with Random House,
an imprint and division of Penguin Random House LLC.
Copyright © dieser Ausgabe 2023 by btb Verlag
Covergestaltung: semper smile, München,
Umschlagmotiv: © Getty Images/Shreya B./EyeEm
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
MK · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-29839-5V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
In Erinnerung an meine Mutter, Nezhat Nafisi Für meinen Vater, Ahmad Nafisi, und meine Familie:
Bijan, Negar und Dara Naderi
Wem erzählen wir, was auf der Erde geschah, für wen stellen wir überall große Spiegel auf, in der Hoffnung, sie werden gefüllt und bleiben es?
Czeslaw Milosz, »Annalena«
Vorbemerkung der Autorin
Die Details einiger Personen und Ereignisse dieser Geschichte wurden verändert, um die Betroffenen zu schützen, nicht nur vor dem Auge des Zensors, sondern auch vor denen, die solche Berichte bloß lesen, um herauszufinden, wer wer ist und wer mit wem was gemacht hat, die von den Geheimnissen anderer leben und damit ihre eigene Leere füllen. Die hier geschilderten Begebenheiten sind so wahr wie jede Erinnerung wahrhaftig ist, aber ich habe alles unternommen, um Freunde und Studenten zu schützen, indem ich ihnen andere Namen gab und Facetten ihres Lebens so veränderte oder miteinander vertauschte – dass sie sich sogar selbst nicht mehr wiedererkennen –, und so ihre Geheimnisse zu bewahren.
Teil I
Lolita
1
Nachdem ich meine letzte Stelle an der Universität aufgegeben hatte, wollte ich mir im Herbst 1995 etwas Gutes tun und mir einen Traum erfüllen. Ich wählte sieben meiner besten und engagiertesten Studentinnen aus und lud sie jeden Donnerstagmorgen zu mir nach Hause ein, um dort über Literatur zu diskutieren. Die Gruppe bestand nur aus Frauen – es wäre zu riskant gewesen, eine gemischte Klasse in der privaten Sphäre meines Hauses zu unterrichten, auch wenn wir nur harmlose Romane gelesen hätten. Ein Student, der von unserem Unterricht ausgeschlossen war, ließ allerdings nicht locker. Also erhielt auch Nima die Texte, die gerade verteilt wurden, und an bestimmten Tagen kam er zu mir nach Hause, um über die Bücher zu sprechen, die wir gerade lasen.
Ich erinnerte meine Studentinnen oft scherzhaft an Die Blütezeit der Miss Jean Brodie von Muriel Spark und fragte: Wer von euch wird mich schließlich verraten? Denn ich bin von Natur aus pessimistisch und war sicher, dass sich zumindest eine mit mir überwerfen würde. Nassrin bemerkte darauf einmal spitz, ich hätte ihnen doch gesagt, dass letztlich wir selbst es seien, die uns verraten und uns wie Judas gegenüber Christus verhalten würden. Manna wies darauf hin, dass ich nicht Miss Brodie sei, und sie, nun, sie seien eben, was sie seien. Sie erinnerte mich an eine Warnung, die ich oft und gern wiederholte: Versuchen Sie nie, unter keinen Umständen, ein dichterisches Werk zu verharmlosen, indem Sie es in einen Abklatsch des wirklichen Lebens verwandeln. Was wir in der Literatur suchen, ist nicht so sehr die Wirklichkeit als vielmehr das Aufscheinen der Wahrheit. Aber wenn ich, was ich ungern täte, das literarische Werk aussuchen müsste, in dem sich die meisten Anklänge an unser Leben in der Islamischen Republik Iran finden, dann wäre es wahrscheinlich nicht Die Blütezeit der Miss Jean Brodie oder 1984, sondern Nabokovs Einladung zur Enthauptung oder noch besser: Lolita.
An meinem letzten Abend in Teheran, zwei Jahre nach unserem ersten Donnerstagmorgen-Seminar, kamen einige Freunde und Studentinnen, um mir beim Packen zu helfen und sich von mir zu verabschieden. Als wir das Haus vollkommen leer geräumt hatten, alle Sachen verstaut und die bunten Farben wie herumirrende Geister, die sich wieder in ihre Flaschen verziehen, in acht grauen Koffern verschwunden waren, stellten meine Studentinnen und ich uns vor die nackte weiße Wand des Esszimmers und machten zwei Fotos.
Diese beiden Fotos liegen jetzt vor mir. Auf dem ersten stehen sieben Frauen vor einer weißen Wand. Sie tragen, dem Gesetz des Landes entsprechend, schwarze Kleider und Kopftücher und sind bis auf das Oval des Gesichts und die Hände vollkommen verhüllt. Auf dem zweiten Bild dieselbe Gruppe, die gleiche Haltung, vor derselben Wand. Nur dass die Frauen ihre Verhüllung abgelegt haben. Die Farbtupfen springen sofort ins Auge. Durch die Farben und den Stil ihrer Kleidung, die Farbe und Länge ihrer Haare bekommt jede etwas Charakteristisches. Nicht einmal die beiden, die auch hier ihr Kopftuch tragen, sehen gleich aus.
Ganz rechts außen auf dem zweiten Bild steht unsere Dichterin, Manna, in weißem T-Shirt und Jeans. Sie machte aus Dingen, die die meisten nicht weiter beachten, Poesie. Auf dem Foto ist jedoch nichts von ihren eigenartig stumpfen, dunklen Augen zu sehen, die Mannas in sich gekehrtem, verschlossenem Charakter entsprechen.
Gleich neben ihr steht Mahshid, deren langes schwarzes Kopftuch nicht recht zu ihren feinen Gesichtszügen und dem vorsichtigen Lächeln passt. Mahshid kannte sich in vielen Dingen gut aus, aber sie benahm sich auch gerne etwas geziert, sodass wir sie schließlich mit »Mylady« anredeten. Nassrin meinte dazu immer, wir würden damit allerdings weniger über Mahshid aussagen als vielmehr dem Wort Lady eine neue Dimension verleihen. Mahshid ist sehr sensibel. Sie sei wie Porzellan, sagte Yassi einmal zu mir, sehr zerbrechlich. Darum wirkt sie auch auf jemanden, der sie nicht gut kennt, so schwach. Aber wehe dem, der ihr zu nahe kommt. Was mich angeht, so fuhr Yassi gutmütig fort, ich bin wie gutes altes Plastik: Egal, was man mit mir anstellt, ich geh nicht kaputt.
Yassi war die Jüngste in unserer Gruppe. Sie ist die in Gelb, die sich nach vorne beugt und sich vor Lachen kaum halten kann. Manchmal zogen wir sie auf und nannten sie unsere Comedy-Queen. Yassi war von Natur aus schüchtern, aber bei bestimmten Dingen erwachte ihr Temperament, und sie verlor jegliche Hemmungen. Mit ihrem sanften Spott konnte sie nicht nur andere, sondern auch sich selbst in Frage stellen.
Ich bin die in Braun, direkt neben Yassi, der ich einen Arm um die Schulter lege. Gleich hinter mir steht Azin, die größte meiner Studentinnen, mit ihrem langen blonden Haar und einem rosa T-Shirt. Wie wir anderen lacht auch sie. Aber Azins Lächeln sah nie wie ein Lächeln aus, es wirkte mehr wie der Vorbote einer unbezähmbaren, nervösen Heiterkeit. Sie strahlte auf eine ganz eigene Art, selbst wenn sie von den jüngsten Problemen mit ihrem Ehemann erzählte. Azin, immer leidenschaftlich und unverblümt, genoss es, wenn sie die anderen mit dem, was sie sagte und tat, schockieren konnte, und geriet oft mit Mahshid und Manna aneinander, was ihr schließlich bei uns den Spitznamen »die Wilde« einbrachte.
Auf der anderen Seite neben mir erkennt man Mitra, die vielleicht Ruhigste von uns allen. Wie die Pastellfarben in ihren Gemälden schien auch sie sich uns immer mehr zu entziehen und in diffusere Gefilde zu entschweben. Zwei wunderbare Wangengrübchen verliehen ihrer Schönheit eine ganz eigene Note, die sie, wenn sie sich jemanden gefügig machen wollte, durchaus einzusetzen wusste.
Sanaz, die sich immer von Familie und Gesellschaft unter Druck gesetzt fühlte und zwischen ihrem Wunsch nach Unabhängigkeit und dem Bedürfnis nach Anerkennung schwankte, hält sich an Mitras Arm fest. Alle lachen wir. Unser unsichtbarer Teilnehmer, der Fotograf, ist Nima, Mannas Ehemann und der einzige wirkliche Literaturtheoretiker unter meinen Studenten – hätte er nur die Ausdauer gehabt, die brillanten Essays, die er begonnen hatte, auch fertigzustellen.
Es gab noch eine Studentin, die aber nicht auf den Fotos ist: Nassrin, die nicht bis zum Ende dabei war. Aber meine Geschichte wäre unvollständig ohne die, die nicht bei uns bleiben wollten oder konnten. Ihre Abwesenheit wirkt immer noch nach, wie ein akuter Schmerz, der keine physische Ursache mehr zu haben scheint. Das ist Teheran für mich: Das, was fehlte, war realer als das, was da war.
Wenn ich mir Nassrin heute vorstelle, dann ist ihr Bild leicht verschwommen, unscharf, irgendwie weit weg. Ich bin die Fotos durchgegangen, die von meinen Studenten und mir im Lauf der Zeit gemacht wurden, und Nassrin ist auf vielen davon zu sehen, aber immer versteckt hinter etwas – einer Person oder einem Baum. Auf einer Aufnahme stehe ich mit acht Studentinnen in dem kleinen Garten vor unserem Fakultätsgebäude, der Kulisse so vieler Abschiedsbilder in all den Jahren. Im Hintergrund eine schattenspendende Weide. Wir lächeln, und in einer Ecke, hinter der größten Studentin, guckt Nassrin hervor, wie ein kleiner Kobold, der spitzbübisch in einer Szenerie auftaucht, in der er eigentlich nichts zu suchen hat. Auf einem anderen Bild ist in dem engen V, das die Schultern zweier anderer Mädchen bilden, kaum ihr Gesicht zu erkennen. Sie sieht merkwürdig geistesabwesend aus und schaut so finster drein, als ob sie nicht bemerken würde, dass sie gerade fotografiert wird.
Wie lässt sich Nassrin beschreiben? Ich habe sie einmal in Anspielung auf Alice im Wunderland die »Grinsekatze« genannt, die an unerwarteten Wendepunkten meines akademischen Lebens auftauchte und wieder verschwand. Die Wahrheit ist: Ich kann sie nicht beschreiben, nicht in Worte fassen. Man kann nicht mehr sagen, als dass Nassrin eben Nassrin war.
Beinahe zwei Jahre lang, fast jeden Donnerstagmorgen, bei Sonne oder Regen kamen sie zu mir nach Hause, und beinahe jedes Mal traf es mich wieder wie ein Schock, wenn sie die vorgeschriebenen Schleier und Umhänge ablegten und die Farben förmlich aus ihnen herausplatzten. Wenn meine Studentinnen diesen Raum betraten, legten sie mehr ab als nur ihre Kopftücher und Mäntel. Schritt für Schritt gewann jede von ihnen an Kontur und Gestalt und wurde so ein eigenständiges, einzigartiges Wesen. Unsere Welt in diesem Wohnzimmer mit seinem Ausblick auf mein geliebtes Elbursgebirge wurde zu unserem Zufluchtsort, einem geschlossenen Universum, das der Realität voller schwarz verschleierter, ängstlich dreinblickender Gesichter in der unter uns liegenden Stadt trotzte.
Das Thema des Seminars war der Zusammenhang zwischen Fiktion und Realität. Wir lasen klassische persische Literatur, wie die Erzählungen unserer eigenen Grande Dame der Literatur, Scheherazade, aus Tausendundeiner Nacht und parallel dazu westliche Klassiker wie Stolz und Vorurteil, Madame Bovary, Daisy Miller, Der Dezember des Dekan und, ja tatsächlich, Lolita. Während ich die Titel der einzelnen Bücher hinschreibe, vertreiben die mit dem Wind hereinwirbelnden Erinnerungen die Ruhe dieses Herbsttages, den ich in einem anderen Zimmer, in einem anderen Land verbringe.
In dieser anderen Welt, die so oft in unseren Diskussionen eine Rolle spielte, sitze ich hier und heute und stelle sie mir wieder vor, meine Mädchen, wie ich sie bald nannte, stelle mir vor, wie wir Lolita lasen, in einem trügerisch sonnigen Raum in Teheran. Aber, um es mit den Worten von Humbert, dem Dichter/Verbrecher aus Lolita, auszudrücken: »Ich brauche Sie, die Leser, in deren Phantasie wir leben, und ohne die wir nicht wirklich existieren werden.« Versuchen Sie uns vor dem Hintergrund der Tyrannei von Zeit und Politik zu sehen, wie wir uns manchmal selbst nicht sehen konnten: in unseren intimsten und geheimsten Momenten, in den außergewöhnlichsten gewöhnlichen Lebenslagen, beim Musikhören, wenn wir uns verliebten, düstere Straßen entlanggingen oder in Teheran Lolita lasen. Und dann stellen Sie sich vor, wie wir lebten, nachdem all das verboten, in den Untergrund gedrängt und uns weggenommen worden war.
Ich schreibe heute über Nabokov, weil ich damit die Tatsache würdigen will, dass wir trotz aller Hindernisse in Teheran Nabokov gelesen haben. Von all seinen Romanen wähle ich den, den ich zuletzt im Unterricht behandelt habe und der mit so vielen Erinnerungen verknüpft ist. Ich will zwar über Lolita schreiben, aber ich kann zumindest jetzt nicht über diesen Roman schreiben, ohne auch über Teheran zu schreiben. Dies also ist die Geschichte von Lolita in Teheran. Sie handelt davon, wie Lolita Teheran eine neue Farbe verlieh und wie Teheran mit daran beteiligt war, dass wir Nabokovs Roman neu lasen und er damit zu dieser Lolita, unserer Lolita wurde.
2
Und so versammelten wir uns an einem Donnerstag Anfang September zu unserem ersten Treffen in meinem Wohnzimmer. Hier kommen sie, noch einmal. Zuerst höre ich die Klingel, eine Pause, und das Schließen der Haustür. Dann Schritte, die die Wendeltreppe heraufkommen, vorbei am Apartment meiner Mutter. Während ich zur Wohnungstür gehe, erspähe ich durch das Seitenfenster ein Stück Himmel. Sobald sie an der Tür sind, nehmen alle Mädchen Umhang und Kopftuch ab, manchmal schütteln sie dabei die Haare. Sie warten einen Moment, bevor sie das Zimmer betreten. Aber: Dieses Zimmer gibt es nicht mehr, nur die quälende Leere der Erinnerung.
Das Wohnzimmer war mehr als jeder andere Ort in unserem Haus ein Symbol für mein nomadisches und unstetes Leben. Ein Sammelsurium an ausgefallenen Möbelstücken, die aus den unterschiedlichsten Zeiten und Orten stammten, teils aus finanziellen Gründen, teils wegen meines eklektischen Geschmacks. Diese an sich unvereinbaren Elemente ergaben zusammen eine merkwürdige Harmonie, die den anderen, einheitlicher eingerichteten Räumen der Wohnung fehlte.
Meine Mutter machte es jedes Mal ganz verrückt, wenn sie die an die Wand gelehnten Bilder, die Blumenvasen auf dem Boden oder die Fenster ohne Vorhänge sah, die ich mich weigerte zuzuhängen, bis ich schließlich ermahnt wurde, dass Fenster in einem islamischen Land zu verhüllen seien. »Ich weiß nicht, bist du wirklich meine Tochter?«, jammerte sie immer. »Habe ich dir nicht beigebracht, wie man Ordnung hält?« Ihre Stimme klang ernst, aber sie beklagte sich nun seit so vielen Jahren darüber, dass es fast schon zu einem zärtlichen Ritual geworden war. »Azi« – das war mein Kosename – »Azi«, sagte sie, »du bist jetzt eine erwachsene Frau, also benimm dich auch so.« Aber ihr Tonfall hatte auch etwas, das mich jung, verletzlich und eigensinnig werden ließ, und noch heute, wenn ich mir ihre Stimme ins Gedächtnis rufe, weiß ich, dass ich ihre Erwartungen nie ganz erfüllt habe. Ich bin nie die Dame geworden, die sie aus mir machen wollte.
Dieser Raum, um den ich mich damals nie sehr gekümmert habe, hat heute für mich, da er zu einem wertvollen Objekt meiner Erinnerung geworden ist, eine ganz andere Bedeutung. Er war ziemlich groß, aber nur spärlich möbliert. In einer Ecke befand sich der Kamin, eine phantasievolle Kreation meines Mannes Bijan. An einer Wand stand ein kleines Sofa, über das ich eine Spitzendecke gelegt hatte, ein Geschenk meiner Mutter aus grauer Vorzeit. Gegenüber dem Fenster eine pfirsichfarbene Couch, dazu zwei passende Stühle und ein großer quadratischer Tisch mit Glasplatte.
Mein Platz war immer der Stuhl, der mit dem Rücken zum Fenster stand, das sich auf eine breite Sackgasse namens Azar hin öffnete. Direkt gegenüber befand sich das einstige Amerikanische Krankenhaus, früher klein und exklusiv, jetzt eine laute, überbelegte Klinik für verwundete und invalide Kriegsopfer. An den Wochenenden – im Iran Donnerstag und Freitag – war die kurze Straße voller Krankenhausbesucher, die wie zu einem Picknick Sandwiches und Kinder mitbrachten. Der Garten vor dem Haus des Nachbarn, der sein ganzer Stolz und seine ganze Freude war, war ihr Hauptangriffsziel, besonders im Sommer, wenn sie sich bei seinen geliebten Rosen bedienten. Wir hörten die Kinder schreien, weinen und lachen und dazwischen das Geplärr ihrer Mütter, wenn sie nach ihnen riefen und mit Strafen drohten. Manchmal drückte eines der Kinder unsere Türklingel und rannte weg, um diesen »gefährlichen« Streich in bestimmten Abständen zu wiederholen.
Von unserer Wohnung im ersten Stock – meine Mutter bewohnte das Erdgeschoss, die Wohnung meines Bruders im zweiten Stock stand oft leer, seit er nach England gegangen war – konnten wir die oberen Zweige eines Baumes mit ausladender Krone sehen, und in der Ferne über den Dächern das Elbursgebirge. Der Blick auf die Straße, das Krankenhaus und seine Besucher aber war uns durch eine Art Zensur versperrt, sie lebten in unserer Wahrnehmung nur durch die körperlosen Stimmen, die zu uns heraufdrangen.
Von meinem Platz aus konnte ich meine Lieblingsberge nicht sehen, aber direkt gegenüber von meinem Stuhl hing an der Wand des Esszimmers ein antiker ovaler Spiegel, ein Geschenk meines Vaters, und darin sah ich die Berge, die selbst im Sommer schneebedeckt waren, und die Bäume mit ihrem sich wandelnden Farbenspiel. Dieser zensierte Blick verstärkte bei mir den Eindruck, dass der Lärm nicht von der Straße käme, sondern von einem weit entfernten Ort, einem Ort, dessen ständiges Summen unsere einzige Verbindung war zu einer Welt, die wir, für diese wenigen Stunden, nicht zur Kenntnis nehmen wollten.
Dieser Raum wurde für uns alle ein Ort der Grenzüberschreitung. Was für ein Märchenland! Wir saßen um den großen, mit Blumensträußen bedeckten Couchtisch und lebten in und aus den Romanen, die wir lasen. Im Rückblick bin ich verblüfft, wie viel wir, ohne es recht zu merken, lernten. Um es mit Nabokov zu sagen: Wir spürten an uns selbst, wie aus einem ganz gewöhnlichen Kiesel ein Edelstein werden kann – durch das magische Auge der Literatur.
3
Sechs Uhr früh: der erste Kurstag. Ich war schon auf. Zu aufgeregt für ein richtiges Frühstück, setzte ich Wasser auf und nahm erst einmal eine ausgiebige Dusche. Das Wasser streichelte meinen Hals, meinen Rücken, meine Beine, und ich fühlte mich gleichzeitig fest verwurzelt und leicht. Zum ersten Mal seit vielen Jahren empfand ich eine Vorfreude, die nicht durch Anspannung getrübt war: keine quälenden Rituale wie in der Zeit, in der ich an der Universität gelehrt hatte – Rituale, die meine Kleidung und mein Verhalten bestimmten und mich zur Selbstkontrolle nötigten. Auf diese Unterrichtsstunde würde ich mich anders vorbereiten.
Das Leben in der Islamischen Republik war unbeständig wie der April. Auf Sonnenschein folgten plötzlich Regenschauer und Sturm. Es war unberechenbar: In diesem Regime folgten Zeiten der Toleranz und Zeiten drastischer Maßregelung fast zyklisch aufeinander. Nach einer Phase relativer Ruhe und sogenannter Liberalisierung waren jetzt wieder härtere Zeiten eingekehrt. Wieder einmal hatten die Kulturpuristen sich auf die Universitäten eingeschossen und erließen immer strengere Vorschriften. Das ging sogar so weit, dass Männer und Frauen in den Seminaren getrennt wurden und ungehorsame Professoren mit Bestrafung zu rechnen hatten.
Die Universität von Allameh Tabatabai, an der ich seit 1987 unterrichtete, galt als eine der liberalsten Universitäten des Iran. Man munkelte, dass jemand im Bildungsministerium die rhetorische Frage gestellt habe, ob die Fakultäten von Allameh denn meinten, sie befänden sich in der Schweiz! Die Schweiz war eine Art Synonym für westliche Laxheit geworden. Jeder Plan und jedes Vorgehen, die als unislamisch galten, wurden mit der höhnisch-vorwurfsvollen Bemerkung kommentiert, der Iran sei schließlich nicht die Schweiz.
Die Studenten litten am meisten darunter. Hilflos hörte ich mir ihre endlosen Klagen an. Studentinnen wurden bestraft, weil sie die Treppen hoch rannten, wenn sie spät dran waren, weil sie in den Fluren lachten, weil sie mit männlichen Studenten sprachen. Eines Tages war Sanaz am Ende der Vorlesung tränenüberströmt in den Hörsaal geplatzt. Schluchzend hatte sie erzählt, dass sie zu spät kam, weil eine Wächterin am Tor in ihrer Handtasche Rouge entdeckt hatte und sie mit einer Rüge hatte nach Hause schicken wollen.
Warum hatte ich so plötzlich aufgehört zu lehren? Diese Frage hatte ich mir schon oft gestellt. Lag es an der nachlassenden Qualität der Universität? An der immer größer werdenden Gleichgültigkeit der Fakultätsmitglieder und Studenten? Dem täglichen Kampf gegen Willkürregeln und Restriktionen?
Lächelnd erinnerte ich mich, während ich mir mit einem rauen Luffaschwamm den Körper abrieb, an die Reaktion der Universitätsverwaltung auf mein Kündigungsschreiben. Die Beamten hatten mich auf alle erdenklichen Arten schikaniert und eingeengt, kontrolliert, mit wem ich Umgang hatte, mein Tun und Lassen überwacht, eine längst fällige Festanstellung torpediert, doch als ich kündigte, hatten sie plötzlich Mitleid mit mir und weigerten sich, die Kündigung zu akzeptieren. Das versetzte mich nun auch wieder in Wut. Die Studenten hatten angedroht, den Unterricht zu boykottieren, und später fand ich zu meiner Genugtuung heraus, dass sie in der Tat trotz Strafandrohungen meinen Nachfolger boykottiert hatten. Jeder glaubte, ich würde letzten Endes doch noch weich werden und zurückkommen.
»Was wirst du denn jetzt machen?«, fragten mich meine Freunde. »Wirst du einfach zu Hause bleiben?« Ich könnte ja wieder ein Buch schreiben, erklärte ich ihnen. Aber in Wahrheit hatte ich keine konkreten Pläne. Ich war immer noch mit den Schockwellen beschäftigt, die die Veröffentlichung meines Nabokov-Buches ausgelöst hatte. Für ein neues Buch hatte ich bislang nicht mehr als ein paar vage Ideen im Kopf. Ich konnte natürlich die Zeit auf angenehme Weise mit dem Studium persischer Klassiker füllen. Aber es gab doch ein bestimmtes Projekt, eine Idee, die ich seit Jahren heimlich hegte. Lange hatte ich davon geträumt, einen speziellen Kurs abzuhalten, einen, der mir die Freiheit ließ, die mir beim offiziellen Unterricht verwehrt war. Ich wollte einige ausgewählte Studentinnen unterrichten, die sich ganz dem Studium der Literatur verschrieben hatten, Studentinnen, die nicht von der Regierung ausgewählt worden waren und sich nicht deshalb für Englische Literatur entschieden hatten, weil sie in anderen Fächern nicht zugelassen worden waren oder weil es ihrer Karriere nützte.
Die Lehrtätigkeit in der Islamischen Republik war, wie jeder andere Beruf, der Politik untergeordnet und willkürlichen Regeln unterworfen. Die Freude am Unterrichten wurde von Schikanen des Regimes getrübt – wie gut kann Unterricht sein, wenn es der Universitätsverwaltung nicht um die Qualität der Arbeit, sondern um die Farbe der Lippen und das subversive Potential einer einzelnen Haarsträhne geht? Kann man sich wirklich auf die Arbeit konzentrieren, wenn die Fakultät über die Frage grübelt, wie sich das Wort »Wein« aus einer Short Story von Hemingway tilgen lässt, wenn sie beschließt, dass Brontë nicht gelesen werden darf, weil sie den Ehebruch zu dulden schien?
Das erinnerte mich an eine befreundete Malerin, die zu Beginn ihrer Laufbahn Alltagsszenen dargestellt hatte, meistenteils leere Räume, verlassene Häuser und weggeworfene Fotos von Frauen. Nach und nach waren ihre Arbeiten immer abstrakter geworden, und die Bilder ihrer letzten Ausstellung zeigten rebellische Farbkleckse, wie die beiden Werke in meinem Wohnzimmer – dunkle Flächen mit kleinen blauen Tropfen. Ich fragte sie, wie sie vom modernen Realismus zur abstrakten Malerei gekommen war. »Die Wirklichkeit ist so unerträglich geworden«, antwortete sie, »so trostlos, dass ich jetzt nur noch die Farben meiner Träume malen kann.«
Die Farben meiner Träume, wiederholte ich in Gedanken und trat aus der Dusche heraus auf die kühlen Fliesen. Das klang schön. Wie viele Menschen haben schon die Chance, die Farben ihrer Träume zu malen? Ich zog meinen voluminösen Bademantel über – es war ein gutes Gefühl, aus der Sicherheit, die mir das mich umfließende Wasser verlieh, in die schützende Hülle des Bademantels zu schlüpfen. Barfuß tappte ich in die Küche, goss Kaffee in meinen Lieblingsbecher, den mit den roten Erdbeeren, und ließ mich gedankenverloren auf dem Diwan im Flur nieder.
Dieser Kurs war die Farbe meiner Träume. Er brachte einen aktiven Rückzug aus einer zum Feind gewordenen Wirklichkeit mit sich. Eine so euphorische, optimistische Stimmung überkam mich nur noch selten, ich wollte sie festhalten. Denn gleichzeitig ließ mir der Gedanke keine Ruhe, dass ich nicht wusste, was mich am Ende dieses Projekts erwartete. Du weißt doch hoffentlich, hatte ein Freund gewarnt, dass du dich immer mehr in dich selbst zurückziehst, und jetzt, wo du deine Arbeit an der Universität aufgegeben hast, wird sich dein Kontakt mit der Außenwelt auf einen einzigen Raum beschränken. Wohin soll das führen? hatte er gefragt. Der Rückzug in eine Traumwelt kann gefährlich sein, überlegte ich, als ich ins Schlafzimmer tappte, um mich anzuziehen. Das hatte ich von Nabokovs verrückten Träumern Kinbote und Humbert gelernt.
Bei der Auswahl meiner Studentinnen hatte ich deren ideologisches oder religiöses Umfeld nicht berücksichtigt. Später erschien es mir als einer der größten Pluspunkte des Projekts, dass die Mitglieder einer so gemischten Gruppe, deren privater, religiöser und sozialer Hintergrund so unterschiedlich war und manchmal zu Konflikten führte, ihren Zielen und Idealen so treu geblieben waren.
Ein Kriterium für meine Auswahl war die eigentümliche Mischung aus Zerbrechlichkeit und Courage, die ich an diesen jungen Frauen wahrzunehmen meinte. Sie waren in gewisser Weise Einzelgängerinnen, die keiner Gruppe oder Gemeinschaft angehörten. Ich bewunderte ihre Fähigkeit, nicht trotz ihrer, sondern eher durch ihre Einsamkeit zu überleben. Wir können den Literaturkurs »ein Zimmer für uns allein« nennen, hatte Manna in Anspielung auf Virginia Woolf vorgeschlagen, eine Art gemeinschaftliche Variante der Woolfschen Vision.
Ich stand an jenem Morgen länger als sonst vor dem Kleiderschrank und probierte verschiedene Kombinationen aus, bis ich mich schließlich für ein rot-gestreiftes T-Shirt und schwarze Cordjeans entschied. Ich legte sorgfältig Make-up auf und schminkte mir die Lippen leuchtend rot. Als ich mir die kleinen goldenen Ohrringe ansteckte, bekam ich plötzlich Panik. Und wenn es nicht funktioniert? Wenn sie nicht kommen?
Nein, so darf ich nicht denken. Wenigstens für die nächsten fünf bis sechs Stunden musste ich mich von diesen Ängsten frei machen. Bitte, bitte, beschwor ich mich selbst. Dann schlüpfte ich in meine Schuhe und ging in die Küche.
4
Ich kochte gerade Tee, als es an der Tür läutete. Ich war noch so in Gedanken versunken, dass ich sie beim ersten Mal nicht gehört hatte. Vor der Tür stand Mahshid. Ich dachte schon, Sie sind nicht zu Hause, sagte sie und überreichte mir einen Strauß weißer und gelber Narzissen. Als sie ihren langen Mantel ablegte, sagte ich: Hier sind keine Männer – du kannst das auch ausziehen. Sie zögerte einen Moment und nahm dann auch ihr langes schwarzes Tuch ab. Mahshid und Yassi trugen beide das Kopftuch, aber Yassi ging in letzter Zeit mit ihrem etwas zwangloser um. Sie knotete es locker unter dem Kinn, und ihre dunkelbraunen, in der Mitte unordentlich gescheitelten Haare lugten darunter hervor. Mahshids Haar dagegen war makellos frisiert und unter dem Schleier verborgen. Ihr kurzer Pony verlieh ihr ein merkwürdig altbackenes Aussehen, das mir eher europäisch als iranisch vorkam. Sie trug über ihrer weißen Bluse eine dunkelblaue Jacke, auf die rechts ein riesiger gelber Schmetterling gestickt war. Ich deutete auf den Schmetterling: Trägst du das zu Ehren von Nabokov?
Ich weiß nicht mehr, wann Mahshid in meinen Seminaren an der Universität aufgetaucht war. Es kam mir vor, als sei sie schon immer da gewesen. Ihr Vater, ein frommer Moslem, war ein glühender Anhänger der Revolution gewesen. Sie hatte schon vor der Revolution den Schleier getragen, und in ihrem Kurstagebuch hatte sie die einsamen Vormittage an dem schicken Mädchencollege beschrieben, an dem sie sich vernachlässigt und ignoriert gefühlt hatte – ironischerweise aufgrund ihrer für damalige Verhältnisse auffälligen Kleidung. Nach der Revolution war sie wegen ihrer Mitgliedschaft bei einer regimekritischen Religionsgemeinschaft fünf Jahre im Gefängnis und konnte auch in den zwei Jahren danach ihre Ausbildung nicht fortsetzen.
Ich stelle mir vor, wie sie in diesen vorrevolutionären Tagen an zahllosen sonnigen Vormittagen die ansteigende Straße zum College entlanggeht. Allein, mit gesenktem Kopf. Damals wie heute konnte sie die Helligkeit des Tages nicht genießen. Ich sage »damals wie heute«, weil die Revolution, die allen Frauen die Verschleierung aufzwang, Mahshid nicht von ihrer Einsamkeit befreite. Vor der Revolution konnte sie in gewissem Sinn stolz auf ihre Isolation sein. Damals war das Kopftuch ein Glaubensbekenntnis für sie gewesen. Sie hatte sich freiwillig dafür entschieden. Als die Revolution alle zur Verschleierung nötigte, verlor dieser Akt für sie seine Bedeutung.
Mahshid ist vornehm im wahrsten Sinne des Wortes: Sie besitzt Anmut und Würde. Ihre Haut ist mondlichtfarben, sie hat mandelförmige Augen und rabenschwarzes Haar. Sie trägt Pastellfarben und spricht leise. Ihr frommes Zuhause hätte sie schützen müssen, aber dem war nicht so. Ich kann sie mir nicht im Gefängnis vorstellen.
In den vielen Jahren, die ich Mahshid kenne, hat sie selten über ihre Zeit im Gefängnis gesprochen, die ihr ein chronisches Nierenleiden eingebracht hatte. Als wir uns einmal im Kurs über unsere täglichen Ängste und Alpträume unterhielten, erwähnte sie, dass sie hin und wieder von Erinnerungen an die Zeit im Gefängnis heimgesucht werde und sie immer noch keinen Weg gefunden habe, sie zu artikulieren. Aber, fügte sie hinzu, der Alltag birgt nicht weniger Gräuel als das Gefängnis.
Ich bot Mahshid eine Tasse Tee an. Rücksichtsvoll wie immer erwiderte sie, sie würde lieber auf die anderen warten, und entschuldigte sich, dass sie etwas zu früh gekommen sei. Kann ich helfen? fragte sie. Es gibt eigentlich nichts zu helfen. Mach es dir bequem, rief ich ihr zu, als ich mit den Blumen in die Küche ging, um nach einer Vase zu suchen. Wieder läutete es. Ich geh schon, rief Mahshid aus dem Wohnzimmer. Ich hörte Gelächter. Manna und Yassi waren gekommen.
Manna erschien mit einem kleinen Rosenstrauß in der Küche. Der ist von Nima, sagte sie. Er will, dass Sie ein schlechtes Gewissen bekommen, weil Sie ihn vom Kurs ausgeschlossen haben. Er sagt, aus Protest werde er, solange wir Unterricht haben, mit einem Rosenstrauß vor dem Haus auf- und abgehen. Sie strahlte, ihre Augen sprühten Funken, die aber schnell verloschen.
Während ich das Gebäck auf einem großen Tablett arrangierte, fragte ich Manna, ob sie sich die Worte ihrer Gedichte in Farbe vorstelle. Nabokov schreibt in seiner Autobiografie, dass er und seine Mutter die Buchstaben des Alphabets farbig gesehen hätten, erklärte ich. Er sagt von sich selbst, er sei ein visueller Schriftsteller.
»Die Islamische Revolution hat meinen Sinn für Farben vergröbert«, sagte Manna und spielte mit den abgefallenen Rosenblättern. »Ich möchte extravagante Farben tragen, knalliges Pink oder Tomatenrot. Ich lechze zu sehr nach Farben, als dass ich sie in den sorgfältig gewählten Worten eines Gedichts sähe.« Manna ist einer jener Menschen, die Ekstase, aber nicht Glück erleben können. »Komm, ich möchte dir etwas zeigen«, sagte ich und führte sie in unser Schlafzimmer. »Als ich noch ganz klein war, war ich besessen von den Farben der Orte und Gegenstände, von denen mir mein Vater in seinen Gutenachtgeschichten erzählte. Ich wollte wissen, welche Farbe Scheherazades Kleid hatte, welche ihre Bettdecke, der Geist und die Zauberlampe, und einmal fragte ich ihn nach der Farbe des Paradieses. Er sagte, ich könne ihm jede Farbe geben, die ich wollte. Es hat mir aber keine Ruhe gelassen. Eines Tages, als wir Gäste hatten und ich im Esszimmer meine Suppe aß, fiel mein Blick auf ein Gemälde, das an der Wand hing, seit ich denken konnte, und in diesem Augenblick wusste ich, welche Farbe mein Paradies hat. Hier ist es«, sagte ich, und deutete stolz auf ein kleines Ölbild in einem alten Holzrahmen; eine grüne Landschaft mit üppigen, lederartigen Blättern, zwei Vögeln, zwei dunkelroten Äpfeln, einer goldenen Birne und einer Spur Blau.
»Mein Paradies ist blau wie ein Swimmingpool!«, stieß Manna hervor, den Blick immer noch auf das Bild geheftet. »Wir haben früher in einem großen Garten gewohnt, der meinen Großeltern gehörte. Sie kennen doch die alten persischen Gärten mit ihren Obstbäumen, Pfirsichen, Äpfeln, Kirschen, Persimonen und ein, zwei Weiden. Am liebsten erinnere ich mich an unseren riesigen, unregelmäßig geformten Swimmingpool. Ich war Schwimmmeisterin meiner Schule, und darauf war mein Vater sehr stolz. Etwa ein Jahr nach der Revolution starb er an einem Herzinfarkt, und dann konfiszierte die Regierung unser Haus und unseren Garten, und wir zogen in eine Wohnung. Ich bin nie wieder geschwommen. Mein Traum liegt am Grund dieses Pools. Ich träume immer wieder davon, wie ich hineintauche, um etwas aus der Erinnerung an meinen Vater und an meine Kindheit heraufzuholen«, sagte sie, als wir ins Wohnzimmer zurückgingen, weil es wieder an der Tür geläutet hatte.
Azin und Mitra waren zusammen gekommen. Azin legte ihr schwarzes kimonoartiges Übergewand ab – damals waren Gewänder im japanischen Stil gerade groß in Mode – und enthüllte eine weiße Bauernbluse, die ihre Schultern nur notdürftig bedeckte, große goldene Ohrringe und pinkfarbenen Lippenstift. Sie hielt einen Zweig mit kleinen gelben Orchideenblüten in der Hand – von Mitra und mir, sagte sie in ihrem sehr eigenwilligen Tonfall, den ich nur als kokettes Schmollen bezeichnen kann.
Als nächste klingelte Nassrin. Sie hatte zwei Schachteln Nougat mitgebracht, ein Geschenk aus Isfahan, wie sie erklärte. Sie trug ihre übliche Uniform – dunkelblauer Mantel, dunkelblaues Kopftuch und schwarze, flache Schuhe. Als ich sie das letzte Mal im Seminar gesehen hatte, hatte sie einen riesigen schwarzen Tschador getragen, der nur ihr ovales Gesicht und zwei unruhige Hände frei ließ, die, wenn sie nicht schrieb oder kritzelte, unablässig in Bewegung waren, als wollten sie dem schweren schwarzen Tuch entkommen. Vor kurzem hatte sie den Tschador durch lange, unförmige, dunkelblaue, schwarze oder dunkelbraune Überkleider ersetzt. Dazu trug sie dicke, farblich passende Kopftücher, die ihr Haar verbargen und ihr Gesicht umrahmten. Sie hatte ein kleines, blasses Gesicht, zarte Haut, durch die die Adern schimmerten, dichte Augenbrauen, lange Wimpern, lebhafte braune Augen, eine kleine, gerade Nase und einen Mund, der ihre Verärgerung verriet: die unvollendete Miniatur eines Meisters, der unvermittelt von seiner Arbeit weggerufen worden war und das akribisch genau gezeichnete Gesicht in einen nachlässig hingeklecksten, dunklen Farbfleck eingesperrt zurückgelassen hatte.
Man hörte Reifen kreischen und Bremsen quietschen. Ich sah aus dem Fenster: ein kleiner, alter cremefarbener Renault hatte am Straßenrand gehalten. Der junge Mann hinter dem Steuer mit der auffällig modischen Sonnenbrille und dem eigenwilligen Profil hatte – wie ein Porschefahrer – den Arm lässig auf das heruntergekurbelte Fenster gelegt. Er blickte starr nach vorne, während er mit der Frau auf dem Rücksitz sprach. Nur einmal wandte er den Kopf mit finsterer Miene nach rechts, und zwar, als die Frau ausstieg und wütend die Autotür zuschlug. Als sie auf die Haustür zuging, steckte er den Kopf durch das offene Fenster und rief ihr etwas hinterher, aber sie drehte sich nicht um. Der alte Renault gehörte Sanaz, sie hatte ihn von ihren eigenen Ersparnissen gekauft.
Ich wandte mich wieder den anderen zu. Sanaz tat mir leid. Das muss der ekelhafte Bruder sein, dachte ich. Sekunden später läutete es an der Tür, ich hörte Sanaz’ eilige Schritte und öffnete. Sie wirkte gehetzt, als wäre sie vor einem Verfolger oder Dieb auf der Flucht. Sobald sie mich sah, setzte sie ihr Lächeln auf und sagte atemlos: »Ich bin hoffentlich nicht zu spät dran?«
Zwei Männer spielten zu jener Zeit in Sanaz’ Leben eine dominante Rolle. Der erste war ihr Bruder. Er war neunzehn, hatte die Highschool noch nicht beendet und war das Lieblingskind ihrer Eltern, die nach zwei Mädchen, von denen eines mit drei gestorben war, endlich mit einem Sohn gesegnet worden waren. Er wurde verhätschelt und hatte nur einen einzigen Lebensinhalt, mit dem er sich geradezu zwanghaft beschäftigte: Sanaz. Neuerdings wollte er seine Männlichkeit unter Beweis stellen, indem er ihr nachspionierte, ihre Telefongespräche belauschte, mit ihrem Auto herumfuhr und jede ihrer Bewegungen überwachte. Die Eltern versuchten, Sanaz zu beschwichtigen, und flehten sie an, als ältere Schwester doch Geduld und Verständnis für ihren Bruder aufzubringen und ihn in dieser schwierigen Phase mütterlich zu begleiten.
Der andere Mann war ihr Jugendfreund, ein Junge, den sie seit ihrem elften Lebensjahr kannte. Beide Familien waren eng befreundet und verbrachten fast ihre gesamte Freizeit und die Ferien miteinander. Sanaz und Ali waren seit Ewigkeiten ein Liebespaar. Ihre Eltern unterstützten die Verbindung und nannten sie ein Himmelsgeschenk. Seit Ali vor sechs Jahren nach England gegangen war, sprach seine Mutter von Sanaz als »die Braut«. Sie schrieben sich Briefe, schickten Fotos, und als sich in letzter Zeit immer mehr Verehrer um Sanaz bemüht hatten, sprach man von einer Verlobung und einem Wiedersehen in der Türkei, einem Land, in das Iraner ohne Visum einreisen durften. Es war nur noch eine Frage von Tagen, und Sanaz sah dem Ereignis mit einigem Zittern und Bangen entgegen.
Ich hatte Sanaz nie unverhüllt gesehen und stand wie gebannt vor ihr, als sie Mantel und Kopftuch ablegte. Sie trug ein orangefarbenes T-Shirt, das sie in enge Jeans gesteckt hatte, und dazu braune Stiefel. Die größte Veränderung war jedoch ihre dunkelbraune, glänzende Haarpracht, die jetzt das Gesicht umrahmte. Sie warf die wunderbaren, langen Haare von rechts nach links, was, wie ich später merkte, eine Angewohnheit von ihr war: In regelmäßigen Abständen schüttelte sie ihre Mähne und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare, als müsse sie sich vergewissern, dass ihr kostbarster Besitz noch da war. Ihre Gesichtszüge wirkten nun weicher und strahlender – durch das schwarze Kopftuch, das sie in der Öffentlichkeit trug, sah ihr kleines Gesicht ausgezehrt, ja fast hart aus.
»Tut mir leid, dass ich ein bisschen spät komme«, sagte sie atemlos und fuhr sich durch die Haare. »Mein Bruder wollte mich unbedingt fahren, und er hat sich geweigert, sich pünktlich wecken zu lassen. Er steht nie vor zehn auf, aber er wollte wissen, wohin ich gehe. Ich könnte ja ein heimliches Rendezvous haben, wissen Sie, ein Date oder so was.«
»Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob eine von euch wegen dieses Kurses Ärger bekommt«, sagte ich, nachdem ich sie aufgefordert hatte, am Wohnzimmertisch Platz zu nehmen. »Ich hoffe, eure Eltern und Ehemänner sind einverstanden mit unseren Treffen.«
Nassrin, die durch das Zimmer wanderte und die Bilder an den Wänden inspizierte, blieb stehen und sagte achselzuckend: »Ich habe meinem Vater so nebenbei davon erzählt, nur um seine Reaktion zu testen, und er war ganz und gar dagegen.«
»Wie hast du ihn dann überreden können?« fragte ich. »Ich habe gelogen«, sagte sie.
»Du hast gelogen?«
»Was soll man denn sonst tun bei einem solchen Diktator, der seine Tochter nicht mal zu einem Literaturseminar gehen lässt, das nur von Frauen besucht wird? Und außerdem, gehen wir so nicht auch mit dem Regime um? Können wir den Revolutionswächtern die Wahrheit sagen? Wir lügen sie an; wir verstecken unsere Satellitenschüsseln. Wir sagen ihnen, wir hätten keine illegalen Bücher und keinen Alkohol zu Hause. Sogar mein verehrter Vater lügt sie an, wenn die Sicherheit seiner Familie auf dem Spiel steht«, erklärte Nassrin trotzig. »Und wenn er mich nun anruft und nachhakt?« fragte ich, halb im Scherz. »Das wird er nicht. Ich habe ein brillantes Alibi. Ich habe gesagt, Mahshid und ich hätten angeboten, islamische Texte ins Englische zu übersetzen.« »Und das hat er dir geglaubt?« »Ja, warum auch nicht? Ich habe ihn früher nie angelogen, und er wollte es ja auch glauben. Und Mahshid vertraut er blind.«
»Wenn er mich also anruft, soll ich ihn anlügen?«, bohrte ich weiter. »Das ist Ihre Entscheidung«, erwiderte Nassrin nach einer Weile, den Blick auf ihre verschränkten Hände gesenkt. »Finden Sie, ich sollte es ihm sagen?« In ihrer Stimme war eine Spur von Verzweiflung. »Bringe ich Sie in Schwierigkeiten?«
Nassrin gab sich immer so selbstbewusst, dass ich manchmal ganz vergaß, wie verletzlich sie unter der rauen Schale war. »Natürlich würde ich dein Vertrauen respektieren«, sagte ich sanfter. »Wie du selbst sagst, du bist schließlich erwachsen. Du weißt, was du tust.«
Ich hatte mich auf meinen späteren Stammplatz gesetzt, gegenüber dem Spiegel, auf dem sich die Berge abzeichneten. Es ist merkwürdig, in einen Spiegel zu schauen und nicht sich selbst zu sehen, sondern etwas so weit Entferntes. Mahshid hatte nach einigem Zögern auf dem Stuhl rechts neben mir Platz genommen. Manna saß rechts außen auf der Couch, Azin ganz links; sie hielten instinktiv Abstand voneinander. Sanaz und Mitra hockten nebeneinander auf dem Zweier-Sofa und steckten tuschelnd und kichernd die Köpfe zusammen.
Erst jetzt sahen sich Yassi und Nassrin nach freien Plätzen um. Azin sah Yassi an und klopfte einladend auf den leeren Mittelteil der Couch. Yassi zögerte kurz und zwängte sich dann zwischen Azin und Manna. Sie machte sich so breit, dass kaum noch Platz für ihre beiden Nachbarinnen blieb, die aufrecht und ein bisschen steif in ihren Ecken thronten. Ohne das Übergewand kam Yassis Babyspeck zum Vorschein, und sie sah rundlicher aus als sonst. Nassrin machte sich auf die Suche nach einem Stuhl. »Du könntest dich hier noch reinquetschen«, sagte Manna. »Nein, danke, mir ist ein Stuhl mit gerader Lehne lieber.« Als sie zurückkam, platzierte sie ihren Stuhl zwischen die Couch und Mahshid.
Sie behielten ihre Sitzordnung, die ihre emotionalen Grenzen und persönlichen Beziehungen widerspiegelte, bis zum Schluss bei. Und so begann unsere erste Stunde.
5
»Ypsilamba!« rief Yassi, als ich ein Tablett mit Tee ins Esszimmer brachte. Yassi liebte Wortspiele. Einmal meinte sie, ihre Sprachbesessenheit habe schon pathologische Züge. Sobald ich auf ein neues Wort stoße, bemerkte sie, muss ich es auch verwenden, wie jemand, der ein schickes Kleid kauft und es kaum erwarten kann, es ins Kino oder Restaurant anzuziehen.
Aber spulen wir den Film ein wenig zurück bis zu den Ereignissen, die erklären, was es mit Yassis Ausruf auf sich hat. Es war unser erstes Treffen. Wir waren nervös und wussten nicht recht, was wir sagen sollten – sonst hatten wir uns ja in aller Öffentlichkeit getroffen, vor allem in Seminarräumen und Hörsälen. Die Mädchen hatten, jede für sich, eine eigene Beziehung zu mir aufgebaut, aber mit Ausnahme von Nassrin und Mahshid, die eng befreundet waren, und Mitra und Sanaz, die eine gewisse Zuneigung verband, kannten sie sich untereinander kaum. Unter anderen Umständen wären sie vielleicht nie Freundinnen geworden – und daher war ihnen diese vertrauliche Atmosphäre unangenehm.
Ich machte ihnen klar, dass es das Ziel dieses Seminars sei, Werke der Literatur zu lesen, zu diskutieren und für das eigene Leben fruchtbar zu machen. Alle sollten ein privates Tagebuch führen, in dem sie die Wirkung, die die Romane auf sie hatten, aufschreiben und festhalten konnten, was diese Werke und unsere Diskussionen mit ihren persönlichen und gesellschaftlichen Erfahrungen zu tun hatten. Sie waren, erklärte ich ihnen, für dieses Seminar ausgewählt worden, weil sie sich offenbar mit Leib und Seele dem Studium der Literatur verschrieben hatten. Ich erwähnte, dass eines der Kriterien, nach denen ich die Bücher ausgesucht hatte, der Glaube der Autoren an die kritische und beinahe magische Macht der Literatur war, und rief ihnen den neunzehn Jahre alten Nabokov ins Gedächtnis, der sich während der Russischen Revolution nicht vom Lärm der Schüsse ablenken lassen wollte. Er hörte die Gewehrsalven, sah von seinem Fenster aus die blutigen Kämpfe – und schrieb weiter seine von Einsamkeit geprägten Gedichte. Schauen wir mal, sagte ich, ob unser unvoreingenommener Glaube auch siebzig Jahre später noch belohnt wird und die durch eine andere Revolution heraufbeschworene düstere Realität verändert.
Das erste Werk, über das wir sprachen, war Tausendundeine Nacht, die berühmte Geschichte von einem betrogenen König, der aus Rache für den Ehebruch seiner Gemahlin eine Reihe von Jungfrauen ehelicht und tötet, bevor seinem mörderischen Treiben durch die bezaubernde Geschichtenerzählerin Scheherazade Einhalt geboten wird. Ich formulierte einige allgemeine Fragen; die wichtigste lautete, inwiefern uns dieses großartige Werk der Phantasie in einer Situation helfen könnte, in der wir als Frauen wie in einer Falle gefangen sind. Wir suchten nicht einfach nach Rezepten oder simplen Lösungen, aber wir hofften schon eine Verbindung zu finden zwischen den Freiräumen, die die Romane boten, und der uns aufgezwungenen Enge. Ich weiß noch, wie ich meinen Mädchen Nabokovs Ausspruch vorlas, nach dem »Leser frei geboren werden und auch frei bleiben sollten«.
Am meisten hatten mich an der Rahmenhandlung von Tausendundeiner Nacht die drei darin porträtierten Frauentypen fasziniert: alle Opfer einer unsinnigen Vorschrift des Königs. Bevor Scheherazade in Erscheinung tritt, lassen sich die Frauen der Erzählung einteilen in die, die betrügen und daraufhin getötet werden (die Königin), und jene, die getötet werden, bevor sie die Gelegenheit haben zu betrügen (die Jungfrauen). Die Jungfrauen, die anders als Scheherazade in der Geschichte keine Stimme haben, werden von der Literaturwissenschaft meist übergangen. Ihr Schweigen ist jedoch bezeichnend. Sie geben ihre Jungfräulichkeit – und ihr Leben – ohne jeden Widerstand oder Protest hin. Sie existieren nicht einmal richtig, da sie in ihrem anonymen Tod keinerlei Spur hinterlassen. Die Untreue der Königin raubt dem König nichts von seiner absoluten Autorität, sie wirft ihn bloß aus dem Gleichgewicht. Beide Frauentypen – die Königin und die Jungfrauen – akzeptieren stillschweigend die öffentliche Autorität des Königs, indem sie innerhalb der von ihm definierten Grenzen seiner Herrschaft agieren und deren Willkürgesetze anerkennen.
Scheherazade durchbricht den Kreislauf der Gewalt, indem sie eine andere Taktik wählt. Sie formt ihre Welt nicht wie der König durch körperlichen Zwang, sondern durch Phantasie und Klugheit. Das gibt ihr den Mut, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, und unterscheidet sie auch von den anderen Figuren dieser Geschichte.
Die von uns verwendete Ausgabe von Tausendundeiner Nacht umfasste sechs Bände. Ich hatte meine zum Glück bereits gekauft, bevor sie verboten wurde und seitdem nur mehr zu horrenden Preisen auf dem Schwarzmarkt zu erwerben war. Ich verteilte die einzelnen Bände an die Mädchen und bat sie, die Erzählungen bis zur nächsten Stunde im Hinblick auf die zentralen Frauenfiguren zu ordnen.
Nachdem ich ihnen ihre Aufgabe gegeben hatte, bat ich jede einzelne, uns zu erklären, warum sie sich entschlossen hatte, den Donnerstagmorgen hier zu verbringen, um über Nabokov und Jane Austen zu diskutieren. Ihre Antworten waren kurz und wirkten ein wenig gezwungen. Um das Eis zu brechen, schlug ich eine kleine Ablenkung vor: Windbeutel und Tee.
Das also ist der Augenblick, als ich mit acht Gläsern Tee auf einem alten, matt glänzenden Silbertablett ins Esszimmer komme. Das Kochen und Servieren von Tee ist im Iran ein mehrmals am Tag vollzogenes ästhetisches Ritual. Wir servieren Tee in durchsichtigen, kleinen, formschönen Gläsern, wobei die mit der »schlanken Taille« am beliebtesten sind: oben rund und voll, in der Mitte schmal und unten wieder dick und rund. Anhand der Farbe des Tees und seines feinen Aromas lässt sich erkennen, wie gut jemand die Kunst der Teezubereitung beherrscht.
Ich komme also mit acht hübsch taillierten Gläsern, in denen die honigfarbene Flüssigkeit verführerisch schaukelt, ins Esszimmer. Da höre ich Yassi triumphierend »Ypsilamba!« rufen. Sie wirft mir dieses Wort wie einen Ball zu, und ich versuche ihn mit einem Gedankensprung aufzufangen.
Ypsilamba! – das Wort führt mich zurück in das Frühjahr 1994, als vier dieser Mädchen gemeinsam mit Nima mein Seminar über den Roman im 20. Jahrhundert als Gasthörer belegten und sich Nabokovs Einladung zur Enthauptung als Lieblingsbuch der Studenten entpuppte. In diesem Roman zeigt Nabokov, wie sein phantasievoller und einsamer Held Cincinnatus C. durch seine Originalität in Widerspruch gerät zu einer Gesellschaft, in der Uniformität nicht nur die Norm, sondern sogar Gesetz ist. Schon als Kind, so erzählt Nabokov, habe Cincinnatus das Neuartige und Schöne an der Sprache geschätzt, während andere Kinder »sich bereits nach dem ersten Wort verstanden, denn sie besaßen keine Worte, die unerwartet endeten, vielleicht mit einem archaischen Buchstaben, einem Ypsilamba, das mit erstaunlichen Folgen zu einem Vogel oder Katapult wurde«.
Niemand im Seminar hatte gewagt, nach der Bedeutung des Worts zu fragen. Niemand, zumindest niemand, der regulär am Seminar teilnahm, denn viele meiner früheren Studenten kamen auch lange nach ihrem Abschluss noch weiter zu meinen Lehrveranstaltungen. Oft zeigten sie mehr Interesse und waren fleißiger als meine normalen Studenten, die das Seminar für ihre Noten brauchten. Und so versammelten sich diese Gasthörer – unter ihnen Nassrin, Manna, Nima, Mahshid und Yassi – eines Tages in meinem Büro, um über diese und viele andere Fragen zu sprechen.
Um die Neugier der Seminarteilnehmer auf die Probe zu stellen, veranstaltete ich mit ihnen ein kleines Spiel. Nach der Hälfte des Kurses gab es einen Test, und eine der Aufgaben lautete: »Erklären Sie den Sinn des Wortes Ypsilamba im Kontext von Einladung zur Enthauptung. Was bedeutet dieses Wort, und in welchem Verhältnis steht es zum zentralen Thema des Romans?« Mit Ausnahme von vier oder fünf Studenten hatte niemand eine Ahnung davon, was ich vielleicht meinen könnte – ein Punkt, an den ich sie im weiteren Verlauf des Seminars immer wieder erinnerte.
In Wahrheit war Ypsilamba eine von Nabokovs bizarren Kreationen, möglicherweise ein Wort, das er aus Ypsilon und Lambda, dem zwanzigsten und dem elften Buchstaben des griechischen Alphabets gebildet hatte. An diesem ersten Tag unseres Privatseminars spielten wir also wieder unser Spiel und erfanden selbst neue Bedeutungen.
Ich meinte, ich würde Ypsilamba mit der unglaublichen Freude über einen Sprung, bei dem man fast zu schweben scheint, assoziieren. Yassi, die ohne ersichtlichen Grund ganz aufgeregt wirkte, bemerkte sofort, dass sie immer dachte, es sei der Name eines Tanzes – in Wendungen wie »C’mon, baby, do the Ypsilamba with me«. Darauf schlug ich vor, dass sie alle bis zum nächsten Mal ein oder zwei Sätze darüber schreiben sollten, was das Wort für sie bedeute.
Manna schrieb, Ypsilamba erwecke in ihr das Bild eines kleinen silberfarbenen Fisches, der aus einem im Mondlicht liegenden See emportauche. Nima fügte in Klammern hinzu: Obwohl Sie mich von Ihrem Seminar ausgeschlossen haben, nur damit Sie mich nicht vergessen: Ein Ypsilamba auch für Sie! Für Azin war es ein Klang, eine Melodie. In Mahshids Vorstellung drei Mädchen, die bei jedem Sprung über ein Seil »Ypsilamba!« rufen. Für Sanaz der geheime magische Name eines kleinen afrikanischen Jungen. Mitra war sich nicht sicher, warum sie das Wort an das Paradox eines glücklichen Seufzers erinnerte. Und für Nassrin war es die Zauberformel, die das Tor zu einer geheimen Höhle voller Schätze öffnete.
Ypsilamba war nur eines aus unserem immer größer werdenden Fundus von verschlüsselten Wörtern und Ausdrücken, der im Lauf der Zeit derart anwuchs, dass wir allmählich unsere eigene Geheimsprache entwickelten. Dieses Wort wurde ein Symbol, ein Sinnbild für die undefinierbaren Gefühle von Freude und Erregung, die Nabokov sich bei seinen Lesern erhoffte, Gefühle, die die »guten« von den »gewöhnlichen« Lesern trennten. Es wurde aber auch das Codewort, das uns das Tor öffnete zu der geheimen Höhle der Erinnerung.
6
Im Vorwort zur englischsprachigen Ausgabe von Einladung zur Enthauptung (1959) weist Nabokov die Leser darauf hin, dass sein Roman nicht »tout pour tous« biete. Nichts dergleichen. Er ist, sagt er, »eine Violine im Leeren.« Und doch, so Nabokov weiter, »ich kenne ein paar … Leser, die aufspringen und sich die Haare raufen werden«. Allerdings. Die Erstfassung, so berichtet er, war 1935 in Fortsetzungen in einer Zeitschrift erschienen. Beinahe sechs Jahrzehnte später, in einer Nabokov unbekannten und vermutlich auch unbegreifbaren Welt, in einem tristen Wohnzimmer mit Blick auf schneebedeckte Berge in der Ferne, wurde ich Zeuge, wie einer der ungewöhnlichsten Lesezirkel, die man sich vorstellen kann, sich immer wieder geradezu verzweifelt die Haare raufte.
Einladung zur Enthauptung beginnt mit der Verkündung des Todesurteils für den schwachen Helden des Romans Cincinnatus C., der sich des Verbrechens eines »gnoseologischen Frevels« schuldig gemacht hat: An einem Ort, an dem alle Bürger transparent zu sein haben, ist er opak, undurchschaubar. Das Hauptcharakteristikum dieser Welt ist die sie beherrschende Willkür – das einzige Privileg des Verurteilten besteht darin, den Zeitpunkt seines Todes zu kennen, aber seine Henker verwehren ihm auch das, indem sie jeden Tag zu einem Hinrichtungstag werden lassen. Im Laufe der Erzählung entdecken die Leser mit wachsendem Unbehagen die kunstvolle Struktur dieses merkwürdigen Schauplatzes. Der Mond vor dem Fenster ist reiner Schwindel, genauso wie die Spinne in der Ecke, die, so verlangt es die Konvention, zum treuen Gefährten des Gefangenen werden muss. Der Direktor des Gefängnisses, der Gefängniswärter und der Strafverteidiger sind ein und dieselbe Person, die nur die Schauplätze wechselt. Die wichtigste Figur, der Scharfrichter, wird dem Gefangenen zuerst unter einem anderen Namen als Mithäftling vorgestellt: M’sieur Pierre. Der Scharfrichter und der Verurteilte müssen lernen, einander zu lieben, und außerdem beim Akt der Hinrichtung, der mit einem rauschenden Fest gefeiert wird, zusammenarbeiten. Inmitten dieser Scheinwelt ist das Schreiben für Cincinnatus das einzige Fenster in ein anderes Universum.
Die Welt des Romans ist voller leerer Rituale. Jegliches Handeln ist sinn- und bedeutungslos, und sogar der Tod verkommt zu einem Spektakel, für das rechtschaffene Bürger Eintritt bezahlen. Erst diese leeren Rituale machen Brutalität möglich. In einem weiteren Roman von Nabokov, Das wahre Leben des Sebastian Knight, entdeckt der Bruder des Titelhelden nach dessen Tod in der Bibliothek zwei Bilder, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben: ein hübsches Kind mit lockigem Haar, das mit einem Hund spielt, und ein Chinese, der gerade geköpft wird. Die beiden Bilder verweisen darauf, wie nah Banalität und Brutalität beieinander liegen. Nabokov hatte dafür einen speziellen russischen Ausdruck: poschlost.
Poschlost, erklärt Nabokov, »ist nicht nur der offenkundige Schund, sondern vor allem das, was fälschlich als wichtig, schön, klug und attraktiv ausgegeben wird«. Es gibt viele Beispiele aus dem alltäglichen Leben, die man hier anführen könnte, von den Süßholzraspeleien der Politiker bis hin zu gewissen Aufrufen von Schriftstellern. Oder die Plastikblumen, die leuchtend rosa-blauen, künstlichen Gladiolen, die sowohl bei fröhlichen als auch traurigen Anlässen an der Universität zum Einsatz kommen.
Nabokov präsentiert uns in Einladung zur Enthauptung nicht die körperlichen Schmerzen und Qualen in einem totalitären Regime, sondern den Alptraum eines Lebens in einer Atmosphäre permanenter Angst. Cincinnatus C. ist schwach, er ist passiv, er ist ein Held, ohne es zu wissen oder auch nur zu ahnen: Er kämpft mit seinen Instinkten, und das Schreiben ist für ihn eine Art Ausweg. Er ist ein Held, weil er sich weigert, so zu werden wie alle anderen.
Im Unterschied zu anderen utopischen Romanen sind die Kräfte des Bösen hier nicht allmächtig, sondern Nabokov zeigt uns auch ihre Schwäche. Sie sind lächerlich, und sie können besiegt werden, was die eigentliche Tragödie – Leben zu vergeuden – aber nicht schmälert. Einladung zur Enthauptung ist aus dem Blickwinkel eines Opfers geschrieben, das schließlich die absurde Heuchelei seiner Peiniger erkennt und sich in sich selbst zurückziehen muss, um zu überleben.
Wir, die wir in der Islamischen Republik Iran lebten, begriffen die Tragödie und Absurdität der Grausamkeit, der wir unterworfen waren. Wir mussten uns über unsere eigene Misere lustig machen, um zu überleben. Und instinktiv merkten wir, was poschlost bedeutete – nicht nur bei anderen, sondern auch bei uns selbst. Darin lag ein Grund, warum Kunst und Literatur für unser Leben so entscheidend wurden: Sie waren nicht Luxus, sondern Notwendigkeit. Nabokov hatte die Struktur des Lebens in einer totalitären Gesellschaft eingefangen, in der man völlig allein ist inmitten einer illusionären Welt voller falscher Versprechungen und zwischen Retter und Henker nicht mehr unterscheiden kann.
Nabokov verband uns nach und nach auf eine ganz spezielle Weise miteinander, obwohl seine Prosa nicht gerade leichte Kost ist. Diese Bindung war stärker als die Identifikation mit seinen Themen. Seine Romane sind um unsichtbare Falltüren herum gebaut, leere Räume, die sich plötzlich auftun und den Lesern den Boden unter den Füßen wegziehen. Sie sind voller Misstrauen gegen das, was wir Alltagswirklichkeit nennen, mit einem feinen Gespür für die Unbeständigkeit und Zerbrechlichkeit dieser Realität.
In seinem Werk und in seinem Leben gab es etwas, das uns instinktiv ansprach und fesselte, die Möglichkeit grenzenloser Freiheit, wenn einem alle Optionen genommen werden. Ich glaube, das war es, was mich dazu brachte, dieses Seminar auf die Beine zu stellen. Meine wichtigste Verbindung zur Außenwelt war die Universität gewesen, und nun, da ich diese Verbindung nicht mehr hatte und vor dem Nichts stand, konnte ich die Violine erfinden oder mich im Nichts verlieren.
7
Am besten legt man die beiden Fotos direkt nebeneinander. Beide verkörpern die »fragile Unwirklichkeit« – um ein Wort Nabokovs über sein eigenes Leben im Exil zu zitieren – unserer Existenz in der Islamischen Republik Iran. Die Fotos widersprechen sich eigentlich, und doch erreichen sie erst zusammen ihre volle Aussagekraft. Auf dem ersten Bild stellen wir in unseren schwarzen Gewändern und Kopftüchern die Verkörperung fremder Träume dar. Auf dem zweiten sehen wir so aus, wie wir uns selbst sahen. Mit keinem von beidem konnten wir uns vollständig identifizieren.
Am treffendsten lässt sich dieses Paradoxon, so glaube ich, mit Hilfe einer Anekdote darstellen, die wie andere, ähnliche Anekdoten, keine Fiktion braucht, um zur Metapher ihrer selbst zu werden.
Bis ins Jahr 1994 war der iranische Ober-Filmzensor blind. Das heißt beinahe blind. Davor war er Theaterzensor gewesen. Einer meiner Dramatiker-Freunde erzählte einmal, er habe ihn mit einer dicken Brille im Theater sitzen sehen, durch die er allerdings noch weniger zu erkennen schien. Ein Assistent, der neben ihm saß, musste ihm berichten, was auf der Bühne vor sich ging, und protokollierte, wo nach Meinung des Zensors gekürzt werden sollte.
Nach 1994 wurde dieser Zensor Leiter des neuen Fernsehsenders. Dort perfektionierte er seine Methoden und verlangte, dass Drehbuchautoren ihre Skripte vorab bei ihm auf Tonband einreichten – wobei es verboten war, sie irgendwie attraktiv oder dramatisch zu gestalten. Anhand dieser Bänder fällte er sein Urteil über die Drehbücher. Noch interessanter jedoch ist der Umstand, dass sein Nachfolger, der nicht blind war – zumindest nicht physisch –, nach demselben System verfuhr.
Unsere Welt unter der Herrschaft der Mullahs war geprägt von den getrübten Linsen des blinden Zensors. Nicht nur unsere Realität, sondern auch unsere Literatur hatte diese merkwürdige Färbung angenommen. Wir lebten in einer Welt, in der der Zensor mit dem Dichter darum wetteiferte, wer am besten die Realität verändern und umgestalten könne, und in der wir uns einerseits selbst erfanden und gleichzeitig ein Phantasieprodukt fremder Mächte waren.
Wir lebten in einer Kultur, die literarischen Werken jeglichen Wert abstritt; sie waren nur dann von Bedeutung, wenn sie zu Handlangern von etwas scheinbar Wichtigerem wurden – der Ideologie. Unser Land war ein Land, in dem jede, auch die privateste Geste, in politischen Kategorien interpretiert wurde. Die Farbe meines Kopftuches oder die Krawatte meines Vaters waren Symbole westlicher Dekadenz und imperialistischer Tendenzen. Genauso westlich und damit dekadent war es, keinen Bart zu tragen, Angehörigen des anderen Geschlechts die Hand zu geben oder bei öffentlichen Zusammenkünften zu klatschen oder zu pfeifen. All das galt als Teil einer Verschwörung der Imperialisten, um unsere Kultur zu zerstören.
Vor ein paar Jahren richteten einige Mitglieder des iranischen Parlaments zur Überprüfung der Inhalte im staatlichen Fernsehen einen Untersuchungsausschuss ein. Der Ausschuss veröffentlichte einen ausführlichen Bericht, in dem er die Ausstrahlung von Billy Budd verurteilte, weil darin, so wurde behauptet, Homosexualität propagiert werde – was insofern nicht ohne Ironie war, als der Film von den Programmleitern des iranischen Fernsehens vor allem deshalb ausgewählt worden war, weil darin keine weiblichen Figuren vorkamen. Auch die Zeichentrickversion von In 80 Tagen um die Welt wurde kritisiert, weil die Hauptfigur – ein Löwe – Brite war und der Film in London, einer Bastion des Imperialismus, endete.
Unsere Seminarrunde entstand vor diesem Hintergrund, sie war ein Versuch, dem Blick des blinden Zensors für einige Stunden in der Woche zu entkommen. Dort, in jenem Wohnzimmer, wurde uns wieder bewusst, dass auch wir lebendige, atmende menschliche Wesen waren – und dass, egal wie repressiv der Staat auch wurde, egal wie eingeschüchtert und ängstlich wir auch waren, wir wie Lolita versuchen würden zu entkommen, um uns unsere eigenen kleinen Freiräume zu schaffen. Und wie Lolita nutzten wir jede Gelegenheit, unsere Aufsässigkeit zur Schau zu stellen: Wir ließen ein wenig Haar unter dem Kopftuch hervorlugen, ein wenig Farbe in die triste Uniformität unserer Erscheinung einfließen, unsere Nägel wachsen, ja wir verliebten uns sogar und hörten verbotene Musik.
Eine absurde Scheinwelt beherrschte unser Leben. Wir versuchten, in dem kleinen Freiraum zu existieren, in dem schmalen Spalt zwischen diesem Zimmer, der zu unserem schützenden Kokon geworden war, und der Welt des Zensors da draußen, voller Hexen und Kobolde. Welche dieser beiden Welten war realer, und zu welcher gehörten wir wirklich? Wir wussten es nicht mehr. Eine Möglichkeit, die Wahrheit herauszufinden, bestand vielleicht darin, das zu tun, was wir uns dann zu tun vornahmen: Wir wollten versuchen, diese beiden Welten so phantasievoll wie möglich zum Ausdruck zu bringen und dabei Schritt für Schritt unseren Träumen und unserer Identität auf die Spur zu kommen.





























