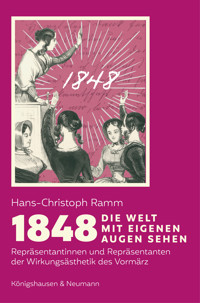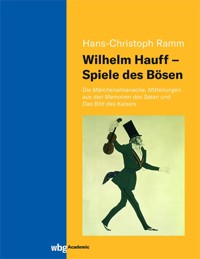Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Zentrum der rezeptionsästhetischen Untersuchung steht die Neugier von Leserinnen und Lesern des dritten Lebensalters. Die erwachsen gewordenen Kinder der Nachkriegszeit gelangen im Rahmen gelenkter literarischer Seminare zu einer selbstreflexiven, kritischen Auseinandersetzung mit vier Romanen ausgewählter britischer Autoren: Charlotte und Emily Brontë, Charles Dickens und Virginia Woolf. Ihre Werke stellen prototypisch die gesellschaftliche Funktionalisierung des Leidens und die damit einhergehende Zerrüttung der Subjektivität mit literarischen Verfahrensweisen dar. Die Erzählwelten eröffnen Einblicke in eine zurückliegende Kultur, die bis in die Gegenwart hinein wirkt. Aufgrund ihrer speziellen Perspektive gelangen die lebenserfahrenen Rezipientinnen und Rezipienten zu bemerkenswerten Ergebnissen in der wissenschaftlich fundierten Romananalyse. Die Erforschung solcher Rezeptionsvorgänge und ihres Potentials für diese Lesergruppe ist das Ziel eines neuen Ansatzes, der beispielsweise an der Universität des 3. Lebensalters in Frankfurt am Main verfolgt wird. Damit schließt die Studie eine Forschungslücke und liefert einen Beitrag zu einer kulturwissenschaftlich orientierten Literaturwissenschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Christoph Ramm
Lesen im dritten Lebensalter
Erfahrungen transitorischer Identität bei der Lektüre britischer Romane
A. Francke Verlag Tübingen
© 2017 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.francke.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
„Mündigkeit lässt sich nicht befehlen, sie muss gewählt werden.“
Susan Neiman
„Meine Identität gehört erst dann zu mir, wenn ich sie akzeptiere, was prinzipiell Raum für Verhandlungen mit meiner Umwelt, meiner Geschichte und meinem Schicksal öffnet.“
Charles Taylor
Danksagung
Dieses Projekt geht von einer Initialzündung aus, die durch eine erneute Lektüre von Milan Kunderas Essay Die Kunst des Romans im Zusammenhang mit seinem faszinierendem Werk Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins entstand. Das Projekt, das eine Forschungslücke schließen möchte, ist von vielen Menschen begleitet und intellektuell gefördert worden. Als erstes gilt mein Dank meiner Frau, Rudi Helena van der Ploeg, deren niederländischer Pragmatismus und Witz mich stets über Wasser gehalten und mich kritisch durch alle Phasen des Forschungs- und Schreibprozesses begleitet haben. Mein Dank gilt auch meiner Tochter Verena Bérénice, die wie eine Verbündete Fassungen meines Manuskripts gelesen, Einwände formuliert und Korrekturvorschläge gemacht hat. Vor allem hat sie mir aus technischen Unbeholfenheiten mit Computer und Laptop herausgeholfen. Danken möchte ich auch Frau Elena Gastring, Lektoratsvolontärin beim Gunter Narr Verlag, die mit Humor und Geduld den Produktionsprozess meines Buches unterstützt und begleitet hat. Die Frauen wissen, wie sehr mir die Vermittlung von Kultur und Literatur in der heutigen hybriden Kultur am Herzen liegt. Für die Gelegenheit, eine Vorstudie zu diesem Projekt, zur Erzählkunst Franz Kafkas, zur Filmkunst Charlie Chaplins und zur bildenden Kunst Edvard Munchs beim Germanistentag in Kiel 2014 vorstellen und dann publizieren zu können, bin ich Frau Professor Dr. Ina Karg zu herzlichem Dank verpflichtet. Kreative Impulse zu meinem Buch kamen auch aus persönlichen Gesprächen mit Herrn Professor Dr. Helmut Viebrock sowie von Seminaren Herrn Professor Dr. Hermann Schweppenhäusers und Gesprächen mit ihm zu Franz Kafka und Walter Benjamin. Danken möchte ich auch Herrn Professor Dr. Thomas Rentsch, der mich ermuntert hat, meinen Ausführungen auf der Spur zu bleiben. Herrn Professor Dr. Lothar Bredella und Herrn PD Dr. Christoph Schöneich, mit denen mich auf ganz unterschiedliche Weise ein freundschaftliches Band über Jahrzehnte hin verknüpft hat, danke ich in Verbundenheit. Ebenso bedanken möchte ich mich bei den Teilnehmer/innen meiner Seminare an der Universität des 3. Lebensalters/Frankfurt/M. Sie haben mit ihren kreativen Deutungen einige wichtige der hier vorgelegten Aspekte, beispielsweise zu unglaubwürdigen Stellen in Charles Dickens‘ frühem Roman Oliver Twist oder zu Emily Brontës kniffligen Roman Wuthering Heights möglich werden lassen.
Ich widme dieses Buch dem Andenken meines früh verstorbenen Vaters, Dr. phil Dr. med. Hans Ramm (1920 bis 1956), der über Kierkegaard promovierte und als junger Augenarzt in Frankfurt/M die Greuel des Russlandfeldzuges im Zweiten Weltkrieg in den ersten Jahren der Nachkriegszeit gesundheitlich nicht überlebt hat.
Vorwort
Impulse zu den folgenden Ausführungen gaben Milan Kunderas Deutungen des modernen Romans. Kundera versteht den modernen Roman als narratives Experiment, das seit Beginn der Moderne mit imaginativen Möglichkeiten und Potenzialen transitorischer Identität spielt, die Gemüter seiner Leser/innen erregt und zum deutenden Diskurs immer erneut herausfordert.1 Lesen, so Sartre, ist gelenktes Schaffen.2 Dieser Spur folgen wir an ausgewählten Romanen Großbritanniens, die nicht nur zu den Meisterwerken der Weltliteratur zählen, sondern trotz der Unterschiede zwischen dichterischen Texten des 19. Jahrhunderts in Europa3 „als großartige Märchen“4 der Moderne anzusehen sind.
Bei der Lektüre wird es um eine kultursemiotische und rezeptionsästhetische Erschließung von Charles Dickens‘ Roman Oliver Twist, Charlotte Brontës Roman Jane Eyre, Emily Brontës Roman Wuthering Heights und Virginia Woolfs Roman Mrs Dalloway gehen. Diese Romane wurden im Fachbereich Neuere Philologien/Anglistik der Universität des 3. Lebensalters zu Frankfurt/M in gelenkten Seminaren mit Rezipient/innen des dritten Lebensalters (den heute 65- bis etwa 80jährigen) erschlossen, reflektiert und besprochen.
Als große Erzählkunst sind die Romane repräsentativ für das in der Moderne seit Beginn der europäischen Romantik geprägte Geschichtsbewusstsein und die „bis dahin nie gekannte Betonung menschlicher Subjektivität.“5 Rezipient/innen des dritten Lebensalters sind in sensibler Wahrnehmung hoch interessiert am Gründungsmythos der Moderne, der sich an kulturgeschichtlichen Fragen „Woher wir kommen“6 und wer wir im dichten Gewebe divergierender und überfordernder Rollenanforderungen, Konflikt- und Entscheidungssituationen heute sind, entfalten lässt.7 In einer globalisierten, disparaten und vernetzten Medienwelt, in der Distanzen aufgehoben werden, weckt die Lektüre der Romane den Wunsch, sich mit mythopoetischen Erzählwelten, die moderne Romane seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert bis hin zu James Joyce, Döblin, Thomas Mann selbstreflexiv gestalten,8 auseinanderzusetzen. Romane des Viktorianischen Zeitalters und der klassischen Moderne entwerfen Varianten einer Poetik des Weltleidens. Sie eröffnen fremde, narrativ eigengesetzliche Welten, evozieren Widerstand und Utopie, an denen sich Wirklichkeit gegenbildlich bricht. Ihr enigmatisch Politisches fasziniert.
Die These, die dieser Arbeit zugrunde liegt, ist die, dass Werke der Literatur, der bildenden Kunst und Musik seit der frühen Neuzeit transitorische Identitätserfahrungen moderner Subjektivität ästhetisch gestalten. Im Bereich der Literatur entstehen kontingenzästhetische Erzählmuster, die als Kulturdiagnosen erschlossen werden können. Rezipient/innen des dritten Lebensalters werden in auffallender Weise von komplexen Erzählmustern affiziert, die die Subjektfrage der Moderne in emotional evokativen Erfahrungsräumen verhandeln. Die Erzählwelten stellen Individuen in ihren Mittelpunkt und beleuchten in gesellschaftkritischen Gegenperspektiven Kehrseiten der Vernunft. Als Antithesis sind sie immanent mit der Negativität des Weltlaufs, den sie verneinen verknüpft: „Keine Kunst, die nicht negiert als Moment in sich enthält, wovon sie sich abstößt.“9 Das Faszinosum liegt in diesem Doppelcharakter, der auf die komplexe Motivlage der Rezipient/innen des dritten Lebensalters trifft.
Der Gründungsmythos der Moderne begann als romantische Bewegung „mit Young in England, in Frankreich mit Rousseau und in Deutschland mit dem Sturm und Drang“.10 Trotz aller Unterschiede setzten sich bildende Künstler, Komponisten, Schriftsteller und Philosophen in Europa mit dem Anbruch einer neuen Zeit, mit der Französischen Revolution und Napoleon auseinander:
Schon bei Fichte, noch nachdrücklicher bei Hegel und Schelling, tritt ein Gedanke in den Vordergrund, der das 19. Jahrhundert bestimmen wird: daß selbst die Grundbegriffe und Argumentationsmuster von Erkennen und Handeln geschichtlich bedingt sind (‚Geschichtlichkeit‘).11
Schriftsteller, bildende Künstler und Komponisten forderten Freiheit von der klassizistischen Tradition; parallel dazu forderten Philosophen politische Emanzipationsmöglichkeiten: in konservativer Hinsicht (Edmund Burke), emanzipatorisch in der Kritik der politischen Ökonomie (Karl Marx, in kritischer Auseinandersetzung mit Hegel). Vor dem Hintergrund des Bruchs mit den christlichen Traditionen des Abendlandes beinhalteten diese Forderungen das Streben nach persönlicher Autonomie (Johann Gottlieb Fichte, in Auseinandersetzung mit Kant), insbesondere des künstlerischen Genies und künstlerisch tätiger Frauen. Mit der Rezeption Shakespeares und Cervantes stand bei Schriftstellern die Verteidigung des Prinzips der Stilmischung in Bezug auf den Roman, die Tragikkomödie und das romantische Schauspiel im Mittelpunkt. Stilmischungen schufen Bewegungsspielräume für den komplexen Ausdrucksreichtum subjektiver Erfahrungen in Werken der bildenden Kunst (William Turner, Caspar David Friedrich), Musik (Ludwig van Beethoven, Giuseppe Verdi) und Literatur. In das Zentrum künstlerischen Schaffens trat die Theodizeefrage, die in der Darstellung des Bösen und Satanischen Handlungsspielräume des modernen Subjekts erprobte und zur Spiegelung des Weltschmerzes machte.12 Als Kehrseite der Verweltlichung und des erweiterten, vertieften Naturverständnisses zeitigte sich die Gefahr des Selbstverlustes, die als transitorische Erfahrung in den Ausdrucksformen von Empfindsamkeit und der englischen Krankheit Melancholie (James Macpherson, d.i. Ossian und auch Lord Byron) die Schaffenskraft der Künstler anregte. Sie wurde zum Lebensgefühl der nachnapoleonischen Epoche. Die komplexe Beziehung zwischen Dichtung und Leben, die kultursemiotisch erschließbar ist, lässt sich an europäischen Romanen anhand des in ihnen zur Geltung kommenden gebrochenen modernen Subjekts studieren. In der Suche nach sinnbezogenen Lebensformen erkunden Romane die Bedeutung des Subjekts in einer komplexen modernen Welt. Sie scheuen nicht zurück vor einer Verwirrungsästhetik der Kontingenzen und des Häßlichen und und verlieren dennoch nicht die Autonomieansprüche des Subjekts und das Ideal der Humanität aus dem Auge. Wie alle Romane der Weltliteratur erzählen sie Geschichten von Menschen und Umständen, lassen im Möglichkeitsraum der Fiktion Menschen „aus dem Gegebenen heraus und ihm gegenüber treten“13, gestalten eine eigene, sprachlich geformte Welt, die durch Selektion und Verdichtung Wirklichkeit zentriert und deshalb zwischen Schein und Realität oszilliert:
Dichtung verdichtet (…). Sie tut es, indem sie am menschlichen Leben, das in der Masse so gleichgültig zu werden vermag, Wert und Wichtigkeit aufleuchten lässt. Deshalb ist sie eine so menschliche Art der Weltbegegnung und übersteigt damit auch die Geschichtsschreibung, selbst die Psychohistorie und Mentalitätsgeschichte, denen sie als Quelle dienen kann. Sie gewinnt ihre Überlegenheit daraus, daß sie den einzelnen (…) zu seiner Würde bringt.14
Da es eine Vielzahl von Romanen des Viktorianischen Zeitalters und der Epoche der klassischen Moderne gibt, macht der hier vorgestellte kultursemiotische Ansatz eine Auswahl von Romanen dieser beiden Epochen, zwischen denen Umbruchszeiten liegen, erforderlich. Ausgewählt wurden Romane, die
im Zeitraum zwischen beginnendem 19. und beginnendem 20. Jahrhundert in Großbritannien entstanden,
eine narrative Kontingenzästhetik durch Kontrastkopplungen und autoreferenzielle Bezüge gestalten und Verwirrungsästhetiken15 generieren,
die Problematik der transitorischen Identität der Moderne als narrative und kulturhistorische Herausforderung in ihrer Ambivalenzstruktur verdichten,
Aspekte des Humanitätsideals in Gestalt der conditio humana anklingen lassen und als Metaphysik des Schwebens16 zum Ausdruck bringen,
in der ambivalenten Transzendierung ihrer Inhalte in die jeweilige Form, offene und komplexe Erzählwelten der ersten und zweiten Phase der Moderne gestalten,
Imagination und Reflexion der Leser/innen anregen.
Die Kriterien ergeben sich aus einer kultursemiotischen Theorie, die das Verstehen moderner Romane verknüpft mit dem Erschließen ihrer epochalen Situierung.
Die ausgewählten Romane erfüllen die genannten Kriterien. Sie entwerfen die Unbehaustheit des modernen Menschen als Paradoxon: Im Versuch, sich seiner habhaft zu werden, entgleitet sich das moderne Subjekt.17 Die Protagonisten der ausgewählten Romane befinden sich auf der anderen Seite der Geschichte. Sie sind – wie Don Quijote –, in der Grenzsituation zwischen Leben und Tod, ganz auf sich selbst gestellt, bewegen sich in einer Welt von geradezu absurden Korrespondenzen und Kontrasten, sind haltlos. Als Resultat entstehen „fruchtbare Hybride“18, die ihren Fokus auf Bedingungen moderner Subjektivität richten, sich auf die Suche nach einem Bild des modernen Menschen im Sinnvakuum der Moderne konzentrieren und Erzählen als je differente Sinnsuche, als je unterschiedlich komplexen Prozess, entwerfen.
Diese Suche gestalten die vorgestellten Romane, wie auch der europäische Roman, parallel und kontrastiv als unabschließbar. Nach dem Verlust metaphysischer Gewissheiten suchen die Protagonisten nach Sinn und Erfüllung. Sie gehen in der Konfrontation mit der Fremdheit gesellschaftlicher Beziehungen über sich hinaus. Das Offene und Unabgeschlossene dieser Sinnsuche affiziert die narrative Form. Erzählen wird zum transgressiven Akt, in dem Identitätserfahrungen unheinholbar als Aspirationen erscheinen. Das Erzählen dieser Erfahrungen bringt den narrativen Prozess selbst zum Vorschein. Die Romane sind widersprüchliche Universen, die in ihrer Unabgeschlossenheit und Mehrdeutigkeit, ihrem grotesken Humor (Charles Dickens), ihrer Hintergründigkeit und ihrem Witz (Emily und Charlotte Brontë, Virginia Woolf) Rezipient/innen des dritten Lebensalters zur Reflexion und zu Sinnfragen herausfordern, die sie – die Romane – verwirrungsästhetisch als „Desintegration (ihres) Systemraumes“19 entwerfen. Durch Erzählbrüche, plötzliche Wendungen, Anachronismen, multiple Perspektiven, entstehen kontingent strukturierte Erzählwelten, die sich mit zunehmender Komplexität der modernen Welt nicht mehr zu einem widerspruchsfreien Ganzen zusammenfügen lassen.
Die weltverwandelnde und -verdichtende Auflösung aller Phänomene, auch der menschlichen Subjektivität, findet im modernen Roman, seit der Mitte des 18. Jahrhunderts ihren Ausdruck in oben definierten eigenen „Verwirrungsästhetiken“20, die auf weiter unten dargelegte gerotranszendente Vermögen der Rezipien/innen stoßen. Verwirrungsästhetiken finden als kulturelle Parallelvorgänge auf dem Weg der bildenden, der erzählenden und der musik-kompositorischen Kunst vom 18. bis ins 20. Jahrhundert statt, zuvor bereits bei Shakespeare oder dann, beispielsweise, bei Giovanni Battista Piranesi, bei Johann Sebastian Bach und seinen für seine Epoche originellen und ungewöhnlichen Kompositionstechniken, bei William Hogarth, bei William Blake, bei Ludwig van Beethoven, dessen 5. Sinfonie (c-moll, Opus 67) bei zeitgenössischen Kritikern, aufgrund ihrer ungewöhnlichen Komposition, auf Ablehnung stieß. Erich von Kahler sieht in der Entwicklung der modernen Erzählkunst einen „unendlichen Weg ins Unbewußte“21, der in drei Etappen verläuft: seit Mitte des 18. Jahrhunderts individualpsychologisch, gegen Ende des 19. Jahrhunderts existenzialistisch, seit Beginn des 20. Jahrhunderts in einer innerweltlichen Transzendenz, die „das Jenseits im Irdischen“22 hervorhebt. Diese Etappen folgen nicht chronologisch aufeinander, sondern bedingen sich in fortschreitender Wechselwirkung.23 Diese Wechselwirkung wird durch die Abwendung der Moderne von der traditionellen Metaphysik bedingt. In der Moderne unterscheidet sich menschliche Existenz von jedem bedingendem, übergreifendem Ganzen. Erich von Kahler siedelt die existenzialistische Etappe der Entwicklung der modernen Erzählkunst zu Ende des 19. Jahrhunderts, in Unterscheidung von der existenzialistischen Philosophie, zwischen der individualpsychologischen und der innerweltlich transzendenten Etappe der modernen Erzählkunst an. Er begründet diese Entwicklung damit, dass das „existenzialistische Erlebnis“24 als Gegenerfahrung zur instrumentellen Vernunft der Moderne zu verstehen und im Sinne Kierkegaards als „Sinnmüdigkeit“25 zu deuten sei. Nach von Kahler entsteht eine neue Sensibilität, die die Haltlosigkeit des modernen Ich antizipiert, Individualität als mögliche Existenz im Angesicht innerweltlicher Transzendenz positioniert. Das existenzialistische Erlebnis rührt an den Daseinsgrund der Dinge, nähert sich der Unaussprechlichkeit eines präexistenten Ich.26 In dieser Perspektive entsteht in der modernen Erzählkunst eine Sicht auf die Welt, die die Befremdung der Dinge und die Auflösung des Erscheinenden in Richtung innerweltlicher Transzendenz vorbereitet.27
Dieser Prozess narrativer Desintegration der täglichen Weltoberfläche lässt sich von Laurence Sternes erzählerischem Kosmos bis zu Virginia Woolfs und James Joyces erzählerischem Werk beobachten. Wie die europäische Erzählkunst des frühen 20. Jahrhunderts, dringen Joyces und Woolfs Werke „in das Reich einer inneren, innerweltlichen Transzendenz“28 vor. Erich von Kahler versteht unter diesem Reich Tiefenbereiche des Ich, die die Schichten des Unbewussten, wie Sigmund Freud und Carl Gustav Jung sie erforschten, durchmessen. Als „jenseitige Tiefen des Ich“ verwandeln sie „den Niederstieg in den Tod“ in eine „Erleuchtung des Todes bis zu jenem mystischen Punkt, wo der Tod zur Lebensverwandlung und zum Schoße der Schöpfung wird“.29
Die drei kulturellen Etappen der modernen Erzählkunst, die zu dieser „neuen Transzendenz“30 hinführen, lassen sich exemplarisch anhand der hier behandelten Romane erarbeiten. Die emotionale Eindringlichkeit, in der die Erzählfiguren mit Dilemmata, Konflikten und erzwungenen Konfliktlösungen umgehen, wirken vor ihrem kulturellen Hintergrund und dem der Rezipient/innen des dritten Lebensalters herausfordernd und diskursanregend.
Im ersten Teil der Arbeit geht es um einen kultursemiotischen Ansatz, der es ermöglicht, Erfahrungen der Gerotranszendenz31, mit ihren Fähigkeiten zu Selbstdistanz, Gelassenheit, einem selbst organisierten, kreativen Leben, mit ihrer Fähigkeit zu Spiritualität und transzendenzbezogenen Welt- und Lebensperspektiven,32 sowie mit ihrer Empfindung für Ganzheit im Sinne eines Werdens zu sich selbst,33 in dialogische Beziehung zu setzen mit ästhetischen Erfahrungen, die Romane des Viktorianischen Zeitalters und des frühen 20. Jahrhunderts in Großbritannien evozieren. In diesem theoretischen Teil wird verdeutlicht, dass die Ambivalenz der Moderne sich narrativ in der Uneindeutigkeit einer Metaphysik des Schwebens in den Romanen niederschlägt: Sie verdichten die Unüberschaubarkeit der Moderne und die Hilflosigkeit moderner Subjektivivität. Erfahrungen transitorischer Identität im dritten Lebensalter werden in der Interaktion zwischen den Leser/innen und den Romanen kreativ affiziert.
In diesem ersten Teil der Arbeit wird die von Andreas Kruse und Hans-Werner Wahl in ihrem Werk Zukunft Altern entwickelte umfassende Kreativitätstheorie der Alternsforschung sowie die von Thomas Rentsch in seinem Werk Negativität und praktische Vernunft, im Rahmen einer Ethik der späten Lebenszeit entfaltete philosophische Anthropologie des Alterns als eines „Werden(s) zu sich selbst“, kultursemiotisch auf den Rezeptionsprozess der Romane durch Rezipient/innen des dritten Lebensalters bezogen.34 Die Theorie der Kreativität im Alter unterscheidet sich von neueren Sozialisationstheorien und eröffnet Sichtweisen auf die rezeptionsästhetische Haltung der Rezipient/innen des dritten Lebensalters. Die in den Fokus genommenen gerontologischen Schlüsselkonzepte sind Generativität, Ich-Integrität und Gerotranszendenz als „Ausdrucksformen einer Kreativität im Alter“.35
Die Schlüsselkonzepte sind eingebunden in eine Anthropologie des Alterns, die vor dem Hintergrund einer Diskriminierung Alternder im öffentlichen und privaten Bereich den Gestaltungswillen und die Gestaltungsfähigkeit Alternder in Bezug auf ein selbstorganisiertes Leben und in Bezug auf gesellschaftliche Mitverantwortung hervorhebt. Andreas Kruse, ein prominenter Vertreter dieser Theorie, hebt auf der Grundlage gerontologischer Forschungen anstelle einseitiger Diskriminierungs- und Belastungsdiskurse, Potenziale des Alters hervor, in denen sich zwei Perspektiven komplementär verbinden: „die Potenzialperspektive einerseits, die Verletzlichkeitsperspektive andererseits.“36 Die Potenzialperspektive hebt die potenziellen Energien Alternder hervor, die sie auch in Fällen von Belastungen und Verlusten eine positive Lebenseinstellung aufrechterhalten lässt. Die Verletzlichkeitsperspektive impliziert eine abnehmende körperliche Leistungsfähigkeit, mit einer höheren Anfälligkeit für Erkrankungen im Alter. Alternden kann es gelingen, so Kruse, beide Perspektiven miteinander zu verbinden. Die Integration beider Perspektiven relativiert Belastungszenarien und ermöglicht Bildungs- und Therapieerfahrungen.37 In die Wechselbeziehung beider Perspektiven ist die im Vorverständnis der Rezipient/innen situierte Spannung zwischen dem ästhetischen Erfahrungspotenzial immanenter Transzendenzerfahrung und dem Bewusstsein menschlicher Mortalität eingebettet. Diese zum gerotranszendenten Vermögen Alternder gehörende Situierung macht das fruchtbare Moment im Erschließungsprozess der Romane aus.
Die Nomenklatur der Theorie der Kreativität im Alter wird durchgängig in vorliegender Arbeit verwendet und differenziert auf den Rezeptionsprozess als Bildungspotenzial Alternder bezogen.38 Aus dieser Öffnung der Literaturdidaktik und institutionalisierten Kultursemiotik, die sich als Ergänzungsdiskurs zum bisher vertrauten Kategoriensystem der Literaturdidaktik versteht, ergibt sich der Schwerpunkt der Rezeption der ausgewählten Romane durch Rezipient/innen des dritten Lebensalters. Ihr Blick richtet sich auf die poetische Praxis, auf das Wie der Ausdrucksgestalt des jeweiligen Romans und seine kulturgeschichtliche Bedeutung. Diese Rezeptionshaltung, die Kreativität und Selbstdenken evoziert, wird durch eine Drei-Phasen-Methode unterstützt. In kultursemiotischer Perspektive und in der Sichtweise moderner transitorischer Identitätserfahrungen entstehen innovative Romandeutungen der Romane Oliver Twist, Jane Eyre, Wuthering Heights und Mrs Dalloway.
Der zweite Teil dieser Arbeit stellt das Konzept der Drei-Phasen-Methode vor. Dies ist ein Konzept, das durch das gelenkte literarische Seminargespräch und die ganzheitliche Romanlektüre in der Kombination zweier Herangehensweisen, des „Straight Through Approach“ und des „Segment Reading“39, die theoretischen Voraussetzungen des ersten Teils in die Praxis umzusetzen verspricht. Eine der aus diesem Konzept folgenden Konsequenzen sind Plausibilitäts- und Dispositionsfragen der Rezipient/innen an die ausgewählten Romane, die im Verlauf von vier Semestern – einem Roman pro Semester – in der Interaktion zwischen den Texten, Zusatzmaterialen und ihren Leser/innen erschlossen und reflektiert wurden.
Die Ausführungen des dritten Teils erproben die theoretischen Prämissen des ersten und die Konzeption des zweiten Teils. Sie beziehen sich, in je einem Unterabschnitt, auf Romane des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die in ihrer Struktur die Ambivalenz der Moderne als sinnentwerfende Vieldeutigkeit und hermeneutisches Reflexionsangebot für Rezipient/innen des dritten Lebensalters und ihre komplexen Motivlage zum Ausdruck bringen. Da die Grundstruktur des Rezeptionsprozesses dialogisch ist, wechselt die Untersuchungsperspektive von der in den ersten beiden Teilen dargelegten Motivlage der Rezipient/innen auf die kultursemiotischen Deutungspotenziale der Romane, wobei die kontrovers oder zustimmend besprochenen Romanpassagen durch Hinweise auf Erschließungs- und Reflexionsmöglichkeiten der Rezipient/innen gekennzeichnet sind.
Charles Dickens‘ Frühwerk Oliver Twist (1837) eröffnet, im Schatten Miguel Cervantes‘ und Laurence Sternes’ sowie vor dem Hintergrund der Ereignisse der Französischen Revolution, mit einem frühen unzuverlässigen Erzähler die Ausführungen im dritten Teil dieses Buches.
Dickens‘ Werk Oliver Twist und Charlotte Brontës Roman Jane Eyre (1847), der in Gestalt einer fiktiven Autobiografie die Zeit des Hochkapitalismus und den Auflösungsprozess des Patriarchats in Großbritannien narrativ konfrontiert, werden einem eigenem Abschnitt zugeteilt. Unter dem leitenden Aspekt transitorischer Identitätserfahrungen in der Moderne kann einsichtig werden, dass beide Romane, trotz ihrer unterschiedlichen Entstehungszeiten und gesellschaftlichen Hintergründe, in Gestalt der Paradoxie des poetischen Realismus ihre Protagonisten scheitern lassen und in die Grundauffassung einer auf Erfüllung angelegten Subjektivität einbetten. In der kulturgeschichtlichen Terminologie Erich von Kahlers bestehen beide Romane aus Mischformen eines individualpsychologischen und, wie oben dargelegt, existenzialistischen Erzählens.
Der Abschnitt zu Charles Dickens‘ Frühwerk Oliver Twist, mit dem der dritte Teil beginnt, fällt etwas umfangreicher als die dann folgenden Abschnitte zu den Romanen der Brontës und zu dem Virginia Woolfs aus. Das liegt daran, dass – entgegen älterer Forschung zu diesem Roman – Dickens‘ Oliver Twist innovative Erzählstrategien an den Tag legt, die ihn in den Deutungen der neueren Forschung zum Wegbereiter des modernen Romans bzw. zum modernen Roman werden lassen (Fludernik, Bowen, Cheadle beispielsweise). Diesen Deutungen, die den Roman als Ganzen in den Blick nehmen, gehen die Ausführungen im dritten Teil nach. Begleitet von eigenen Beobachtungen werden sie zu innovativen rezeptionsästhetischen Erschließungspotenzialen.
Der zweite Abschnitt des dritten Teils wird durch Deutungen von Emily Brontës Roman Wuthering Heights (1847) und Virginia Woolfs Roman Mrs Dalloway (1925) beschlossen. Emily Brontës Roman antizipiert durch seine raffiniert gestaffelten dezentrierten Ich-Erzähler die Multiperspektivität der durch innere Monologe ineinandergreifenden, chiastischen Textstruktur von Mrs Dalloway, der exemplarisch für experimentelle Romane der klassischen Moderne anzusehen ist. Unter dem leitenden Aspekt transitorischer Identitätserfahrungen in der Moderne erkennt man, dass beide Romane, trotz der unterschiedlichen Epochen, in denen sie entstanden sind, durch die narrative Auflösung der Paradoxie des poetischen Realismus, die Nicht-Erfüllbarkeit privaten Glücks und subjektiver Chancen gestalten. Die Mehrdimensionalität moderner Subjektivität und die Undurchschaubarkeit ihres Weltbezuges40 verdichten narrativ die Orientierungs- und Haltlosigkeit von Subjekterfahrungen in der modernen Welt. In der kulturgeschichtlichen Terminologie Erich von Kahlers bestehen beide Romane aus Mischformen des im oben dargelegten Sinne existenzialistischen und innerweltlich transzendenten Erzählens. Die vier Romane stellen zusammen mit der Frage nach Herkunft und Zukunft moderner Identitätserfahrungen auch die Frage nach dem Sinn romanhaften Erzählens in der Moderne. Sie gestalten gegensätzliche Figuren und Erzählsituationen mit spiegelsymmetrisch geheimen Verwandtschaften. Multiperspektivisch erforschen sie Facetten der modernen transitorischen Identitätsproblematik, die angesichts signifikant Anderer virulent wird, und sie regen über diese strukturellen Ambivalenzen zum hermeneutisch-kritischen Diskurs an. Der abschließende Teil dieser Arbeit zieht ein Fazit und gibt Hinweise auf Forschungsdesiderate, deren Bearbeitung einen Paradigmenwechsel in der kultursemiotisch orientierten Literaturwissenschaft herbei führen könnte.
Teil 1Moderne Romane als Möglichkeitsräume des transitorischen Identitätsparadigmas
1.1Romane lesen. Die Ambivalenz der Moderne
Warum Romane lesen, die in Großbritannien im 19. und frühen 20. Jahrhundert entstanden – ausgewählte Romane von Charles Dickens, Charlotte und Emily Brontë und von Virginia Woolf? Was bieten diese Romane Rezipient/innen, die an der Goethe-Universität des 3. Lebensalters zu Frankfurt/M Literaturseminare im Fachbereich Anglistik freiwillig und aus Interesse besuchen?
Zum einen eröffnen die Erzählwelten Einblicke in eine zurückliegende Kultur, die bis in die Gegenwart hinein wirkt. Zugleich setzen sie eine selbstreflexive, kritische Auseinandersetzung in Gang, in der die Rezipient/innen, im Erschließen dieser Erzählwelten, ihre Werte und Normen aufs Spiel setzen. Sieht man mit Jürgen Straub persönliche Identität als normativen und sozialen Anspruch, den Individuen zwar an sich selbst stellen, aber auch wissen, dass sie ihn nicht erfüllen können,1 so kommen im Erschließen der Erzählwelten Fragen der Selbst- und Fremdbestimmung, der Autonomiebildungsmöglichkeiten und ihrer Vorenthaltungen oder Verhinderungen ins Spiel, die im Horizont eines Sich-in-der Zeit-Verstehens, anhand komplexer Erzählfiguren und ihrer Einbindung in die jeweilige Gestalt der Erzählwelten erarbeitet und ästhetisch erfahren werden können.
Wie alle modernen Romane gestalten auch Romane, die seit Beginn der Moderne um 1750 in Großbritannien entstanden, Erforschungen des Ich, in die das Paradoxon persönlicher Identitätserfahrung in der Moderne eingelassen ist.
Der Psychoanalytiker Donald W. Winnicott fasst dieses Paradoxon als Kommunikation des sozialen Selbst mit einer nicht-kommunizierbaren Energie des persönlichen Selbst. Diese Energie muss sich der Mensch bewahren, will er nicht zum außengelenkten, falschen Selbst werden. Sie macht seine Menschlichkeit aus, die die Gesellschaft als sein Heiligtum unangetastet lassen sollte:
Im Zentrum jeder Person ist ein Element des ‚incommunicado‘, das heilig und höchst bewahrenswert ist (…). (Ich) glaube, daß dieser Kern niemals mit der Welt wahrgenommener Objekte kommuniziert, und daß der Einzelmensch weiß, daß dieser Kern niemals mit der äußeren Realität kommunizieren oder von ihr beeinflußt werden darf (…). (Jedes Individuum ist) in ständiger Nicht-Kommunikation, ständig unbekannt, tatsächlich ungefunden.2
Das von Winnicott formulierte Paradox persönlicher Identitätserfahrung besteht demnach darin, dass im individuellen Allein-sein-Können „eine außerhalb des einzelnen liegende Bedingung (…), eine soziale Bedingung“3, zur Geltung kommt, die im Zusammenspiel von Selbstakzeptanz, Verhandelbarkeit persönlicher Identität und selbstorganisertem Leben, den potenziellen Raum des Selbst zwischen sich und signifikanten Anderen öffnet.
Nach Jürgen Straub besteht das Paradox persönlicher Identität in sozialpsychologischer Weiterführung darin, dass es die Erfahrung „(…) einer Einheit (ist), die unabschließbar, entzweit, unangreifbar und vor allem zugleich dauerhaft angestrebt und fortwährend unerreichbar bleibt.“4
Im Laufe eines Entwicklungs- und Bildungsweges entstehen individuelle Handlungspotenziale, die, weil sie sich in Interaktionen mit signifikanten Anderen entwickeln, komplexe und reiche Identitätsbildungsmöglichkeiten entstehen lassen, die Konstrukte einer tautologischen Identität als Sich-Selbst-Gleichheit nicht ermöglichen. Persönliche Identität, so Straub, „meint aspirierte, angestrebte, imaginierte Identität“, die die Handlungspotenziale einer Person konstituiert und ihre Verhaltensweisen motiviert.5 Mit Erikson grenzt Straub eine für Erfahrungen offene persönliche Identität von einer Identitätsdeutung ab, die Identität als totalitär strukturiertes Zwangs- und Gewaltverhältnis sieht.6 Aus der Unterscheidung von Totalität und Identität gewinnt Straub das Konzept „transitorische(r) Identität“7, dessen konstitutives Elemen ein „unhintergehbare(r) Selbstentzug“ ist,8 der in diachroner und synchroner Differenzierung zur Grundlage einer offenen und kreativen Persönlichkeit mit der Fähigkeit zur Selbsttranszendierung wird.9
Aus dieser resultiert ein Weltinteresse, das menschliches Leben nicht als funktionales Teilelement eines übergreifenden Zusammenhanges sieht, sondern als Sinn-Ganzes entwirft:
Jedes menschliche Leben ist (…) ein Sinn-Ganzes. Der einzelne hat selbst seine Handlung in einem unbedingten Sinne zu verantworten. Sogar wenn er versuchsweise handelt, experimentell, sogar wenn er die Folgen seiner Handlung nicht absehen kann, so ist doch die Tatsache, daß er hier und jetzt dies oder das getan hat oder nicht getan hat, ein unwiderrufliches Faktum und als solches für immer Bestandteil seines Lebens. Als solches hat er es zu verantworten.10
Aus der Ambivalenz der Moderne, dass wir gleichzeitig um die Determiniertheit wissen, die uns in übergreifenden Zusammenhängen als Teilmomente hält und der menschlichen Freiheit als radikaler Unabhängigkeit, folgt nach Robert Spaemann die individuelle Erkenntnis, dass es kein voraussetzungsloses Handeln gibt und man aus gegebenen Bedingungen das Bestmögliche, auch hinsichtlich ihrer dringenden Veränderungen, machen sollte. Da Handeln immer auch sich loslassen können, seine Intentionen aus der Hand geben können, bedeutet, ist Gelassenheit gegegenüber Geschehenszusammenhängen und gegenüber einer erfahrungsoffenen Zukunft, eine Vernunftshaltung, die vor Resignation bewahrt und zur Bedingung eines geglückten sinnbezogenen subjektiven Lebens werden kann.11
Martin Seel bezeichnet diese Paradoxie als Erfahrung persönlicher Autonomie, die sich selbst in reflektierter Akzeptanz des sie Bestimmenden bestimmen kann.12 Susan Neiman versteht unter persönlicher Autonomie die Fähigkeit und den Mut erwachsen zu werden, ein Gespür für den eigenen Charakter zu entwickeln, weil „Integrität (…) niemals statisch (ist); dazu ist sie zu leicht zu verlieren.“13
Auch archaische Mythen und Feste – verstanden als Augenblicke „gesteigerter Lebensintensität“14 – sowie Kunstwerke, die wie Feste zum Verweilen einladen,15 verwandeln gesellschaftliche Funktionszusammenhänge in holistische Erfahrungen. Ganzheitlichkeit liegt als Weltinteresse und Erfahrung immanenter Transzendenz, die sich der Ambivalenz in Bezug auf die Dignität menschlicher Würde und menschlichen Lebens stellt,16 in mythopoetischer Gestaltung modernen Romanen zugrunde.17
Ernst Tugendhat definiert immanente Transzendenz als Fähigkeit des modernen Menschen, sich seine Werte in nachmetaphsischer Zeit selbst erschaffen zu können:
Statt vorgegebene, scheinbar übersinnliche Werte zu befolgen, soll der Mensch jetzt seine Werte selbst schaffen. Das bedeutet, daß das Transzendieren auf einen Sinn hin in das Innere des menschlichen Seins zurückgenommen wird. Man kann also (…) von einer immanenten Transzendenz sprechen, von einem Übersichhinausgehen, das nicht mehr ein Übersichhinausgehen zu etwas Übersinnlichem ist, sondern ein Übersichhinausgehen innerhalb des Seins des Menschen.18
Immanente Transzendez, mythopoetisch gestaltet, öffnet in den hier ausgewählten Romanen in Bezug auf Altersgelassenheit, Kreativität und Erfahrungen der Gerotranszendenz hermeneutische Reflexionsräume für Rezipient/innen des dritten Lebensalters. Gerhard Kaiser sieht die transzendierende Wirkung moderner Literatur in ihrer Eröffnung von Möglichkeitsräumen: Die Werke der Moderne „wollen dorthin, wo sie nicht ankommen, und ziehen den Leser in diese Bewegung hinein.“19
Gefragt, was für ihn als Romanautor beim Schreiben und Lesen von Romanen wichtig sei, antwortet der britische Romancier Ian McEwan in einem mit Julian Barnes geführtem Werkstattgespräch: „Eine Erzählung soll uns das Universum aufschließen. Ungeachtet dessen, ob sie gut oder schlecht ausgeht.“20 Auf die Frage, welche Rolle Musik für ihn (McEwan) spiele und ob sie ihm „persönlich das Universum“ aufschließe, antwortet er, dass er vor seinem Studium besessen von Mendelsohns Violinkonzert gewesen sei, in der städtischen Bibliothek die Partitur gefunden und gelesen habe:
„Ich wollte verstehen“, so McEwan, „Wie hat er das gemacht? Wie kann einer dieses Wunderwerk an menschlicher Empfindsamkeit niederschreiben? Wie ist es möglich, dass jemand eine Sprache beherrscht, die solche Empfindungen festhält?“21
Bildende Kunst, Musik, Literatur der Moderne erhellen mit seismographischer Empfindlichkeit (Thomas Mann)22 die Ambivalenz, d.h. die Mehrdeutigkeit der Moderne und ihre divergierenden Deutungsmöglichkeiten. Ins Spiel kommt die von Auflösung bedrohte Kohärenz des modernen Subjekts, mithin die nie zu erreichende Ganzheitlichkeit des Menschen, für die er mit seinen Empfindungen und seiner Vernunft angesichts des Wegfalls übersinnlich-metaphysischer Gewissheiten einsteht.
Ins Spiel kommt zudem die Frage, ob nach dem Untergang der traditionellen Metaphysik ontologische Fragen überflüssig geworden sind? Walter Schulz löst in seinem Werk Metaphysik des Schwebens moderne Kunst aus ihrer Verklammerung mit traditioneller Metaphysik, um eine feststellende Ontologie zu vermeiden. Dabei stößt er auf die Frage, ob das Ende der traditionellen Metaphysik das Ende einer jeden möglichen Metaphysik überhaupt bedeute und ob sich nicht gerade in der modernen Kunst „Möglichkeiten zeigen, das Wesen der Metaphysik neu zu bedenken“?23
Schulz schlägt vor, die Zeitgemäßheit moderner Kunst in ihrer Negativität und Subjektivität zu deuten. Unter Negativität versteht er die „Aufhebung des Weltvertrauens zugunsten der Weltungesichertheit“. Subjektivität entspricht, so Schulz, der Erfahrung der Negativität. Subjektivität „(findet) in sich selbst keinen Halt und (hat) gerade darum die Tendenz (…), sich an die Welt, die auch keine Sicherheit bietet, zu verlieren.“24
Diesen Zustand wechselimplikativer Unsicherheit, den Zygmunt Bauman als Ambivalenzstruktur der Moderne und Jürgen Straub als Paradoxie transformatorischer Identität reflektieren, reflektiert Schulz in Bezug auf Erscheinungsgestalten moderner Kunst „als Zustand des Schwebens“25, im Sinne eines Verlusts von Festigkeit, Fraglosigkeit und Positivität. Ästhetisches Schweben ist nach Schulz eine dynamische Subjekt-Welt-Beziehung, die, da moderne Kunst nicht mehr metaphysisch fundiert ist, die „Möglichkeit heraufführt, das Schweben als legitime ‚Grundlage‘ der modernen Kunst zu bedenken.“26 Moderne Kunst als genuiner Ort einer Metaphysik des Schwebens verwebt im Gegenzug zu einer ontologisierenden Metaphysik, Schein und Sein, Wahrheit und Lüge, Anschauung und Reflexion. Werke der modernen Kunst und Literatur sind mehrdeutig. Sie sind ambivalent. In ihrem Rätselcharakter stellen sie Grundfragen an die Gegenwart und transzendieren, im Beleuchten unterschiedlicher Perspektiven und Sinnentwürfe empirische Erfahrungen, die das auf sich selbst zurück geworfene Subjekt betreffen. Sie gestalten, indem sie sie verweigern, eine schwebende, ästhetische Erfahrung des Trostes: „(…) ein wirklich großer Roman“, so McEwan in Bezug auf Cervantes und Gegenwartsliteratur, „hat etwas Ermutigendes, egal, wie finster die Welt ist, die er beschreibt.“27
Seit 1750 gestalten moderne Romane Möglichkeitsräume des transitorischen Identitätsparadigmas, die vor dem Hintergrund der ersten Phase des Modernierungsschubes aus Genremischungen bestehen, mit dem sie Erwartungen ihrer Rezipient/innen transzendieren, darin transformatorische Identitätserfahrungen der Moderne affizieren und sich – wie auch moderne bildende Kunst – gegen den instrumentellen Charakter der modernen Warenwelt gerichtet, der Verwandelbarkeit metaphysischer Aspekte stellen: Aspekten des Heiligen, des Göttlichen, des Erhabenen, des Geheimnisses, des Bösen in seinen vieldeutigen Varianten, Aspekten des Todes, konventionsüberschreitender Liebes- und Kommunikationserfahrungen, den widersprüchlichen Aspekten des „Sorgenkind(es) der Moderne“28, d.i. des Subjekts, und dem Wagnis der Freiheit.29
Zygmunt Bauman definiert ambivalente Situationen als solche, in denen, im Versuch Ordnung herzustellen, herkömmliche bzw. erlernte Ordnungs- und Sprachmuster nicht greifen. Es entstehen Kontrollverlust, ein Gefühl der Unentscheidbarkeit und Unentschiedenheit: „Die Konsequenzen der Handlung werden unvoraussagbar, während Zufälligkeit, die doch eigentlich durch Bemühung um Strukturierung aufgehoben sein sollte, ungebeten zurückzukehren scheint.“30
Baumans Buch stellt, wie auch das Werk Walter Schulz‘, die Moderne als vergeblichen Versuch dar, Ordnung und Eindeutigkeit herzustellen; vergeblich deshalb, weil die ineinander greifenden funktionalsierten Systeme Kontingenzen enthalten, die Ordnungsversuche immer wieder unterlaufen und Individuen in der funktionalen Differenzierung der Systeme sozial ortlos werden lassen. Das Individuum wird vieldeutig ambivalent, „ein partieller Fremder“31, oder, wie Walter Schulz formuliert, scheiternd und haltlos „bis zu den Erfahrungen der Selbstauflösung hin“32. Beide Autoren, der Soziologe und der Philosoph, verwenden u.a. Franz Kafkas Werke – Walter Schulz bezieht sich auch auf James Joyce – als Belege einer ästhetisch transzendenten Immanenz der Moderne.
Der moderne Roman als offenes Genre – er ist „a mighty melting pot, a mongrel among literary thoroughbreds“33 – spricht, indem er sie narrativ gestaltet, die Ambivalenz der Moderne als Daseinsdiffusion und die aus ihr folgenden transitorischen Identitätserfahrungen der Rezipient/innen an. Er gestaltet als narrativer Kosmos Sinnfragen, er findet sie nicht.
Rezipient/innen, insbesondere die des dritten Lebensalters, werden in ihren aspirierten imaginativen Identitätsmöglichkeiten von modernen Romanen affiziert. Fragen der Selbst- und Fremdbestimmung, des Selbstentzuges, der Autonomiebildungsmöglichkeiten, der Selbstranszendierung, der Gerotranszendenz, werden anhand der Konflikt- und Dilemmasituationen, in die die Erzählfiguren verstrickt sind, virulent. Immer geht es den Romanen um eine verdichtete Vergegenwärtigung von Vergangenheit, um eine an scheiternden Lebenserfüllungen orientierten Ganzheit,34 die transitorisch zukunftsoffen gestaltet ist:
The novel presents us with a changing, concrete, open-ended history rather than a closed symbolic universe. Time and narrative are of its essence. In the modern era, fewer and fewer things are immutable, and every phenomenon, including the self, seems historical to its roots. The novel is the form in which history goes all the way down.35
Moderne Romane sind unterhaltsame, erkenntnisfördernde Gedächtnismedien, deren Erzählwirklichkeit als „subjektiv entworfene Welt()“ in der „subjektiven Brechung“ des Erzählers und der Romanfiguren entsteht.36 Diese subjektiven Erzählwirklichkeiten sind als moderne Gedächtnismedien zu verstehen: „The novel is the mythology of a civilization fascinated by its own everyday existence.“37 Die kulturgeschichtlich transitorische Offenheit moderner Romane öffnet ihren Protagonisten prekäre Freiheitsspielräume, in denen konstitutive Identitätserfahrungen des Selbstentzugs gestaltet werden:
Modern subjects, like the heroes of modern novels, make themselves up as they go along. They are self-grounding, and self-determining, and in this lies the meaning of their freedom. It is, however, a fragile, negative kind of freedom, which lacks any warranty beyond itself.38
1.2Kultursemiotischer Ansatz. Die Rezeption moderner Romane als kulturelle Gedächtnismedien
Bei der Erschließung literarischer Texte sind diese nicht nur als Texte zu berücksichtigen, sondern auch als kulturelle Institutionen ihrer Entstehungszeit. Literarische Texte sind aufgrund ihrer spezifisch ästhetischen Differenz zwar Teile kultureller Ordnungen, aus denen sie hervorgehen, sie wirken aber auch auf diese zurück und sind zukünftig erschließbar. Geht man mit Ansgar Nünning und Roy Sommer von einem Kulturbegriff aus, der „semiotisch(), bedeutungsorientiert() und konstruktivistisch()“ ist,1 dann sind Kulturen, in Anlehnung an Roland Posners Kulturmodell, menschlich hergestellte Gebilde, die „nicht nur eine materiale Seite haben, sondern auch eine soziale und mentale“.2
Modellhaft formuliert lassen sich der sozialen Dimension Individuen, Institutionen und Gesellschaft, der mentalen Dimension Mentalitäten, Selbstbilder, Normen und Werte und der materialen Dimension Gemälde, Architektur, Gesetzestexte und literarische Texte zuordnen.3 In Bezug auf die Epoche der Moderne lassen sich demzufolge der sozialen Dimension Industrialisierung, Urbanisierung, Autoren und Leser, der mentalen Dimension Utilitarismus, Egoismus und patriarchalisches Tugendsystem und der materialen Dimension, in Bezug auf literarische Texte, beispielsweise Romane mit problemorientierten Handlungen und spezifischen Lösungsvorschlägen zuordnen.
Nach Nünning und Sommer fasst dieser Kulturbegriff Kultur als den „von Menschen erzeugte(n) Gesamtkomplex von Vorstellungen, Denkformen, Empfindungsweisen, Werten und Bedeutungen auf(), der sich in Symbolsystemen materialisiert.“4
Nünning und Sommer schließen mit Posner, dass dem bedeutungsorientierten Kulturbegriff zufolge künstlerische Ausdrucksformen der materialen Dimension ebenso zuzuordnen sind, wie die mentalen Dispositionen und die sozialen Dimensionen, die diese Ausdrucksformen hervorbrachten bzw. prägten. Da zwischen diesen drei Dimensionen komplexe Wechselwirkungen bestehen, ergibt sich für das Erschließen literarischer Texte aus einer bestimmten Kultur, in Bezug auf ihre Gehalte und Formen, dass sie in verdichteter Form „Aufschluss über die mentalen Dispositionen der entsprechenden Epoche geben“.5 Literarische Texte sind also nicht nur künstlerischer Ausdruck zeitgenössischen Denkens, sondern geben Aufschluss über die Selbstwahrnehmung und das kulturelle Bewusstsein einer Epoche, wie sie sich selbstreflexiv kulturdiagnostisch in den Werken als ästhetisch Besonderes thematisieren.
Nünning und Sommer ziehen aus dem von ihnen konzipierten Gegenstandsbereich einer kulturwissenschaftlich orientierten Literaturwissenschaft drei Konsequenzen:
Bei kulturellen Einheiten handelt es sich nicht um vorgefundene Objekte, sondern um menschliche Konstrukte.
Wenn Literaturwissenschaft als Teil der Kulturwissenschaft verstanden wird, dann ist von einem weiten Literaturbegriff – Literatur als Teil der Medienkultur – auszugehen.
Die Gegenstandskonstitution einer kulturwissenschaftlich ausgerichteten Literaturwissenschaft ergibt sich aus den drei Dimensionen des Kulturbegriffs. Neben literarischen Texten berücksichtigt sie die mentale Dimension einer Kultur und die literarische Verarbeitung „gesellschaftlich dominanter Sinnkonstruktionen (…)“.6
Die von Nünning und Sommer konzipierte kultursemiotische Theorie bietet Anschlussmöglichkeiten an die zentralen Kategorien Literatur, Mentalität, kulturelles Gedächtnis.7 Sie bietet zudem Anschlussmöglichkeiten an die rezeptionsästhetisch kontroverse Erschließung moderner Romane als kulturelle Gedächtnismedien. Diese werden als „kulturelle Ausdrucksträger“8 verstanden, die nicht Objekte, sondern „Formen der kulturellen Selbstwahrnehmung und Selbstthematisierung“9 einer Epoche sind. Sie können in der Interaktion mit Rezipient/innen kultursemiotisch reflektiert werden.
Romane sind fiktionale Welten, Erzählwelten.10 Als das Andere der Realität entwerfen sie Möglichkeitswelten, die die kognitiven, imaginativen und affektiven Fähigkeiten ihrer Leser/innen ansprechen. Literarische Texte regen im Lektüreprozess ihre Leser/innen an, sich mit dem Selbst- und Weltverständnis der Figuren, ihren Gedanken, Gefühlen und Entscheidungen auseinanderzusetzen und damit „die Gefühle und Gedanken anderer zu erschließen“.11 Im Lektüreprozess baut sich die erzählerische Form der Selbst- und Weltbilder der Figuren und ihrer Interaktionen als Gegenentwurf zu ideologischen Mustern und begrifflichen Vereinnahmungen auf.12 Dieser Gegenentwurf zeichnet sich als Möglichkeitsraum aus, dessen Rätsel- und Fragecharakter die Erfahrungswirklichkeit seiner Leser/innen durch die Nähe zu ihrer Erfahrungswelt und durch die ästhetische Distanz seiner erzählerischen Gestalt, die diese Nähe ermöglicht, zum Ausdruck bringt.
Die ästhetische Erfahrung „(…) gewährt den Leserinnen und Lesern auf dem Weg der Lektüre Anteil an anderen, entfernten oder fremden Welten und Denkvorstellungen und macht ihnen zugleich das Angebot, bisher ungewohnte oder, im wörtlichen Sinne, befremdliche Erfahrungen und Wahrnehmungen in ihr eigenes Denken und Handeln zu integrieren.“13
Die Lektüre von literarischen Texten, insbesondere von Romanen, die „ihrer begrifflichen Monosemierung“14 widerstehen, kommt dem kulturellen und biografischen Bedürfnis seiner Leser/innen nach Antwortmöglichkeiten auf ihre Sinnfragen dadurch entgegen, dass die Leser/innen um die Differenz zwischen ihrer Lebenswirklichkeit und der erzählten Welt wissen. Diese grundsätzliche ästhetische Differenz evoziert literarischen Sinn.15 Sie besteht aus der erzählten Textur, die auf der Inhaltseben den Grundkonflikt zwischen Individuum und Gesellschaft erzählsituativ, konfliktual differenziert und auf der Ausdrucksebene, der Ebene der erzählerischen Form, diesen Grundkonflikt in der Differenz zwischen der Erzählwelt und ihren Leser/innen metafiktional repräsentiert. Die Gesinnung zur Totalität, die Georg Lukács als Form des modernen Romans im Unterschied zum Epos bezeichnet,16 wird im Aufschub erfüllter Ganzheit, in ihren Episoden, Kontingenzen, in ihrer Weigerung rationale Gründe anzugeben, in der Isolation der Individuen, im gestalteten Chaos lebendig. Romane gestalten die Illusion, unerfüllte Sehnsüchte könnten künftig erfüllt, Liebende vereint werden. Es ist diese Illusion, die die Differenz zum Alltag der Leser/innen ausmacht, die die im Roman ersehnte Ganzheit belebt, „notwendige Voraussetzung der ‚Unbestimmtheit‘ (seiner) Einzelmomente“17 ist, ihm den Charakter des Fragments gibt, und die Ganzheitssehnsucht der Rezipient/innen in der modernen Welt affiziert.
Die Lektüre der Romane Dickens‘, der Geschwister Brontë und Virginia Woolfs sprechen eine Generation an, die als Nachkriegsgeneration des Zweiten Weltkrieges von den Traumatisierungen ihrer Eltern und Großeltern in Mitleidenschaft gezogen worden ist, aber auch kreative Entwicklungsmöglichkeiten in der neuen Bundesrepublik hatte. Dickens‘, Brontës und Woolfs Romane öffnen ihnen imaginative Räume, die im Zusammenspiel von Identifikation und Distanzierung mit diesen Erzählwelten, Identitätsvorstellungen, Vorenthaltung von Identitätsmöglichkeiten, Ambivalenzen, Erfahrungen evozieren, die Potenziale transitorischer Identitätserfahrungen und narrativer Identität in den Verstehensprozess der Erzählwelt einflechten und Pathologien der modernen Gesellschaft aus der Perspektive viktimisierter Außenseiter oder hochindividuailisierter Einzelgänger erzählerisch erschließen lassen.
Durch erzählerische Verfahren, die die Romane strukturieren – Erzählerperspektiven, Figureninteraktionen, Handlungsverwicklungen, Zeit- und Raumerfahrungen, Leerstellen –, entstehen strukturiert offene Textgewebe, die die Interaktionen zwischen diesen Texten als fiktionalen Möglichkeitsräumen und ihren Leser/innen als Frage- und Antwortspiel dynamisieren. In dieser Interaktion flechten sich Einstellungen der Leser/innen durch Rückgriffe auf ihr Erfahrungswissen in die Erzählgewebe ein und erlauben Einblicke in bislang unzugängliche menschliche Möglichkeiten. Im imaginativen und diskursiven Wechselspiel zwischen literarischen Texten und ihren Leser/innen entsteht durch irritierende Stellen, durch nonkonformistische Sinnentwürfe, durch die Vorenthaltung fixierbarer Erzählintentionen, eine „energetische Kraft“18, die den Deutungsprozess zwischen den literarischen Texten und ihren Leser/innen trägt, eine Vielzahl von Deutungen ermöglicht, zu Veränderungen der Selbst- und Weltbilder der Leser/innen und zu innovativen Deutungen der rezipierten Werke führen kann. Die Reflexion auf die erzählerische Textur, die sich in der ästhetischen Differenz zwischen erzählter Welt und der Erfahrungswelt der Leser/innen ausdrückt – sie wissen, dass sie Romane lesen – ist wesentlicher Bestandteil des Lektüre- und Verstehensprozesses, der Aktivierung narrativer Identitätsmöglichkeiten sowie der Reflexion auf transitorische Identitätserfahrungen. Diese wird durch Spielarten des Selbstentzugs, die die Romane verdichten, angeregt. Die Erzählwelten sind nicht auf ein Deutungsschema, beispielsweise auf melodramatisches Erzählen, festzulegen.
In literarischen Werken begegnen wir „besonderen Orten, Augenblicken, Figuren mit Eigennamen, spezifischen Rede- und Handlungsweisen, Arten des Denkens und Fühlens“.19 Sinnlich wahrnehmbar, ästhetisch, ist darin die „imaginative Erfahrung des Besonderen als physischer Erscheinung und/oder inneren Konkretheit anstelle abstrakter Begrifflichkeit“.20 Rezeptionsästhetisch bedeutet dies, dass wir literarische Texte aufgrund ihrer ästhetischen Differenz als kulturell vergangenheits- und zukunftsbezogene gestaltgewordene Ereignisse auffassen können, „bei (denen) unsere kognitiven, affektiven und evaluativen Fähigkeiten aktiviert werden“.21 Bei der Erschließung literarischer Texte aus früheren Epochen geht es also darum, ihre neue kulturelle Funktion in Bezug auf unser heutiges Selbst- und Weltverständnis zu verstehen.
Fünf komplexe Problemkreise werden im Folgenden miteinander in Beziehung gesetzt:
Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Debatten um den Alternsprozess. In den Blick kommt die kulturgeschichtliche Situation der Nachkriegsgeneration in Deutschland, der die Rezipient/innen des dritten Lebensalters angehören,
der Problemhorizont der Identität in der reflexiven Moderne,
das Erschließen und Verstehen der Romane des Viktorianischen Zeitalters und der klassischen Moderne als Wegbereiter der Moderne, bzw. als moderne Romane, die den metaphysischen Orientierungsverlust narrativ gestalten,
die kritisch-hermeneutischen Auseinandersetzung mit der Kulturdiagnostik der Romane durch Rezipient/innen des dritten Lebensalters.
Der rezeptionsästhetische Zugang sucht demzufolge die kontrovers reflektierte Bedeutung der Werke und „(…) ihr Wirkungspotenzial heute zu bestimmen, als einer Etappe im seither erfolgten Entfaltungsprozess des Werkes, dessen Bedeutung als nicht in der Entstehungssituation festgeschrieben verstanden wird (…).“22
Im Rahmen des semiotischen Kulturbegriffs bedeutet dies, dass literarische Werke im Zusammenhang mit ihrem kulturellen Kontext rezeptionsästhetisch, im Zusammenspiel zwischen literarischen Texten und ihren Leser/innen, diskursiv werden. Dabei wird die vom Autor intendierte Bedeutung als einmalig und historisch situiert verstanden, während Leserschaften sich historisch verändern, fortwährend erneuern, also eine heterogene Größe darstellen, die sich bei der Erschließung literarischer und nicht-literarischer Texte, nicht auf eine Bedeutung festzulegen vermag:
Zu viele sprachliche, kulturelle, ideologische und ästhetische Interessen kollidieren im Bereich der Rezeption, als daß sich eine Textbedeutung auf Dauer durchsetzen könnte.23
Im Zusammenspiel von literarischen Texten und Leser/innen werden die jeweils kulturell bestimmten und persönlich ausgebildeten „kognitiven, affektiven, imaginativen und evaluativen Kompetenzen“24 evoziert. In den Blick geraten dabei kontrovers besprochene Plausibilitätsfragen wie diese: Inwieweit literarische Werke kulturdiagnostisch das symbolische Wertsystem ihrer Zeit erhalten bzw. verstärken, oder ob sie sich durch ihre formale Komposition von diesen Wertsystemen distanzieren?25
Der Erkenntniswert von Romanen
Diese kulturdiagnostische Fragestellung kann rezeptionsästhetisch nicht durch eine Übertragung individualpsychologischer Erfahrungen auf epochal und ästhetisch differente kollektive Erfahrungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts einer Entscheidung zugeführt werden. Vielmehr geht es darum, diese Erfahrungen, wie sie in der symbolischen Form des modernen Romans selektiert, kombiniert und verdichtet zum Ausdruck kommen, hermeneutisch in Bezug auf das Wechselverhältnis der drei Kulturdimensionen zu reflektieren. Sieht man im Rahmen einer semiotischen Kulturtheorie moderne Romane als kulturelle „Gedächtnisphänomene“ der materialen Seite der Kultur an,26 dann bedeutet das Erschließen, Verstehen und die kritische Reflexion dieser Erzählwelten, diese als eigenständige symbolische Formen zu lesen, deren Rückversetzung der Handlung (bei Romanen des Viktorianischen Zeitalters um 40 – 50 Jahre) sie zu einzigartigen Gedächtnismedien der Krise ihrer Kultur werden lassen.
Zentral sind in diesem Zusammenhang die Plausibilitäts- und Dispositionsfragen der Rezipient/innen des dritten Lebensalters, die sie an die Erzählwelten stellen. Im Unterschied zu Plausibilitätsfragen von Zuhörer/innen, die sich auf den Ich-Fokus narrativer Identitäten richten, zielen Plausibilitätsfragen von Leser/innen auf den Fiktionsstatus von Romanen. Romane vergegenwärtigen Ereignisse poetisch im Erzählten. Ihr „Erkenntniswert (besteht) in einer Vergegenwärtigungsleistung“.27
Narrative Identitäten vergegenwärtigen ebenso. Mit zunehmendem Alter der Erzähler/innen werden sie bedeutungsvoller und intensiver. Lebenserfahrungen werden teleologisch und adressatenbezogen in linearer, temporaler und kausaler Verknüpfung, mit markiertem Anfangspunkt, auf einen sinnstiftenden Endpunkt hin erzählt.28
Aber mit einem wichtigen Unterschied gegenüber Romanen: Narrative Identitäten weisen teleologisch zurück und vergegenwärtigend hin. Sie weisen auf gemachte Erfahrungen und versuchen sie in den kohärenten Zusammenhang eines und dann zu bringen. Der Referenzcharakter narrativer Identitäten zielt auf Kohärenz und Plausibilität gemachter Erfahrungen, die, wie juristische Plädoyers biografische Ereignisse geordnet und/oder assoziativ zusammenziehen und durch Dokumente belegen können, um außergewöhnliche Handlungen „von gängigen Normalitätserwartungen“ plausibel zu unterscheiden.29 Demgegenüber verzichten Romane auf „verweisende Bezugnahme“, auf Referenz.30 Romane stellen autoreferenziell dar und ermöglichen eine Konfrontation mit fiktionalen Erfahrungen und damit eine „Richtungsänderung des Bedeutens“, die die reflektierende Urteilskraft der Rezipient/innen auf der Suche nach Deutung und Sinn aktiviert.31 Während Identität als narrative Konstruktion „stets von Brüchigkeit gekennzeichnet ist“32, sind Romane kontingenzästhetisch strukturiert und verweisen im Erzählen des Erzählens auf ein Spiel mit Brüchen in und mit der Fiktion – siehe z.B. Miguel Cervantes‘ Roman Don Quichote, Laurence Sternes‘ Roman Tristram Shandy, Virginia Woolfs Roman The Waves, James Joyces Roman Ulysses, Günter Grass‘ Roman Die Blechtrommel. Dieses Spiel macht ihre Gesinnung zur Totalität aus und lässt sie zur gegenweltlichen Zeitdiagnose für Rezipient/innen des dritten Lebensalters werden. Der Strukturunterschied, der Romane und narrative Identität voneinander unterscheidet, macht narrative Identität zu einer literarischen „Mischform“33, die das Erschließen fiktional erzählter Welten in ästhetischer Distanz ermöglicht. Plausibilitätsfragen sind also die von den Lebenserfahrungen der Rezipient/innen des dritten Lebensalters bereitgestellten Bedingungen einer kreativen Auseinandersetzung mit den fiktiven Texturen erzählender Literatur. Literarische Texte werden im Lichte der riskierten Ganzheit der Lebenserwartungen der Rezipient/innen des dritten Lebensalters zu bedeutsamen Möglichkeitsräumen, in denen sie sich als ganze Menschen wiedererkennen: als Individuen mit Ängsten und Hoffnungen, mit Widersprüchen, mit Abgründen und als Individuen, die kreativ und zerstörerisch sein, lieben und hassen können und Visionen haben.
Zu symbolischen Gedächtnismedien werden Romane also dadurch, dass sie im Akt des Fingierens Elemente der drei Kulturdimensionen, mithin „Elemente der außerliterarischen Realität“, in andere imaginäre, diffuse Bedeutungen ohne Objektreferenz überführen.34 Damit irrealisieren sie empirische Wirklichkeitselemente und weisen ihnen fiktional den Status der Realität zu. Als Ausdrucksformen des kulturell Imaginären35 verdichten moderne Romane, durch Rückgriffe Vergessenes, Erinnertes und Zukunftsweisendes ihrer Kultur. Durch Neu- oder Umstrukturierungen temporaler und kausaler Ordnungen eröffnen sie im Rezeptionsakt Analogien, die, im Rahmen des kollektiven Gedächtnisses moderner Erfahrungen, kulturspezifische Schemata des 19. Jahrhunderts mit Schemata individuell kulturellen Erinnerns des 20. und 21. Jahrhunderts aktualisierend verknüpfen.
Beide Formen des kollektiven Gedächtnisses, nämlich kulturelles Erinnern als individueller Akt und das Gedächtnis der Kultur in den ästhetischen Formen der Romane des Viktorianischen Zeitalters sowie der frühen Moderne, wirken durch ihre jeweilige narrative Struktur im Zusammenspiel von individueller und kollektiver Ebene im Rezeptionsakt zusammen.36 Mit Paul Ricoeur kann man diese Aktualisierung kultureller und biografischer Muster als Refiguration bezeichnen, in der die Dynamik der erzählten Welten an ihr Ziel kommt: „Erst in der Lektüre kommt die Dynamik der Konfiguration an ihr Ziel. Und erst jenseits der Lektüre, in der tatsächlichen Handlung, die bei den überkommenen Werken in die Lehre gegangen ist, verwandelt sich die Konfiguration des Textes in Refiguration.“37
Rezeptionsästhetisch bedeutet diese Aktivität der Leser/innen, dass ihr Selbst- und Weltbild, ihre Werte und Normen aufs Spiel gesetzt und Erfahrungen ihrer transitorischen Identität affiziert werden. Zudem öffnen sich ihnen Potenziale narrativer Identität und transgenerationaler Diskurse.
1.3Die Refiguration des Paradigmas moderner Identität
Der moderne Roman als offenes Genre, so wurde eingangs erläutert, spricht, indem er sie narrativ gestaltet, transitorische Identitätserfahrungen an und lässt sie in der Interaktion zwischen Text und Leser/innen thematisch werden. Die Grundstruktur dieser Interaktion besteht darin, dass der literarische Text nicht als ein Objekt begriffen wird, das sich von außen analysieren lässt, sondern als ein, wie oben gezeigt, subjektiver Weltentwurf, durch den Leser/innen zu kreativen Mitspielern werden. Die Welt des narrativen Textes entsteht in der Interaktion zwischen Text und Leser/innen. Das bedeutet, dass literarische Texte von den Erfahrungen her, die Leser/innen mit ihnen machen, verstanden werden müssen. Ästhetische Erfahrung wird zur transformativen Energie, die den Horizont der Rezipient/innen, unter Rückbezug auf das individuelle Vorverständnis, für Neues öffnet.1
Romane des Viktorianischen Zeitalters und der klassischen Moderne geben ihren Protagonistinnen und Protagonisten als Waise und Außenseiter Gestalt. Mit Helmut Plessner und Karl Jaspers formuliert, symbolisieren sie die exzentrische Positionalität des Menschen in Grenzsituationen. Auf der Suche nach dem Ich, die diese Romane als transitorisches Werden zu sich selbst gestalten, werden sie mit Erfahrungen des Leidens, der Krankheit, des Kampfes um Liebe, des Zufalls und des Todes konfrontiert. Hunger, Kälte und Illusionsverlust kommen hinzu.
Nach Karl Jaspers sind dies keine philosophischen, sondern existenzerhellende Grenzsituationen des Menschen, denen man nicht ausweichen, die man aber mit dem Mut zum Neubeginn bewältigen kann.2 Das trifft auch auf den eigenen Tod zu:
Der Tod ist nur als ein Faktum eine immer gleiche Tatsache, in der Grenzsituation hört er nicht auf zu sein, aber er ist in seiner Gestalt wandelbar, ist so, wie ich jeweils als Existenz bin. Er ist nicht endgültig, was er ist, sondern aufgenommen in die Geschichtlichkeit meiner sich erscheinenden Existenz.3
Grenzsituationen als lebendige Notwendigkeit erfahren, heißt folglich, sie zum Eigentlichen unserer Existenz werden lassen: „(…) wir werden wir selbst, wenn wir in die Grenzsituationen offenen Auges eintreten. Sie werden, dem Wissen nur äußerlich kennbar, als Wirklichkeit nur für Existenz fühlbar. Grenzsituationen erfahren und Existieren ist dasselbe. In der Hilflosigkeit des Daseins ist es der Aufschwung des Seins in mir.“4
Die Nicht-Endgültigkeit der Endgültigkeit des menschlichen Todes stellt ein Paradoxon dar: Zwar macht jeder Mensch die Erfahrung, dass andere Menschen sterben können, aber die Bedeutung von Tot-Sein kann man nicht erfahren.5 Jaspers bringt die Erfahrungen der Grenzen menschlichen Daseins, auch das Paradoxon der menschlichen Todeserfahrung, in den Zusammenhang der Fähigkeit des Menschen zur immanenten Transzendenz: Der Einzelne könne, so Jaspers, als Teil einer Gesamtheit, mit der er kommuniziere, seine Existenz verstehen. Menschsein entstehe aus Krisenerfahrungen, nämlich in der individuellen Fähigkeit zu freier Selbstschöpfung.6 Eine analoge Weltdeutung findet sich in Virginia Woolfs Werk, in Varianten aber auch in den anderen hier vorgestellten Romanen.
Die jeweilige Form der Romane nimmt Grenzerfahrungen menschlicher Existenz und ihre narrativen Aufschwungs- und Lösungsmöglichkeiten in ihre kontingenzästhetische und multiperspektivische Struktur als fiktionale Existenzerhellung auf. Die jeweilige erzählerische Form wird zum fiktionalen „Wagnis des Lebens“7 und damit zum interessanten, spannenden, unterhaltsamen, die Gefühle und kognitiven Fähigkeiten der Rezipient/innen des dritten Lebensalters anregenden Lektüre- und Diskursangebot.
Sie können ein großes Spektrum menschlicher Grenzsituationen, in denen sich die Protagonisten der Romane befinden und ihre Bewältigungsmöglichkeiten, erschließen: Im Oliver Twist als Todeserfahrungen im Leben, in Jane Eyre als drohende Existenzvernichtung, in Wuthering Heights als archaische Gegenperspektive gegen viktorianische bzw. bürgerliche Ordnungsvorstellungen, bei Virginia Woolf als „Zeitlichkeit und Veränderlichkeit“8 des individuellen Lebens, in seiner Ambivalenz von Leben und Tod.
Ins Spiel kommen dabei Fragen der Alternsidentität, die, nach Erikson, an die Aufgabe gebunden sind, das eigene Leben in seiner Gesamtheit als stimmig zu erfahren und in seinen positiven wie negativen Aspekten als einmalig, unumkehrbar und endlich zu bejahen.9 In der Weiterführung der Entwicklungstheorie Eriksons hebt Andreas Kruse mit Günter Anders und Hans Thomae hervor, dass Identitätserfahrungen im Alter durch Offenheit, als „Fähigkeit und Bereitschaft (…), sich von der Welt berühren, beeindrucken, ergreifen zu lassen“, entstehen. Daraus folgen „Mitverantwortung“ für die Welt und ihre Veränderungsmöglichkeiten und Dispositionen für „im Lebenslauf entwickelte (…) neue Möglichkeiten und Anforderungen“.10 Entscheidend ist hierbei, dass im Alternsprozess eine „tragfähige Lebensperspektive“ entwickelt werden kann, die sich in Bezug auf die verbleibenden Jahre des Lebens als positive Lebensbewertung und als Wunsch nach sozialer Teilhabe äußert.11 Dieses Konzept der Generativität im Alter, das sich familiär und gesellschaftlich verwirklichen kann, ist in engem Zusammenhang mit Identitätstheorien zu sehen, in deren Zentrum Erfahrungen der transitorischen Identität und ihre Möglichkeiten der Selbstorganisation subjektiven Lebens in der Moderne stehen.
Die mit Industrialisierung, Kapitalisierung und unterschiedlichen Strömungen von Individualisierung entstandene Moderne, die sich durch das lange 19. Jahrhundert erstreckte, wird von Soziologen und Kulturkritikern, wie Charles Taylor, Peter Gay, Ulrich Beck, Anthony Giddens, Axel Honneth, mit einer reflexiven, sich ständig revidierenden Moderne, dem Verlust stabiler Wertorientierungen, extrem gesteigerter Auswahlmöglichkeiten, mit Reflexionen auf transitorische Identitäts- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten und transformatorischen Bildungschancen in Verbindung gebracht.
Romane des Viktorianischen Zeitalters und des frühen 20. Jahrhunderts generieren das Paradigma moderner, transitorischer Identität: „The fact that so many novels centre on a search, quest or voyage suggests that meaning is no longer given in advance.”12
In Bezug auf Identitäts- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten in der Moderne spricht Jürgen Straub, wie oben erläutert, von unabschließbaren Ambitionen, die aktiv keine Kohärenz des Selbst herbeiführen. In der Auseinandersetzung mit den Romanen wird das Selbst als Fremdes, als Anderes, als nicht einholbarer, konstitutiver Selbstentzug, der kreative Potenziale und Möglichkeiten der Selbsttranszendierung freisetzen kann, thematisch.13
Der Individualismus hatte sich in England bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zur Blüte entwickelt und war hauptsächlich männlich konnotiert.14 Fragen nach „moralischen Grundlagen der Marktwirtschaft“15 wurden nicht systematisch gestellt. Sie wurden von Intellektuellen in Bezug auf den Homo oeconomicus als Persönlichkeitstypus, nicht aber in Bezug auf soziale Verelendung und Ausbeutung durch Freisetzung privater Profitinteressen diskutiert.16 Sie tauchten als Skizzen eines moralischen Ökonomismus bei Adam Smith, Hegel, Durkheim und Marx auf.17 Die seit dem 18. Jahrhundert publizierten englischen Romane jedoch gingen in Varianten der Frage nach, ob ökonomisch, d.h. in der Sprache der Romane, malevolent strukturierte Machtasymmetrien moralisch legitimiert seien und ob der Typus des Homo oeconomicus nicht mit der „Gefahr einer allmählichen Aushöhlung sozialer Bindungen verknüpft sei“.18 Im Möglichkeitsraum der Fiktion entwarfen Romane Vorstellungen individueller Autonomiebildungsmöglichkeiten und brachten diese Fragen, im 19. Jahrhundert über die Paradoxie des poetischen Realismus, wie zu zeigen sein wird, als Herausforderungen in den öffentlichen Diskurs ein.19 Im 19. Jahrhundert verdichteten Romane die unauflösbare Diskrepanz des modernen Kapitalismus, die sich „(…) zwischen dem an universalisierbaren Werten orientierenden Verständigungs- und Geltungsanspruch demokratischer Politik einerseits und der sich demokratischer Politik und moralischer Gestaltung entziehenden Dynamik des Kapitalismus andererseits (…)“ als „Dauerproblem“ aufspannte20 und, wie Peter Gay dies nennt, ein normatives Vakuum erzeugte.21
In ihrer narrativ subjektiven Perspektivierung der Kulturkrise, die sie 40–50 Jahre vor ihren Publikationsdaten, meist in der Mitte des 18. Jahrhunderts, ansetzen, sind Romane des Viktorianischen Zeitalters Teil des modernen Literatursystems.22 Sie konfrontieren – wie auch die Romane, die der klassischen Moderne zugerechnet werden – die Diskrepanz des modernen Kapitalismus und die mit ihr einhergehenden Problematik des normativen Vakuums kontingentästhetisch und multiperspektivisch.
Rezipient/innen des dritten Lebensalters können diese Romane als kulturelle Gedächtnismedien über die Fähigkeit zur Aktiven Imagination refigurieren, wenn sie deren paradoxe bzw. multipersektivische narrativen Strategien erschließen und auf die epochale und ästhetische Differenz dieser fiktionalen Möglichkeitsräume zu heutigen individuellen Akten kulturellen Erinnerns reflektieren. Bei der Erschließung dieser Romanwelten kommen komplexe moderne Entfremdungserfahrungen, die „wirklichkeitsgeneriernd“23 das Erzählen des Erzählens hervorheben, ins Spiel. In narrativen Konstruktionen, die das Geschehen allererst erzeugen, erkunden Romane das moderne Selbst, loten Möglichkeiten seiner Handlungsspielräume und persönlicher Autonomie aus und dringen zu „Zonen des Vor- und Unbewussten (…) vielfach im Modus der Angst“24 vor. Da jeder dieser Romane Wahrnehmungsformen moderner Subjektivität anders perspektiviert, entsteht eine enorme Vielfalt unterschiedlicher narrativer Ausdruckswelten – auch bei Autoren, wie beispielsweise Charles Dickens, in dessen Werk kein Roman dem anderen gleicht –, so dass man von einer einheitlichen Gattung Roman nicht sprechen kann.25
In der Refiguration moderner Romane als kulturelle Gedächtnismedien durch Rezipient/innen des dritten Lebensalters, wird die Komplexität des modernen Ich, werden Gattungsmuster erschließbar, die Entwicklungsverläufe unterschiedlichster Art, bzw. archetypische Formen wie Komödie, Tragödie, Satire, Melodrama26 und ihre – besonders bei Charles Dickens ausgeformten – Mischformen zum Ausdruck bringen. Die kontingenzästhetische Multiperspektivität der Romanwelten bringt moderne Erfahrungen der transzendentalen Obdachlosigkeit (Georg Lukács) und die daraus folgenden Pathologien der Angst, der Verlusterfahrungen und Bedrohung zum Ausdruck; in Romanen des Viktorianischen Zeitalters in den Modi des Unheimlichen, der Groteske, des Erhabenen, des Grotesk-Erhabenen mit kathartische Lösungsmöglichkeiten im Modus des Märchenhaften oder der Märchen-Groteske, in Romanen der klassischen Moderne in den Modi des Selbstverlustes und der Selbsttranszendenz.
Charles Taylor leitet das in den Romanen gestaltete moderne Identitätsparadigma aus unterschiedlichen kulturgeschichtlichen Quellen her.27 Taylor entwirft drei Elemente oder Facetten des abendländischen Identitätsparadigmas: Das erste ordnet er dem Platonimus zu. Identität ist kosmologisch orientierte Innerlichkeit und an der Ordnung eines guten Lebens orientiert.28 Das zweite Element ordnet er Descartes‘ Erkenntnistheorie zu. Dieses Paradigma des distanzierten Subjekts entsteht in der Übergangszeit zwischen Augustinus und Descartes. Sein Merkmal ist eine radikale Reflexivität, die von eigenen Ideen, statt vom äußeren Sein ausgeht. Im Unterschied zur augustinischen Innerlichkeit verlegt Descartes die sittlichen Quellen in den Menschen selbst.29 Diese Verlagerung sittlicher Quellen in Erfahrungen der Endlichkeit des Lebens bildet den Übergang zum dritten Element des Identitätsparadigmas, in dem das „ganze menschliche Leben (…) nun in Begriffen von Arbeit und Produktion einerseits und Ehe und Familie andererseits definiert (wird).“30 Es entsteht die bürgerliche Ethik, die mit ihren Idealen der Gleichheit, ihrem universellen Rechtsgefühl, ihrem Arbeitsethos, ihrer Unterstützung von Erwerb und Handel, ihrer Normierung sexueller Liebe und Familie, eine wesentliche Rolle bei der Konstituierung der bürgerlichen Gesellschaft spielt. Das sich in der Romantik herausbildende bürgerliche Subjekt ist mit den widersprüchlichen Herausforderungen von Fortschritt, Sinnsuche und Lebensbejahung konfrontiert, die aus dem Dilemma zwischen instrumenteller Vernunft und kreativem Schöpfertum resultieren.31 Die „Synthese dieser Bejahung des normalen Lebens mit der Vorstellung des distanzierten Subjekts“32 ist das wesentliche Paradigma moderner Identität, „nach dessen Maßgabe wir uns seither zu definieren haben.“33 Die Folge ist, dass mit dem Schwinden kosmischer Ordnungen von Ideen und theologischer Perspektiven das Gefühl in der Moderne wächst, „daß die Aufgabe das Leben zu bejahen und eine Quelle inneren Wertes zu finden, uns selbst zufällt.“34
Persönliche Identität ist ein fester Bestandteil der modernen Zivilisation geworden. Es gilt: „Meine Identität gehört erst dann zu mir, wenn ich sie akzeptiere, was prinzipiell Raum für Verhandlungen mit meiner Umwelt, meiner Geschichte und meinem Schicksal öffnet.“35 Das moderne Paradigma einer Selbstdefinition, das im menschlichen Lebenslauf ausgebildet wird, kann unter der Bedingung immer wieder umdefiniert werden, dass es sich auf die Anerkennung der Anderen zu stützen vermag.36
Anthony Giddens erläutert Selbstbestimmungsmöglichkeiten als kontextbezogene „self-actualisation“, nämlich als „balance between opportunity and risk“37, die es Individuen ermöglicht, ihre Lebenswege selbstverantwortlich auszuhandeln und zu gestalten. Giddens begründet diese Selbstverantwortlichkeit mit der Fragilität und Schutzlosigkeit des modernen Selbst: „Self-Identity becomes problematic in modernity in a way which contrasts with self – society relations in more traditional contexts; yet this is not only a situation of loss, and it does not imply either that anxiety levels necessarily increase.”38
In Bezug auf Möglichkeiten einer Bildung transitorischer Identitäten in der Moderne folgert Giddens an anderer Stelle: „A person’s identity is not to be found in behaviour, nor – important though this is – in the reactions of others, but in the capacity to keep a particular narrative going. The individual’s biography (…) cannot be wholly fictive. It must continually integrate events which occur in the external world, and sort them into the ongoing ‘story’ about the self.”39
Um einen Sinnbezug zu uns als selbstentzogenen Subjekten herzustellen, müssen wir in anwesenden oder abwesenden sozialen Kontexten vergangene und gegenwärtige Erfahrungen mit unseren Zukunftserwartungen verknüpfen.
Axel Honneth führt in diesem Zusammenhang Paradoxien eines reflexiven Individualismus der Moderne ein, die er in Begriffe organisierter Selbstverwirklichung, bzw. in den Begriff dezentrierter Autonomie fasst.40 Unter dezentrierter Autonomie versteht Honneth eine von Kontingenz und Heteronomie bestimmte Form von Subjektivität und personaler Identität, deren Struktur so angelegt ist, dass „subjektübergreifende Mächte“ von Beginn des Lebenslaufs an zu „Konstitutionsbedingungen der Individualisierung“ und der Entwicklung persönlicher Autonomie werden.41 Persönliche Autonomie versteht Axel Honneth „(…) nicht als Gegensatz zu, sondern als bestimmte Organisationsform der kontingenten, jeder individuellen Kontrolle entzogenen Kräfte“ des Unbewussten und der Sprache.42
Seit den 1960