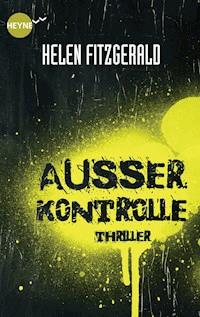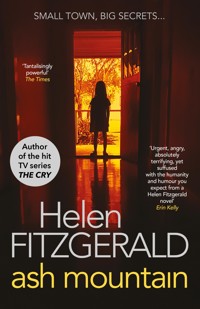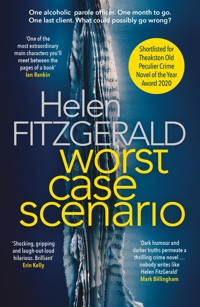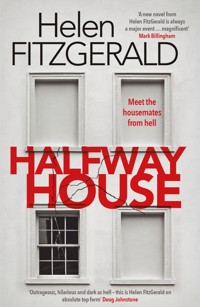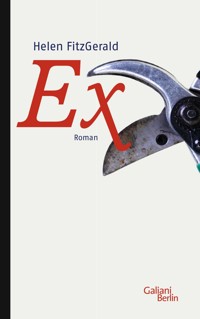9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Job im Knast ist keine Kaffeefahrt. Nach dem dramatischen Tod ihrer besten Freundin musste Krissie Donald erst einmal zur Ruhe kommen. Jetzt ist sie fest entschlossen, ihr Leben in den Griff zu kriegen: ein glückliches Familienleben mit Chas, ihrer großen Liebe, und mit ihrem kleinen Sohn Robbie, dazu eine neue Wohnung und ein neuer Job. In einer romantischen Anwandlung kauft Krissie sich sogar probehalber ein Brautkleid. Aber der neue Job bringt alles durcheinander. Als Sozialarbeiterin im Sandhill-Gefängnis soll Krissie anhand weniger Gespräche entscheiden, wer auf Bewährung freikommt und wer nicht. Einer ihrer ersten Klienten ist Jeremy Bagshaw: gutaussehend und sympathisch, von grausamen Mitgefangenen schikaniert, mit einer grauenvollen Kindheit, und vielleicht sogar unschuldig. Jeremy soll eine Frau brutal erstochen haben, aber Krissie kommen Zweifel. Sie lernt Amanda kennen, Jeremys Verlobte, und freundet sich mit ihr an. Es dauert nur ein paar Wochen, bis Krissie knietief in einer verzwickten Beziehungsgeschichte steckt und auf eigene Faust versucht, Jeremys Unschuld zu beweisen. Mit fatalen Folgen. Sie verstrickt sich in ein Netz aus Fehltritten, Lügen und Manipulation, das sie und die, die sie liebt, in Lebensgefahr bringt. Eine ganz spezielle Mischung aus schwarzem Humor und Herzenswärme, aus Coolness und Charme – Helen FitzGeralds Romane sind suchtauslösend.Nach ihrem Bestseller-Debüt Furchtbar lieb lässt Helen FitzGerald ihre liebenswerte und schrecklich inkonsequente Heldin wieder in einen Höllentrip hineinstolpern – und der Leser folgt ihr atemlos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Helen FitzGerald
Letzte Beichte
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Helen FitzGerald
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Helen FitzGerald
Helen FitzGerald wurde 1966 als zwölftes von dreizehn Kindern in Australien geboren und lebt seit 1991 in Schottland. Sie war Sozialarbeiterin im Strafvollzug und schrieb Drehbücher fürs Kinderfernsehen der BBC. »Letzte Beichte« ist ihr zweiter Roman, ihr dritter »Tod sei Dank« erschien dieses Frühjahr bei Galiani.
Steffen Jacobs, Jahrgang 1968, lebt als freier Übersetzer und Schriftsteller in Berlin. Er hat mehrere Gedicht-Essaybände veröffentlicht, z. B. »Der Lyrik-TÜV. Ein Jahrhundert deutscher Dichtung wird geprüft«, 2007. Er übersetzt Romane u. a. von Philip Larkin und Neil Jordan ins Deutsche.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als Sozialarbeiterin im Gefängnis soll Krissie entscheiden, wer auf Bewährung freikommt und wer nicht. Einer ihrer ersten Klienten ist Jeremy. Er soll eine Frau brutal erstochen haben, aber Krissie kommen Zweifel. Sie lernt Amanda kennen, Jeremys Verlobte, und freundet sich mit ihr an. Es dauert nicht lange, bis Krissie knietief in einer verzwickten Beziehungsgeschichte steckt und versucht, Jeremys Unschuld zu beweisen. Sie verstrickt sich dabei fatal in ein Netz aus Fehltritten, Lügen und Manipulation, das sie und die, die sie liebt, in Lebensgefahr bringt.
Nach ihrem Bestseller-Debüt »Furchtbar lieb« lässt Helen FitzGerald ihre liebenswerte und schrecklich inkonsequente Heldin wieder in einen Höllentrip hineinstolpern – und der Leser folgt ihr atemlos.
»Fein getunter Zynismus, der an beste anglophone Erzähltradition erinnert.« Süddeutsche Zeitung
Inhaltsverzeichnis
Förderung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
Die Arbeit an dieser Übersetzung wurde gefördert von der Kunststiftung NRW.
1
Tipps für Bewährungshelfer:
Schmuggeln Sie kein Heroin ins Gefängnis.
Trinken Sie keinen Wodka zum Stressabbau.
Geben Sie nie einem Kollegen einen Zungenkuss, um Ihren Freund eifersüchtig zu machen.
Schnupfen Sie kein Speed.
Verbringen Sie niemals mehr Zeit mit Mördern als mit Ihrem Sohn.
Laden Sie keine cracksüchtigen Klienten zu Ihrer Party ein.
Hätte man die Sache etwas besser vorbereitet, wäre der Tag meiner Hochzeit vielleicht der schönste Tag meines Lebens geworden. In meinem hautengen Nixenkleid mit dem blumenbestickten Oberteil hätte ich alle überstrahlt. Der kleine Robbie wäre in seinem Schottenrock samt Mini-Felltasche und Riesenlächeln vor mir herstolziert.
Mit seiner Fünfziger-Jahre-Haartolle hätte er ausgesehen wie ein Aufziehmännchen – in seiner Hemdtasche hätte ein batteriebetriebener Motor gesurrt. Er hätte unsere Freunde und Familienmitglieder mit Rosenblütenblättern beworfen und vielleicht sehr laut »Scheiße« gerufen, so wie ich es ihm versehentlich beigebracht hatte. Und Chas hätte den Schleier vor meinem Gesicht gelüftet, mich geküsst und zur glücklichsten aller Bräute gemacht.
Ich hätte zugesehen, wie Chas mit feuchten Augen einen Toast auf uns ausgebracht und eine Rede gehalten hätte. Stattdessen drückte mich jemand auf den Boden, und ich schlug im Dunkeln blindlings um mich, als wäre ich Clarice Starling in Das Schweigen der Lämmer.
Ich hätte mit Chas Walzer getanzt. Stattdessen musste ich zusehen, wie er aus dem Leben glitt, während ich schrie, jemand solle bitte einen Krankenwagen rufen … bitte …
Ich hätte Champagner geschlürft. Stattdessen schluchzte ich voller Schreck und Entsetzen.
Es war alles meine Schuld. Weil ich mich in den ersten Monaten in meinem neuen Job so dämlich angestellt und all die Sachen gemacht hatte, die ein Bewährungshelfer niemals machen sollte.
In den zwei Jahren, ehe ich Bewährungshelferin geworden war, hatte sich vieles in meinem Leben geändert. Ich hatte zu arbeiten aufgehört, um mich ganz meinem kleinen Robbie zu widmen. Ich war dabei gewesen, als er gelernt hatte, erst zu krabbeln, dann zu gehen, dann zu sprechen, dann meinen Freund Chas zu Boden zu werfen, bis die beiden vor Lachen nicht mehr konnten. Ich war Hals über Kopf in das Reich der Liebenden eingetaucht.
Jeden Morgen genehmigte ich mir eine Tasse Kaffee im Bett, während Chas neben mir noch einmal einschlief. Ich genoss unsere gemeinsamen Schaufensterbummel, wenn wir zu zweit den Kinderwagen schoben und an mäßig edlen Geschäften vorbeigingen. Ich wechselte mich mit Chas beim Anschubsen der Schaukel im Park ab, formte im Bad lustige Figuren aus Badeschaum, las Robbie Geschichten vor und lag neben ihm, wenn er einschlief.
Und Chas und ich berührten uns. Wir konnten überhaupt nicht mehr damit aufhören, uns zu berühren. Ich bekam einfach nicht genug von dem Menschen, den ich so viele Jahre auf Abstand gehalten hatte.
Anfangs lebten wir von der Unterstützung meiner Eltern. Als ich eines sonnigen Septembertages Hilfe gebraucht hatte, hatten sie alles Nötige aus meiner Wohnung in ihr Haus geschafft und mich so lange unter ihre Fittiche genommen, bis ich wieder auf die Beine gekommen war. Sie verordneten mir einen festen Tagesablauf, vernünftige Ernährung, Fitnesstraining und frische Luft. Sie hielten mich vom Trinken, von Unbesonnenheiten, Selbsthass und Vorwürfen ab. Mein Tagesablauf verschmolz mit dem von Robbie. Nach langem, ruhigem Nachtschlaf löffelte ich brav den Teller leer, den sie mir vorsetzten. Vormittags unternahm ich gemächliche Spaziergänge im Park. Mittags schlürfte ich ihre hausgemachten Suppen, nachmittags legte ich mich zu einem Nickerchen hin, abends brach ich zu einem zweiten Spaziergang auf. Ich aß ein ausgewogenes Abendessen, nahm ein Bad und ging ins Bett. Zuerst langweilte ich mich zu Tode. Kein Alkohol, keine Partys, Freunde, Kollegen, Sorgen, kein Tratsch. Nichts als die beruhigende Anwesenheit von Chas und meinen Eltern. Aber schon nach kurzer Zeit begann ich das, was ich früher Langeweile genannt hatte, neu zu definieren: Ich nannte es jetzt Entspannung und Gesundheit. Und mir wurde klar, dass all dies mich allmählich in ein glückliches und erfülltes Leben führte.
Anfangs kam Chas nur auf Besuch vorbei, dann blieb er gelegentlich über Nacht. Einige Jahre zuvor war er aus dem Gefängnis entlassen worden. Man hatte ihn verknackt, weil er einen Pädophilen angegriffen hatte, der zufälligerweise der Stiefvater meiner engsten Kindheitsfreundin Sarah war. Jahrelang hatte dieser Mann das Leben der ihm anvertrauten Kinder zerstört. Bei mir hatte er es fast geschafft, und bei Sarah hatte er durchschlagenden Erfolg gehabt. Ich fand es schrecklich, dass man Chas so schwer bestraft hatte.
Nach seiner vorzeitigen Entlassung wohnte Chas während der Bewährungszeit bei seinen Eltern in Edinburgh. Das waren piekfeine, todernste Menschen, die wollten, dass Chas sein Leben änderte und sich einen anständigen Beruf und eine andere Freundin suchte. Rebellisch wie er war, malte er weiter und fuhr so oft wie möglich zu mir.
Als Chas verkündete, dass seine Bewährungszeit abgelaufen sei und er folglich wohnen könne, wo er wolle, bat ich ihn, bei uns einzuziehen. Er gab seinen besorgten Eltern einen Abschiedskuss und stand mit zwei großen Koffern vor unserer Tür. Von da an machte sich Chas jeden Morgen auf den Weg zu dem Atelier, das er sich in den Räumen einer Bildhauergemeinschaft in Hillfoot gemietet hatte, und verbrachte den ganzen Tag damit, die Skizzen auszuarbeiten, die er auf der ganzen Welt gemacht hatte. Nach unserer Unizeit, als wir in einer WG gewohnt hatten, war er jahrelang gereist und hatte sich durch alle Breitengrade skizziert. Aber seit er zurückgekehrt war und wir ein Paar geworden waren, hatte er seine Skizzen immer vor mir versteckt. Sie seien eine Überraschung, sagte er. Er würde sie mir zeigen, sobald er eine Ausstellung habe.
Es dauerte einige Zeit, bis ich den Tod meiner besten Freundin Sarah akzeptieren konnte. Wenn ich an sie dachte, kam ihr Name immer nach den Worten »die arme«. Die arme Sarah hatte eine schreckliche Kindheit gehabt. Die arme Sarah hatte nicht schwanger werden können. Die arme Sarah war von ihrem Ehemann Kyle mit ihrer besten Freundin betrogen worden – mir.
Die arme Sarah hatte sich umgebracht.
Nachdem ich monatelang mit einem Gefühl der Übelkeit in der Magengegend aufgewacht war und das Gesicht der armen Sarah über meinem Bett geschwebt hatte, ging es mir allmählich besser. Ich fand, dass ich so ziemlich alles hatte, was eine junge Frau sich vom Leben erhoffen kann:
Einen hübschen, gesunden Dreijährigen, der sich zur Melodie der Teletubbies Lieder wie dieses ausdachte:
Mum und Daddy
Mum und Daddy
Essen rohes Mett
Mum und Daddy
Mum und Daddy
Sind seeeehr nett!
(Hab gesehn, wie sie sich geküsst haben … IGITT!)
Einen liebevollen Partner, der immer die Zeit und die Kraft hatte, mich zu unterstützen und zu trösten. Der wusste, wie man meine negativen Gedanken in positive verwandeln konnte und meine schlechte Laune in gute. Der immer die richtige Antwort fand, wenn ich ihn – manchmal mitten in der Nacht – fragte, ob alles gutgehen würde. »Ja, meine Kleine«, antwortete er dann. »Alles ist perfekt, weil ich dich mehr als alles auf der Welt liebe. Sogar mehr als Pizza.«
(Und Chas liebte Pizza wirklich sehr.)
Ich hatte wundervolle, großzügige Eltern, die mit ihren Wochenendausflügen pausierten und zwei ihrer kostbaren Zimmer an uns abgetreten hatten, damit ich auf die richtige Spur zurückfand.
Und ich hatte eine unheimlich gute Frisur. Jahrelang hatte ich mein Haar gewellt getragen und es meistens zu einem Pferdeschwanz gebunden, damit es mir nicht im Weg war. Doch eines Tages, als das schöne Bauchgefühl Oberhand über das üble Bauchgefühl gewann, entschied ich, dass es an der Zeit für einen Stufenschnitt sei. Ich rief Jenny an, die Friseurin der Stars (und meine), und sie schnitt sie mit Vergnügen stufig. Danach sah ich wie strahlende fünfunddreißig aus. Tagelang blieben alle stehen, um mir zu sagen, wie toll ich aussähe.
Die neue Frisur markierte das Ende einer alten Lebensphase und den Anfang einer neuen. Es wurde Zeit, dass ich wieder in meine eigene Wohnung zog. Es wurde Zeit, dass ich mir einen Job suchte. Ich war wieder bereit, da rauszugehen – ins richtige Leben.
Meine Eltern waren wohl auch bereit. Meine Mutter vermisste ihr Bastelzimmer, durch das jetzt Eisenbahnschienen aus Holz führten und in dem das Kinderbett stand. Und mein Vater vermisste das Gästezimmer, in dem Chas und ich schliefen und in das er sich früher immer geflüchtet hatte, wenn meine Mutter mitten in der Nacht Zappelfüße bekommen hatte.
Ich gab meinen Mietern einen Monat im Voraus Bescheid, und wir begannen, unsere Sachen zu packen und alles vorzubereiten, damit wir pünktlich zum Umzug unser Zeug aus der Lagerhalle holen konnten.
Da Chas’ Bewährungszeit vorüber war, beschloss ich, mich auf eine Stelle in der Strafjustiz zu bewerben. Das war etwas ganz anderes als die Arbeit im Kinderschutz, die ich so lange gemacht hatte und die dazu beigetragen hatte, dass ich zwei Jahre zuvor nichts als ein ausgebranntes Häuflein Asche gewesen war – irgendwie sicherer, weil ich nur den Anweisungen des Gerichts folgen würde. Ich würde niemandem die Kinder wegnehmen oder irgendwelche Anschuldigungen erheben. Ich wäre Teil des Strafrechtssystems und könnte mir deshalb sicher sein, dass meine Klienten mich nicht bedrohen, verprügeln oder abgrundtief hassen würden. Eine Freundin hatte auch mit Straftätern gearbeitet und gesagt, das sei viel familienfreundlicher als der Kinderschutz. Und ich muss zugeben, dass ich die Vorstellung, den ganzen Tag mit schweren Jungs zu reden, immer noch so aufregend wie als Teenager fand.
Eines Abends, nachdem Robbie eingeschlafen war, füllte ich einen Bewerbungsbogen für eine Stelle als »Sozialarbeiterin im Strafrecht« aus. Ich schrieb einen prachtvollen Begleitbrief, in dem stand, dass ich teamfähig sei, dass ich mir über die erforderliche Balance von Betreuung und Kontrolle im Klaren sei, dass ich über herausragende Fähigkeiten im Zeitmanagement verfüge – und der ganze andere Scheiß, den sie hören wollten.
Am nächsten Tag brachte ich die Bewerbung zur Post.
2
Als ich mich am Morgen des Vorstellungsgespräches anzog, wetteiferten dort, wo sich sonst mein Gehirn befand, Schuldgefühle, Selbsthass und Nervosität miteinander. War es die richtige Entscheidung gewesen, wieder arbeiten zu gehen? Oder hatte Zachs Mutti die bessere Wahl getroffen: Schatzmeisterin der Spielgruppe; Fahrdienst für vielversprechende Jungschwimmer, Turner, Baby-Yogis, Lied-Mitsinger und Ballfreunde; Köchin streng vorausgeplanter und streng beaufsichtigter Bio-Mahlzeiten (ohne Zusatzstoffe!); Mutter von Kindern, die wussten, wie man sich zu benehmen hat, und die ihr Alphabet und ihre Tastaturen kannten; Kämpferin gegen das Wort »bloß« als Vorsilbe von »Hausfrau«?
Oder hatte Marthas Mutti recht: Gelegenheitskifferin, die mit ihrer Kleinen herumkicherte und jeden Augenblick genoss, den sie mit ihr verbrachte, auch wenn sie manchmal vergaß, Abendessen zu machen? Andererseits, so argumentierte Marthas Mutti, würde die Kleine ja wohl nach etwas Essbarem fragen, wenn sie wirklich hungrig wäre, oder?
Oder war ich es, die recht hatte? Ja, genau: Ich! Die Frau, die in ihren Kleidern herumwühlt, dauernd »Verdammt« und »Scheiße« sagt, einen lauwarmen Lavazza hinunterstürzt und sich anschickt, Robbie in seinem warmen »Bob-der-Baumeister«-Schlafanzug zurückzulassen?
Als ich mich an diesem Morgen für mein Vorstellungsgespräch anzog, wusste ich, dass ich von allen drei Müttern diejenige war, die am wenigsten recht hatte.
Nachdem mir die Kraftausdrücke fürs Erste ausgegangen waren, zerrte ich meine alte Sozialarbeiterinnen-Montur aus dem Schrank (nicht zu förmlich à la »Ich bin hier die Vorgesetzte«, nicht zu leger à la »Mich könnt ihr ruhig schikanieren«) und gab meinem Sohn einen Abschiedskuss.
Wenn ich die Stelle bekam, wollte Chas den Robster mit ins Atelier nehmen. »Sei nicht so altmodisch, K«, hatte er gesagt. »Warum regst du dich auf? Ihm wird’s gutgehen!« Robbie würde einen Pinsel und ein paar alte Leinwände bekommen und seinen Spaß haben. Glaubte Chas. Zwei Jungs mit Farbe, die gemeinsam abhingen – was konnte da schon schiefgehen?
(Ha! Ich freute mich schon darauf, Chas diesen Erkenntnisgipfel erklimmen zu sehen.)
Chas und Robbie standen winkend in der Tür meines Elternhauses und strahlten mir hinterher, als ich die Straße hinabging und um die Ecke bog. Sobald ich verschwunden war, hörte ich in der Ferne, wie aus Robbies Gekicher ein Weinen wurde. Es war wie früher beim Stillen, als die Milch aus meinen Brüsten spritzte, sobald Robbie weinte – die Stärke der körperlichen Verbindung zwischen uns war erschreckend intensiv gewesen, aber auch wunderschön. Damals waren wir eins gewesen, und im Grunde waren wir es immer noch. Wenn auch keine Milch aus meinen Titten spritzte (Gott sei Dank, denn ich hatte ein hübsches schwarzes Hemd an), so berührte sein Weinen doch etwas in mir, das durch niemandes anderes Weinen jemals berührt werden konnte.
Ich rannte zu ihm zurück. Aber als ich bei ihm ankam, hatte Chas ihn schon abgelenkt, indem er ihn mit einer Papierlaterne aus dem Nachbargarten unterm Kinn kitzelte. Robbie schaute lachend hoch, und es war unübersehbar, dass er sich fragte, warum um alles in der Welt ich so schnell zurück sei. Also machte ich kurz mit bei der Kitzelei und gab Chas einen Kuss auf seine schönen, perfekten Malerhände (dieselben Hände, in die ich mich vor zwei Jahren auf dem Rücksitz eines Ford verliebt hatte).
Dann machte ich kehrt und lief zum Auto. Den ganzen Weg über erfüllte mich eine andere Art von Kummer: die Art, die an einen körperlichen Schmerz erinnert, weil man letztlich nicht einmal als Mutter unersetzbar ist.
Es schiffte, als ich an zwei Hochhäusern vorbeiging, die irgendjemand mitten ins Ödland geklatscht hatte. Der Wind pfiff zwischen ihnen hindurch, und sie schwankten. Ich sah hoch und fragte mich, wer da oben in zweiundzwanzig Stockwerken Höhe wohl alles mitschwankte, wessen fleckige Kaffeebecher auf dem Küchentisch erst nach links, dann nach rechts rutschten. Mir wurde schwindlig dabei, also blickte ich nach unten und konzentrierte mich aufs Gehen, was nicht leicht war, da der Wind mich vorwärts drückte, wie wenn er sagen wollte: Geh weg hier, geh weg.
Das Vorstellungsgespräch fand an meinem potenziellen neuen Arbeitsplatz in einer heruntergekommenen Gegend statt (wenn ich doch nur auf die Warnung des Windes gehört hätte) – will sagen: eine Gegend, die das Allerletzte ist; eine Gegend, in der die Fenster mit Brettern vernagelt sind und kein Kind auf den Spielplätzen spielt; eine Gegend, in der es mehr Wind als in anderen Gegenden gibt, selbst wenn die nur wenige Meter entfernt sind – mehr Wind und keine Straßennamen, keine Hausnummern, keine Zebrastreifen. Eine Gegend, in die man nicht einfach so geht, sondern nur mit einem Messer bewaffnet und der Bereitschaft, es zu benutzen. Mitten auf der Fahrbahn gingen Menschen, die offensichtlich fest entschlossen waren, sich der von Autos verkörperten Gewalt des Mammons nicht zu beugen. An den Ecken standen Grüppchen junger Männer, die mit Rauschgift dealten, sofern sie nicht gerade die Steakpasteten aus der nächstgelegenen Greggs-Filiale aßen.
Ich ging an ihnen vorbei und fragte mich, ob sie wohl merkten, dass gerade eine Außenseiterin vorbeispazierte. Jemand aus einer anderen Gegend. Einer Gegend, die nur zwei Meilen entfernt war. Einer Gegend, wo es Hausnummern, Lavazza und Hoffnung gab.
Das Vorstellungsgespräch lief nicht gut. Plötzlich wollte ich nur noch zu Hause bei Robbie sein, vor allem angesichts des trostlosen Zustands, in dem sich das Büro und seine Umgebung befanden. Trotzdem versuchte ich, den drei Leuten, die mich ausfragten, Enthusiasmus vorzuspielen, als ich da auf meinem wackeligen Stuhl inmitten eines großen, hässlichen und mit allerlei Krempel vollgestopften Raumes saß.
In meiner Ausbildung zur Sozialarbeiterin hatte ich viele wichtige Sachen lernen können – Risikoabschätzung, Antidiskriminierung, Krisenintervention und so weiter. Aber eine der wichtigsten Lektionen, die jeder, der diese Ausbildung durchlief, von Grund auf lernte und lebenslang nicht mehr vergaß, war die folgende Regel: Zieh dich so fürchterlich an, dass sich die Junkies in der Methadonklinik im Vergleich zu dir schick fühlen.
Die drei hier hatten es mit dieser Regel etwas zu weit getrieben. Stellen Sie sich den Stil und die Eleganz überzeugter Christen vor und vervierfachen Sie selbige, dann haben Sie die drei Sozialarbeiter, die mich damals befragten. Lobenswerter Mut zur Hässlichkeit, ohne Kompromisse, vom Scheitel bis zur Sohle. Samt fettigen Haaren, schlechten Zähnen und Klamotten, die entweder zu klein oder zu groß, aber jedenfalls spottbillig waren.
Als sie mich mit Fragen bombardierten, fiel mir wieder ein, warum es sich so gut angefühlt hatte, mit der Sozialarbeit aufzuhören: Sozialarbeiter sind extrem ernsthafte Menschen, und sie haben oft Mundgeruch.
Ich hatte die falsche Ausbildung, und ich bewarb mich auf die falsche Stelle. So dachte ich, als ich an meinem Handrücken leckte und daran roch.
(Oh je … Kaffeezunge. Vielleicht doch nicht.)
Die Fragen waren die gleichen wie bei meinem ersten Vorstellungsgespräch vor zehn Jahren. Ich beantwortete sie halbherzig, schwafelte ein bisschen herum und zitierte die passenden Stellen aus meiner Diplomarbeit, soweit ich mich daran erinnerte. Einmal versuchte ich, witzig zu sein. »Meine Schwächen?«, wiederholte ich. »Na ja, da wäre mein Perfektionismus, der kann schwierig sein. Und ich bin Workoholic, kann einfach nie genug Arbeit bekommen … das kann auch ein bisschen problematisch sein. Und dann wäre da noch meine Kokainabhängigkeit …«
Meine Chefin in spe, eine Frau irgendwo in den Vierzigern mit ausdruckslosem Gesicht und einer Stimme, so weich und therapeutisch, dass ich sie am liebsten erwürgt hätte, verzog keine Miene. Die beiden Männer, die sie links und rechts wie Buchstützen einrahmten, bissen sich immerhin auf die Lippen. Gott möge es ihnen vergelten.
Als ich das graue Gebäude verließ, dankte ich dem Herrn, dass ich die Sache so gründlich vermasselt hatte. Wer wollte schon an so einem Ort arbeiten? Wo sollte man hier eigentlich zum Mittagessen hingehen?
Aber als ich zu Hause ankam, hatten sie schon angerufen und mir die gute Nachricht hinterlassen: Ich war jetzt Sozialarbeiterin im Strafjustizsystem. Bewährungshelferin. Eine sautaffe, Klartext redende Gesetzesvertreterin, die den schweren Jungs zeigt, wo der Hammer hängt. So scheiße sexy war mein Job, dass ich in Amerika sogar eine Pistole und eine Uniform bekommen hätte.
Am nächsten Tag schenkte mir Chas eine Polizeiuniform und eine Spielzeugpistole, und er war unheimlich froh (wenn auch ein wenig gekränkt), wie schnell und problemlos ich meine sautaffe Ich-zeig-den-bösen-Buben-wo-der-Hammer-hängt-Attitüde gefunden hatte.
3
Meine Eltern freuten sich für uns. Wir begannen ein neues Leben miteinander, so wie sie vor siebenunddreißig Jahren. Einige Tage vor unserem Auszug saßen wir abends alle beisammen und schauten uns gemeinsam ihre Hochzeitsfotos an. Sie hatten auf Bali geheiratet, lange Zeit, ehe das in Mode gekommen war und Leute wie Mick Jagger und Jerry Hall dort den Bund fürs Leben schlossen (oder auch nicht). Nach der Trauung hatten sie mit vier Freunden bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, dann waren sie am Strand eingeschlafen.
»Wir waren unheimlich verliebt!«, sagte meine Mutter. Sie lächelte, denn sie waren immer noch verliebt, nach siebenunddreißig Ehejahren. Auf Partys sprachen sie sich nach wie vor am liebsten gegenseitig an, ehe sie sich den anderen zuwandten, und wenn sie in einem schicken Restaurant saßen, hatten sie sich immer noch was zu sagen.
»Chas ist ein Glückspilz«, sagte meine Mutter, und wir umarmten uns.
»Ich verdiene ihn nicht«, sagte ich. Da schob sie meinen Pony zur Seite – sie hatte eine seltsame Vorliebe für meine Stirn und meine Augenbrauen – und sagte mir, dass ich nicht genügend Selbstbewusstsein hätte und dass alle sich immer unbändig freuen würden, mich zu sehen. Sie sagte mir, dass meine Tanten und Onkel und Cousins an Weihnachten immer einsilbig am Tisch säßen, bis ich hereinkäme und Schwung in die Gespräche brächte. Ich würde Freude verbreiten, meinte sie. Ob mir nicht klar sei, dass Chas ohne mich völlig aufgeschmissen wäre? Verschlossen und traurig?
»Sei zur Abwechslung mal ein bisschen vernünftig!«, sagte sie. »Aber ansonsten bleib genau so, wie du bist. Und glaub mir, du verdienst ihn.«
Ich ging als ein Mensch, der sich selbst liebt, zu Bett. Aber mir war auch klar, dass meine Eltern ein Händchen dafür hatten, Fröhlichkeit zu verbreiten. Mit allem, was sie taten und sagten, verbreiteten sie Fröhlichkeit. Das war mein glückliches Erbe.
Als wir unseren ganzen Kram endlich ins Auto verfrachtet hatten, regnete es. Ich umarmte meine Mutter, dann meinen Vater, und uns allen standen Tränen in den Augen. Den ganzen Weg ins West End liefen die Scheibenwischer, und dann mussten wir viel zu weit von meiner Wohnung entfernt parken. Und obwohl die Parkerei mühselig war, fühlte es sich doch großartig an, wieder in einer Gegend zu sein, deren Bewohner sich in Hautfarbe und Lebensart unterschieden. Ich hüpfte mit Chas und Robbie das Treppenhaus hoch und sehnte mich nach meinem Bad, meinen Gewürzen, unserem Zuhause.
Wir verbrachten den ersten Tag damit, Schränke, Fenster und Klos kleinkindsicher zu machen, und wir rannten Robbie hinterher, als der weitere Sachen ausfindig machte, die kleinkindsicher gemacht werden mussten.
Abends, nachdem ich ihn ins Bett gebracht hatte und in die Küche gegangen war, saß Chas dort mit eisgekühltem Champagner und einem schön verpackten Geschenk.
»Auf unser neues Leben zu dritt!« sagte er, ließ den Korken knallen und schenkte Schampus ein.
Ich nahm einen Schluck und öffnete das Geschenk mit all den schmalzigen Erwartungen einer verknallten Jungvermählten. Das Papier glänzte rosa, und dasselbe galt für den darin eingewickelten Hasenvibrator.
»Chas!«, sagte ich und betrachtete den Pimmel mit Gummiohren.
»Mit Orgasmus-Garantie!«, sagte er.
Ach Gott, nicht das schon wieder.
Ich hatte nie einen gehabt. Einen Orgasmus, meine ich. Trotz zweiundzwanzig Sexualpartnern (oder dreiundzwanzig, je nach Definition) hatte ich nie einen gehabt. Ich hatte nie auch nur zugegeben, dass ich keinen gehabt hatte, bis ich das erste Mal mit Chas geschlafen hatte.
Das war im Haus meiner Eltern gewesen, im damaligen Hobbyraum. Robbie schlief im Bastelzimmer, und meine Eltern sahen fern. Chas hatte sehr viel Geduld mit mir gehabt, aber sosehr er es auch zu schätzen wusste, dass man seine Hände liebkoste, war er doch unheimlich geil. Dass ich an seinen Fingern nuckelte und seinen Pimmel kraulte, würde ihn auf Dauer nicht befriedigen.
Gekuschelt et cetera hatten wir da schon nächtelang, aber diesmal wusste ich, dass die Zeit reif sei. Als wir fertig waren, seufzte ich glücklich, denn es war der beste Sex gewesen, den ich je gehabt hatte.
»Das war der beste Sex, den ich je gehabt habe«, sagte ich.
»Wirklich?«, fragte er.
»Ja«. Ich fühlte mich, als ob man mich angegriffen hätte. »Warum?«
»Na ja, weil du nicht …«, sagte er.
»Was?«
»Du weißt schon, du bist nicht gekommen.«
»Aber sicher bin ich das.«
»Krissie …«
»Aber sicher bin ich das!«, schrie ich, sprang eingeschnappt aus dem Bett und stolzierte ins Bad. Wie konnte er es wagen, mich des Nichtkommens zu bezichtigen? Natürlich war ich gekommen. Ich war dreiunddreißig, und ich war in mehr als zwei Jahrzehnten nicht so umfassend und grundlegend gekommen.
Unbeholfen stand er hinter mir im Badezimmer. Ich wusch mir die Hände und wollte aus dem Bad gehen, aber er versperrte mir mit den Armen die Tür. Es gab ein Gerangel. Ich versuchte, unter einem seiner Arme durchzukommen, zwischen seinen Beinen und so weiter, aber es half nichts.
Es endete damit, dass ich auf dem Boden lag und weinte. »Ich glaube, ich hatte noch nie einen«, sagte ich und verbarg mein Gesicht peinlich berührt mit den Händen.
Ich war mir nicht sicher. Ich war mir auch nicht sicher gewesen, ob ich je verliebt gewesen war, ehe ich mich ohne jeden Zweifel in Chas verliebt hatte. Es hatte Zeiten gegeben, da hatte ich einen Mann so sehr vermisst, dass es wehtat. Hätte Liebe sein können. Zeiten, in denen ich tagelang nichts gegessen hatte, nachdem Schluss gewesen war. Vielleicht Liebe. Auch hatte ich sexuelle Erlebnisse gehabt, nach denen ich tagelang gelächelt hatte. Und eines, das mich zum Weinen gebracht hatte. Natürlich hatte ich regelmäßig laute, animalische Geräusche ausgestoßen. Aber Chas hatte auf eine Meile Entfernung spitzgekriegt, dass meine Geräusche niemals laut oder animalisch genug gewesen waren, um die Selbstvergessenheit einer werwolfartigen Transformation zu bezeugen. Und das sei es, was ich anstreben solle, erklärte er: Selbstvergessenheit – mit weiß flackernden Augen und einem mit aller Pein einer Besessenen aufgerissenen und verzerrten Mund.
Klang schrecklich, fand ich, aber Chas hatte immer recht, wusste es immer am besten. Und deshalb machte es mir nichts aus, als er mir an besagtem Samstag den Hasen schenkte, am Sonntag dann das spezielle Gel, am Montag die vibrierenden Kugeln, vier Nächte in Folge ein Nichts mit Spitze aus dem Anne-Summers-Sortiment, und während der folgenden zwei Wochen weitere Lustknochen. Wir waren im Kampfeinsatz, und unser Auftrag lautete: meinen Orgasmus zu finden!
Anfangs legten wir den Hasen geraume Zeit, nachdem Robbie eingeschlafen war, auf den Couchtisch, um uns an ihn zu gewöhnen. Ich fand das riesige Gummiteil ziemlich furchteinflößend, aber dann lag es für mindestens zwei Big-Brother-Rausschmisse auf dem Couchtisch und summte uns des Öfteren wie ein Dalek an (Sie wissen schon: die Außerirdischen aus Doctor Who). Folglich war ich zu dem Zeitpunkt, als Chas das Häschen und seine Entourage ins Schlafzimmer mitnahm, nicht mehr allzu verängstigt.
Er dachte sich weitere Übungen aus. Fünf Tage nichts als Anfassen ohne Penetration. Frauenpornos, also ohne derbes Brustwarzenzupfen und zu viel mechanisches Gerammle. Duschaufsätze und ausgedehnte Zeitspannen allein, »zum Üben«.
Ich würde liebend gern sagen, dass ich meinen Gummifreund letztlich nicht gebraucht hätte. Dass alles, was ich gebraucht hätte, eine neue, unbefangene Geisteshaltung gewesen sei und die Liebe und Geduld eines Mannes, der nach allen guten Dingen der Welt roch (Toast, frisch gemähter Rasen, der Rauch eines prasselnden Lagerfeuers). Aber das kann ich nicht, denn Chas war in seinem Atelier und malte, und ich war allein und drückte fest auf die Hasenohren – und dann verwandelte ich mich plötzlich in den furchteinflößendsten, grimmigsten Werwolf im ganzen Hochmoor.
Ich war fünfunddreißig, und endlich wusste ich Bescheid.
4
Einige Tage später bereiteten sich Chas und Robbie auf ihren ersten gemeinsamen Tag im Bildhaueratelier vor. Robbie brauchte viele Sachen, um für seine neue Aufgabe als offizieller Malerassistent gerüstet zu sein. Pinsel? Haben wir. Großes altes T-Shirt? Haben wir. Absurd große Baskenmütze? Haben wir. Als Robbie endlich seine »Arbeitskluft« anhatte, waren nur noch sein winziges Kinn und sein kleiner weißer Hals wirklich sichtbar. Nachdem wir uns an der Wohnungstür kichernd einen Abschiedskuss gegeben hatten, trennten sich unsere Wege. Ehe ich zum Auto ging, sah ich zu, wie die beiden Hand in Hand glückselig die Gardner Street hochmarschierten.
Ich brauchte fünfundzwanzig Minuten bis zur Arbeit, dann noch einmal fünfundzwanzig, um zu parken. Der Parkplatz war mit den billigen Autos der Gemeindeangestellten vollgestellt. Die Behörde war in einer ehemaligen Textilienfabrik untergebracht, und irgendwelche Architekten hatten es geschafft, daraus etwas zu machen, das sogar noch deprimierender als eine Fabrik wirkte.
Ich schlug mich zum Empfangsbereich durch. Als ich am Tresen stand, grübelte ich, wie ich Blickkontakt mit der Person, deren Nase zwanzig Zentimeter von meiner eigenen entfernt war, herstellen sollte. Husten? Mit den Fingernägeln auf den Tresen trommeln? Sprechen?
»Hallo, ich bin Krissie Donald«, sagte ich in der Annahme, dass diese Information ausreichen würde, um eine Antwort hervorzulocken. Sie bewirkte nicht einmal Blickkontakt.
»In Hilary Sweeneys Team«, sagte ich. »Strafjustiz.«
»Hat uns niemand gesagt«, sagte die Dame, deren Anwesenheit offenbar das Resultat einer Richtlinie zur Beschäftigung Ortsansässiger war.
Nachdem ich mein schönstes falsches Lächeln aufgesetzt hatte, öffnete sie widerwillig die Klappe, die erregte Klienten von erregten Schreibkräften trennte, und geleitete mich durch den unordentlichen Verwaltungsbereich zur Hintertür und zwei Stockwerke hoch in einen kleinen, mit vier Schreibtischen vollgestellten Büroraum.
»Setzen Sie sich an den hier«, sagte sie, ehe sie ging.
Ich hatte eine halbe Stunde lang an dem leeren Schreibtisch gesessen, ehe nacheinander drei Leute in den Raum schlenderten.
»Ich glaub’s nicht«, sagte der Erste, »sie haben endlich die Stelle besetzt!« Er war fünfundvierzig, über einsneunzig groß, hatte – wie ich bald erfahren sollte – drei Studienabschlüsse und trat in seiner Freizeit als Stand-up-Comedian auf. Der größte Teil seiner Freizeit schien sich im Büro abzuspielen.
»Ich bin Robert«, fügte er hinzu, ehe er mir einen Witz erzählte, der alle Fragen über den Grad an politischer Korrektheit an meinem Arbeitsplatz beantwortete (niedrig).
»Bist du verrückt? Du musst total verrückt sein, wenn du hier arbeitest«, sagte Danny, der Zweite, ein umwerfend gutaussehender Typ mit getönten Brillengläsern und hochglanzpolierten Schuhen. »Dein Oberteil übrigens auch«, sagte er, als er sich an den Schreibtisch mir gegenüber setzte und seinen Computer anschaltete.
»Danke«, sagte ich.
Der Computer begann mit ihm zu sprechen, und er zog einen Gegenstand in Tamponform hervor und begann daran zu saugen. »Windows läuft«, sagte der Computer. »Outlook geöffnet … E-Mail-Eingang … Sie haben fünf neue Nachrichten …«
»Ist es neu?«, fragte er mich.
»Bitte?«, fragte ich. Der sprechende Computer hatte mich von unserer Plauderei abgelenkt.
»Dein Oberteil?«
»Nein«, erwiderte ich, während Über-einsneunzig-Robert mir eine Psst-Geste zukommen ließ. Dann schlich er sich hinter Danny und legte irgendein Gerät unter dessen Telefonhörer. Danny, der davon nichts mitbekommen hatte, sog erneut an seinem Nikotin-Inhalator und nahm den Hörer ab, der daraufhin so laut explodierte, dass ich augenblicklich Dankbarkeit für den Menschen empfand, der die Slipeinlage erfunden hat.
Einen Moment lang herrschte Stille, dann griff Danny nach einem Stock unter seinem Schreibtisch und wedelte damit hinter sich herum, bis er Roberts Knie getroffen hatte.
Jetzt erst wurde mir klar, dass Danny vollkommen blind war.
Danach konnte ich meinen Blick kaum noch von ihm wenden. Wie er tippte, Brailleschrift las, Nummern in seinen winzigen elektronischen Terminkalender tippte, ans Telefon ging und sprach.
»Er ist also zu krank, um herzukommen, Mrs. Thom?«, sagte er zu der Mutter seines säumigen Neunuhrtermins. »Heißt das, dass er stirbt? Verblutet? Dass ihm jemand den Kehlkopf zerschossen hat?« (Eine gedämpfte Antwort.) »Nein? Dann holen Sie ihn bitte an den Apparat.« (Mehr Gemurmel.) »Na, dann wecken Sie ihn halt!«
Danny wartete.
»Peter, letzte Woche habe ich Sie zum zweiten Mal förmlich verwarnt, weil Sie am Empfang aggressive und rassistische …«
Noch eine Pause.
»PETER! Es ist irrelevant, ob Ihre Sozialarbeiter von Asylanten verheizt werden oder nicht. Tatsache ist, dass Sie geliefert sind. Sie wandern wieder in den Bau.«
Sprach’s und legte den Hörer auf. Mein neuer blinder Held sog noch einmal am Nikotininhalator und setzte unser Gespräch fort.
»Ist hübsch, das Oberteil, aber es passt nicht zu deiner Hose.«
Mein dritter Kollege war eine Kollegin: groß, ernst und über fünfzig, mit einem Oberschichtakzent, der einen Beiklang von ›Ich mache den Job aus Nächstenliebe‹ hatte. Sie hieß Penny und war ungeheuer beschäftigt mit ihrem Papierkram. Ihr Gesicht war ganz rot und verschwitzt vor lauter Anstrengung.
Hilary, die Chefin, war eine der drei Personen, die mich bei meinem Vorstellungsgespräch interviewt hatten. Während ihre männlichen Vorgesetzten wenigstens ein Lächeln unterdrücken mussten, als ich meine unpassenden Witzchen riss, hatte sie keine derartigen Schwierigkeiten gehabt. Ihr Lächeln blieb den Klienten vorbehalten. Und es bedeutete keineswegs Heiterkeit.
Nach einem ziemlich entspannten Vormittag mit meinen drei Kollegen rief mich Hilary in ihr Büro, das direkt gegenüber unserem lag. Meine erste Kontrollsitzung stand an, und sie drehte sich größtenteils um die Terminfindung für zukünftige Kontrollsitzungen. Nachdem wir zwölf weitere Treffen im Zweiwochentakt vereinbart hatten, sprach Hilary eine geschlagene Stunde lang ohne Punkt und Komma. Sie genoss den Klang ihrer Stimme so sehr, dass ihr Mund vor Freude Schaumbläschen bildete.
»Transparenz ist von größter Wichtigkeit«, sagte sie, »für unsere nachhaltige Form der Fürsorge, bei der wir kompetente Überwachung mit einem therapeutischen Ansatz kombinieren, welcher die mannigfaltigen im Kontext der Rückfallgefahr auftretenden Probleme aufgreift und zu beheben trachtet.«
Ich nickte in angemessenen Abständen und gab mir größte Mühe zu verstehen, worüber sie da um Himmelswillen eigentlich sprach, und ich dankte dem Herrn, als sie mir zwei gerichtliche Gutachtenanfragen aushändigte und mich aus ihren Fängen entließ.
Im Büro befestigte Robert Bonbonpapier an Dannys »Mauer der Scham«, und Penny verschob schnaufend und keuchend dicke Papierstöße auf ihrem Schreibtisch.
Ich setzte mich an meinen wackeligen Schreibtisch und sah mir die erste Gutachtenanfrage an: einen Bericht über den familiären Hintergrund von Jason Marney. Obendrauf klebte ein Haftzettel: »Überfällig! Fallbespr. Sandhill, 16 Uhr.« Jason Marney war ein neununddreißigjähriger Witwer und hatte wegen anstößiger und triebhafter Handlungen an seinen Kindern zwölf Monate hinter Gittern verbracht. Scheiße, ein Sexualtäter. Ich hatte gehofft, diesen Typen aus dem Weg gehen zu können. Er hatte vier Straftaten begangen – zwei sittenwidrige Entblößungen vor zehn und acht Jahren, eine sittenwidrige Tätlichkeit in einem Schwimmbad vor zwei Jahren und die besagten anst. und triebhftn. Hdlgen. Laut Anklageschrift hatte er seine damals vier und sechs Jahre alten Jungen dazu gezwungen, Hardcore-Pornos mit ihm anzusehen und seine Genitalien anzufassen. Kotzwürg. Ernsthaftes, schwerwiegendes Kotzwürg, bei dem sich mir der Magen umdrehte. Immerhin, so tröstete ich mich, war es ein einfaches Gutachten. Mr. Marney hatte angegeben, nach seiner Entlassung bei seinen Eltern in Toryglen wohnen zu wollen. Ich musste lediglich überprüfen, ob die Unterbringung sicher und angemessen war. Dann musste ich Hilary anflehen, mich nach seiner Entlassung nicht als seine Aufsichtsbeamtin einzusetzen. Zeitlich war es zwar ziemlich knapp, aber wahrscheinlich konnte ich seinen Eltern noch vor der Fallbesprechung um 16 Uhr einen Besuch abstatten.
Die zweite Gutachtenanfrage bezog sich auf einen Voruntersuchungsbericht für Jeremy Bagshaw.
Ich ahnte es damals nicht, aber dies war der Fall, der mein Leben beinahe zerstören würde.
5
Jeremy hatte den größten Teil der letzten zwei Wochen mit dem Versuch verbracht, nicht zu weinen. Weinen ging in Sandhill gar nicht. Weinen war das Gegenteil von allem, was ging: Harte Burschen wittern deine Schwäche und machen sich an dich heran, Wärter lachen dich aus, und was das Schlimmste von allem ist: Andere Heulsusen glauben, dass sie einen Leidensgefährten gefunden haben, und suchen deine Nähe.
»Ich weiß, wie du dich fühlst«, hatte ihm ein ausgemergelter Typ mit narbigem Gesicht am Tag zuvor gesagt.
Er hatte sich umgeschaut und gedacht: »Nein, tust du nicht.«
Während der gesamten zwei Wochen hatte er täglich dreiundzwanzig Stunden lang allein in seiner Zelle gesessen. Die restliche Stunde hatte er damit verbracht, auf Zementboden im Kreis zu gehen und sich zu fragen, warum er seine Zelle überhaupt verlassen hatte – angesichts des Regens, der gehässigen Blicke der Aufseher und des allzeit drohenden Todes durch die harten Burschen, die wie Piranhas im Innenhof zirkulierten.
Er hatte Gefängnisse wie Sandhill im Fernsehen gesehen, aber er hatte nicht gedacht, dass sie so schlimm seien – fünf Hallen aus Stein, jede ein höhlenartiges Rechteck, drei Stockwerke hoch, mit verschlossenen Stahltüren: Backstein und Stahl, alles so hart und kalt wie die Wärter, die auf den Treppenabsätzen Posten standen.
In seiner Zelle befanden sich ein Etagenbett, ein Tisch, ein Fernseher, ein Junkie (es waren immer Junkies) und eine Toilette. Jeremy war dankbar für die Toilette, nachdem er erfahren hatte, dass er nur zwei Jahre zuvor an ihrer Stelle einen dampfenden Eimer voll Scheiße vorgefunden hätte.
Dreiundzwanzig Stunden am Tag starrte Jeremy entweder auf den Fernseher oder auf die Unterseite der oberen Pritsche und dachte an Amanda.
Amanda, deren schottischer Akzent ihn erst von einem Ende des »Stoke and Ferret« ans andere, dann von einem Ende des Landes ans andere gelockt hatte. Sie hatte dagesessen und billigen Cider getrunken, als er ihr zum ersten Mal begegnet war, und als der Abend zu Ende ging, tanzte sie in Kensington Gardens und sang »Blume von Schottland«. Mehr laut als schön.
»Ich habe Schokolade zu Hause«, hatte Amanda gesagt und sich neben Jeremy ins Gras fallenlassen.
»Dann müssen wir sie holen gehen«, hatte er geantwortet. Er war aufgestanden und hatte sie zu sich hochgezogen.
Die Frühstückspension, in der sie wohnte, war ein kleines, schäbiges Haus, umrahmt von zwei großen Hotels. Amanda schloss die Eingangstür auf und führte Jeremy durch die Diele in die Küche, wo sie die Schränke durchstöberte. Es gab gebackene Bohnen, Dosentomaten und Brot, aber Schokolade gab es nicht.
»Du hast mich mit falschen Behauptungen hergelockt«, sagte Jeremy.
»Stimmt«, erwiderte sie, drückte ihn gegen den Kühlschrank und küsste ihn heftig.
Später in dieser Nacht schlief Jeremy an ihrer Seite ein. Und als sie am frühen Morgen aufwachten, stellten sie überrascht fest, dass sie sich nüchtern sogar noch attraktiver fanden. Sie waren auch überrascht, dass sie nackt waren, und Jeremy wunderte sich, dass eine Frau Mitte zwanzig sie von einem Bett unter dem Fenster aus anstarrte.
»Hallo«, flüsterte Jeremy und schaute Amanda in die Augen.
»Hallo«, antwortete Amanda.
»Ich habe noch nie jemanden wie dich getroffen«, sagte Jeremy.
»Was heißt das?«
»Das heißt, dass ich noch nie jemanden wie dich getroffen habe. Sag meinen Namen.«
»Wie heißt du noch mal?«
»Jeremy.«
Sie gehorchte: »Jeremy.«
»Sag ihn noch mal.«
»Jeremy« sagte sie, dann weicher: »… Jeremy.«
»Jeremy und Amanda …« – er legte eine Pause ein – »… werden beobachtet.«
Die Katzenaugen der Mitbewohnerin glänzten in schamlosem Voyeurismus.
»Komm, wir gehen Schokolade holen!«, sagte Amanda.
Sie zogen sich an und legten vier Blocks auf der Suche nach Lion-Riegeln und Crunchies zurück. Schließlich kamen sie zu einem Supermarkt, der rund um die Uhr geöffnet hatte, und wie durch Zauberei hatte er Lion-Riegel, Crunchies und sieben verschiedene Sorten Kondome.