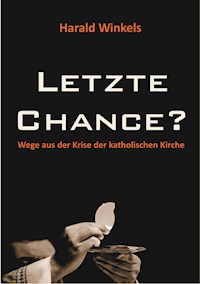
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die katholische Kirche befindet sich in einer tiefen Krise. Sexueller Missbrauch, Reformstau, fehlender Mut und festgefahrene Strukturen verhindern die dringend notwendigen Veränderungen. Der Autor sucht nach Wegen aus diesem Dilemma, erörtert Auswege und gibt Lösungsansätze.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ein großes Dankeschön an all die Menschen, die mich bei der Umsetzung dieses Buches unterstützt haben. Danke für Eure Anregungen, den Ideenaustausch und die Kritik.
Mein besonderer Dank gilt meiner Frau Nicola und der guten Freundin Sonja Pfeiffer, die sich die Mühe gemacht haben, das Buch im Vorfeld zu lesen, um mich auf den ein oder anderen Fehler - sei es inhaltlicher, logischer oder orthografischer Art - hinzuweisen.
Harald Winkels
Letzte Chance?
Wege aus der Krise der katholischen Kirche
Copyright © 2022 Harald Winkels, Mönchengladbach
Umschlaggestaltung: Harald Winkels
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN Print Softcover:
978-3-347-58402-0
ISBN Print Hardcover:
978-3-347-58403-7
ISBN E-Book:
978-3-347-58404-4
Auch als Hörbuch erhältlich unter: [email protected]
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor Harald Winkels verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“,
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
Inhalt
1. Meine Erfahrungen in der katholischen Kirche
2. Die Evangelien und ihre Interpretation
3. Ist die Aussage Christi noch zeitgemäß?
4. Kirche versus Glaube
5. Die Kirche als moralische Instanz
6. Die hierarchische Struktur der Kirche
7. Das Weiheamt und die Position der Kleriker
8. Der Priestermangel in Deutschland
9. Die Stellung und Bedeutung der Eucharistie
10. Die Widersprüche der kirchlichen Lehre
11. Das Rechtsverständnis der katholischen Kirche
12. Die Entfremdung der Kirche von den Laien
13. Das Ehrenamt in der katholischen Kirche
14. Die Angst vor der Veränderung
15. Die verpasste Chance des Konzils?
16. Brauchen wir ein neues Konzil?
17. Die Aufgaben der katholischen Kirche in der Zukunft
18. Summa summarum
1. Meine Entwicklung und Erfahrungen in der katholischen Kirche
An einem kalten Wintertag im Jahre 1963 wurde ich in der damals noch von Mönchengladbach getrennten Stadt Rheydt geboren. Wie es vor über 50 Jahren noch üblich war, wurde ich wenige Tage später, am 2. Weihnachtstag, also dem Festtag des heiligen Stephanus, in meinem Geburtskrankenhaus getauft.
Meine Familie war eine christlich geprägte, aber sicherlich nicht tiefgläubige Familie. Zu Tisch wurde nicht gebetet, höchstens abends vor dem zu Bett gehen. An Sonn- und Feiertagen ging man in die Kirche, jedoch eher aus Gewohnheit und den gesellschaftlichen Regeln der damaligen Zeit heraus; weniger aus tiefer Gläubigkeit. Mütterlicherseits war es in meiner Familie jedoch Tradition, dass man Ministrant und Pfadfinder wurde. So war es nicht verwunderlich, dass auch ich – genau wie mein zwei Jahre älterer Bruder – nach der Kinderkommunion im Jahre 1972 in die Messdienerschaft und den DPSG-Stamm, der deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, unserer Heimatpfarre eintrat. Für mich als jungen heranwachsenden Menschen war die Gemeinschaft der beiden Jugendgruppen extrem prägend und vor allem der Ministrantendienst und die Arbeit in der Messdienerschaft waren für meine Entwicklung zum überzeugten Christen von großer Bedeutung.
Die Erfahrungen als Jugendlicher innerhalb der Gruppen, mit Gruppenleitern, Verantwortlichen und Angehörigen des klerikalen Standes waren durchweg positiv und sexueller Missbrauch oder ähnliche Übergriffe waren mir völlig unbekannt und auch nicht im Ansatz erkennbar. Als Jugendlicher und späterer Gruppenleiter erhielt ich von den Pfarrverantwortlichen, Pfarrern und Kaplänen Respekt und eine Anerkennung auf Augenhöhe. Meine Entwicklung vom kleinen Ministranten zum selbstbewussten überzeugten Christen hätte somit nicht besser verlaufen können.
Mitte der 1980er Jahre beendete ich meine Schullaufbahn mit dem Abitur und mit dem Einstieg ins Berufsleben endete auch meine aktive Zeit als Ministrant. Mein ehrenamtliches Engagement innerhalb der katholischen Kirche ging jedoch mit der Übernahme anderer pfarrlicher Aufgaben (z.B. in Laiengremien) unbeirrt und überzeugt weiter.
Dies ist bis zum heutigen Tage so geblieben. Mit tief greifendem Enthusiasmus habe ich mich in verschiedenen Gemeinden in unserer Stadt ehrenamtlich und aktiv mit meinen Fähigkeiten eingebracht. Dabei reichte mein Engagement von der Mitgliedschaft in Chören über diverse Gruppierungen und Ausschüsse bis hin zu mitverantwortlichen Gremien. Auch auf diözesaner Ebene erstreckte sich zeitweise diese ehrenamtliche Arbeit.
Alles in allem würde ich mich als überzeugten Christen und gläubigen Menschen bezeichnen. Der Glaube an Gott und an Jesus Christus ist ein essenzieller Bestandteil meines alltäglichen Lebens, der mich in guten wie schweren Zeiten getragen hat und immer noch trägt.
Innerhalb meines Alltags macht sich diese christliche Überzeugung vor allem im Respekt, der Toleranz und der Ehrlichkeit anderen Menschen gegenüber bemerkbar. Dabei liegt mir eine Bekehrung oder Belehrung meiner Mitmenschen fern und ich hege nicht die Absicht, diese Menschen von meiner Glaubensauffassung zu überzeugen. Ein solches Verhalten wäre für mich ein Widerspruch zur Nächstenliebe, denn Nächstenliebe definiert sich für mich als Beziehung zu einem Menschen. Die Zugehörigkeit zu einer Religion oder Konfession, zu einer Nation, einer Rasse, zu einem Geschlecht oder zu einer sexuellen Neigung spielen hierbei keine Rolle. Im Mittelpunkt steht für mich der Mensch, egal ob gläubiger Christ oder überzeugter Atheist. Ein Mensch, der an Gott glaubt, ist nicht besser als ein Andersgläubiger oder ungläubiger Mensch. Folglich erhebt mein Glaube an einen lebendigen Gott mich nicht in eine besondere Position. Ein Leben als Christ ist kein Privileg, kein herausragendes Merkmal. Das „Christ-sein“ macht einen Menschen nicht zu etwas Besonderem. Vielmehr ist es eine Aufgabe, die uns Christus aufgetragen hat. Christ zu sein hat somit nur bedingt mit der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zu tun. Ein guter Christ kann man auch dann sein, wenn man nicht der christlichen Religion angehört, aber die Grundaussagen Christi verstanden hat und danach lebt. Und das ist in erster Linie die Liebe zu den Menschen - zu allen Menschen. Die Lehre Christi ist folglich keine komplexe theologische Wissenschaft, sondern eine simple und leicht verständliche - wenn auch sicherlich nicht ganz einfach umzusetzende - Aufgabe, die jeder verstehen kann. „Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.“1
Aber schafft es die katholische Kirche in der heutigen Zeit noch, eine solche Offenheit zu den Menschen innerhalb oder außerhalb ihrer Religionsgemeinschaft an den Tag zu legen? Hat sie noch Verständnis für die Lebens- und Denkweise derer, die nicht ins klassische Klischeebild eines Christen passen und die nicht aktiv am Gemeindeleben teilnehmen und brav jedes Wochenende die sonntägliche Messfeier besuchen? Leider habe ich im Laufe meines Lebens immer wieder erfahren müssen, dass die kirchlichen Gemeinschaften sehr nach innen gekehrt sind. Schnell wird sich nach außen abgegrenzt. Verständnis wird zu vorderst denen entgegengebracht, die sich an die kirchlichen Regeln, Gepflogenheiten, Traditionen und Hierarchien halten. Anderen Lebens- und Denkweisen wird oft - zu oft - mit Unverständnis und fehlender Toleranz entgegengetreten. Gelingt in wenigen Fällen doch zumindest noch ein Dialog, endet dies nicht selten in theologischer Belehrung. Wir sind die Guten, die den richtigen Weg gehen; die anderen diejenigen, die die falsche Richtung eingeschlagen haben.
Dies wird paradoxerweise vor allem in der Feier der Eucharistie deutlich. Verstärkt durch die dicken Mauern der Kirchengebäude hat sich über die Jahrhunderte eine Zeremonie herausgebildet, in der genau definiert ist, wer auf welcher Stufe steht und wer nicht dazugehört. Wer ausgegrenzt wird, der darf Christus in der Gestalt von Brot und Wein nicht erfahren. Das gilt für Menschen anderer Konfessionen und Religionen ebenso wie für wiederverheiratete Geschiedene oder für Homosexuelle. Sie alle dürfen an der Kommunion nicht teilnehmen. Die Institution Kirche stellt sich zwischen Mensch und Christus in der Verweigerung der konsekrierten2 Hostie. Sie entscheidet, wer Christus erfahren darf und wer nicht. Welches Recht nimmt sich die Kirche hier heraus? Hat Christus nicht genau die gesucht, die als Außenseiter gelten? Die Entscheidung, ob Mensch und Christus sich suchen und zueinander finden, obliegt nicht der Kirche. Sie verwehrt durch diesen Schritt Suchenden den Zugang zu Christus. Ein Punkt, an dem die Kirche zweifelsohne ihre Kompetenz überschreitet. Da beruhigt es, dass Christus sicherlich andere Wege finden wird.
Mir ist bewusst, dass jetzt so mancher Theologe aufschreien wird, weil meine Analyse wenig theologisch fundiert ist. Das mag durchaus so sein und diese Problematik wird im Laufe dieses Buches zweifelsohne immer wieder aufkeimen. Doch gerade der Blick auf einen gelebten Glauben, im Speziellen hier in Deutschland, abseits der klassischen Theologie, abseits von jahrhundertealten Kirchengesetzen, Traditionen und Regeln ist mir wichtig. Ich möchte aufzeigen, dass die Kirche sich an vielen Stellen verrannt hat. Stellen, die für den einfachen Gläubigen widersprüchlich sind, die die Grundaussage Christi nicht mehr erkennen lassen und die dazu führen, dass die Menschen sich abwenden. Genau das ist der Grund dieses Buches. Ich sehe eine Kirche, die immer mehr an Bedeutung verliert. Im alltäglichen gesellschaftlichen Leben ist sie jetzt schon kaum noch präsent, ebenso verliert sie ihre Bedeutung als Wächter einer christlich geprägten Werteordnung und als moralische Instanz.
Meine Intention mit diesem Buch ist die Suche nach Auswegen aus diesem Dilemma. Weg von festgefahrenen Gedankenmustern, theologischen Regeln und Strukturen, hin zu einem Gedankenspiel basierend auf den wesentlichen Grundlagen der Aussage Jesu. Ich will versuchen zu entschlüsseln, wo die Kirche sich zu weit von der Botschaft Christi entfernt hat und wo sie sich zu weit von den Menschen entfernt hat. Denn wenn sich die Kirche von den Menschen entfernt - egal ob gläubig oder ungläubig -, dann entfernt sie sich auch von Christus. Und wenn sie sich von Christus entfernt, dann verliert sie ihren Sinn und ihre Bedeutung. Dann wird sie zu einer Kirche, die niemand braucht. Daraus lässt sich unweigerlich schlussfolgern, dass die Kirche immer den Menschen zugewandt sein muss. Und genau hier scheint das Problem der Kirche zu liegen. Sie verschanzt sich zu sehr hinter einer über die Jahrhunderte geformten Theologie, die sich zu viel um die Institution Kirche kümmert, und die zu oft, aus den unterschiedlichsten Gründen, den Menschen - bewusst oder unbewusst - vergessen oder übergangen hat. Dabei entfernen sich das innerkirchliche Leben und das Alltagsleben der gläubigen und nichtgläubigen Menschen immer mehr voneinander, so dass das Verständnis füreinander und das Wissen übereinander immer geringer und die Beziehung zueinander immer problematischer wird.
So wird es dringend Zeit, dass sich etwas ändert. Es ist kurz vor zwölf. Noch gibt es Menschen, die der Kirche nicht den Rücken zugewandt haben. Und diese Menschen kommen aus den unterschiedlichsten Beweggründen. Da sind die sozialen Kontakte, die für alte und einsame Menschen von großer Bedeutung sind sowie die eigene Bestätigung, die man in der Gemeinschaft erfährt. Da gibt es den Wunsch sich karitativ einzubringen und somit in der Freizeit anderen hilfsbedürftigen Menschen beizustehen. Da treffen sich Menschen in Gruppen, in denen sie ihre Fähigkeiten und Talente sinnvoll und erfüllend einsetzen können. Da findet man Menschen auf der Suche nach Spiritualität, Besinnung und dem gemeinsamen Gebet. All diese Menschen leben im Alltag in klassischen Familienstrukturen, in unverheirateten Beziehungen mit Kindern, als gleichgeschlechtliche Paare, Alleinerziehende, Wiederverheiratete, Patch-Work-Familien und in vielen anderen Strukturen. Sie alle verbindet der Glaube an einen Gott und sie alle – egal aus welchen Gründen sie auch in die Kirche kommen mögen – dürfen nicht abgewiesen werden und müssen willkommen sein.
1 Joh. 15,12
2 geweihten
2. Die Evangelien und ihre Interpretation
Seit der Jahrtausendwende wird auf unserem Planeten ein Phänomen immer deutlicher. Viele Menschen machen sich ihre eigene Wahrheit. Was nicht sein darf, das gibt es auch nicht. Die Flut der Informationen, die uns heute durch das Internet und einen omnipräsenten Journalismus zur Verfügung stehen, wird nicht hinterfragt. Sie werden falsch gedeutet oder den eigenen Wünschen und Meinungen angepasst. Wahrheiten hingegen werden als Fake-News und Lügen abgestempelt, wenn sie nicht in das gewünschte Bild passen. Zugegeben gab es diese Eigenart auch schon zu früheren Zeiten, doch moderne Kommunikationsmittel und Social-Media-Plattformen helfen heutzutage bei der Verbreitung der obskursten Theorien. „Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe“ soll schon der ehemalige britische Premierminister Sir Winston Churchill gesagt haben und es ist zu befürchten, dass viele Menschen nach dieser Devise leben und handeln. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich möchte nichts gegen die modernen digitalen Kommunikationsmittel und Plattformen sagen. Ihre Erfindung und Entwicklung sind ein Segen für die Menschheit. Aber wie bei allen Dingen muss man auch hier beide Seiten in Betracht ziehen und die positiven Aspekte nutzen, die negativen aber unterlassen. Nur am Rande sei hier erwähnt, dass es dringend nötig ist, dass für solche modernen Medien weltweit gültige gesellschaftliche und juristische Reglements eingeführt werden.
Doch zurück zur Wahrheitsfindung! Wenn man nun auf der Suche nach der Wahrheit ist oder ihr zumindest so nah wie möglich kommen will, so muss die Schlussfolgerung aus dieser Erkenntnis unweigerlich lauten, dass man, bei der Fülle an Informationen, die einem heute zur Verfügung stehen, diese Quellen und Informationen möglichst genau prüfen und auf Widersprüche und mögliche Fehler achten muss. Nur so kann man falsche von richtigen Informationen trennen und nur so hat man die Chance, der Wahrheit näher zu kommen. Mag es auch viele Bereiche geben, deren genaue Analyse nicht lohnen und die man kopfschüttelnd belächeln kann, so sollte man doch die grundlegenden und lebensbegleitenden Einflüsse umso mehr auf ihren genauen Wahrheitsgehalt hin überprüfen – zumindest soweit dies möglich ist. Denn diese Einflüsse entscheiden in nicht unwesentlichem Maße über den Verlauf unseres Lebens, als dass man sie einfach, ohne zu hinterfragen, hinnehmen sollte. Das gilt auch – in ganz besonderem Maße – für unseren Glauben.
Ein tiefer überzeugter Glaube kann nur wachsen und gefestigt werden, wenn man durch eigene Erkenntnisse und Überzeugungen den Wahrheiten und folglich auch den Unwahrheiten und Fehlern innerhalb der Lehre einer Religion möglichst nahe kommt. Nur dann bleibt der Glaube keine leere Hülle, sondern kann aus tiefer Überzeugung gelebt werden. Und nur dann kann man durch sein Leben und Handeln zum Vorbild für andere Menschen werden. Ein Glaube, der das eigene Handeln bestimmt, kann folglich nicht darauf basieren, dass man eine vorgefertigte und aufdoktrinierte Meinung kommentarlos hinzunehmen hat. Der Glaube muss einem nicht anerzogen werden, man muss ihn nicht auswendig lernen wie das 1x1 in der Schule, er muss einen überzeugen.
Es bleibt einem also nichts anderes übrig, als sich selber zu bemühen, die Wahrheit am Glauben zu ergründen. Natürlich wird einem diese Erkennung von Wahrheit und Fehlern nie zu 100% gelingen, aber die Suche danach wird einem den eigenen Weg offenbaren. So entsteht eine persönliche und ganz eigene Beziehung zu Gott, die unabhängig vorgegebener Dogmen völlig individuell ist. Wichtig dabei zu wissen ist, dass sich in dieser persönlichen Suche die individuelle Antwort auch gegen Gott und gegen einen Glauben entscheiden kann. Auch dies muss man gegebenenfalls akzeptieren, da auch dies ein Teil der Glaubensfreiheit ist.
Doch wie findet man nun die Wahrheit im Glauben? Widersprechen sich die Begriffe „Wahrheit“ und „Glaube“ nicht? Sicherlich die Wahrheit beinhaltet immer auch das Wissen über etwas. Und wer etwas weiß, der braucht nicht zu glauben. Diese einfache Erkenntnis führt uns schon zur Lösung der Frage. Wer meint die ganze Wahrheit zu kennen, der glaubt nicht. Oder umgekehrt: Wer glaubt, der ist offen für das Finden neuer Wahrheitsstücke. Denn die ganze Wahrheit wird man in letzter Konsequenz nicht finden können. Wir können ihr höchstens in kleinen Stückchen näher kommen. Diese Erkenntnis ist von immenser Bedeutung, da sie uns nicht nur vor arroganter Besserwisserei schützt, sondern uns auch die Möglichkeit der Korrektur offen lässt. Historische und wissenschaftliche Forschungen werden uns immer wieder tiefere Einblicke in die Wahrheit gewähren, die die bisherigen Erkenntnisse verändern und eine Anpassung nötig machen. Findet diese Anpassung nicht statt, würde man sich von der Wahrheit wieder mehr entfernen anstatt sich ihr anzunähern. Man darf also im Glauben nicht stehen bleiben. Der Glaube verlangt von uns immer wieder offen zu sein für neue Denkansätze, neue Interpretationen. Er muss kontinuierlich angepasst werden, um so step by step näher an die Wahrheit und somit näher an Christus zu rücken. Doch wo genau müssen wir diese Wahrheit suchen?
Für uns Christen gibt es eine Grundlage unseres Glaubens und der Wahrheit. Diese liegt im Leben und Handeln des Zimmermannsohnes aus Nazareth begründet. Dieser Jesus ist für jeden Menschen, der sich mit der christlichen Religion befasst, der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die Frage nach der Wahrheit im Glauben geht. Jener Wahrheit, der wir doch ein kleines Stück näher kommen wollen. Doch was ist an dieser Person und ihrem Leben wahr? Versuchen wir uns also erst einmal der historischen Person des Jesus von Nazareth zu nähern.
Betrachten wir die Situation aus historischer Sicht, so drängt sich eine grundlegende Frage direkt auf. Hat dieser Jesus von Nazareth überhaupt gelebt oder ist er eine fiktive, erfundene Person?
Die Existenz eines Menschen in der Antike ist bis heute historisch schwer zu beweisen. Hilfreich sind hier neben Schriftstücken, die die entsprechende Person selber verfasst hat, vor allem Gegenstände und Fundstücke aus der Zeit der entsprechenden Person, die ihr direkt zugewiesen werden können oder auf der sie dargestellt ist (z.B. Münzen). Doch bezogen auf unsere gesuchte Person gibt es diese Gegenstände und materielle Fundstücke genauso wenig wie Schriften, die von ihr selber verfasst und hinterlassen wurden. So bleibt nur die letzte Möglichkeit eines historischen Beweises, die aus Schriften Dritter besteht, in denen Bezug zu der historischen Person genommen wird. Verständlicherweise sind in der Frage nach dem historischen Jesus die nichtchristlichen Quellen hier die wichtigeren für diesen Beweis, da sie weniger anfällig für Manipulation oder erdachter fiktiver Geschichten sind. Und diese nichtchristlichen Quellen gibt es tatsächlich. So erwähnt unter anderem der jüdische Historiker Flavius Josephus jenen Jesus aus Nazareth in seiner um das Jahr 93 n. Chr. verfassten Antiquitates Judaicae. „Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Mann nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen“. Auch der römische Schriftgelehrte Tacitus erwähnt Jesus im Jahre 117 in einer seiner Schriften. „Der Namensspender Christus war unter der Herrschaft des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus zum Tode verurteilt worden; und der für den Augenblick unterdrückte verderbenbringende Aberglaube brach wieder hervor, nicht nur in Judäa, dem Ursprung dieses Übels, sondern auch in der Stadt Rom, wo von überall her alles grässliche und schändliche zusammenfließt und gefeiert wird.“3 Diese beiden Stellen stehen beispielhaft für einige weitere nichtchristliche Schriften, die auf den Mann aus Galiläa verweisen.
Etwa seit Mitte des letzten Jahrhunderts bezieht die moderne historische Forschung in der Frage nach einer Existenz Jesu dann auch noch Kenntnisse aus der Archäologie, Sozialgeschichte, Orientalistik und Judaistik zur Zeit des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung mit ein. Summa summarum gehen aus heutiger Sicht die meisten Historiker davon aus, dass dieser Jesus aus Nazareth tatsächlich um die Zeitenwende herum gelebt hat.
Die zweiten wichtigen Quellen über diesen Jesus von Nazareth sind natürlich die christlichen Schriften. Diese Schriften beginnen etwa um das Jahr 50 n. Chr. mit dem ersten Brief des Apostel Paulus. Erste Aufzeichnungen der Evangelien wurden etwa dreißig Jahre nach der Kreuzigung Christi, also etwa um das Jahr 60-70 n. Chr. niedergeschrieben. Vorsicht ist hier geboten, denn spricht man von den Evangelien, so muss man genau genommen zwei Gruppen unterscheiden. Zum einen sind mit diesem Begriff meistens die vier Evangelien gemeint, die man im Neuen Testament findet. Hierzu zählen das Markus-Evangelium4, das Matthäus-Evangelium5, das Lukas-Evangelium6 und das Johannes-Evangelium7. Diese vier Evangelien gehören dem Kanon der heiligen Schrift an, das heißt, sie sind Teil der Bibel oder genauer gesagt, Teil des Neuen Testamentes.
Darüber hinaus gibt es jedoch noch einige weitere apokryphe8





























