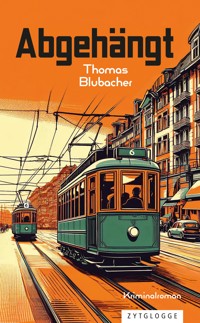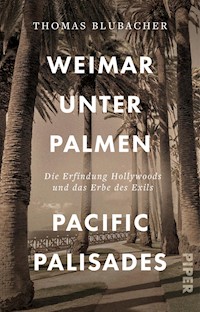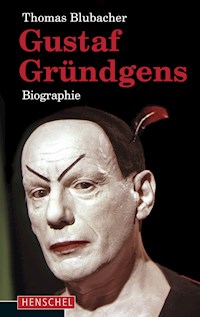Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Auf den fünf heute noch genutzten Friedhöfen auf basel-städtischem Boden liegen unzählige Persönlichkeiten begraben, die Lokal-, Landes- und manche sogar ein Stück Weltgeschichte geschrieben haben. Der Autor lädt dazu ein, auf ausgewählten Routen über den Wolfgottesacker, den Israelitischen Friedhof, den Friedhof am Hörnli, den Gottesacker Riehen und den Friedhof Bettingen die Grabstätten einiger dieser Menschen zu besuchen und ihre Geschichten zu entdecken. Für die körperlich leicht zu bewältigenden und geistig stimulierenden Spaziergänge, die kein kräftezehrender Bildungsmarathon werden sollen, wurden die an den vorgeschlagenen Strecken Ruhenden weder einem Bedeutungsranking folgend ausgewählt, noch mit dem vermessenen Anspruch auf Vollständigkeit versammelt. Dafür finden sich ein Couturier, ein doppelt besternter Cuisinier, der Erfinder der lila Kuh, das reale Vorbild der Hanna aus Max Frischs «Homo faber», ein Kleinbasler Postbeamter, der mit einer Fehlentscheidung in die Fussballgeschichte einging, ein deutsch-baltischer Chemiker, dessentwegen Generationen von Kindern Unmengen von Spinat verspeisen mussten, und übrigens auch der Begründer der Promenadologie, der Spaziergangswissenschaft, unter den vorgestellten Menschen, die in Basel ihre letzte Ruhe gefunden haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
Vor-Letzte Worte
Die Toten von Basel
Wolfgottesacker
Israelitischer Friedhof
Friedhof am Hörnli
Der westliche Bereich
Der östliche und der zentrale Bereich
Gottesacker Riehen
Friedhof Bettingen
Friedhofspläne
Dank
Personenregister
Über den Autor
Über das Buch
Thomas Blubacher
Letzte Ruhe am Rheinknie
Autor und Verlag danken für die Unterstützung:
Ruth und Paul Wallach Stiftung
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021 – 2024 unterstützt.
© 2021 Thomas BlubacherZytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat und Fotos: Thomas GierlUmschlaggestaltung: Kathrin Strohschnieder
Thomas Blubacher
Letzte Ruhe am Rheinknie
Spaziergänge zu bemerkenswerten Toten auf Basels Friedhöfen
Vor-Letzte Worte
Zugegeben, keiner der fünf noch heute genutzten Gottesäcker auf basel-städtischem Boden spielt in der Champions League der Prominentenfriedhöfe. Auf dem Père Lachaise in Paris pilgern jährlich 3,5 Millionen Menschen zu den sterblichen Überresten von Oscar Wilde und Marcel Proust, Edith Piaf und Jim Morrison. Am Eingang des Wiener Zentralfriedhofs, bekanntlich halb so gross wie Zürich, aber doppelt so lustig, ergiessen sich aus Bussen ganze Reisegruppen, die den Wunsch nach einem Selfie vor den Grabmalen von Beethoven und Brahms, Curd und Udo Jürgens haben oder sich angesichts der Büste Helmut Qualtingers mit einem seligen «Karl, du bist es nicht» auf den Lippen ihres fortdauernden irdischen Daseins erfreuen. Und der Dorotheenstädtische Friedhof in Berlin lässt bildungsbürgerliche Herzen höher wallen bei der glücklicherweise einseitig postmortalen Begegnung mit Hegel und Fichte, Bertolt Brecht und Heiner Müller. Selbst das Zürcher Sihlfeld punktet mit Zelebritäten wie Gottfried Keller und Johanna Spyri, August Bebel und Henri Dunant.
Basel kann immerhin mit einem Rekord aufwarten: Der Friedhof am Hörnli ist der grösste der Schweiz, und so ruhen dort natürlich nicht nur die beiden berühmten Karls, also Barth und Jaspers, sondern etliche weitere bemerkenswerte Persönlichkeiten – wie auch auf den anderen Gottesäckern des Kantons. Einige Namen sind wie jener Alfred Rassers wohl allen geläufig, bei anderen bedarf es vielleicht einer kleinen Anschubhilfe: Selbst wer noch nie vom Nobelpreisträger Tadeus Reichstein, geschweige denn von der Reichstein‐Synthese gehört hat, kennt ohne Frage das Vitamin C. Wieder andere ehedem Ge- und Verehrte sind in Vergessenheit geraten, lohnen aber eine Wiederbegegnung oder Neuentdeckung.
Dazu laden die vorgeschlagenen Spaziergänge ein, und so wurden die an den Routen Ruhenden weder einem Bedeutungs- noch einem Popularitätsranking folgend ausgewählt, geschweige denn mit dem vermessenen Anspruch auf Vollständigkeit versammelt. Lokalhistorisch Bewanderte werden das Fehlen so mancher Person beklagen, die sich in Basel um, ach! Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus verdient gemacht hat, Kunstinteressierte den einen oder anderen längst verblichenen Schöpfer farbenfroher Malereien vermissen, Theaterbegeisterte einstmals gefeierte Bühnenstars, denen die Nachwelt, wie man weiss, ohnehin keine Kränze flicht. Und, horribile dictu, nicht einmal alle, deren Namen sich mit «Veegeli-Vau» oder «ckdt» schreiben, werden gebührend gewürdigt. Dafür ein Couturier und ein doppelt besternter Cuisinier, der Erfinder der lila Kuh und das reale Vorbild der Hanna aus Max Frischs «Homo faber», ein Kleinbasler Postbeamter, der mit einer Fehlentscheidung Fussballgeschichte schrieb, und ein deutsch-baltischer Chemiker, dem wir den spinatverschlingenden Matrosen Popeye verdanken.
Dass alte weisse Männer oder in diesem Falle tote weisse Männer dominieren, ist keine programmatische Absage an Frauenquote und Diversity, sondern spiegelt die historische Realität. Der Verzicht auf Sternchen oder Gap ist der vermeintlich besseren Lesbarkeit geschuldet und wird, hiermit sei’s versprochen, spätestens bei der zehnten Auflage korrigiert, wenn sich Augen und Ohren sicherlich an eine gendersensible Sprache gewöhnt haben. Apropos: Sollten Sie diese Erstausgabe in zwanzig oder dreissig Jahren antiquarisch erwerben, werden Sie einige dann aufgelassene Gräber vergeblich suchen, dafür aber Grabsteine entdecken, deren Besitzer bei der Drucklegung noch munter Tennis gespielt haben.
Viel Freude also beim Flanieren über Basels Friedhöfe – nach dem Motto: «Ich lebʼ, weiss nit wie lang, ich sterbʼ und weiss nit wann, ich fahrʼ, weiss nit wohin, mich wundertʼs, dass ich fröhlich bin.»
Die Toten von Basel
Ob die Gäste, die im Café Zum Kuss an der Elisabethenanlage «Totebeinli» verzehren, wissen, dass sie im einstigen Leichenhaus des St. Elisabethen-Friedhofs einkehren? Sind sich Spaziergänger, deren Kinder das ägyptisch anmutende «Pfludder-Tempelchen» beim Sandkasten im Kannenfeldpark mit Kreide bekritzeln, bewusst, dass es sich um das Grabmal des Philologen Johann Jakob Merian handelt, das letzte übrig gebliebene des Kannenfeld-Gottesackers? So mancher aufgelassene Friedhof hat Relikte hinterlassen, sei es die Miniaturausgabe des Pantheons im Rosentalpark, die einst als Abdankungskapelle diente, sei es die Villa der «familea Kita Horburgpark», die mit einem Zwillingsbau den Portalbereich des Eingangs zum Horburg-Friedhof bildete. Die meisten Gottesäcker aber sind spurlos verschwunden.
Bestattungen wurden auf dem Gebiet des heutigen Kantons Basel-Stadt vorgenommen, seit Menschen hier ansässig waren. In Riehen fand man sogenannte Glockenbecher-Gräber aus der Zeit des Spätneolithikums, einfache Grabgruben, in denen die Toten in Hockerstellung beigesetzt wurden. Internationales Aufsehen erregte die Ausgrabung einer rund 150 000 Quadratmeter umfassenden keltischen Grosssiedlung am linken Rheinufer, unterhalb der heutigen Dreirosenbrücke. Die engen, nur wenig eingetieften und meist in Nord-Süd-Richtung angelegten Grabgruben datieren vom 3. bis zum Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. und zeugen von den komplexen Totenritualen der jüngeren Latènezeit. Man fand neben Schmuckstücken wie Perlen und Armringen aus Glas auch Beigaben wie Münzen oder Keramikgefässe, mit denen die Toten für ein Weiterleben im Jenseits ausgestattet wurden. Im Areal zwischen den Strassenzügen Aeschenvorstadt, Elisabethenstrasse, Henric Petri-Strasse und Sternengasse wurden in den vergangenen zweihundert Jahren über vierhundert Gräber entdeckt, die ältesten aus der spätkeltisch-römischen Übergangszeit um Christi Geburt, die jüngsten aus dem 7. Jahrhundert. Ein fränkisches Gräberfeld am heutigen Bernerring stammt aus der Zeit zwischen 530 und dem beginnenden 7. Jahrhundert, etwa derselben Zeit wie Gräber der Alamannen in Kleinhüningen, bei der Schwarzwaldallee und bei St. Theodor.
Die etwa zwanzig bekannten Basler Begräbnisplätze des Mittelalters befanden sich innerhalb des Wohngebiets bei den Pfarr- und Klosterkirchen. Einige Gräber bei der Pfarrkirche St. Theodor reichen zurück auf das 11. Jahrhundert. Im frühen 12. Jahrhundert übertrug Bischof Adalbero III. dem Chorherrenstift St. Leonhard das Bestattungsrecht auf eigenem Friedhof; die ältesten dort entdeckten Gräber stammen aus der Zeit zwischen 1200 und 1360. Die erstmals 1206 erwähnte Johanniterkommende unterhielt in der heutigen St. Johanns-Vorstadt einen Kirchhof, der heute vollkommen verschwunden ist; auch beim Kloster Klingental deutet nichts mehr auf einen Friedhof hin. Der einstige Laienfriedhof des nach der Reformation von 1529 geschlossenen Predigerklosters wurde berühmt durch den «Basler Totentanz», der Mitte des 15. Jahrhunderts von einem Schüler Konrad Witz’ auf die Innenseite der sechzig Meter langen und zwei Meter hohen Friedhofsmauer gemalt wurde, im Lauf der Jahrhunderte verwahrloste und 1805 zerstört wurde. 23 Bild- und drei Textbruchstücke konnten gerettet werden, 19 von ihnen sind im Historischen Museum ausgestellt. Das Friedhofsareal dient heute als öffentlicher Park; die Tramhaltestelle «Totentanz» wurde aus Rücksicht auf das angrenzende Spital umbenannt und heisst seit 2004 «Universitätsspital». Nicht in die Kunst-, sondern in die Geschichtsbücher eingegangen ist der Kirchhof von St. Jakob, auf dem sich 1444 die Eidgenossen in der Schlacht gegen die zahlenmässig weit überlegenen Armagnaken verschanzten: «Wie wilde Tiere im brennenden Käfig wüteten sie, ums blutrote Schweizer Panner geschart. Ein immerwährendes Aufblitzen der Schwerter und das Krachen der Knüttel kam aus ihrem Haufen, als wären sie ein eingeschlossenes Donnerwetter», heisst es in Meinrad Lienerts 1914 veröffentlichten «Schweizer Sagen und Heldengeschichten». Für die Bestattung der rund 1300 Toten musste der Kirchhof erheblich erweitert werden, heute ist aus ihm eine Gartenanlage geworden. Allenfalls noch zu erahnen ist auch der Kirchhof der 1864 abgerissenen Pfarrkirche St. Elisabeth im Pfarrgarten der heutigen Elisabethenkirche.
Als einziger mittelalterlicher Kirchhof zumindest teilweise erhalten hat sich jener neben der um 1270 als Teil eines bereits bestehenden cluniazensischen Klosters erbauten St. Alban-Kirche, der noch bis 1872 als Bestattungsort für wohlhabende Basler Familien diente und 2012/13 restauriert wurde. Das älteste zu identifizierende Epitaph stammt aus dem Jahr 1593. Auf Grabsteinen entlang der Nord- und der Südmauer kann man Namen wie Bernoulli, Burckhardt, Heusler, Iselin, Merian, Preiswerk, Staehelin und Thurneysen lesen. In Grab S 30 A ruht seit seinem Freitod im Jahr 1854 der Architekt Melchior Berri, der Schöpfer des «Basler Dybli».
Grabmale und Epitaphe finden sich selbstverständlich auch innerhalb der Kirchen. Im Chor des Münsters kann man das einzige figürliche königliche Grabmal der republikanischen Schweiz bestaunen: die prächtige, mit den Wappen Österreichs, des römisch-deutschen Reiches und der Steiermark verzierte Grabtumba für den 1281 aus Wien überführten Leichnam der Königin Anna von Habsburg, der Gemahlin des ersten römisch-deutschen Königs Rudolf von Habsburg und Stammmutter der Habsburger-Dynastie. Ihre Gebeine wurden allerdings 1770 auf Verfügung Kaiserin Maria Theresias nach St. Blasien und 1809 nach St. Paul im Kärntner Lavanttal verlegt. Im nördlichen Seitenschiff liegen zu Füssen eines Epitaphs aus rotem Kalkstein die Gebeine des grossen Theologen und Humanisten Erasmus von Rotterdam, der 1536 in Basel verstarb und, obgleich Katholik, im protestantischen Münster bestattet wurde. Der Doppelkreuzgang des Münsters diente, bis es dort im 19. Jahrhundert schlicht zu eng wurde, als Bestattungsort für Basels Elite. Hier ruhen der Reformator Johannes Oekolampad, der Humanist Thomas Platter, der Bürgermeister Johann Rudolf Wettstein, der Mathematiker Jacob I. Bernoulli und der Philosoph Isaak Iselin. In der Peterskirche befinden sich ausser der Grabplatte für den Buchdrucker Johann Froben, deren dreisprachige Inschrift Erasmus von Rotterdam und Sebastian Münster verfassten, Epitaphien für die Mathematiker Johann I. Bernoulli, Nicolaus I. Bernoulli und Daniel Bernoulli.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verdoppelte sich die Stadtbevölkerung auf 30 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Neben der Überfüllung der Kirchhöfe war es eine Typhusepidemie im Jahr 1814, die die Stadt veranlasste, neue Bestattungsorte zu suchen – man befürchtete, die Beisetzung der Toten mitten in den Wohnquartieren stelle eine Ansteckungsfahr dar. Zwischen 1817 und 1832 wurden drei Gottesäcker eingeweiht: zuerst der Elisabethengottesacker als Friedhof der Münstergemeinde, dann, als Ersatz für den 1825 geschlossenen Friedhof zu St. Leonhard und als erster Gottesacker vor der Stadtmauer, der Spalengottesacker (heute befindet sich dort der Botanische Garten) und schliesslich der Friedhof St. Theodor im Kleinbasler Rosental, dort, wo in unserer Zeit auf dem unterdessen stark verkleinerten Areal Zirkusse ihre Zelte aufschlagen. Er diente als Ersatz für den Theodorskirchhof, wodurch die «dissmahligen Ruehstätten der bereits Entschlafenen biss zu ihrem künftigen Auferstehungstage ohngestört bleiben können». 1845 folgte der Äussere St. Johann-Gottesacker als Spitalbegräbnisstätte; bis 1985 hatte auf dem Areal die Stadtgärtnerei ihr Domizil, deren Anlagen bis zur polizeilichen Räumung 1988 von Kulturschaffenden genutzt wurden. 1992 übergab man der Öffentlichkeit den fertig gestalteten St. Johanns-Park – in dem noch immer Hunderte Tote ruhen. 2015 wurden wegen eines Leitungsbaus 54 vollständig erhaltene Bestattungen geborgen, anthropologisch untersucht und mit dem Gräberverzeichnis sowie den überlieferten Krankenakten des Bürgerspitals abgeglichen. Das Skelett des 1799 geborenen, 1859 als Alkoholiker verstorbenen Hafners und Taglöhners Johann Salathé etwa zeigt am Hüftgelenk und an den Wirbeln ausgeprägte Spuren von Arthrose und lässt Rückschlüsse auf ein von harter Arbeit geprägtes Leben zu. Charakteristische Rillen im Zahnschmelz und der Zustand der Zahnwurzeln zeugen von Hunger und Mangelernährung während der Kindheit, aber auch noch in der Jugend – der Ausbruch des Vulkans Tambora auf der Insel Sumbawa im Jahr 1815 hatte gravierende Ernteausfälle in der Schweiz zur Folge. Auch der ab 1849 belegte und bis 1881 genutzte Friedhof bei der Kleinhüninger Dorfkirche ist heute eine Grünanlage.
Das weitere Anwachsen der Bevölkerung führte in den 1860er-Jahren zur Überbelegung auch dieser Begräbnisstätten, und die wenig pietätvollen Zustände dort machten die Anlage neuer Friedhöfe unumgänglich. 1866 beschloss der Stadtrat den Bau zweier grosser Friedhöfe ausserhalb des Stadtgebietes, der eine dauerhafte Lösung des Problems darstellen sollte. Auf der Suche nach geeigneten Grundstücken fand man eine Weide, auf der der Patron des Gasthauses Zur Kanne in der Spalenvorstadt seine Enten in freier Bodenhaltung hielt. 1868 wurde dort der im Stil englischer Parkanlagen gestaltete Gottesacker auf dem Kannenfeld für die linksseitig des Birsigs gelegenen Quartiere eröffnet; der Spalen-, der Innere St. Johann- und der Spitalgottesacker wurden geschlossen. Davon begeistert zeigten sich weiss Gott nicht alle – zu weit entfernt von der Stadt war ihnen der neue Friedhof. Die Katholiken klagten, dass es nun nicht mehr möglich sei, den Sarg mit dem Verblichenen auf den Schultern von dessen Wohnhaus, wo man ihn aufgebahrt hatte, zum Grab zu tragen; die Reformierten monierten, der einsame Landweg zum Friedhof biete für einen würdigen Trauerzug mit bekränztem Leichenwagen keine adäquate Kulisse. Dennoch wurde 1872 der damals ebenfalls weit ausserhalb der Stadt gelegene Gottesacker auf dem Wolf eingeweiht, der der übrigen Grossbasler Bevölkerung dienen sollte; die Friedhöfe St. Elisabethen, St. Alban und St. Jakob wurden aufgelassen. Als Ersatz für den Friedhof St. Theodor im Rosental wurde 1890 auf den bis dahin hauptsächlich als Weideland genutzten Dreirosenfeldern der Horburggottesacker errichtet, auf dem 1898 das erste Krematorium Basels den Betrieb aufnahm – gegen massiven Protest insbesondere der Katholiken, die Feuerbestattungen als «neuheidnisch» ablehnten. Vor der offiziellen Einweihung wollte man die Anlage mit zwei Leichnamen testen. Als Erstes sollten unter Anwesenheit zahlreicher Schaulustiger die sterblichen Überreste eines verstorbenen Sträflings kremiert werden. Doch der Heizer bediente die Anlage falsch und verlor, als Gase entwichen, das Bewusstsein, worauf sich die Angehörigen des zweiten Toten dann doch für eine Erdbestattung entschieden.
Mit der Inbetriebnahme des Zentralfriedhofs am Hörnli 1932 wurden sämtliche alte Gottesäcker geschlossen. Am 8. Dezember 1931 hatte die Regierung verfügt, dass die Begräbnisstätten Horburg und Kannenfeld auf Ende 1951 aufgehoben würden, ebenso der 1882 unmittelbar an der Landesgrenze eröffnete Kleinhüninger Friedhof. Allein der Wolfgottesacker blieb als historischer Bestattungsort und als Refugium wertvoller Grabsteine erhalten, noch heute werden dort Beisetzungen vorgenommen. Die Hälfte des Horburgfriedhofs, auf dem bis 1932 immerhin 20 290 Tote bestattet worden waren, ging 1940 an die Ciba und wurde nach Ablauf der Ruhefrist überbaut. Der Rest wird seit 1951 als Park genutzt, der heute mit Robi-Spielplatz, Planschbecken für Kleinkinder, Boulodrome, Slackline-Pfosten und Hundespielplatz samt Buddelecke lockt. Einige berühmte Grabmale verlegte man von dort auf den Wolfgottesacker, ebenso vom Kannenfeldfriedhof, als dieser 1952 aufgehoben wurde. Seit seiner Eröffnung hatte man dort rund 46 000 Menschen beigesetzt. Nun wurden 1300 Familiengräber und 6000 Reihengräber geräumt. 43 Lastwagenladungen Grabmale wurden im Rheinhafen verbaut, dreissig Lastwagen gelangten in die Langen Erlen, die gesprengten Überreste der auszementierten Familiengräber nutzte man für das Fundament des neuen Parkplatzes am St. Jakob-Stadion. Einige Grabmale an der Friedhofsmauer blieben zunächst erhalten, sind aber mittlerweile verschwunden, darunter auch jenes der 1877 verstorbenen Charlotte Kestner, der Tochter der als Lotte in Goethes Briefroman «Die Leiden des jungen Werthers» unsterblich gewordenen Charlotte Buff. Das gesamte Friedhofsareal wurde unter Federführung des Stadtgärtners Richard Arioli sukzessive in eine öffentliche Grünanlage umgewandelt, mit Spielplätzen und Planschbecken, einem mittlerweile zum Parkcafé erweiterten Kiosk sowie, auf Initiative des Komödie-Direktors Egon Karter, einem Gartentheater mit 400 Quadratmeter grosser Bühne und halbkreisförmigen, ansteigenden Sitzreihen für 1200 Zuschauerinnen und Zuschauer. Es wurde nicht nur von lokalen Bühnen und Truppen bespielt, 1977 gastierte sogar das avantgardistische Living Theatre aus New York mit seinen «Sieben Meditationen über den politischen Sadomasochismus». Passend zur Vergangenheit des Ortes zeigte das Theater Basel im Februar 1992, drei Jahre nach dem Suizid des Autors, eine Dramatisierung von Hermann Burgers Roman «Schilten»: die Geschichte eines jungen Dorflehrers, der die Nähe seiner Schule zum Friedhof nicht erträgt, seine Schüler in «Todeskunde» unterrichtet, an seiner Existenz verzweifelt, sich scheintot glaubt und nach seiner Entlassung ein ausuferndes Memento mori in Form eines Schulberichts verfasst, eine vergebliche Verteidigungsschrift gegen den Tod.
Wolfgottesacker
Der seit 1995 unter Denkmalschutz stehende, dank alten Baumbestands und klassizistischer, neogotischer, von Renaissanceformen oder dem englischen Tudorstil geprägter Familiengrabstätten schönste aller Basler Gottesäcker liegt wenig idyllisch mitten im Gewerbegebiet Dreispitz, zwischen SBB-Gleisen, einem Rangierbahnhof und einem Tramdepot.
Als die Stadt 1869 das leicht abfallende Terrain an der Ausfallstrasse nach Münchenstein als künftige Begräbnisstätte für die rechts des Birsigs wohnende Bevölkerung von Christoph Merians Witwe Margarethe pachtete (erworben hat sie es erst zwanzig Jahre später), befand es sich freilich in ländlich geprägter Umgebung, zwischen Feldern und Wiesen. Weil man erkannt hatte, dass die Bodenbeschaffenheit auf dem Wolffeld, das seine Bezeichnung den hier noch im 17. Jahrhundert umherstreifenden Wölfen schuldet, nicht ideal für die Leichenverwesung war, und man zudem eine Bodensenke aufschütten musste, liess man zunächst einmal grosse Mengen Erde vom Bruderholz hierher transportieren. 1870 konnte man mit der eigentlichen Gestaltung beginnen, nach einer Grundkonzeption Amadeus Merians, dem Basel das Café Spitz und den Neubau des Hotels Drei Könige verdankt. Man errichtete an der Südseite ein von Johann Jakob à Wengen entworfenes, dreibogiges Eingangsportal im neobyzantinischen Stil, an dessen Flanken sich ein Verwaltungs- und ein Gärtnerflügel anschliessen, und östlich davon ein Leichenhaus. Der geplante Zentralbau, eine imposante Kapelle, fiel Sparplänen zum Opfer – das erklärt den etwas überdimensioniert wirkenden asphaltierten Platz, auf den man nach dem Betreten des Friedhofs zustrebt. Im nördlich anschliessenden eigentlichen Begräbnisbereich legte man längs der Mauern Grüfte für die Verblichenen betuchter Familien an, im Zentrum günstige Reihengräber. Die Randzonen gestaltete der Stadtgärtner Georg Lorch im Stil eines Landschaftsparks mit sanft geschwungenen Kieswegen und zwei von Felsformationen hinterfangenen Wasserbecken. Einer allerdings, der auf diesem Gelände seine Ruhestätte bereits gefunden hatte, musste weichen, besser gesagt, sein doch recht spärlicher Überrest: Die bei den Arbeiten gefundenen Backenzähne eines Rhinoceros tichorinus, eines wollhaarigen Nashorns aus dem Pleistozän, wurden ins Museum an der Augustinergasse disloziert.
Am 23. Mai 1872 konnte man den Wolfgottesacker mit einem Festzug, der sich beim Sommercasino formierte, mit Chorgesang und Posaunenmusik feierlich einweihen; die erste Beerdigung folgte am 3. Juni. Gerade mal ein Jahr später war der neue Friedhof den Bauplänen der Schweizerischen Centralbahngesellschaft im Weg, die einen Rangier- und Güterbahnhof errichten wollte, und so wurde ab September 1874 prophylaktisch niemand mehr bestattet. Schliesslich mussten dem Schienenverkehr nur der Nordteil des Friedhofs und damit aber auch sein harmonischer, an ein Kirchenschiff mit Apsis erinnernder Grundriss geopfert werden. Im Juni 1879 wurde der Wolfgottesacker wiedereröffnet, das 1880 abgetretene untere Friedhofsareal glich man durch Erweiterungen an der Ost- und Westflanke aus. Letztere wurde 1957 wieder um 1270 Quadratmeter beschnitten, damit die Bahnhof-Kühlhaus AG eine Lagerbaracke errichten konnte. Aber nicht nur auf diese Fläche musste der seither nur noch 58 300 Quadratmeter grosse Wolfgottesacker, der gut 2800 Grabstätten birgt, verzichten. 1999 verlor er auch seinen Namen im Basler Strassenbahnnetz, als die Tramhaltestelle «Wolfgottesacker» der Linien 10 und 11 zu «MParc» umbenannt wurde – die tägliche Kundenfrequenz des umsatzstärksten Schweizer Detailhändlers mit dem Slogan «Einfach gut leben» ist freilich wesentlich grösser als die von Gevatter Tod. Ganz zu schweigen von der Produktpalette: Das Angebot des Wolfgottesackers beschränkt sich auf das 40-jährige Nutzungsrecht für ein Grab, in dem zwei oder mehrere Tote Platz finden (das kann auch eine Grabstätte mit einem bestehenden historischen Grabmal sein) oder alternativ das 20-jährige Nutzungsrecht für einen Urnenplatz in einer Grabgemeinschaft.
Zwar zählt der Friedhof am Hörnli 14-mal so viele Gräber wie der Wolfgottesacker, dafür kann letzterer mit einer weit höheren Dichte an Prominentengräbern aufwarten. Auf dem vorgeschlagenen Spaziergang besuchen Sie 66 davon und benötigen für diese «Route 66» je nach Kondition und Verweildauer gerade mal zwei bis drei Stunden.
Gehen Sie nach Betreten des Friedhofs – hinter dessen Eingang eine Informationstafel die Gräber einiger Prominenter verzeichnet – geradeaus durch die kurze Lindenallee und durchqueren das angeschnittene Oktagon mit dem mittigen, von Kastanienbäumen und Parkbänken umstandenen Rondell. Wenn Sie nun rechts einbiegen, lohnt ein kurzer Abstecher auf das Weglein, das links zum Grabsektor 8 führt. Nach wenigen Schritten gelangen Sie zu Grab 8-45, in dem der polnische Sänger ZBYSŁAW WOŹNIAK (1906 – 1991) bestattet wurde. Er wirkte von 1938 bis 1972 als lyrischer Tenor am Stadttheater Basel und gestaltete dort unter anderem die Titelrollen in der deutschsprachigen Erstaufführung von Benjamin Brittens «Peter Grimes», in Gounods «Faust», in Offenbachs «Orpheus in der Unterwelt» und «Hoffmanns Erzählungen», gab den Baron Mirko Zeta in Lehárs Operette «Die lustige Witwe» sowie den Grafen Almaviva in Rossinis «Barbier von Sevilla» und übernahm zentrale Partien in Mozart-, Verdi- und Wagner-Opern. Sein Herodes in Richard Strauss’ «Salome» wurde 1957 mit der damals erst 24-jährigen Montserrat Caballé in der Titelrolle auf Schallplatte eingespielt und 2012 neu auf CD herausgebracht.
Wieder zurück auf dem Weg durch den Sektor 35 gelangen Sie gleich zu Beginn zu zwei weiteren Gräbern, die Ihre Aufmerksamkeit verdienen, das eine zu Ihrer Linken, das andere schräg gegenüber. «S git männgmool so verlooreni Dääg, / so grau, so stumpf, so inhaltsläär – / Luff aim doch eppis iber e Wääg! / (Und wenn s der Gäldbrieffdrääger wäär – )», reimte der originelle, auch unter den Pseudonymen «Beuz» und «Emanuel» bekannte Dichtermaler EMIL BEURMANN (1862 – 1951), der in Grab 35-67 ruht. Grau und stumpf dürften indes nicht allzu viele Tage im bunten Leben des Bohemiens gewesen sein. Nach einer Ausbildung zum Dekorationsmaler und Malunterricht bei Hans Sandreuter in Basel und bei Hans Thoma in Karlsruhe übersiedelte der als Sohn eines Tapezierers am Basler Klosterberg geborene Beurmann 1881 ins Pariser Quartier Latin, wo er Künstler wie Albert Anker, Cuno Amiet und Giovanni Giacometti kennenlernte. 1894 und 1895 führte «Monsieur Émile», der schon in jungen Jahren als Belami gegolten hatte, in Kairo ein angenehmes Leben mit seinen beiden Modellen Nebiha und Chadiga. Letztere begleitete ihn bei seiner Rückkehr in die Schweiz ebenso wie die Bauchtänzerin Amina, Feuerspeier, Trommler, Magier und Schlangenbeschwörer, die er als Impresario im «Palais des Fées» an der zweiten Schweizer Landesausstellung von 1896 in Genf auftreten liess. Seinen Lebensunterhalt verdiente er mit dem Malen von Porträts und Akten, zudem begann er, inspiriert durch zahlreiche Reisen, die ihn nach Italien, Spanien, Holland, Norwegen und in die Türkei geführt hatten, humorvolle Reiseberichte und Feuilletons für die «National-Zeitung» zu verfassen. 1914 heiratete «Beuz» sein «Beuzli», die ein Vierteljahrhundert jüngere Maria Brunner. Sie war genauso theaterbegeistert wie ihr Mann, der 1900 bis 1937 der Theaterkommission angehörte, und so begrüssten sie in ihrem Haus Berühmtheiten wie Richard Strauss, Max Reinhardt und Richard Tauber, als diese zu Gastspielen nach Basel kamen. Der als Stadtpoet geltende Beurmann schrieb Fasnachtszeitungen unter dem Titel «Basler Giggernillis», satirische Verse und amüsante Kolumnen, in denen er das Geschehen in Basel kommentierte, aber auch Gedichte mit zum Teil politischem Inhalt für die «Neue Basler Zeitung», die offen die Frontenbewegung unterstützte, und für den «Basilisk», das Organ der «Nationalen Volkspartei». Mit 75 Jahren fertigte er für das Stadttheater das Libretto zu Hans Haugs Dialektoperette «E liederlig Kleeblatt» nach Johann Nestroys «Lumpazivagabundus» an, die ein grosser Publikumserfolg wurde. Einige Jahre nach seinem Tod überliess die Witwe den gesamten Bildernachlass der Pensionskasse des Stadttheaters.
Die im Grab 35-14 bestattete Harfenistin URSULA HOLLIGER (1937 – 2014), geborene Hänggi, konzertierte unter anderem mit den Berliner und den Wiener Philharmonikern, dem Los Angeles Philharmonic Orchestra, den Musici di Roma, dem English Chamber Orchestra und dem Orchestre de Paris, unter der Leitung von Dirigenten wie Michael Gielen, Pierre Boulez, Simon Rattle, André Previn und Sir Neville Marriner. Ihre Schallplattenaufnahmen der Harfenkonzerte von Händel, Mozart und Spohr erreichten ein breites Publikum, vor allem aber engagierte sie sich für zeitgenössische Musik; Hans Werner Henze, György Ligeti und Witold Lutosławski komponierten jeweils ein Doppelkonzert für sie und ihren Ehemann, den Oboisten, Dirigenten und Komponisten Heinz Holliger.
Wenden Sie sich nun nach links. Dort, wo der Weg sich teilt, sehen Sie in Sektion 27 das mit der Nummer 1A bezeichnete Grab des Philologen WILHELM VISCHER (1808 – 1874), dessen aus der bayerischen Gemeinde Lechhausen stammende Familie seit 1649 das Basler Bürgerrecht besass und bis heute das Leben in der Stadt mitprägt. Er war Professor der griechischen Sprache und Literatur an der Universität Basel und in den Jahren 1845, 1846 und 1857 deren Rektor. «In der damals blühenden Erziehungsanstalt Eman. Fellenberg’s zu Hofwyl (Kt. Bern) gewann V. vom 8. bis 17. Lebensjahre eine tüchtige wissenschaftliche und sittliche Jugendbildung und unter trefflichen Lehrern die Liebe zu seinen spätern Studien in Geschichte und griechischer Litteratur. Die Erziehung der Anstalt sorgte auch für Ausbildung des Körpers, so daß der anfangs schwächliche Knabe mit der Zeit ein rüstiger Fußgänger und Freund des Turnens wurde, dessen Beförderung er später in seiner Vaterstadt eifrig betrieb. Der Verkehr mit Zöglingen aus vornehmen Familien des Auslandes, namentlich Deutschlands, und der Geist der Erzieher legten den Grund zu einem selbständigen, pflichtgetreuen Charakter und einer streng sittlichen Auffassung aller Lebensverhältnisse», wusste die «Allgemeine Deutsche Biographie» 1896 über Vischers Jugendjahre zu berichten. Vischer, ab 1834 konservativer Basler Grossrat, erwarb sich aber nicht nur Verdienste beim Aufbau des Turnwesens in Basel, er war auch Mitgründer der Historischen Gesellschaft und der Antiquarischen Gesellschaft, ab 1849 Leiter der antiquarischen Abteilung des Museums an der Augustinergasse und förderte 1869 die Berufung Friedrich Nietzsches nach Basel. Sein Sohn WILHELM VISCHER D. J. (1833 – 1886) war Oberbibliothekar an der Universitätsbibliothek, ab 1874 ordentlicher Professor für Schweizer Geschichte, ebenfalls konservativer Grossrat und machte sich durch seinen Einsatz für kirchliche Organisationen verdient.
Wenn Sie einen Abstecher Richtung Norden machen, erblicken Sie in Sektion 56, umgeben von einer grossen Wiesenfläche, das Grab der bedeutenden Mäzenin VERA OERI-HOFFMANN (1924 – 2003), die sich, getreu dem altbaslerischen Motto «Tue Gutes und sprich nicht darüber», in meist anonymer Wohltätigkeit in karitativen und ökologischen Bereichen engagierte, sowie des Arztes, Politikers und Mäzens JAKOB OERI (1920 – 2006), mit dem sie von 1948 an verheiratet war. Die Enkelin des Roche-Gründers Fritz Hoffmann, ehemals Privatsekretärin ihres Stiefvaters Paul Sacher, war von 1959 bis zu ihrem Tod aktives Stiftungsratsmitglied der Emanuel Hoffmann-Stiftung, der sie 1979 bis 1995 als Nachfolgerin ihrer Mutter Maja Sacher vorstand. Zudem gehörte sie den Stiftungsräten der Maja Sacher-Stiftung, der Musik-Akademie der Stadt Basel, der Paul Sacher Stiftung und der Jubiläumsstiftung F. Hoffmann-La Roche an. Deren Kunstsammlung verschaffte sie mit dem Bau des Museums für Gegenwartskunst ein repräsentatives Zuhause, und auch der Bau des Museums Jean Tinguely ist ihr zu verdanken. Noch heute wendet die Familie Oeri-Hoffmann, mit einem geschätzten Gesamtvermögen von rund 35 Milliarden Franken die reichste der Schweiz, für Sponsoring und Mäzenatentum jährlich Dutzende von Millionen auf, die aus den üppigen Dividendenzahlungen der Roche, des zweitgrössten Pharmakonzerns der Welt, stammen. Neben seinen Schwiegereltern beigesetzt wurde der 1989 mit einer Doktorarbeit über Weihrauch promovierte MICHAEL KESSLER (1958 – 2018), von 1987 an Leiter des Pharmaziemuseums der Universität Basel, der zuletzt physisch und psychisch so sehr unter den Folgen einer Magenkrebserkrankung litt, dass er sich, wie es in der Todesanzeige der Familie hiess, entschied, «in seinem geliebten Museum aus dem Leben zu scheiden».
Zurück auf dem Weg, der zwischen den Sektoren 27 und 30 verläuft, nehmen Sie die Abzweigung zur erwähnten Erweiterung an der östlichen Flanke und folgen dem Weg entlang der an der Aussenmauer gelegenen Grabstätten, die nach einer Linkskurve zum Sektor 38 gehören. Das Grab 38-14 ist jenes des Physikers und Mathematikers EDUARD HAGENBACH-BISCHOFF (1833 – 1910), der sich für die Einführung des Proporzverfahrens bei Grossrats- und Nationalratswahlen einsetzte und das Hagenbach-Bischoff-System entwickelte, eine Variante des D’Hondtschen-Höchstzahl-Verfahrens: Zunächst erhält jede zur Wahl angetretene Liste Sitze entsprechend ihrer abgerundeten Quote, dann werden in einem zweiten Schritt die Restsitze verteilt. Von 1863 bis 1906 war er ordentlicher Professor für Physik in Basel, 1874 bis 1879 Präsident der Schweizer Akademie der Naturwissenschaften, 1874 wurde er Direktor der physikalischen Anstalt am neugegründeten Bernoullianum. Anfangs beschäftigte er sich vor allem mit der Zähigkeit der Flüssigkeiten, dann mit den Erscheinungen der Fluoreszenz, den Phänomenen der Gletscherwelt, ab 1886 mit der Fortpflanzung der Elektrizität im Telegrafendraht – als Versuchsfeld diente ihm die Linie Basel–Olten–Luzern – und schliesslich mit der elektrischen Entladung in verdünnter Luft. Sein Sohn AUGUST HAGENBACH (1871 – 1955) arbeitete in der Spektroskopie. Er war als Nachfolger seiner Vaters 1906 bis 1942 Vorsteher der Physikalischen Anstalt der Universität Basel und liess 1926 ein modernes Physikalisches Institut erbauen.
Die Grabstätte 38-14A gleich daneben gehört Eduards Grossvater KARL FRIEDRICH HAGENBACH (1771 – 1849), 1798 bis 1818 Professor für Anatomie und ab 1801 auch Professor für Botanik an der Universität Basel, und seinem Vater KARL RUDOLF HAGENBACH (1801 – 1874), ab 1824 Extraordinarius, ab 1828 Ordinarius für Kirchen- und Dogmengeschichte in Basel, der zusammen mit seinem Förderer Wilhelm Martin Leberecht De Wette wesentlich zur Modernisierung der Basler theologischen Fakultät beitrug. Neben theologischen und kirchenhistorischen Schriften veröffentlichte der Freund Jeremias Gotthelfs und Verehrer Johann Peter Hebels auch Gedichte und einen Band mit einhundert gereimten Rätseln wie diesem, das bestens zu unserem Spaziergang passt: «Dem lieben Vieh zur Weide, / Der lieben Erdʼ zum Kleide / Bin ich von Gott geschenkt. / Kehrst du mich um, so werde / Ich in die kühle Erde / Bald mit, bald ohne Prunk versenkt.»
Beigesetzt in Grab 38-11 wurde der Botaniker GUSTAV SENN (1875 – 1945). Der Jugendfreund Carl Gustav Jungs veröffentlichte 1908 seine wegweisende Arbeit «Die Gestalts- und Lageveränderung der Pflanzenchromatophoren» und wurde 1912 ordentlicher Professor an der Universität Basel. Seine Passion galt neben den Alpenpflanzen der Erforschung der antiken Biologie; im Zentrum seiner Studien stand der Aristoteles-Schüler Theophrastos von Eresos, der erste Gelehrte, der sich ernsthaft mit Baum- und Holzkunde beschäftigt hat. Senn, der den Rang eines Oberstleutnants bekleidete, hatte vom Ende des Ersten Weltkriegs bis 1928 in Basel das Platzkommando inne und war 1919 für die Unterdrückung des auch als «Färberstreik» bekannten Basler Generalstreiks zuständig: Den streikenden Arbeiterinnen und Arbeitern aus der Textil-, Maschinen- und Chemieindustrie hatten sich Staatsangestellte angeschlossen. Es kam zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen; als die Situation eskalierte und Steine auf die Soldaten geworfen wurden, eröffneten diese das Feuer, drei Frauen und zwei Männer starben. Am Ende unterlagen die Färber; sie erhielten zwar zehn Prozent mehr Lohn, doch glich das nicht einmal die Teuerung aus. Im selben Jahr 1919 begründete Senn zusammen mit dem Altphilologen Johannes Stroux die Basler Volkshochschule, die schon im ersten Jahr ihres Bestehens mehr als 5300 Hörende zählte.
Auf der rechten Seite des mittleren der gegenüber abzweigenden Wege liegt, versehen mit der Nummer 45-80, das Grab des Schriftstellers und Journalisten CHRISTOPH MANGOLD (1939 – 2014), der sich mit Porträts von Menschen, die nicht im Rampenlicht stehen, der Unverstandenen und Randständigen profilierte – als deren «Chronist» bezeichnete sich das langjährige Mitglied der Partei der Arbeit selbst. Sein Erstlingswerk «Manöver. Ein kleiner Roman» erschien 1962 im renommierten deutschen Rowohlt-Verlag und wurde daher viel beachtet – aber zum Fiasko: Kritiker führender Zeitungen benutzten das Debüt des 23-Jährigen zum exemplarischen Nachweis einer angeblich verirrten Literaturförderung. Es folgten Romane mit wenig marktkonformen Titeln wie «Konzert für Papagei und Schifferklavier» und einige Lyrikbände, von der Kritik verschwiegen, gelesen von einer Handvoll Insider, zudem Hörspiele und ein Theaterstück. In Erinnerung bleibe Mangold in Basel auch als auffällige Erscheinung, meinte Dominique Spirgi in seinem Nachruf in der «TagesWoche»: «Einer, der praktisch das ganze Jahr hindurch im Rhein schwimmen ging. Und dem man mit seinem unverwechselbaren Bart in der Stadt, stets aufrecht auf seinem alten Velo sitzend und das ganz normale Stadtleben beobachtend, immer wieder begegnete.»
Gehen Sie wieder zurück auf den Weg, der am Rand des Friedhofs entlang Richtung Norden führt, und nehmen den drittnächsten Querweg. Hier ruht in Grab 46-74 der einer württembergischen Familie von Glockengiessern, Theologen und Kirchenmusikern entstammende Missionsprediger HERMANN KNITTEL (1857 – 1931). Bis 1895 im Dienst der Basler Mission im indischen Karnataka tätig, kehrte er mit seiner Schweizer Frau und drei Kindern nach Basel zurück, wo fünf weitere Sprösslinge zur Welt kamen. Sein 1891 in Dharwar geborener Sohn John, der als Mitschüler Carl Jacob Burckhardts das Humanistische Gymnasium Basel besuchte, avancierte mit spannenden Romanen, die er teilweise auch dramatisierte, zu einem der meistgelesenen Schriftsteller seiner Epoche. Der Millionenbestseller «Via Mala» wurde gleich drei Mal verfilmt: 1944 mit Carl Wery, 1961 mit Gert Fröbe und 1985 mit Mario Adorf als despotischem Familienvorstand.
Biegen Sie bei der nächsten Möglichkeit links und dann gleich wieder rechts ab. Linker Hand liegt im Grab 46-28 der langjährige Vizedirektor und Ernährungsspezialist des Basler Zolli, HANS WACKERNAGEL (1925 – 2013). Nach seinem mit der Promotion abgeschlossenen Zoologie-Studium arbeitete er eine Zeitlang als Tierpfleger im Zoologischen Garten von Philadelphia, bevor er 1956 der erste wissenschaftliche Assistent des Basler Zolli wurde. Er setzte eine moderne, wissenschaftlich fundierte Zootierernährung durch; bald stellten sich spektakuläre Fortpflanzungserfolge ein. 1973 zum Vizedirektor ernannt, war Wackernagel massgeblich an der Gründung des 1977 eröffneten Kinderzolli beteiligt und beschrieb dessen Idee so: «Die Kinder putzen die Tiere. Der Striegel ahmt knabbernde Zähne nach, Bürste und Schwamm leisten die Arbeit von Lippen und Zunge. So entstehen solide Freundschaften auch mit Tieren, die durchaus Hörner, Hufe und Zähne haben.» Und anlässlich des zehnjährigen Jubiläums bilanzierte er zufrieden: «Fast unverhofft sind wir im Kinderzolli auf die Einsicht gestossen: Wenn Du freundlich bist, kommt die Freundlichkeit zurück.»
Links zweigt ein Weg ab, an dem Sie nach wenigen Metern zu Ihrer Rechten das Grab 23-22 sehen. Der in Basel geborene, 1901 vom bayerischen Prinzregenten Luitpold in den persönlichen Adelsstand erhobene Philologe EDUARD (VON) WÖLFFLIN(1831 – 1908), 1880 bis 1905 Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, initiierte das wohl am längsten andauernde Forschungsprojekt der Welt, mit dessen Materialsammlung 1894 begonnen wurde und an dem gegenwärtig 31 Akademien und gelehrte Gesellschaften aus drei Kontinenten beteiligt sind: den «Thesaurus Linguae Latinae», das umfassendste Lateinwörterbuch aller Zeiten. Der erste Band oder genau genommen: der erste Faszikel, «a–absurdus», erschien 1900, der bislang letzte, «refocilo–regnum», im Jahr 2017. Eduard Wölfflins Sohn, der Kunsthistoriker HEINRICH WÖLFFLIN (1864 – 1945), studierte zunächst Philosophie in Basel und Berlin, dann Kunstgeschichte in München, wurde 1893 als Nachfolger seines Lehrers Jacob Burckhardt Professor für Kunstgeschichte an der Universität Basel, lehrte in Berlin, München und Zürich. Wölfflin suchte objektive Kriterien für die Kunstbetrachtung und strebte nach einem Brückenschlag zwischen Sinnesphysiologie und Wahrnehmungspsychologie. In seinen über den Vergleich von Werken der Renaissance mit Werken des Barock entwickelten «Kunstgeschichtlichen Grundbegriffen» formulierte er die fünf Gegensatzpaare «linear – malerisch», «Fläche – Tiefe», «geschlossene Form – offene Form», «Vielfalt – Einheit», «Klarheit – Unklarheit», die dauerhaft Eingang in das kunsthistorische Vokabular fanden.
Gehen Sie weiter und nehmen den vorletzten Weg auf der linken Seite. Gleich das zweite Grab zur Rechten mit der Nummer 44-32 gehört dem aus Bayern stammenden Basler Ehrenbürger LUDWIG WILLE (1834 – 1912)
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: