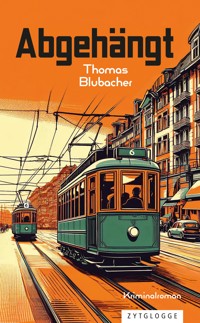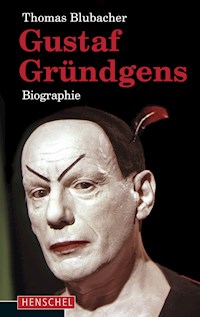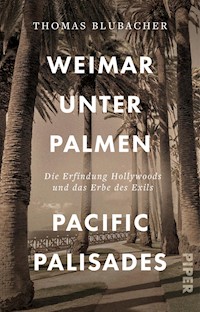
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Von Glamour und großen Geistern
Wo man ab 1911 im modernsten Filmstudio Amerikas Western drehte und 1922 das größte christliche Zentrum der Welt errichten wollte, versammelten sich nach 1933 emigrierte KünstlerInnen und Intellektuelle wie Thomas Mann, Vicki Baum und Lion Feuchtwanger. Sie machten Pacific Palisades zu einem »Weimar unter Palmen«. Dieses Buch erzählt die dort bis heute lebendige Geschichte des deutschsprachigen Exils, entwirft ein farbenfrohes Sittengemälde Hollywoods und nimmt uns mit auf eine Reise zu diesem besonderen Ort.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2022Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCovermotiv: Ed-Ni-Photo / iStock
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Ein wahres Schloss am Meer
Fritz springt von der Klippe, die Sioux tanzen, und Christus kehrt auf die Erde zurück
Methodisten campen, und ein vereinsamter Schwabe baut einen japanischen Palast
»Lass Dich anstecken von ihrem: take it easy«
»What watch?« – »Ten watch.« – »Such much?«
»Man verliert seine Heimat und gewinnt keine neue«
Goethe in Hollywood lässt sich huldigen
Der König von Pacific Palisades hilft, die toten Mäuse wegzuschaufeln
»Dieses Wesentliche aber ist unsere Arbeit«
Salka Viertel tischt Wurstsuppe auf, und Alfred Döblin sucht Gott
»Schauerlich berührt von dem schwindenden Rechtssinn in diesem Land«
Ronald Reagan spielt Helden, Henry Miller Pingpong und Jakob Gimpel Klavier
Das Erbe des Exils
Literatur
Anmerkungen
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Ein wahres Schloss am Meer
Die Luft ist frühlingshafte 22 Grad mild, es riecht nach Bougainvilleen und frisch geschnittenem Gras. Kolibris schwirren durch den blühenden Garten der Villa Aurora. Bei mir zu Hause in Basel zeigt das Thermometer jetzt, im Januar 2002, zehn Grad minus. In New York, wo ich einen Zwischenstopp eingelegt habe, um in der Public Library für mein Projekt zu recherchieren, die erste Biografie der 1935 ins amerikanische Exil gegangenen Geschwister Eleonora und Francesco von Mendelssohn, war es in den letzten Tagen kaum wärmer. Von meinem Fenster blicke ich vorbei an einem schattenspendenden Eukalyptusbaum und zwei hohen, dünnen Palmen, wie sie das bekannte Straßenbild von Los Angeles prägen, auf die Bucht von Santa Monica, deren Lichter nachts funkeln, und auf den spiegelglatten, offenbar wirklich stillen Ozean. Hier, im unmittelbar am Meer gelegenen Stadtteil Pacific Palisades, ist von der berüchtigten dicken Dunstglocke der Stadt der Engel nichts zu sehen.
Die im spanischen Kolonialstil erbaute Villa, in der ich drei Monate lang als writer-in-residence wahrlich residieren darf, wirkt unscheinbar vom Paseo Miramar aus, einer Serpentinenstraße, die sich, kurz bevor der Sunset Boulevard auf die Küste stößt, rechter Hand den steilen, von Büschen bewachsenen Hügel hinaufwindet. Von der schmalen Pforte mit der Hausnummer 520 führt eine Treppe hinab zu einem mit Azulejo-Mosaiken versehenen Patio. Erst drinnen und von der Südseite her eröffnet sich die imposante Dimension: 14 Zimmer mit 622 Quadratmetern Wohnfläche, die sich über drei Etagen erstrecken, auf einem 1765 Quadratmeter großen Grundstück. »Ein wahres Schloss am Meer«,[1] staunte Thomas Mann, und Hermann Kesten bemerkte ironisch: »So sollten Schriftsteller wohnen, […] mit zwanzig Zimmern, mit 11 Tausend Büchern […], einem hügeligen Park mit zwei Acres, einer Sekretärin und einer Frau, die kocht, gärtnert, bäckt, chauffiert und dem großen Dichter aufs Ergebenste dient, was für ein Leben.«[2] Jetzt wohne also ich dort, zusammen mit einer kasachischen Komponistin und einem österreichischen Filmemacher, ohne Sekretärin und Frau natürlich, aber der Garten wird von Juan gepflegt, die famose Betty hält unsere Zimmer in Ordnung – die beiden sind aus Mexiko und Guatemala immigriert –, und unter der Woche kümmern sich Joachim und Claudia im Büro um sämtliche Wünsche. In der Tat: Was für ein Leben.
Vor 60 Jahren war die Villa Aurora einer der wichtigsten Treffpunkte europäischer und amerikanischer Intellektueller. Zu Marta und Lion Feuchtwangers Gästen zählten neben Thomas Mann dessen Bruder Heinrich, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Bruno Frank, Franz Werfel mit Gattin Alma Mahler-Werfel, Arnold Schönberg und Kurt Weill, Ludwig Marcuse und Max Horkheimer, Charles Laughton, Peter Lorre, Ingrid Bergman und Charles Chaplin. Jetzt schlafe ich in Lion Feuchtwangers Bett. Der Schreibtisch, an dem ich arbeite, gehörte einst Franz Werfel. Er saß daran, als sein Herz zu schlagen aufhörte und er von seinem Drehsessel auf den Boden sank. Viele Jahre später wurden Werfels Möbel ebenso in die Villa Aurora gebracht wie ein mäßig bequemes Sofa Hanns Eislers. Auf dem Blüthner-Flügel von Ernst Toch spielt meine Mitstipendiatin, deren künstlerische Kompromisslosigkeit von der Presse gerühmt wird, nun unter Ausschluss der Öffentlichkeit, nur für uns, leicht konsumierbare Songs von Mariah Carey, aufmerksam beobachtet von Toch, dessen von Gustav Mahlers Tochter Anna geschaffene Büste auf einem Sims steht. Daneben zeigt eine weiße Schrift auf grünem Grund den Weg ins Exil. Heiner Müller, der 1995 als erster Gast die frisch renovierte Künstlerresidenz sozusagen trockenwohnte, machte mithilfe von Tesafilm aus dem »Exit« des Notausgangzeichens ein »Exil«. Das Exil als Notausgang, der Notausgang ins Exil. Die 34-registrige Unterhaltungsorgel, die erst noch wieder nutzbar gemacht werden wird, stand von Anfang an hier; einst diente ein solches Instrument als Statussymbol wie später ein Swimmingpool. Hanns Eisler intonierte darauf anlässlich von Feuchtwangers Einzug Üb’ immer Treu und Redlichkeit.
Auch 22 000 Bände aus Feuchtwangers letzter Bibliothek sind in der Villa Aurora geblieben, nur die 8000 wertvollsten Bücher, darunter eine Nürnberger Chronik aus dem Jahr 1493, hat man in der University of Southern California untergebracht. In einer Vitrine werden Feuchtwanger-Memorabilien aufbewahrt: ein Medikamentenfläschchen, ein Brieföffner, Papierscheren, ein Tintenfass, ein Tintenlöscher, eine Lackschatulle, ein kleines Metallkästchen und das Große Bundesverdienstkreuz, mit dem Marta Feuchtwanger 1966 geehrt wurde. Auf einem Zettel kann man in Feuchtwangers Handschrift lesen: »Ich bin ein deutscher Schriftsteller, / Mein Herz schlägt jüdisch, / Mein Denken gehört der Welt.« Doch wie in einem Museum fühlen wir uns in der Villa Aurora keine Sekunde. Nur als wir ein in die Jahre gekommenes Schnapsglas fallen lassen, durchzuckt uns der beschämende Gedanke, dass es mit ziemlicher Sicherheit Marta gehörte und vielleicht schon Einstein oder Brecht daraus getrunken haben.
Ihre Geister lassen uns in Frieden. Die großen Namen, die uns begegnen, sind andere. Pacific Palisades, das mit seinen 27 000 Seelen wie eine beschauliche Kleinstadt wirkt, mit drei Supermärkten, sieben Tankstellen, keinem Kino, aber immerhin einer bis spätabends geöffneten Buchhandlung im überschaubaren, bezeichnenderweise »The Village« genannten Zentrum, ist der Wohnort der Reichen und Berühmten. Michael Douglas, Nicole Kidman und Arnold Schwarzenegger sollen hier leben, höre ich, Anthony Hopkins, Sylvester Stallone und Whoopi Goldberg. Tatsächlich sitzt Tom Hanks im Starbucks-Café, wo ich einen Americano trinke, und an der Kasse von Gelson’s wartet Steven Spielberg. Aufgrund seiner abgeschiedenen Lage bietet Pacific Palisades ausreichend Privatsphäre. Anders als in Beverly Hills fahren durch die Straßen keine Busse auf stargazing tour, mit Neugierigen, die die Palazzi der Prominenz ablichten wollen und aufgeregt in jedem Gärtner eine Celebrity vermuten, auch Paparazzi lauern nur selten auf Beute. Wer hier wohnt, hat ohnehin regelmäßig mit Menschen, die die meisten nur von der Leinwand kennen, zu tun, sei es beruflich, sei es beim Elternabend in der Schule.
In einem Nachbarhaus der Villa, in das wir Stipendiaten eingeladen werden, um dort beim unbezahlbaren Blick über das Lichtermeer von L. A. den von einem mexikanischen Dienstmädchen servierten Kaviar in für uns gleichfalls unbezahlbaren Mengen zu löffeln – ein beinahe surreales Erlebnis –, bemühe ich mich um den sozial erforderlichen Small Talk mit einer jungen Frau, die neben mir auf der Couch lümmelt. Ich lobe die bis hin zum passenden Coffee Table Book konsequent balinesische Einrichtung. Meine Gesprächspartnerin bedankt sich, als hätte ich ihr ein Kompliment gemacht, und tatsächlich zeichnet Constance für das interior design verantwortlich. Das alles sei noch ganz neu, viele Häuser würden alle paar Monate anders möbliert und umdekoriert, zurzeit kümmere sie sich um das Anwesen von Sharon Stone. Als ein anderes Mal die Rede auf Tom Cruise kommt, fragt mich Doug, ein arrivierter junger Dramatiker, der gerade an einem Stück über den einst mit Francesco von Mendelssohn befreundeten Pianisten Vladimir Horowitz arbeitet und bei dem ich einige der interessantesten Künstler von L. A. kennenlerne – die meisten links, jüdisch und schwul –, ganz lapidar, ob ich den Megastar treffen möchte: »Shall I call him?« Viel wichtiger ist mir, dass ich Mickey Rooney kennenlernen darf, der vor fast einem Menschenleben, vor 67 Jahren, in Max Reinhardts A Midsummer Night’s Dream den Puck spielte.
Schon lange vor meiner Ankunft habe ich gelesen, dass Alfred Döblin einst über die »furchtbare Gartenstadt«[3] jammerte und Vicki Baum monierte, man könne nicht zu Fuß unterwegs sein, ohne sich verdächtig zu machen – was Thomas Mann indes nicht vom täglichen Spaziergang durch die Palisades abhielt. Also miete ich einen tomatenroten Mitsubishi, und schon bald habe ich mich nicht nur an den anfangs für mich beängstigenden Verkehr auf den vielspurigen Highways gewöhnt, sondern auch daran, fast täglich Strecken zurückzulegen wie sonst nicht in Wochen. Autofahren ist in Los Angeles eine Lebensform. Den linken Arm aus dem auf Knopfdruck heruntergefahrenen Fenster gelehnt – zu Hause muss ich natürlich noch kurbeln –, im Radio 94.7 The Wave eingestellt, sause ich zu Smooth Jazz den Paseo Miramar hinab und kaufe im Supermarkt Vons an der Ecke von Sunset Boulevard und Pacific Coast Highway rasch ein paar Bagels, Shrimps oder eine Flasche Cabernet Sauvignon, fahre nach Santa Monica, wo ich das Thai-Restaurant mit dem besten Panang Nua der ganzen weiten Welt ausfindig gemacht habe, oder kutschiere gemächlich auf dem mäandernden Sunset Boulevard durch Beverly Hills in Richtung Hollywood und Downtown, um eine Bibliothek aufzusuchen oder ins Theater zu gehen. Gleich in der ersten Woche stolpere ich eher zufällig in eine meine Vorurteile über kommerzielle amerikanische Spielpläne widerlegende Aufführung von Mephisto nach Klaus Manns Exilroman, im kleinen Actors’ Gang Theater inszeniert vom Hollywoodstar Tim Robbins. Mit Bill Cusack, dem jüngeren Bruder von John und Joan, der die Rolle des Sebastian Bruckner spielt, also quasi Klaus Mann, komme ich in ein langes Gespräch über Deutschland und die Emigration.
Überhaupt erstaunt mich, wie eng verquickt mir die beiden Grundthemen meines Aufenthalts, Hollywood und das Exil, ständig begegnen. Nicht nur als im Garten, auf der großen Terrasse und im Salon der Villa, den wir mittlerweile als unser Wohnzimmer empfinden, die Film- und Kulturszene zusammenkommt, um am Vorabend der Academy-Awards-Vergabe die deutschen Hoffnungen zu feiern. Auf der Steinbank, auf der, wie ein bekanntes Foto dokumentiert, einst Feuchtwanger und Brecht diskutierten, sitzen jetzt Udo Kier und die 68er-Ikone Uschi Obermaier, auf Martas Sofa Jürgen Prochnow und der Muskelberg Ralf Moeller. Apropos Berge: Dass die Lebensgefährtin eines Hollywoodstars, als ich erzähle, ich komme aus der Schweiz, ihre Brüste entblößt, sich rücklings auf dem Teppich rekelt und »Here are the mountains!« ruft, hätte Lion vermutlich amüsiert – seit ich in seinem Bett schlafe, wage ich, ihn zu duzen.
Als Bühnenregisseur brenne ich darauf, mehr über die in Amerika entwickelten Schauspieltechniken zu erfahren, und als Stipendiat der Villa Aurora öffnen sich mir, auch dank der Hilfe von Claudia und Joachim, sonst verschlossene Türen. Der Schauspieler Ron Gilbert, geboren als Ronald Goldstein und, wie könnte es anders sein, Sohn eines jüdischen Emigranten, verschafft mir Zugang zum legendären Actors Studio. Es ist keine Schauspielschule, sondern eine gemeinnützige Organisation, deren Mitglieder, allesamt arrivierte Profis, ihre Fähigkeiten in einer experimentellen Umgebung verfeinern möchten. Vielleicht dreißig, vierzig von ihnen kommen zweimal pro Woche zusammen, um sich Spielszenen ihrer Kolleginnen und Kollegen anzusehen, von denen manche bereits das Greisenalter erreicht, aber ganz offenbar das Bedürfnis, immer besser zu werden, nicht verloren haben, und um die Arbeit im Anschluss zu kommentieren. Typisch amerikanisch sorgt Ron mit Charme und Chuzpe dafür, dass alle mich beachten. Frances Fisher kenne ich aus dem Blockbuster Titanic als Mutter von Rose, Bruno Kirby aus Filmen wie Birdy,When Harry Met Sally oder City Slickers und natürlich als Vito Corleones Freund Peter Clemenza in The Godfather Part II. Wo meine Kenntnisse erschöpft sind, hilft Ron mir diskret auf die Sprünge, bei Terry Moore etwa, die schon als junges Mädchen nicht nur mit Shirley Temple und Judy Garland drehte, sondern auch mit Emigranten wie Albert Bassermann, später Filmpartnerin von Burt Lancaster und Fred Astaire war und – nach eigenen Angaben – von 1949 an die geheime Ehefrau von Howard Hughes, was Ron selbstverständlich erwähnt und ihr damit ein Lächeln entlockt.
So fahre ich nun immer mittwochs und freitags in die knapp 30 Kilometer entfernte De Longpre Avenue 8341 zum einstigen Haus des Westernhelden William S. Hart, von dessen großer Bedeutung für die Historie von Pacific Palisades ich freilich noch nichts ahne. Als foreign observer darf ich an allen sessions teilnehmen, mich aber nicht zu Wort melden. Später werde ich in New York erleben, wie streng das dort von den moderators Ellen Burstyn, Lee Grant und Estelle Parsons gehandhabt wird. Hier an der Westküste geht alles deutlich entspannter zu, bei Kaffee und Cookies vor Beginn und in den Pausen ohnehin. Wieder bin ich verblüfft ob des unerwartet großen Interesses an deutscher Kultur, erstaunt vor allem darüber, dass man mich ausgerechnet hier, im Mekka des Method Acting, das den typisch amerikanischen Schauspielrealismus, wie er das Hollywoodkino bis heute prägt, zur Vollendung gebracht hat, auf Bertolt Brecht anspricht und dessen Verfremdungseffekt diskutieren will.
Auch der Oscargewinner Martin Landau interessiert sich dafür. Der Sohn eines aus Österreich eingewanderten Juden, welcher darum kämpfte, seine Verwandten vor der Shoah zu retten, besuchte als junger Schauspieler das Actors Studio in New York gemeinsam mit James Dean und Steve McQueen, jetzt teilt er sich die Leitung des Studios West mit Mark Rydell, dem Regisseur von Filmen wie On Golden Pond mit Katharine Hepburn und Henry Fonda oder For the Boys mit Bette Midler. Wie Marty stammt auch Mark von jüdischen Immigranten ab, seine Großväter Abraham Rubinstein und Michael Cohen kamen in den 1880er-Jahren aus Russland nach New York. Vor allem von ihm werde ich in den nächsten Wochen viel lernen.
So allgegenwärtig und groß mir das Thema Emigration in L. A. zu sein scheint, ich schreibe an der Lebensgeschichte zweier Berliner, die in den 1930er-Jahren hierherkamen, und interessiere mich vor allem für die Zeit, in der Pacific Palisades zum »Weimar unter Palmen« wurde, und das im doppelten Sinne: Zwischen den Bergen und der Bucht von Santa Monica versammelten sich einige der wichtigsten Exponenten des Kulturlebens der Weimarer Republik auf ähnlich kleinem Raum wie einst die bedeutenden Geistesgrößen im Weimar der Goethezeit. Mit Marta Feuchtwanger sei 1987 die letzte Repräsentantin des deutschen Exils in Los Angeles gestorben, heißt es gewöhnlich, und sie war tatsächlich die Letzte aus dem engeren erlauchten Kreis ebenjenes sonnenbeschienenen, palmenbeschatteten Weimars. Noch aber scheint dessen Erbe lebendig, und einige Menschen, die Zeugnis von jener Zeit ablegen können und die ich nun kennenlernen darf, sind trotz ihres Alters höchst agil.
Wenige Meter bergauf von meinem temporären Zuhause lebt im Paseo Miramar 540 der fast 90-jährige Konrad Kellen, der einstige Privatsekretär Thomas Manns. Zwei Jahre nur war er für den »Zauberer« tätig, vor nunmehr sechs Jahrzehnten, doch nichts scheint präsenter in seinem Leben als der hochverehrte Autor. »Er schrieb damals jeden Tag von neun bis zwölf am vierten Band des Joseph, alles mit der Hand, und gab mir das zur Abschrift«,[4] erinnert sich Kellen und zeigt in seiner Bibliothek stolz eine gerahmte Fotografie des Dichters, gewidmet »Konrad Katzenellenbogen – dankbar für seine Hilfe«.
Als Konrad Moritz Adolf Katzenellenbogen kam er 1913 in Berlin zur Welt. Seine Familie gehörte zum deutsch-jüdischen Großbürgertum; der Vater Ludwig hatte ein Firmenimperium aufgebaut und war unter anderem Generaldirektor der Brauerei Schultheiß-Patzenhofer. In der Stadtvilla und auf dem stattlichen Rittergut in der Nähe von Oranienburg mit dem schönen Namen Freienhagen verkehrte die beste Gesellschaft, Albert Einstein gehörte zur Verwandtschaft. Kunst und Kultur waren selbstverständlicher Bestandteil des Familienalltags. Die Mutter nannte eine bedeutende Sammlung französischer Impressionisten ihr Eigen, der Vater finanzierte das linkspolitische Theater des avantgardistischen Regisseurs Erwin Piscator und heiratete 1930 in zweiter Ehe die Schauspielerin Tilla Durieux, die meistporträtierte Frau ihrer Zeit, die unter anderem von Corinth, Kokoschka, Liebermann, Renoir, Slevogt und Stuck gemalt worden war.
Auf Wunsch des Vaters, der sich erhoffte, dass sein Sohn die Nachfolge in der Firmenleitung antreten werde, begann Konrad in Heidelberg das Studium der Rechte, nach einem Semester wechselte er an die Universität München. Dort hielt der Rektor bei einer Gedenkfeier »eine zündende Rede über die herrliche Schlacht von Langemarck«, die im Herbst 1914 in der deutschen Propaganda zum Mythos jugendlicher Kriegsbegeisterung verklärt wurde. Noch heute merkt man Kellen die Erregung an: »Kaum war er damit fertig, ging zu meiner Überraschung und zu meinem Entsetzen ein ungeheurer Jubel der Studentenschaft los. Und ich sagte mir: Um Gottes willen, hier kann man doch nicht leben, besonders nicht als Rechtsstudent. Hier muss ich weg.« Er übersiedelte nach Paris, hielt sich in Holland und Jugoslawien auf, plante die Auswanderung nach Indonesien – und emigrierte schließlich nach New York. »Da ich es aber weder zu Geld noch zu Ruhm gebracht habe in New York, bin ich nach Los Angeles gekommen, um mein Glück zu versuchen.«
Durch Erika Mann erfuhr er, dass deren Vater einen Sekretär suchte, und bewarb sich. »Wie viele deutsche Knaben und deutsche Mädchen war ich ein Bewunderer seiner Werke, besonders des Felix Krull.« Thomas Mann fand Gefallen an »Konny«, und so kam dieser ab 1941 täglich zu ihm, tippte jeweils zwei bis drei neue Manuskriptseiten ab und half ihm bei seiner umfangreichen Korrespondenz. Natürlich lernte Konrad auch andere Exilanten wie Bruno Frank, Lion Feuchtwanger oder den Dirigenten Bruno Walter kennen, doch blieb der Kontakt flüchtig: »Die Emigranten waren alles gesetzte Herren, die sich groß über die Zukunft der Welt unterhalten haben, aber ich war in den Zwanzigern und war ein junger Mann.« Die Faszination, die Thomas Mann auf Kellen ausübte, ist noch heute ungebrochen. »Er war eher ein Hörer als ein Erzähler. Das war den Leuten nie klar, die sich mit ihm über die Welt unterhalten wollten. Er hat zwar gerne zugehört, aber er hat selbst keine großen Aussprüche getan. Das hat die Leute immer frustriert, die glaubten, wenn sie mit dem großen Mann sprechen, dann muss er vor Weisheit nur so träufeln in ihre Köpfe. Wenn ihm jemand von einer Reifenpanne erzählt hat, dann hat das Thomas Mann mehr interessiert, als wenn er ihm seine Meinung über Goethe gesagt hat.«
Im August 1943 wurde Kellen, wie sich Katzenellenbogen nach einem kurzen Versuch mit dem Namen Bogen nun nannte, in die Armee eingezogen und diente in einer Propagandaeinheit. »Man musste mich als Soldaten gegen die Festung Europa werfen, um den Krieg zu gewinnen«, scherzt er. Nach Kriegsende als Besatzungsoffizier in Deutschland stationiert, war er an den zunehmend laxer werdenden Entnazifizierungsverfahren beteiligt, später dann in den USA im Staatsdienst tätig. Stets hielt Kellen den Kontakt zu Thomas Mann aufrecht, auch nachdem dieser Pacific Palisades verlassen und sich in Kilchberg am Zürichsee niedergelassen hatte. »Er hat sich in der Schweiz wohlgefühlt, das hat er sich nach dem Kriege in Deutschland nie. Er war enorm von den Deutschen enttäuscht nach dem Kriege. Vor allen Dingen hat ihn erschüttert, dass so furchtbar viele Deutsche keine richtigen Antinazis waren, sondern immer irgendetwas an den Nazis haben gelten lassen. Er hat gesprochen von den ›Menschen mit verjauchten Gehirnen‹. Und diese Sucht der Deutschen, sich zu entschuldigen für den Nazismus und ihn mit reinzuziehen, hat ihn ungeheuer entfremdet von den Deutschen.«
Mit großer Skepsis hat Kellen daher im letzten Jahr Heinrich Breloers viel gelobten Fernsehdreiteiler über die Familie Mann mitsamt den publizistischen Begleiterscheinungen verfolgt, die er »das Gefeiere da« nennt. Breloer hatte unter anderem in der Villa Aurora gedreht und auch Kellen über dessen einstigen Arbeitgeber befragt: »Ich wusste nicht, was die Leute über Mann hören wollen. Eine Weile haben sie ihn geradezu gehasst, jetzt wird er groß gefeiert. Das hätte ihm nicht gefallen. Ich kann nicht für ihn sprechen, aber da bin ich sicher. Die Deutschen wollen Thomas Mann vereinnahmen, aber er war wirklich ein Weltbürger geworden, und deswegen hat er auch in der neutralen Schweiz so gerne gelebt.«
Auch für Kellen selbst kam eine Rückkehr nach Deutschland nie infrage: »Nichts war mir ferner auf dieser ganzen Welt einschließlich dem Mond, als je nach Deutschland zurückzugehen. Das ist für mich eine unvorstellbare Angelegenheit. Das soll nicht heißen, dass ich die Deutschen hasse, aber unter den Deutschen zu leben, das wäre für mich, wie unter den Hottentotten zu leben.« Der höfliche, fast bescheiden wirkende alte Herr sagt das ganz ruhig, ohne sich zu echauffieren, formuliert bewusst, manchmal zögernd. »Es ist schade, dass ich den täglichen Umgang mit meiner Muttersprache verloren habe«, verabschiedet sich, völlig akzentlos, der sportlich wirkende Greis vor seinem flachen, lang gestreckten Haus, in dessen Garten die üppigen Blüten in der kalifornischen Sonne leuchten. »Aber vielleicht könnte ich ja versuchen, etwas auf Deutsch zu schreiben, für eine Schweizer Zeitung?«
Bei einer Veranstaltung in der Villa Aurora komme ich mit Walter Arlen ins Gespräch, geboren 1920 als Walter Aptowitzer in Wien. Nachdem sein Vater 1938 von den Nationalsozialisten festgenommen und in ein Konzentrationslager deportiert, seine Mutter in eine Nervenheilanstalt eingeliefert worden war, wanderte er im März 1939 allein zu Verwandten nach Chicago aus; 1946 konnte er seine Familie in London wiedersehen. Erst arbeitete er in einem Kürschnergeschäft und studierte nebenbei Komposition, 1952 bis 1980 schrieb er Musikkritiken für die Los Angeles Times, 1969 gründete er die Musikabteilung der Loyola Marymount University, der er bis 1990 vorstand. Als ich ihn nach den Mendelssohns frage, erinnert er sich an eine Max-Reinhardt-Inszenierung von Maria Stuart mit Eleonora in der Titelrolle, die er knapp 14-jährig im Wiener Theater in der Josefstadt gesehen hat. Viele der Mitwirkenden gingen später wie er ins amerikanische Exil, auch der 24-jährige Darsteller von Maria Stuarts Liebhaber Mortimer, Herbert Berghof, der dann in New York als Schauspiellehrer Weltstars wie Al Pacino, Robert De Niro und Liza Minnelli ausbildete.
Eine Dame Anfang sechzig stellt sich als Barbara Zeisl Schoenberg vor. Die Tochter des 1959 in Los Angeles verstorbenen österreichischen Komponisten Eric(h) Zeisl, eines Spätromantikers, der im Exil Filmkomponist bei Metro-Goldwyn-Mayer in »Schein-Heiligenstadt«,[5] wie er Hollywood doppelbödig bezeichnete, und auf Empfehlung Igor Strawinskys Kompositionslehrer am City College war, und Schwiegertochter des ungleich berühmteren Schöpfers der Zwölftontechnik Arnold Schönberg[6] ist ausgestattet mit einer Mischung aus verblichenem Wiener Charme und unverwüstlichem jüdischem Humor. Promoviert wurde sie mit einer Dissertation über den Kaffeehausliteraten Peter Altenberg; passenderweise lädt sie mich zum Kaffee zu sich ein und nimmt mir auch die Dreistigkeit nicht übel, mit der ich eine selbst gebackene Sachertorte erbitte.
Einige Tage später läute ich in der North Rockingham Avenue 116, der Villa im spanischen Kolonialstil in Brentwood, die Schönberg im Mai 1936 bezog und bis zu seinem Tod 1951 bewohnte. In prominenter Nachbarschaft: In der Straße lebten der Komponist Cole Porter, die Filmstars Tyrone Power, Johnny Weissmuller, Paul Henreid, Bette Davis und Shirley Temple. Letztere, in Nummer 231 zu Hause, verdiente 1938 mit 307 014 Dollar etwa 60 mal so viel wie ihr Nachbar Schönberg. Früher seien die Sightseeing-Busse im Schritttempo vorbeigefahren, erzählt Barbara, zu Shirley Temples ehemaligem Anwesen auf der gegenüberliegenden Straßenseite seien es nur wenige Schritte. Seit einigen Jahren aber konzentriere sich das Interesse auf die North Rockingham Avenue 360, obschon das Haus, in dem der des Mordes an seiner Exfrau Nicole angeklagte ehemalige American-Football-Spieler O. J. Simpson wohnte, mittlerweile abgerissen wurde.
Im Haus der Schoenbergs – Barbaras Mann Ronald, der seinem Vater frappant ähnelt, sagt nur kurz Hallo – spürt man noch immer die Aura des berühmten Komponisten. Die Einrichtung im Salon scheint unverändert, auf dem Flügel steht ein Foto, das Schönberg an ebenjenem Instrument zeigt, über dem Sofa hängt ein entsprechendes Bild. Barbara erzählt von ihrem Sohn Randol, der sich als brillanter Anwalt Maria Altmanns, der Nichte und Erbin des 1945 im Schweizer Exil gestorbenen Wiener Zuckerfabrikanten und Kunstsammlers Ferdinand Bloch-Bauer, gerade um die Rückgabe einiger Klimt-Gemälde bemüht. 2006 werden sie von der Republik Österreich tatsächlich restituiert werden, vier davon werden bei Christie’s in New York 192,7 Millionen Dollar einbringen. Das berühmteste, Ferdinands Ehefrau darstellende Bild Adele Bloch-Bauer I, die »Goldene Adele«, wird der Unternehmer Ronald Lauder für 135 Millionen Dollar erwerben und Randol Schoenberg laut Presseberichten 40 Prozent des Erlöses erhalten. 2015 wird der Spielfilm Woman in Gold in die Kinos kommen, mit Helen Mirren als Maria Altmann, Ryan Reynolds als Randol und Frances Fisher, die ich im Actors Studio kennengelernt habe, als Barbara.
Die echte Barbara berichtet mir im Januar 2002 nicht nur sichtlich stolz von ihrem Filius, sie zeigt sich auch an meiner Arbeit interessiert. Als sie hört, Francesco von Mendelssohn habe einige Jahre als Cellist konzertiert, greift sie zum Telefon, ruft eine Freundin aus dem Tennisclub an und kündigt ihr unseren Spontanbesuch an. Auf dem kurzen Weg in den South Bundy Drive 400 erzählt sie mir lediglich, der längst verstorbene Mann ihrer Freundin sei ebenfalls Cellist gewesen, es sei doch möglich, dass diese etwas wisse, das ich für meine Biografie verwenden könnte.
Die Tür wird von einer 90-Jährigen im Overall geöffnet, die augenscheinlich bis eben mit Bildhauerarbeiten in ihrem Atelier beschäftigt gewesen ist, sie zeigt nicht ohne Schaffensstolz einige Skulpturen, abstrahierte Vögel aus Alabaster und völlig Abstraktes aus Carrara-Marmor, dann bittet sie uns in den Salon. Freundlich, aber bestimmt erklärt sie, sie könne mir nicht helfen, sie habe sich nie für den Beruf ihres Mannes interessiert. Der war, so höre ich nun, Gregor Piatigorsky, und ich weiß zwar, dass er zu den bedeutendsten Cellisten des letzten Jahrhunderts zählte, wie eng »Grischa« und »Cecso« befreundet waren, weiß ich aber leider noch nicht, und da ich folglich nicht nachbohre, erfahre ich es an diesem Nachmittag auch nicht. Und doch wird dieser mir unvergesslich bleiben: Über der alten Dame hängt an der Wand ein Gemälde von Modigliani, und als ich es rühme, fragt sie, ob ich mich für Kunst interessiere: »Vous vous intéressez pour l’art?« – sie parliert ausschließlich französisch mit mir. Als ich, weiß Gott nicht aus Höflichkeit, bejahe, führt sie mich zu Bildern von Chagall, Degas, Manet, Pechstein, Soutine und Toulouse-Lautrec, einer Sammlung von Impressionisten und Expressionisten, um die sie manches Museum beneiden dürfte.
Erst auf der Rückfahrt klärt mich Barbara lachend auf: »Habe ich dir nicht gesagt, dass Jacqueline eine geborene Rothschild ist?« Die Tochter des Bankiers Édouard de Rothschild floh kurz nach Kriegsbeginn mit ihrem Gatten aus Frankreich in die USA, auch sie waren einst in der Villa Aurora regelmäßig zu Gast bei den Feuchtwangers. Ihre von keinem Geringeren als Frank Lloyd Wright umgebaute Villa, in der ich Jacqueline Rebecca Louise de Rothschild Piatigorsky besucht habe, wird nach deren Tod mit 100 Jahren abgerissen werden, und nicht wenige der von mir bewunderten Kunstwerke werden, vom Auktionshaus Christie’s nur unzulänglich in einem Storage in Brooklyn gelagert, dem Hurrikan Sandy zum Opfer fallen.
Zur bei Weitem eindrücklichsten Begegnung wird für mich aber jene mit Ann Sommer, die noch ein Jahr älter als Jacqueline Piatigorsky ist, also 91. Die Witwe des 2000 verstorbenen Filmkomponisten Hans Sommer lerne ich ebenfalls bei einer Veranstaltung in der Villa Aurora kennen und besuche sie von da an regelmäßig in ihrem Häuschen im Mount Holyoke Drive 569, genau acht Fahrminuten vom Paseo Miramar entfernt. Auch Ann sitzt noch selbst am Steuer, fährt weit schneller und furchtloser als ich, und jedes Mal bin ich erleichtert, wenn wir heil bei dem chinesischen Lokal ankommen, das sie liebt, weil man für eine Handvoll Dollar vom Buffet schlemmen kann, so viel man möchte. Nach und nach erzählt mir die gebürtige Berlinerin von ihrer Familie, ihrer Flucht, ihren Exilerfahrungen. Für mich ist das mindestens so interessant wie die Lektüre von Marta Feuchtwangers Erinnerungen oder von Thomas Manns Tagebüchern, es ist unmittelbarer und berührt mich mehr. Auch, weil ihre Schwiegertochter Veronika meint, »Moppi«, die seit 1939 nie mehr deutschen Boden betreten hat, habe noch nie so freimütig und ausführlich berichtet.
»Ich war ein High-Society-Girl«,[7] lacht Ann, die in ihrer Jugend von einem heute nur noch schwer vorstellbaren Luxus umgeben war, dem verlorenen Reichtum aber keine Träne nachweint und lediglich eines vermisst: eine großformatige Zeichnung, die Max Liebermann von ihrem Großvater Oscar Huldschinsky angefertigt hatte und die bis zur Emigration 1939 im Salon ihrer Eltern hing. Nicht nur zum Porträtierten hat Ann einen engen Bezug, auch mit dem Maler ist sie um ein paar Ecken verwandt: Seinen ersten Malkasten hatte Liebermann als Kind aus den Händen seines Onkels Ferdinand Reichenheim bekommen, der wiederum Anns Urgroßonkel war. Ihr Großvater zählte zu den wichtigsten Repräsentanten der schlesischen Schwerindustrie in Berlin; das Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre in Berlin listet ihn 1913 mit einem Vermögen von 27 Millionen Mark auf Rang zwölf der reichsten Einwohner. Oscar Huldschinsky und seine aus der Wiener Bankiersfamilie Brandeis-Weikersheim stammende Frau Ida besaßen neben einer Stadtwohnung eine repräsentative Sommervilla am östlichen Ufer des Wannsees, deren Räume eine Sammlung alter Meister schmückte, Gemälde von Frans Hals, Rembrandt, Rubens, Botticelli, Tiepolo und Sebastiano del Piombo sowie der einzige Raffael in einer deutschen Privatsammlung. Oscars jüngste Tochter Susanne heiratete den Physiker Otto Reichenheim, einen Freund Albert Einsteins und späteren Kollegen von Otto Hahn und Lise Meitner; auch er gehörte zu einer der bekanntesten jüdischen Familien Berlins, die mit vielen anderen einflussreichen Familien verschwägert war. So hatte zum Beispiel seine Cousine Charlotte, im Familienkreis »Tante Lotte Fettgenick« gerufen, 1902 den Bankier Paul von Mendelssohn-Bartholdy geheiratet und ebenfalls eine erlesene Kunstsammlung zusammengetragen, zu der schon um 1910 Werke Pablo Picassos zählten.
Ich horche auf, nicht Picassos wegen, sondern beim Namen Mendelssohn. Ja, auch mit Eleonora und Francesco habe sie verkehrt, erzählt Ann, und sie sei mit Anthony Goldschmidt befreundet, der als Kind Francesco bei seinem Großvater Jakob Goldschmidt erlebt habe und inzwischen ein »ganz kolossal erfolgreicher Filmproducer« sei. Ich müsse Anthony unbedingt treffen, der kenne »eine ganz reizende Anekdote«[8] …
Otto und Susanne Reichenheim, Anns Eltern, lebten verglichen mit den Mendelssohns oder Anns Großvater Oscar Huldschinsky bescheiden, doch auch in ihrem Haushalt sorgten eine Köchin und ein Küchenmädchen, zwei Dienstmädchen und eine Kammerjungfer, ein Gärtner und ein Chauffeur für ein angenehmes Leben; gab man größere Gesellschaften, lieh man sich Diener von Huldschinsky aus. Um die 1910 geborene Anna-Susanne warben mehrere Millionärssöhne, doch zum Entsetzen ihres Großvaters verliebte sie sich in den Pianisten, Komponisten und Dirigenten Hans Sommer, dessen Jazzmusik sie schon als 14-jähriger Backfisch mit Begeisterung im Radio gelauscht hatte. »Manche Leute heiraten ihren Kutscher«,[9] soll der standesstolze Huldschinsky, der sogar den ihm vom Kaiser offerierten Adelstitel abgelehnt hatte, angesichts dieser Mesalliance mit einem Künstler, der noch dazu kein Jude, sondern ein »Goj« war, ausgerufen und seiner Enkelin mit Enterbung gedroht haben. Gut fünf Wochen nach dem Tod ihres Großvaters heiratete Anna-Susanne 1931 den von ihm als »Gaukler« beschimpften Hans Sommer. Von 1933 an war er vorwiegend für den Film tätig; bis heute am bekanntesten ist Jawohl, meine Herr’n, ein übermütiges Lied, das Hans Albers und Heinz Rühmann 1937 in der Kriminalfilmparodie Der Mann, der Sherlock Holmes war singen und das zum veritablen Schellack-Hit wurde. Um weiterhin im Reich arbeiten zu können, war er, nachdem er »den Nachweis der arischen Abstammung bis zu den Großeltern ordnungsgemäß«[10] erbracht hatte, der Reichsfachschaft Film beigetreten.
Im Dezember 1937 wurde Sommer während einer laufenden Theatervorstellung verhaftet und zur Gestapozentrale in der Wilhelmstraße gebracht. Er sollte eine Erklärung unterzeichnen, dass er sich von seiner jüdischen Frau scheiden lasse – dass sie überhaupt jüdisch war, war Anna-Susanne bis zur Machtübergabe an die Nazis kaum bewusst gewesen, noch nie hatte sie eine Synagoge besucht. Da für Sommer eine Trennung nicht infrage kam, wurde er im Januar 1938 aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen; als »jüdisch Versippter« besaß er gemäß Paragraf 10 der I. Durchführungsverordnung zum Reichskulturkammergesetz vom 1. November 1933 nicht »die erforderliche Eignung im Sinne der nationalsozialistischen Staatsführung«.[11] Doch ein halbes Jahr später erteilte ihm Joseph Goebbels, der wie Hermann Göring und Adolf Hitler insbesondere von einem Marsch begeistert war, den Sommer für den Film Kinderarzt Dr. Engel geschaffen hatte, eine »jederzeit widerrufliche Sondergenehmigung«,[12] weil er sich die Komposition von »Kindermärschen« wünschte.
In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde Anna-Susannes Onkel Paul Huldschinsky, der im Jahr zuvor in die USA emigriert, aber wieder nach Berlin zurückgekehrt war, um seine Familie abzuholen, in einem Hotel festgenommen und ins KZ Oranienburg verschleppt. Dank einflussreicher Kontakte konnte Hans Sommer seine Freilassung erwirken und erwartete ihn am 22. November persönlich am Lagertor. Paul Huldschinsky, seine Frau, deren Tochter aus erster Ehe und die gemeinsame Tochter bestiegen in Hamburg die SSPresident Roosevelt und fuhren nach New York.
Hans Sommer, der natürlich um die Gefährdung seiner jüdischen Frau und des 1935 geborenen Sohnes Michael, laut den »Nürnberger Rassegesetzen« »Mischling 1. Grades«, wusste, forcierte nun die Auswanderung seiner kleinen Familie. Mit guten Beziehungen zu Bekannten, die er selbst als »Gangsterbande« bezeichnete, und mit 15 000 Reichsmark gelang es ihm am 9. Januar 1939, Reisepässe zu besorgen. Als kurz vor der geplanten Abfahrt der Telefonanruf einer früheren Geliebten von Hans, die nun mit einem hohen SS-Würdenträger liiert war, die Sommers vor der unmittelbar bevorstehenden Verhaftung warnte, verließen sie ihr Berliner Zuhause fluchtartig. Die Lichter ließen sie brennen, die Nachbarn sollten glaubten, sie seien noch daheim. Durch Vermittlung von Freunden hatten sie ein einmonatiges Visum für Dänemark erhalten. Harry Warner, einer der vier Warner-Brüder, und Louis B. Mayer von Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) hatten Affidavits für die USA ausgestellt. Am 10. Februar 1939 schiffte sich die Familie in Kopenhagen auf der SSErria ein, über Jamaica und durch den Panamakanal ging die Fahrt nach Los Angeles, wo der Ocean-Liner am 18. März anlegte. Beachtliche 38 Koffer hatten sie mitgenommen, und Ann erzählt, die Amerikaner hätten sich kringelig gelacht, als sie ihr aufgesticktes Monogramm auf der Bettwäsche gesehen hätten: ASS. Anna-Susanne Sommers Mutter Susanne Reichenheim starb noch im Februar 1939 an einer Lungenentzündung, der Vater überlebte die Shoah in England, die vier Geschwister gingen ins Exil nach Brasilien, England und in die Schweiz.
Zunächst kamen die Sommers bei Paul Huldschinsky im Rodeo Drive 310 in Beverly Hills unter. Hans wurde in den Warner-Studios von Harry Warner persönlich empfangen, der nicht nur mit Interesse Anna-Susannes Pass mit dem eingefügten Namen »Sara« begutachtete, sondern ihrem Mann einen Fünfjahresvertrag mit einer Wochengage von 100 Dollar anbot. Da sie aber nur befristete Besuchervisa besaßen, mussten sie noch einmal ausreisen. Wie fast alle in dieser Lage fuhren die Sommers nach Mexiko und harrten in Nogales an der Grenze zu Arizona aus, wo Hans sich und seine Familie als Barmusiker durchbrachte. Trotz der Unterstützung durch Warner Bros. und MGM erhielten sie abermals nur visitor visa, reisten damit am 12. Juni beim texanischen El Paso wieder in die USA ein, wohnten vorübergehend bei Paul Huldschinsky, der inzwischen in die Via Florence 370 in Pacific Palisades gezogen war, und kehrten kurz darauf nach Mexiko zurück, abermals in der Hoffnung, die USA endlich als legale Einwanderer mit quota visa betreten zu können. Diesmal brachte man sie ins 85 Kilometer südlich von Mexico City gelegene Cuernavaca, wo sich in der Pension Mueller Juden und Nazis beim gemeinsamen Frühstück, Mittag- und Abendessen die Hand reichten.
Ich merke, wie schwer es Ann fällt, von diesen gut anderthalb Jahren in Mexiko zu erzählen, erfahre nur, dass ihr Mann lebensbedrohlich an Ruhr erkrankte, sie selbst an einer Gehirnhautentzündung, beinahe sei sie erblindet.
Am 31. Mai 1941 konnten die Sommers in Mexico City endlich ein Flugzeug nach Los Angeles besteigen und sich dauerhaft dort niederlassen. Zunächst lebten sie erneut bei Paul Huldschinsky, der zu dieser Zeit mit Thomas Mann die Inneneinrichtung von dessen geplantem Neubau im San Remo Drive besprach, dann fanden sie ein kleines Haus in der Cheremoya Avenue 2271 in Hollywood. Mit dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten am 8. Dezember 1941 wurden sie wie alle Deutschen über 14 Jahren zu enemy aliens, feindlichen Ausländern. Jeden Abend mussten sie von acht Uhr an zu Hause sein und durften sich nur noch in einem Fünfmeilenradius um ihre Wohnung bewegen. Zwar konnte Hans Sommer für die Warner-Studios in Burbank arbeiten, aber nie mehr an seine Erfolge in Deutschland anknüpfen; unzählige Komponisten, darunter viele Emigranten, konkurrierten um die Aufträge. Später schrieb er die Musik zu Douglas Sirks 1950 gedrehtem Drama The First Legion, 1954 dirigierte er Bronisław Kapers Musik für das Filmmusical Lili, die er arrangiert und teilweise mitkomponiert hatte und die mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.
Hans Sommer beantragte in der Bundesrepublik Wiedergutmachungszahlungen für sich, nicht aber für seine Frau Ann, wie sie sich nun amerikanisiert nannte. Teils aus Stolz, weil er der Ernährer der Familie sein wollte, teils, weil er zeit seines Lebens unter der Verfolgungserfahrung litt, mit deutschen Behörden möglichst wenig zu tun haben und schon gar nicht auf Anns jüdische Abkunft verweisen wollte – so zumindest erzählt es mir Ann. Erst 1979 habe es Hans Sommer gewagt, bei der GEMA eine vollständige Liste seiner in Deutschland noch immer gespielten Musikstücke einzureichen, um die ihm zustehenden Tantiemen zu erhalten, doch habe man ihn mit der Anerkennung von lediglich zwei Titeln abgespeist. Als sie selbst, die als Immobilienmaklerin den Lebensunterhalt für die finanzielle Not leidende Familie verdient habe, endlich von Gesetzes wegen auch ohne Einwilligung des Ehemannes ihre Ansprüche hätte geltend machen können, sei die Einklagefrist für Reparationen bereits abgelaufen gewesen. Auf meine Frage, wie sie die schwere Zeit der Emigration habe überstehen können, lächelt Ann: »Ich bin als Kind so geliebt und so mit von Herzen ausgesuchten Geschenken überschüttet worden, dass es mir Kraft für mein ganzes Leben gab.«
Ich bleibe mit Ann, der letzten Bewohnerin von Pacific Palisades, die noch aus eigenem Erleben vom »nervösen Schrecken der Heimatlosigkeit« und vom »Herzasthma des Exils«[13] berichten kann, wie das Thomas Mann formulierte, auch nach meiner Zeit in der Villa Aurora in Kontakt; schon ein Jahr später, als ich für eine Theaterregie nach Los Angeles zurückkehre, sehe ich sie wieder.
Das letzte Mal besuche ich Ann, die 2009 unverschuldet Opfer eines Verkehrsunfalls werden wird, am 25. Februar 2007 – das Datum kann ich im Rückblick mühelos eruieren, denn wir feiern unsere kleine, private Oscarparty. Tags zuvor war ich auf dem traditionellen Empfang für die deutschen Nominierten in der Villa Aurora, ein wenig wehmütig, fünf Jahre nach meinem Stipendium. Nun sitzen die bald 97-Jährige und ich in ihrem altersschwachen Häuschen in Pacific Palisades nebeneinander auf dem Sofa, trinken Sekt, essen Canapés und verfolgen die viele Stunden dauernde Liveübertragung der Zeremonie. Ich finde alles schrecklich glamourös, Ann scheint enttäuscht: »Früher waren die Kleider schöner.« Über Hollywood und seine Stars haben wir nie gesprochen, jetzt erzählt sie während der nicht gerade raren Werbeunterbrechungen, wen sie in den 1940er-Jahren alles kennengelernt hat, schwärmt von Greta Garbo, vom MGM-Chefkostümbildner Gilbert A. Adrian und dessen eleganten Kreationen – und von der Oscarverleihung 1945, die sie in Grauman’s Chinese Theatre miterlebt hat. »Onkel Paul bekam einen Academy Award für die Bauten zu George Cukors Gaslight mit Ingrid Bergman. Und als er gefragt wurde, woher er die brillante Idee für die Einrichtung genommen habe, da hat er geantwortet: ›Ich habe den Set ganz einfach so eingerichtet, wie wir zu Hause in Berlin gelebt haben.‹«