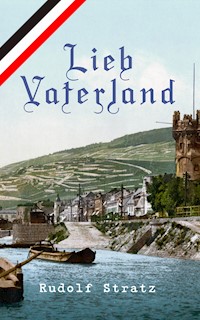
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Lieb Vaterland" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Karl Feddersen hatte inzwischen mit seinem Bruder im Hotel Adlon diniert. Alexandre Feddersen war blond und blauäugig, von unverkennbar teutonischem Typus wie er, aber kleiner und von schmächtiger Gestalt. Paris, sein langjähriger Aufenthaltsort, hatte auf ihn abgefärbt. Sein Gesicht war blaß und nervös, er gestikulierte im Sprechen viel mit den Händen. Mit seinem Spitzbart und dem Zwicker vor den Augen erinnerte er an einen französischen Advokaten." Rudolph Stratz (1864-1936) war ein erfolgreicher Romanschriftsteller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lieb Vaterland
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
In diesen Tagen, da es wieder ein Glück und ein Stolz ist, ein Deutscher zu sein, nahm ich dies Buch zur Neubearbeitung in die Hand, das ich vor Jahren im tiefsten Frieden schrieb. Im scheinbaren Frieden der Tage zwischen Algesiras und Agadir, blauer Himmel und goldene Sonne über Deutschland, Tages Arbeit und Abends Feste und die ganze Welt bei uns als Gäste, und um uns, unsichtbar spinnend, lautlos wühlend, rastlos geschäftig, die lauernde Todfeindschaft einer ganzen Welt. Und in unseren Seelen bei manchem doch wohl ein Ahnen der kommenden, ehernen Notwendigkeit: »Was du ererbt von deinen Vätern hast – erkämpf' es, um es zu besitzen!« Kämpfen aber, so kämpfen wie das deutsche Volk in diesen herrlich großen Tagen kann man nur für das, was man mehr liebt als sich selbst: das Vaterland. Auf unser liebes deutsches Land wollte ich damals, für mein bescheidenes Teil, mit diesem Buch Blicke und Herzen wenden, in einer Zeit, wo vielfach und gottlob nur äußerlich Ausländerei uns umnebelte.
War das wirklich einmal? Wir wissen's kaum mehr! So Gewaltiges und Wunderbares ist uns seitdem widerfahren. Wenn jetzt »Lieb Vaterland« in seiner neuen Gestalt wieder vor die Leser tritt, wird es emporgehoben und mitgerissen, wie ein Blatt im Sturm, von einem Ruf wie Donnerhall aus Schloß und Hütte, von Maas und Memel, von groß und klein:
»Lieb Vaterland – magst ruhig sein – Fest steht und treu die Wacht am Rhein!«
München, im glorreichen August 1914Rudolph Stratz
1.
Karl Feddersen war an diesem Januar-Nachmittag vor einer Stunde auf der Durchreise von Moskau nach Paris in Berlin eingetroffen. Im Hotel hatte man den jungen deutsch-russischen, in Frankreich wohnhaften Millionär mit der geziemenden Rücksicht empfangen. Seine gewohnten Zimmer standen bereit. Die Briefschaften des Welthauses Iwan Feddersen und Söhne, zu dessen Inhabern er gehörte, lagen auf dem Diplomatenschreibtisch. Er hatte sie flüchtig durchmustert, sich gebadet und umgezogen. Nun stieg er, während sein französischer Kammerdiener den Koffer auspackte, den kurzen Treppenabsatz in die Vorhalle des Hotel Adlon hinab, ein stattlicher Mann mit blauen Augen und blondem Schnurrbart, mit solider Eleganz nach Pariser Mode gekleidet, das verwöhnte Lächeln eines reichen Junggesellen in den Dreißigern auf den kühlen, selbstbewußten Zügen. Als er vorhin angekommen, hatte die Hotelhalle noch völlig leer in träumerischem Dämmern dagelegen. Jetzt war da eine Flut von Licht und Gelächter, Uniformen, wippende Riesenhüte, blaubefrackte Diener – das Gewimmel des Five-o'clock-tea's.
Karl Feddersen war das neu. Er kam selten nach Berlin. Seine Fahrten von Paris nach Südrußland machte er gewöhnlich mit dem Orient-Expreß über Wien. Ein Kellner, der aus seiner schwerfälligen ausländischen Eleganz ein reiches Trinkgeld herauswitterte, richtete ihm ein eigenes kleines Tischchen und schob ihm einen Strohsessel hin, in dem der blonde Finanzmann halb versank und, sich eine Zigarette anzündend, phlegmatisch das Gewühl vor sich betrachtete.
Das schwirrte, das schwatzte und lachte, das kam und ging und schob sich durcheinander. Viel Offiziere. Elegante junge Frauen. Hübsche Mädchen. Schlanke, große Erscheinungen. Karl Feddersen kannte keine Menschenseele in diesem bunten Jahrmarkt – überhaupt in ganz Berlin vielleicht ein halbes Dutzend Leute ...
Ein lautes Lachen von dem großen Rundtisch vor ihm weckte ihn aus seinen Träumen. Eigentlich wurde dort immer gelacht, solange er hier saß: junges Volk. Ein halbes Dutzend Leutnants, ein halbes Dutzend Mädchen, ein paar davon im Reitkleid, wie sie vom Tatterfall kamen, die andern im Straßenkostüm, ein Gekicher und Geflirte. Der junge Millionär sah sich das nüchtern an, mit Nachsicht, wie man spielende Kinder betrachtet. Da stand plötzlich einer der Offiziere, ein glattrasierter Ulan, auf und kam lachend auf ihn zu:
»Kennen Sie Ihren alten Kabinenkameraden von der »Therapia« noch, Herr Feddersen? Wie ich vor zwei Jahren meine große Mittelmeerreise mit der Levante-Linie machte, da kamen Sie doch auf dem Rückweg in Batum an Bord und fuhren bis Odessa mit!«
»Ach ja – richtig!«
Karl Feddersen machte so häufig die Ueberfahrt von Südrußland nach dem Kaukasus, daß er sich gerade dieser Reise nicht weiter entsann, aber er neigte mit der beistimmenden, unpersönlichen Höflichkeit, die ihn als Geschäftsmann nie verließ, das blonde Haupt. Der andere fuhr fort:
»Drollig, wie man sich so wieder trifft! ... Höllisch weltstädtisch wird dies Berlin nachgerade – nicht?«
»Ja, mir scheint! Ich bin hier ein seltener Gast.«
»Darum sitzen Sie auch hier so einsam und verlassen! Warten Sie auf jemanden?«
»Erst in einer Stunde. Auf meinen Bruder!«
»Dann kommen Sie doch ein bißchen zu uns hinüber! Fidele Gesellschaft! ... Da tauschen wir dann noch Reiseerinnerungen aus!«
Der junge Reitersmann sah den andern freundlich an, und jener dachte: Warum nicht? Er ging Menschen nie aus dem Wege. Schließlich konnte man immer da und dort etwas hören, was für das Geschäft nützlich war.
»Wenn ich nicht störe ...«
»Ach wo! Sehen Sie sich doch nur die Blase an!«
Aber an dem runden Tisch, an den sie traten, war die Heiterkeit plötzlich in tiefe Stille umgeschlagen. Ein anderer Offizier stand da. Er hatte eine Hiobspost gebracht. Jetzt rief er sie auch dem herankommenden Ulanen zu:
»Elendt – wissen Sie schon: Gellin ist in Südwest gefallen!«
»Herrgott, ne – wo denn?«
»Ganz unten, mit dem Kamelreiterkorps in der Kalahari. Gegen versprengte Witboys. Eben kam die Kabeldepesche.«
Auf den ernst gewordenen Gesichtern der jungen Mädchen, der jungen Leutnants lag ein für Karl Feddersen, den Kosmopoliten, seltsamer, gleichförmiger Ausdruck, des Sich-eins-fühlens mit diesem einen Toten in fernen Landen, mit den ganzen Kolonien, mit der großen deutschen Armee. Es waren keine Verwandten des Gefallenen anwesend. Die wären aufgestanden und weggegangen. Aber es war doch, als habe dieser Verlust hier die Mitglieder einer bis ins Unendliche weitverzweigten Familie getroffen, so feierlich war die Stimmung. Es wurde weniger als sonst beachtet, daß plötzlich ein fremder Zivilist vorgestellt wurde und an der Tafelrunde Platz nahm. Gleich darauf begann wieder das Gespräch über den toten Gellin – wo er früher gestanden – ob er dann in das zweite oder dritte Seebataillon gekommen sei – wann er zur Schutztruppe übergetreten, ob der andere Gellin, der sich drüben nach dem Aufstand als Farmer niedergelassen habe, sein Vetter oder sein Bruder sei – Namen und Jahreszahlen schwirrten durcheinander. Dann versetzte der neuangekommene Leutnant:
»Großartig, wie der Vater das trägt! ... Winkt jedem, der kondolieren will, schon an der Türe ab und meint, es sei höchste Zeit, daß wieder einmal ein Gellin für den König gestorben sei ...«
Ein Schweigen entstand. Eine Stimme rief: »Das ist aber doch zu spartanisch!« Andere widersprachen. Nein, das sei groß. Uebrigens habe er ja noch zwei Söhne!
Das war eine Welt, die Karl Feddersen nicht verstand – ein Hauch von Kurbrandenburg – von Roßbach und Leuthen, von Waterloo und Sedan. Er tadelte das nicht. Er tadelte überhaupt nie etwas. Er war gewohnt, Menschen und Dinge nicht zu beurteilen, sondern zu benutzen. Er dachte sich: also solche Leute gibt es! ... und schwieg, als wohlerzogener Mann, bei einer Sache, die ihn nichts anging, und saß mit ruhiger Teilnahme da.
Dabei fiel ihm auf, daß das junge Mädchen ihm gerade gegenüber ein anderes Gesicht machte als die andern. Was sich darauf spiegelte, war schwer zu sagen. Am ersten schien es eine Art stiller Widerspruchsgeist zu sein – so, als ob sie manches lieber für sich behielte, was sie dachte. Vorhin, als er vorgestellt wurde, hatte er sie nur mit einem flüchtigen Blick gestreift. Nun sah er sie näher an. Sie hatte dunkles Haar und dunkle, glänzende Augen. Der Mund war sprechend, halboffen. Aber sie schwieg. Sie seufzte nur mit einer seltsamen, verächtlich kurzen Schulterbewegung in kaum merklicher Ungeduld vor sich hin. Jetzt war deutlich ein Zug von Ironie auf ihrem jugendlichen Gesicht, dessen Hautfarbe nicht so rosig war wie die der übrigen jungen Mädchen, sondern leise in das Bräunliche schimmerte und ihr dadurch etwas Fremdartiges gab. Die anderen achteten nicht auf sie. Sie schienen diese stumme Art bei ihr schon gewohnt. Aber als nun die Rede auf die Römergröße des alten Generals von Gellin kam, konnte sie nicht mehr an sich halten und murmelte, mit gebeugtem schlanken Nacken, vor sich hin auf die Tischplatte schauend, und hartnäckig ein Stückchen Teegebäck zwischen den schmalen weißen Fingern zerzupfend:
»Sagt mal, Kinder: Was hat man denn davon, wenn man nun glücklich für den König stirbt?«
Dieser Ausspruch erregte Entsetzen. Es war allgemeiner Protest. Von der anderen Seite des Tisches rief eine Stimme:
»Quatsch' nicht so dämlich, Gretel ... wenn ich bitten darf – ja?«
So grob konnte nur ein Bruder sein. Karl Feddersen blickte, innerlich belustigt, hinüber. Jawohl: dieser hübsche, hochmütige junge Gardeinfanterist, in dessen rechter Augenhöhle das bandlose Monokel wie festgewachsen stak, sah der Rebellin vor ihm ähnlich. Die warf den Kopf zurück und sagte nachlässig:
»Regt Euch nur nicht auf! Es ist weiß Gott nicht der Mühe wert!«
Es ging aus ihren Worten nicht hervor, ob es um ihret- oder um der andern willen nicht der Mühe wert sei. Sie zuckte wieder die schmächtigen Schultern, wie jemand, der gewohnt ist, in Meinungsverschiedenheit mit seiner Umgebung zu leben, und rührte verstockt in ihrer Teetasse. Eine Freundin, ein zartes, blondes Persönchen, nahm sie in Schutz.
»Laßt sie doch in Ruhe. Sie meint's doch nicht so! Ihr kennt doch die Grete!«
»Nein, Ihr kennt mich nicht!« erwiderte die Angegriffene eigensinnig. Die andern lachten. Man nahm sie nicht ernst. Das Gespräch ging wieder seinen Gang. Nur Karl Feddersen beobachtete, während er sich mit seinem damaligen Reisegefährten, dem Ulanen-Rittmeister von Elendt, unterhielt, verstohlen sein Gegenüber. Sie gefiel ihm. Es war ein schönes Mädchen zu Anfang der Zwanzig. Sie war ziemlich einfach gekleidet, in eine weiße Tüllbluse, durch deren Gitterwerk die zarte Haut des Halses und der Arme schimmerte. Ihr dunkles Jäckchen hatte sie hinter sich auf die Stuhllehne gelegt. Ein großer, schief aufgesetzter weißer Filzhut mit steifer, schwarzer Sammetschleife beschattete ihr längliches, schmales Gesicht.
Er konnte sie unauffällig betrachten. Seine Blicke mußten eigentlich, so wie er saß, von selbst auf dem hübschen, trotzigen Mädchengesicht da drüben ruhen. Sie beobachtete es nicht. Sie hatte noch einmal mit dem verächtlichen Zug um die Mundwinkel, der ihr eigen war, für sich gemurmelt: » Pour le roi de Prusse!« Dann tat sie, als ob sie die ganze Sache weiter nichts anginge, und schaute, absichtlich die Gelangweilte spielend, durch den Saal. Sie nickte dabei da und dort einer Freundin zu und erwiderte mit einem halben kameradschaftlichen Lächeln den Gruß von jungen Offizieren. Sie gehörte offenbar, wenn auch als schwarzes Schaf, mitten in diese Clique von zweifarbigem Tuch hinein. Aber wie sie hieß, wer sie war, ahnte Karl Feddersen nicht. Und hätte es doch gerne erfahren, ohne sich Rechenschaft geben zu können, warum. Nun hörte er, wie jemand von der anderen Seite des Tisches her laut zu ihrer Nachbarin rief:
»Gräfin ... geben Sie doch mal der Grete 'nen Stups! Sie sitzt ja da wie drei Tage Regenwetter!«
»Sie bockt wieder mal!« sagte die kleine Blondine in einem Ton, der hieß: da ist nichts zu machen. Karl Feddersen spürte einen merkwürdigen Aerger. Wer war denn das, der so familiär per Grete von der da drüben sprechen durfte? Der monokeltragende, brünette, elegante Bruder von der Garde nicht. Wer das gerufen hatte, konnte auch nicht ein anderer Bruder von ihr sein. Es war ein blonder, vierschrötig-gesunder Leutnant, mit dem schwarzen Samtkragen der Linien-Feldartillerie. Seine klugen, grauen Augen zwinkerten humoristisch, während er mit einem versöhnlichen Lächeln zu dem schönen Mädchen sagte:
»Du, Grete ...«
»Ich heiße Margarete! ... Grete klingt so ordinär! ... Das ist auch so Euer Ton! Was ich den schon dick hab' ...«
Sie machte dabei eine matte Bewegung mit der Hand gegen den Hals, als bekäme sie keine Luft mehr. Der stämmige Artillerist wurde tiefernst. Nur in den Augen blieb der Schalk.
»Ich werde Dich Marguerite nennen! Ist das fein genug? Ja? Du ... Nun sei doch nicht so! ... Stell' Dich doch nicht so an! ... Es beißt Dich doch keiner!«
Auf ihrer glatten Stirne, über der das reiche dunkle Haar sich widerspenstig wellte, standen immer noch wie Wetterwölkchen drei senkrechte Falten. Aber es schien Feddersen, als ob der blonde Offizier drüben mehr Macht über sie habe als andere Sterbliche. Denn sie antwortete, wider Erwarten, bereitwillig:
»Gott! Du hast recht, Moritz! Es verlohnt sich alles gar nicht ...«
Und wieder dachte sich der Finanzmann: Grete ... Moritz ... sind das Vetter und Cousine? Oder miteinander verlobt? Diese Vermutung gab ihm einen Stich. Er hörte, halb geistesabwesend, auf das Stimmengeschwirr um ihn und saß still, mit seinem gewohnten verbindlichen und undurchdringlichen Geschäftsausdruck da.
Außer ihm schwieg nur noch eine am Tisch und war mit ihren ketzerischen Gedanken offenbar wo anders. Das war das schöne, dunkeläugige Mädchen ihm gegenüber, die er für sich bereits Margot nannte. Der Name gefiel ihm besser als Grete. Unter Grete stellte man sich so etwas derb Teutonisches vor. Sie aber hatte eher in ihrem Aeußern einen romanischen Reiz. Sie erinnerte an die brünetten Erscheinungen, an die er in Paris gewohnt war. Nur besaß sie einen viel klareren, gesunderen Teint als die gepuderten Französinnen und einen ganz unbefangenen Gesichtsausdruck. Es schien ihr völlig gleichgültig, ob und welchen Eindruck sie machte. Offenbar weil sie schon von einem Einzigen beherrscht war. Dem da drüben am Tisch. Dem breitschultrigen, klugen Artilleristen. Karl Feddersen dachte daran, zu gehen. Er fühlte sich sonderbar aufgeregt, ganz gegen seine Art, und unbehaglich in dieser Gesellschaft, in die er so gar nicht hineinpaßte. Was waren das für Kirchturminteressen ... die gerade von einer Garnison zur anderen, von der Rekrutenbesichtigung zum Wohltätigkeitsbasar reichten? Und dabei schlug ihm überall aus den hellen Stimmen der Mädchen, dem Lachen der Leutnants ein naives Selbstbewußtsein entgegen: Wir sind die Ersten im Lande, die Nächsten am Thron, die Edelsten der Nation – ein Stolz, der ihn verstimmte und der doch eigentlich frei von Ueberhebung war. Denn er sah zu deutlich aus dem Respekt der Kellner, in den wohlwollenden Blicken des andern Publikums, wie zufrieden alle Welt damit war, daß so reichlich Offiziere mit ihren Damen den gedrängten vollen Raum schmückten und aus der dunklen Masse des Zivils aufleuchteten wie der rote Mohn aus dem Feld.
Er konnte es gar nicht vermeiden, daß seine Blicke und die des schönen Mädchens ihm gegenüber sich immer wieder kreuzten. Sie waren die beiden einzigen, die sich – sie freiwillig, er unfreiwillig – aus dem allgemeinen Gespräch ausschlossen. Er hätte sie gern angeredet. Aber er fand beim besten Willen keinen Anknüpfungspunkt. Da kam sie ihm plötzlich zu Hilfe und fragte ihn in einer norddeutsch kühlen und herrischen Art, in der, ohne daß sie es selbst wußte, etwas vom Hochmut der Generalstochter gegen einen Zivilisten mitklang:
»Leben Sie hier in Berlin?«
Er mußte lachen. Er hätte beinahe geantwortet: »Gott sei Dank, nein!« Die Reichshauptstadt war ihm nicht nur eine fremde, sondern eine feindliche Welt. Sie war die Hochburg der Konkurrenz, der verwünschten deutschen Konkurrenz ... aber er erwiderte nur höflich:
»Doch nicht, gnädiges Fräulein! ... Ich bin nur einen Tag auf der Durchreise hier.«
»Wo wohnen Sie denn für gewöhnlich?«
»In Paris!«
»Ach!« sagte sie erstaunt und verstummte. Er hatte den komischen Eindruck, daß er dadurch in ihren Augen stieg. Aber es war noch die alte Herablassung in ihrem Ton, als sie wieder anhub:
»Kamen Sie jetzt aus Paris?«
»Nein! Aus Samarkand!«
»Samarkand? ...« Sie war nicht ganz sicher. »Das liegt doch so ... so ganz da hinten?«
»In Zentralasien, gnädiges Fräulein!«
»Um Gottes willen, was haben Sie denn dort gemacht?«
Er lachte.
»In Europa ruhen doch die Eisenbahnschienen gewöhnlich auf Holzschwellen – nicht wahr?«
»Ja.«
»Nun: in Turkestan hat die Natur aus unbekannten Gründen einen Bohrwurm hervorgebracht, der alle hölzernen Schwellen zernagt. Infolgedessen liefern wir dorthin lauter eiserne. Dann gibt es doch dort einen großen Anbau von Baumwolle, die zum Transport zusammengedrückt werden muß. Dazu stellen wir eiserne hydraulische Pressen. Ferner sind eiserne Brücken nötig. In Transkaspien haben wir immer Geschäfte.«
»Wer denn wir?«
»Unsere Firma: Iwan Feddersen und Söhne. Mein Vater ist seit einigen Jahren tot. Seitdem führen wir drei Brüder das Geschäft!«
»Da haben Sie also eine Fabrik?«
»Wir haben Eisengießereien im südrussischen Donetz-Bassin. Auch Kohlengruben, Dampfmühlen, Stahlwerke. Im ganzen mehr als 15 000 Arbeiter!«
»Aber Sie sagten doch vorhin, Sie lebten in Paris?«
»In Paris haben wir unser Bankbureau.«
»Und das haben Sie alles unter sich?!«
»Die russischen Werke kontrolliert mein jüngster Bruder. Unser Pariser Direktionsbureau, die › Compagnie métallurgique‹, mein ältester. Ich selbst bin Chef der Finanzierungsgruppe, einer › Société anonyme‹, und als solcher meist auf Reisen. Jetzt muß ich wahrscheinlich wieder von Paris weiter nach Marokko.«
Die lebhaften Augen seines Gegenüber hatten sich vor Erstaunen geweitet. Sie rief mit ihrer natürlichen Raschheit mitten in eine Pause der Unterhaltung hinein:
»Habt Ihr gehört? Der Herr hier ...« Offenbar hatte sie seinen Namen nicht verstanden oder bei der Vorstellung nicht darauf geachtet, »war schon in Samarkand. Er fährt jetzt nach Marokko. Er hat fünfzehntausend Arbeiter!«
Es klang wie ein Triumph, daß sie diese Entdeckung gemacht und den unscheinbaren Gast an das Tageslicht gezogen hatte. Es war, als wollte sie den übrigen sagen: Seht Ihr – es gibt auch noch andere Leute auf der Welt! Alle Augen richteten sich nach Karl Feddersen, und irgend jemand sagte:
»Donnerwetter! das ist ja ein Bombenbetrieb!«
Eine der jungen Damen, eine frische, mächtige Blondine, meinte mit tiefer Stimme:
»Herrgott – wer so reisen könnte! ... Wir geh'n den Sommer nach Rügen ...«
»Und bei uns langt's nach Ostende – aber man knapp!«
Man lachte über das naive Geständnis der zarten kleinen Gräfin neben Margarete. Die saß allein gleichgültig da. Nachdem sie ihren Zweck erreicht hatte, der Tafelrunde einen ordentlichen Hieb zu versetzen, und hauptsächlich – so schien es Feddersen – dem stiernackigen Artilleristen unten am Tisch. Er merkte, wie die beiden sich mit herausfordernden Blicken maßen, und empfand als Zeuge dieses Liebesgeplänkels eine plötzliche Regung von Eifersucht.
Der Bruder des schönen Mädchens, der Leutnant von der Garde, ging jetzt aus seiner bisherigen Zurückhaltung heraus und frug den Gast:
»Da haben Sie also bei dem marokkanischen Klimbim gehörig die Hand im Spiel, was? Na – da legen Sie sich mal da unten ordentlich für unsere deutschen Interessen ins Zeug!«
»Das wird mir allerdings schwer fallen. Ich vertrete eine französische Interessengruppe!« versetzte der junge Millionär lächelnd. Er war erstaunt über die Wirkung seiner Worte: Ein betretenes Schweigen ... Ein Blickewechseln. Dann versetzte der Monokelträger trocken:
»Da arbeiten Sie also gegen uns?«
»Das klingt wohl zu tragisch! Das Kapital kämpft immer und überall auf der Erde. So auch die Belgier und wir gegen die deutschen Syndikate. A la guerre comme à la guerre!«
Der Leutnant verstummte kopfschüttelnd. Sein Nachbar, der Artillerist, wurde statt seiner plötzlich munter. Er reckte sich in den Schultern, mit einem anscheinend dummen, schläfrig-schlauen Lächeln auf dem gesunden Gesicht, ein verdächtiges Zwinkern in den grauen Augen.
»Sie müssen Nachsicht mit uns haben!« sagte er einfach. »Wir sind hier furchtbar rückständige Leute, ohne viel Geld im Hosenbeutel. Darf ich mal ganz töricht fragen? Sie sagen, Sie stemmen sich aus Leibeskräften gegen Deutschland. Sie sind aber doch ein Deutscher!«
»Ich bin russischer Untertan! Mein Großvater wurde es schon!«
»Aber Sie leben doch in Paris?«
»Ja.«
»Als was betrachten Sie sich denn dann?«
»Als Kosmopoliten!« sagte Karl Feddersen kühl. Dies Verhör durch einen kleinen Leutnant langweilte ihn. Aber der andere ließ nicht locker.
»Und ... verzeihen Sie ... ich rede jetzt immer dämlicher ... wie Sie noch ein kleiner Junge waren, in welcher Sprache hat da wohl Ihre Frau Mutter des Abends mit Ihnen gebetet?«
»In deutscher. Es wurde bei meinen Eltern immer Deutsch gesprochen.«
»Leben sie noch?«
»Leider nicht mehr!«
»Und in welcher Sprache hat man wohl an ihrem Grab das Vaterunser gesagt?«
»Natürlich in deutscher! Wir sind Lutheraner. Aber nun möchte ich ...«
»Bitte – werden Sie nicht böse! Ich hab' noch nicht viel gesehen und erlebt! Ich möchte mich nur belehren. Sie erzählen, Sie haben große Reichtümer in Rußland. Haben Ihre Vorfahren die nicht dadurch erworben, daß sie deutsche Tüchtigkeit ins Land gebracht haben?«
»Ja gewiß!«
»Nun steht mir also der Verstand still!« versetzte der Linienartillerist anscheinend bescheiden. »Was Sie haben, verdanken Sie den deutschen Vorfahren! ... Sie sind deutsch geboren ... deutsch aufgewachsen, und dann hauen Sie mit den Rothosen auf Ihre Stammesbrüder los! Verzeihen Sie: das ist nicht schön! ... Die Zeiten sollten doch weiß Gott vorüber sein!«
Karl Feddersen verlor seine Ruhe nicht.
»Sie meinen, Herr Leutnant, – wenn man Deutsch redet, muß man ein Deutscher sein?«
»Gott Strombach, ja – das mein' ich!« sagte der Artillerist ehrlich.
»Dann muß also, wer Englisch als Muttersprache spricht, sich in zwei Teile teilen. Eine gehört nach London, eine nach New York! Oder umgekehrt: Es fühlt sich einer als Schweizer! Was redet er dann? Die Schweiz hat drei Sprachen!«
»So meine ich es nicht! ... Das sind überhaupt Gefühlssachen! Die müssen einem sagen, wohin man gehört!«
»Ja bitte – was soll ich denn also nach Ihrer Ansicht tun?« frug Karl Feddersen höflich mit einer einladenden Handbewegung. »Was raten Sie mir, Herr Leutnant?«
»Vor allem, finde ich, sollte man deutscher Reichsangehöriger werden!«
»Schön! Wer leitet dann unsere Geschäfte in Rußland? Ein Ausländer darf dort nicht Grund und Boden besitzen und keinem Großbetrieb vorstehen!«
»Dafür gibt's Beamte!«
»Mit solchen Strohmännern werden wir tolle Erfahrungen machen! ... Und wer treibt in Paris die Millionen auf, um Kultur unter die Wilden zu bringen? Ein Reichsdeutscher bekommt keinen Sou! Auf die Weise geht unser Geschäft zugrunde, das könnte ich nicht verantworten! Theoretisch ist es leicht, streng zu sein. Aber stehen Sie einmal mitten in einem solchen Getriebe – sehen Sie die Unzahl kleiner Existenzen, die ihr bißchen Wohl und Wehe einem anvertraut haben – dann werden Sie zugeben: Das ist unmöglich!«
Der Artillerist hatte einen roten Kopf bekommen. Er fühlte die Ueberlegenheit des Weltmanns drüben auf einem Gebiet, auf das er ihm nicht folgen konnte, und fühlte trotzdem, daß er recht hatte, und wiederholte:
»Das mag alles ganz gut und schön sein. Darüber hab' ich kein Urteil. Aber der Mensch hat nur eine Muttersprache und die ...«
»Vorgestern ungefähr um diese Zeit fuhr ich von Moskau weg!« sagte der Millionär. »Da sprach ich mit Geschäftsfreunden auf dem Bahnhof Russisch. Heute, wo ich die Ehre habe, mich unter Ihnen zu befinden, rede ich natürlich Deutsch. Uebermorgen, in Paris, würde ich mich damit keinem Menschen begreiflich machen können und gebrauche daher das Französische. Wenn ich nächstens über Gibraltar komme, werde ich mich auf englisch verständigen. Wie?« Er hatte seinen Kammerdiener sich mit einer Visitenkarte durch das Gedränge heranwinden sehen und nahm sie ihm ab. »Mein Bruder ist draußen? Schön! Ich komme!« ...
Karl Feddersen hatte, während er sprach, unbewußt seine Worte nicht an den gleichgültigen Leutnant da drüben, sondern an das schöne Mädchen ihm gegenüber gerichtet, ohne sie einmal dabei anzusehen. Er wußte trotzdem: sie hörte gespannt zu. Er merkte, daß sie auch jetzt mit einem gewissen Interesse seine seidenschillernde Pariser Weste, seine vatermörderähnlich hochgeschlungene schwarze Krawatte musterte. Er war befriedigt, daß er ihr ein vorteilhaftes Bild von sich hinterließ. Er war ein großer, stattlicher, gut aussehender Mann, wie er da vor ihr stand, dem Rittmeister von Elendt zum Abschied die Hand reichte und sich dann gegen sie und die anderen verbeugte. Eine Sekunde schwankte sie. Dann streckte sie ihm im Sitzen mit einem freimütigen Lächeln und einem kurzen Nicken des dunklen Kopfes ihre kühle, schlanke Rechte herüber. Das galt nicht ihm; das war wieder Trotz gegen den Hitzkopf im schwarzen Artilleristenkragen. Karl Feddersen war zu besonnener Geschäftsmann, um sich den Täuschungen bei Eitelkeit hinzugeben. Die ganze Sache erschien ihm jetzt komisch und zugleich voll einer unerklärlichen Wehmut. Er drückte die schmale Mädchenhand und sagte: »Auf Wiedersehen, mein gnädiges Fräulein!« und dachte sich, als er durch das Gedränge fremder Menschen dem Ausgang zuschritt: »Was heißt denn das: Auf Wiedersehen! ... Ich seh' sie ja nie wieder ...«
2.
Kaum hatte Karl Feddersen den Saal verlassen, so reckte sich sein Feind, der Feldartillerist, in den eckigen Schultern und meinte trocken:
»Das sind die Leute, die ich liebe! ... Kinder: man soll ja nicht über 'nen Abwesenden sprechen, wenn sein Platz hier noch warm ist. Aber was zu toll ist, ist zu toll. Wie haben Sie sich nur dies Gewächs aufgegabelt, Herr Rittmeister?«
Baron Elendt war ärgerlich.
»Sie könnten auch höflicher sein, wenn ich einen Gast hier am Tisch einführe, mein lieber Lünemann! Ich weiß doch auch, was ich tu'! Ich reiße mir doch auch nicht um jeden beliebigen Zeitgenossen die Beine aus dem Leib. Der Mann ist eine Nummer! Auf dem Schiff damals hätten Sie den Respekt der Russen und Ausländer vor ihm sehen sollen. Er galt allgemein als ein Reichmeier erster Güte!«
»Das hat er ja auch hier betont!« sagte Margaretes Bruder, der Gardeleutnant. Seine Stimme schwankte zwischen Ironie und unfreiwilliger Hochachtung.
»Ach ... blasse Renommage ... weiter nichts!« Der Oberleutnant Lünemann stand auf, um zu zahlen. Auch die anderen erhoben sich. In dem allgemeinen Aufbruch trat Margarete an ihren Verlobten heran. Sie blickte ihn an und kämpfte mit sich. Sie war in ihn verliebt. Er war nicht schön. Aber sie fand ihn schön. Sie sah tausend Züge an seinem Aeußeren, die anderen entgingen. Sie war verliebt in den Klang seiner Stimme – in die Wölbung des Kinns – in den Schalk in seinem Blick. Ihre Züge hatten sich verändert. Sie waren weich und kummervoll geworden, in den Augen lag ein feuchter, schmerzlicher Schein. Sie hielt die Hände ineinander gepreßt, um die Tränen zu unterdrücken.
»Wirklich, Moritz ... Es ist schon furchtbar mit Dir!« sagte sie mit zuckenden Lippen.
»Was hab' ich denn wieder verbrochen?«
»Du hast Dich wieder so unvernünftig benommen wie nur möglich!«
Er warf einen Blick nach den übrigen. Die kümmerten sich nicht um sie. Die kannten diese Auftritte zwischen den beiden schon, zwei Leuten, die sich heiraten wollten und aus Mangel an Mitteln nicht konnten und in dem ewigen Suchen nach einem Ausweg beide schon ganz nervös und herunter waren. Das junge Mädchen musterte den Artilleristen traurig und schüttelte den Kopf.
»Hat man 'mal irgendwo die Spur von einer Möglichkeit, dann mußt Du es doch auch gleich wieder verpatzen ... mit Deiner ewigen Dickfelligkeit. Da schneit 'mal durch Zufall ein Millionär in unseren Kreis, ein Mensch, der vielleicht Stellungen oder sonst was zu vergeben hat, und ich gebe mir die gräßlichste Mühe, nett und freundlich zu ihm zu sein und ihn uns warm zu halten – Du weißt: ich bin sonst gar nicht so überströmend liebenswürdig ...«
»Das hat mich ja gerade geärgert!«
»... und da fährst Du dazwischen und verdirbst alles! Auf die Weise wird es natürlich nie etwas mit uns werden, Moritz! Da können wir noch zehn Jahre nach einem Posten im Zivilberuf für Dich suchen!«
Sie verstummte betrübt und schritt neben ihm zum Ausgang, mit ihrem hohen, schlanken Wuchs ihm bis über die Schulter reichend. Moritz Lünemann machte zornig Halt.
»Ich tu' doch, was ich kann, Grete! Ich schreib' mir ja doch schon die Finger krumm und lauf' mir die Absätze schief, um mit Anstand irgendwo unterzukommen! Und was hat's geholfen? Nichts! Die Leute halten einen hin. Man ist ja ein Esel, wenn man's ernst nimmt!«
Draußen war Winterabend und lichterhell. Sie gingen zu Fuß nach dem Westen zu, wo sie alle wohnten. Moritz Lünemann und Margarete allein hinter den anderen. Das junge Mädchen hatte seinen Arm genommen. Sie schmiegte sich im Dahinschreiten leise an ihn. In der Wehmut, in der sie sich befand, mochte sie gar nicht reden. Moritz Lünemann aber sagte plötzlich wie aus ihren Gedanken heraus:
»So ein Kerl, wie dieser vaterlandslose Geselle von vorhin, der mit Leichtigkeit zehn oder hundert Familien ernähren könnte, der hat natürlich keine Frau ...«
»Nein, er trug keinen Trauring!«
»Und unsereins wieder, der ums Totschlagen gern heiraten möchte, der hat wieder kein Geld. Es ist zu dämlich im Leben eingerichtet. Das Schicksal haut immer daneben!«
»Ja. Wenn mir 'ne Million hätten ...« pflichtete das junge Mädchen bei. Die Vorstellung fiel in ihrer Seele auf fruchtbaren Boden. Sie fing an, sich etwas auszumalen, was man wohl im Besitz einer Million tun würde. Sie rechnete es sich und dem Verlobten vor: Erst gab man natürlich den Eltern gehörig ab. Die Geschwister kriegten auch was, wenn sie nett waren. Den Rest – vielleicht drei Viertel oder zwei Drittel – behielt man für sich. Es gab so herrliche Sachen auf der Welt: Die Trauungsfeier im Dom, das Festmahl bei Adlon, die Hochzeitsreise nach Paris – Schmuck von Lalique – Kleider von Paquin – solche Dinge und Adressen vergaß sie nicht, wenn sie sie einmal gehört und gelesen hatte – die Riviera – ein Auto ... Mitten in diese erträumte Seligkeit hinein sagte der Leutnant Lünemann trocken, fast strafend:
»Wie stellst Du Dir das eigentlich vor? Denkst Du denn, dann täte man überhaupt nichts mehr, als so als Hotelwanze da und dort zu vegetieren? Nee – ich bin für stramme Arbeit! Dann gerade! Ich bin kein solcher Faulpelz wie Du ...«
Margarete seufzte. Die Worte ihres Bräutigams ernüchterten sie schmerzlich. Eine Wolke der Enttäuschung verdüsterte ihr Gesicht. Er tat ihr immer weh mit seinem schonungslosen Verstand. Er war ein harter Mensch. Auf einmal empfand sie wieder, wie manchmal, die tiefe Kluft zwischen seinem und ihrem Wesen, die nur die Liebe von beiden Seiten überbrückte. Sie ärgerte sich und wurde heftig.
»Schön! Dann reite Du vor Deinen Kanonen herum, bis Du alt und grau bist! Und ich verhutzle daheim bei den Eltern sachte mit! Das ist eine reizende Perspektive! ... Tu' mir den einzigen Gefallen, Moritz, und schau nicht so phlegmatisch drein, als ob Du Dir im Laden ein paar Zigarren kauftest, statt daß wir über unser Lebensglück sprechen!«
»Du solltest unser Lebensglück von einer ernsteren Seite ansehen, Grete. Was sollen denn all die Kinkerlitzchen? Du bist viel zu äußerlich ... viel zu sehr aufs Vergnügen erpicht!«
»Ja. Ich bin nun einmal so! Ich bin für so ein Leben wie geschaffen!«
Sie ließ ihn nicht zu Worte kommen. Sie fuhr rasch und trotzig fort:
»Ich glaub' nicht an das Spartanertum, das unsereinem in unseren Kreisen von Kind an eingebläut wird. Das mag früher so gewesen sein, noch zu Mamas Zeit – aber jetzt ... Warum sollen es denn andere besser haben als ich und Du – das möchte ich bloß wissen! Ihr seid alle viel zu bescheiden! Das macht mich immer so wütend, wenn Ihr Euch immer gleich so duckt! Du besonders!«
Plötzlich kamen ihr die Tränen. Sie blieb stehen und weinte hellauf. Zum Glück war es mitten auf dem halbdunklen Viktoria-Luise-Platz, wo sich niemand in der Nähe befand als ihre vorausgegangenen Gefährten, die umdrehten und zu dem unter einer Laterne stehenden Paar zurückkehrten. Der Gardeleutnant musterte seine schöne Schwester kaltblütig durch das Monokel.
»Na, Du Heulliese! Was ist denn nun wieder los?«
»Gott ... sie hat sich!« sagte Lünemann ärgerlich. »Grete, sei doch vernünftig! Du blamierst einen ja auf offener Straße!«
Aber sie schluchzte krampfhaft weiter.
»Ich möcht' bloß wissen, wozu man eigentlich auf der Welt ist! Es wär' viel besser, man wäre gar nicht geboren! Dann hätte man doch nicht die ewige Plackerei! Das geht nun so zweiundeinhalb Jahr mit uns! Und Du fühlst Dich, scheint's, ganz wohl dabei! ... Du zuckst ja immer bloß die Achseln! Du hast mich ja gar nicht lieb!«
Sie schaute blaß und bang, am ganzen Körper zitternd, zu ihrem Verlobten hinauf, der den Arm um sie legte und nur sagte:
»Ich hab' Dich lieb, Grete!«
Das beruhigte sie ein wenig. Sie fing wieder an leis zu weinen und murmelte, während die anderen weitergingen:
»Sei nicht bös! Ich bin so auseinander! ... Wie zerprügelt ... Ich bin so mutlos, Moritz!«
»Ach was!«
Er sah sich rasch um, ob jemand sie beobachtete, und gab ihr einen Kuß, sie holte tief Atem, zupfte sich den Schleier zurecht und wurde gefaßter. Beide setzten ihren Weg fort. Der Artillerieleutnant fühlte, daß er seiner Verlobten Trost schuldig war. Eigentlich war sie noch gar nicht recht seine Verlobte, es war noch nicht offiziell ausgesprochen oder gar angezeigt worden, bei der vorläufigen Aussichtslosigkeit ihrer Lage. Margaretens Eltern drückten nur einstweilen die Augen zu. Alle Welt war nachsichtig, in Erwartung irgendeines Glücksfalles. Plötzlich ein Jauchzen in ihrer Stimme. »Moritz! Jetzt hab' ich 'ne Idee!«
»Na?«
»Nein. Das sag' ich Dir nicht! ... Du machst doch bloß wieder flau! Und dabei ist es das reine Ei des Columbus! Laß mich nur allein machen! Am Ende wird nun alles gut!«
Sie waren jetzt dicht bei den anderen, die vor Margaretens Elternhaus standen. Das junge Mädchen ging elastisch auf die Gruppe zu. Sie trug auf einmal den Kopf im Nacken und musterte die anderen belustigt von oben herab.
»Ach ... Ihr ...,« sagte sie. Weiter nichts.
»Was denn?«
»Ihr seid dumm! Allesamt! ... Aber meinetwegen! Macht nur weiter, wie Ihr's versteht! Wir fliegen Euch doch eines schönen Tages davon!«
»Na ... glückliche Reise!« meinte der Bruder und öffnete die Tür.
»Ihr seid furchtbar langweilige Leute! ... Du auch, Moritz! Aber ich hab' Dich doch gräßlich lieb!«
Sie sprach es weicher und innig. Er sah den geheimnisvollen glücklichen Schein auf ihrem Gesicht und zog sie ein paar Schritte abseits in das Halbdunkel. »Erzähl' doch, was Du vorhast!« bat er. Aber sie schüttelte hartnäckig den Kopf.
»Nein! Frag' mich nicht! Das darf man nicht berufen!«
3.
Karl Feddersen hatte inzwischen mit seinem Bruder im Hotel Adlon diniert. Alexandre Feddersen war blond und blauäugig, von unverkennbar teutonischem Typus wie er, aber kleiner und von schmächtiger Gestalt. Paris, sein langjähriger Aufenthaltsort, hatte auf ihn abgefärbt. Sein Gesicht war blaß und nervös, er gestikulierte im Sprechen viel mit den Händen. Mit seinem Spitzbart und dem Zwicker vor den Augen erinnerte er an einen französischen Advokaten. Die beiden redeten miteinander Deutsch. Das war Gewohnheit in der Familie geblieben, so wenig sie sich auch als Deutsche fühlten. Die laufenden Finanzangelegenheiten nahmen sie während der Mahlzeit so in Anspruch, daß sie rein mechanisch aßen. Karl Feddersen meinte:
»Das Balkangeschäft geht überhaupt nicht nach Wunsch. Wir sind da schlecht vertreten! Wir sind ewig ungenügend informiert! Dabei gilt unser Moise Kabiljo zum Beispiel da unten als Autorität. Lewy Frères in Saloniki auch. Und trotzdem ...«
»Weißt Du, was der Grund ist?«
»Da bin ich gespannt!«
Alexandre Feddersen suchte nach gallischer Art die klarste Form für das, was er sagen wollte.
»Es kommt daher, mon ami, daß das alles Kaufleute sind. In diesen halbwilden Gegenden aber – sei es Marokko oder der Balkan – entscheidet immer noch mehr oder minder die Gewalt, die Waffe – die militärische Seite einer Angelegenheit. Das können wir nun gar nicht beurteilen ... Wir haben ja selber auch in Rußland nicht gedient! Darin sind uns die Deutschen über. Wir müßten unter unsern vielen Leuten einen Sachverständigen dafür haben – einen fixen Kerl – irgendeinen früheren Offizier, den man nach Bedarf da und dorthin schickt ...«
»Ja, gewiß!« sagte Karl Feddersen. Er hatte nur halb zugehört. Seine Augen schweiften durch den Grillroom, die Treppenstufen hinab in die jetzt leere Vorhalle. Dann sagte er, mehr für sich, als zu seinem Bruder:
»Zu drollig ... die Gesellschaft, mit der ich vorhin da unten gesessen hab'!«
»Ja, Du hast's erzählt!«
»Leute, die buchstäblich von nichts eine Ahnung haben! Und dabei in einer Weise von sich überzeugt ... Ein junges Mädchen war darunter. Die schien ein wenig anders als die andern!«
»Auf das merkwürdige junge Mädchen kommst Du nun schon zum drittenmal heute abend. Bleib' doch bei der Sache!«
»Ja! Wovon sprachen wir doch? Nein, Sascha: was die Antitrust-Bewegung betrifft! Die Standard Oil ist stärker. Unsere Petroleumpreise in Baku ...«
»Das haben mir bereits beim Fisch festgestellt,« sagte der Pariser kaltblütig. »Hast Du denn die ganze Zeit geschlafen? Hör' doch gefälligst zu ...«
Er wiederholte seinen Vortrag. Karl Feddersen saß ihm zerstreut gegenüber. Der leere Tisch in der Vorhalle ließ ihn nicht los. Wenn er die Augen halb schloß, nickte da unten eine große, steife schwarze Sammetschleife von einem weißen Tellerhut, eine lichte Bluse schimmerte, und dazwischen war ein lebendiges, schönes Mädchengesicht – tiefdunkles Haar – große dunkle Augen ...
»Ich hab' in der Sache Briefe aus Liverpool!« Er hörte die Stimme des Bruders wie aus der Ferne. »Es nimmt mit dem Baumwoll-Corner in New York noch ein schlimmes Ende!«
»Recht so!« pflichtete Karl Feddersen mechanisch bei. Er vernahm über den Tisch etwas von Diskonterhöhung der Bank von England, von einem halben Prozent ... aber die Versteifung des internationalen Geldmarktes ließ ihn heute kühl, und er brachte in der ersten Pause die Rede wieder auf den Tisch da unten:
»Eine gute Rasse ist doch noch hier im Lande!« sagte er. »Die Gesellschaft, mit der das junge Mädchen vorhin zusammen war ...«
Sein Bruder warf ihm einen mehr als mißtrauischen Blick zu. Er wurde unruhig. Aber er zweifelte noch. Der gute blonde Charley war so gar nicht der Mann, sich Hals über Kopf zu verlieben. Er klopfte vorsichtig auf den Busch.
»Hör' mal, mon cher ... die alte Frage ... Du bist doch nun zweiunddreißig. Warum heiratest Du eigentlich nicht?«
»Gott ... Du weißt doch ... Ich bin noch nicht dazu gekommen ... Die ewige Arbeit seit Papas Tod. Aber ich lass' es mir immer 'mal durch den Kopf gehen. Es wäre auch ganz gut, wenn die Firma mit ihren Geldmitteln etwas liquider würde!«
Der blonde Deutsch-Pariser war beruhigt. Gott sei Dank: sein Bruder dachte noch an die Mitgift! Er sagte wie beiläufig:
»Dieser Tage war Mademoiselle Pharasli zum Tee bei meiner Frau!«
»So ... Die Pharasli ...!«
Karl Feddersen schnitt eine Grimasse. Der andere runzelte die Stirne.
» Eh bien ... was hast Du denn gegen sie?«
»Nichts!«
» Tiens! Das wäre so eine Partie für Dich! ... Es ist so ziemlich das erste levantinische Haus an der Pariser Börse. Dabei ist sie hübsch, in ihrer Art ...«
»Ein winziges, schwarzes Püppchen ist sie!«
»Herrgott ... es geht doch nicht nach dem Gardemaß!«
Karl Feddersen wurde ohne allen Grund zornig.
»Doch! Ich bin, unberufen, ein stattlicher Kerl. Das ist ja lächerlich: ich und dieser Knirps! Nein ... bringe mir eine« ... Er brach ab. Er hatte fortfahren wollen: »Die etwa so ausschaut wie das junge Mädchen da unten.« Sein Herz wurde wieder unruhig. Er schwieg.
Der Bruder erriet seinen Gedanken. Er wußte jetzt genug. Es war wirklich Gefahr im Verzug. Er frug:
»Mir scheint, Du denkst schon wieder an die junge Dame von vorhin? Wer war denn das eigentlich?«
»Das weiß ich nicht!«
»Wie heißt sie denn?«
»Grete. Ein scheußlicher Name! Nicht?«
Dabei formte sich in seinen Ohren wie ein Klavierakkord das weiche, helle, gallisch tändelnde: Margot. Der andere forschte:
»Und ihr Familienname?«
»Den weiß ich nicht!«
»Was ist denn der Vater?«
»Weiß ich nicht!«
»Wo wohnt sie denn?«
»Weiß ich nicht!«
»Was treibt sie denn?«
»Weiß ich nicht!«
Sascha Feddersen mußte lachen. Er schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Charley! ... Charley!« sagte er. »Ich hätte Dich für vernünftiger gehalten! ... Sieh mir ins Gesicht!«
Karl Feddersen tat es und wurde unter dem spöttischen Blick des anderen ein wenig rot. Ihm war unbehaglich zumut. Der Pariser schaute ihn scharf an.
»Du bist ja im Begriff, Dich zu verlieben, Du Unglücklicher!«
»Unsinn!«
»Und noch dazu in eine Unbekannte ...«
»Ach, laß mich in Ruhe!«
»Und gar noch in eine Dame, von der Du selbst vorhin erzähltest, sie sei schon mit einem Offizier verlobt! ... Charley ... Gib mir mal Deine Hand ...«
»Wozu?«
»... und versprich mir, daß Du morgen abend mit mir nach Paris fährst!«
Eine Pause. Dann sagte Karl Feddersen zu des anderen Erstaunen mit einem plötzlichen Entschluß und in seinem alten, nüchternen Ton: »Gut! Ich komme mit!«
» Parole d'honneur?«
» C'est décidé!«
Aber als am nächsten Abend die zehnte Stunde sich über Berlin senkte, das Gepäck fertig dastand, die Hotelrechnung quittiert daneben lag, saß Karl Feddersen immer noch untätig in seinem Zimmer. Sein Bruder hatte noch auf dem französischen Generalkonsulat zu tun. Es war verabredet, daß sie sich auf dem Bahnhof treffen sollten. Hinter ihm hustete es diskret. Sein Kammerdiener mahnte:
»Monsieur, es ist höchste Zeit!«
»Stören Sie mich jetzt nicht, Adolphe ...«
Und wieder nach zehn Minuten:
»Monsieur können zur Not noch mit dem Handgepäck in einem Auto zurechtkommen!«
»Adolphe ... Sie wissen, daß ich nicht gerne ewig unterbrochen werde!«
Die Uhr schlug ein viertel nach zehn. Der Glattrasierte verzog keine Miene. Er begann schweigend das Reisenecessaire wieder auszupacken. Karl Feddersen wandte unwirsch den Kopf.
»Was machen Sie denn da, Adolphe?«
»Monsieur, der Nord-Expreß ist vor fünf Minuten abgegangen!«
Sein Herr stand auf. Er mußte lachen, wenn er an das enttäuschte Gesicht seines Bruders dachte, der jetzt allein im Abteil des Luxuszuges saß. Am nächsten Morgen schon kamen entrüstete Depeschen von Sascha: eine von Hannover, eine aus Köln, eine von der Grenze. In allen dasselbe: Ein Kaufmann halte das Wort! Auch unter Brüdern! Karl Feddersen ließ das ganz kühl. Er warf die Telegramme in den Papierkorb. Nachmittags sprang er plötzlich auf, als ob er etwas Wichtiges vergessen hätte, sah auf die Uhr und ging hinunter in die große Halle des Hotels. Da war das Treiben des Five-o'clock wie gestern. Der blaubefrackte Diener hatte ihm einen Platz reserviert, dicht vor jenem runden Tisch. Aber an dem saßen heute nur gleichgültige, unbekannte Leute. Fremde Gesichter überall. Karl Feddersen wartete gut zwei Stunden, bis der große Raum fast leer war. Dann zog er seinen Frack an, dinierte allein, las dabei gähnend die neuesten blauen Wolffschen Handelsdepeschen und legte sich mit den Hühnern schlafen.
Am nächsten Tage ging das ebenso, am dritten auch. Jeden Nachmittag sah er andere Gestalten an dem runden Tisch. Das junge Mädchen kam nicht wieder. Die Millionenstadt hatte sie verschlungen. Dabei flogen die Briefe des Bruders aus Paris. Jeden Tag einer. Er mußte sie lesen, weil auch Geschäftliches darin stand, und dazwischen immer ein wütendes »Was soll das? ... Wann fährst Du?« ... Und endlich eine unverhüllte Drohung: »Wenn Du nicht gleich kommst, erzähle ich überall, daß Du Dich hoffnungslos in eine kleine Berlinerin verliebt hast ... Alle lachen Dich dann hier aus!« Das wirkte am meisten. Karl Feddersen war empfindlich. Er hatte eine starke Meinung von sich und seinem Geldwert. Er war gewohnt, respektiert zu werden und fühlte selber: er stand im Begriff, sich ein wenig lächerlich zu machen ... auch vor sich selber ...
Er sagte sich: Sascha hat reich geheiratet – eine Amerikanerin. Auch Nicolais, des Moskauer Bruders, Frau, eine Russin, hatte viel Geld. Er, Charley, war es der Firma schuldig, auch eine Millionen-Mitgift hineinzubringen. Er stieg noch einmal hinunter zu dem Five-o'clock. Hunderte von Menschen waren da. Das einzige Gesicht, das er suchte, nicht. Er faßte einen letzten Entschluß. Er winkte dem Kellner. Wer das neulich wohl alles an dem runden Tisch gewesen sei? Aber der Blaubefrackte entsann sich nur noch dunkel. Er kannte die Herrschaften nicht. Die kamen sonst nicht hierher.
Nun gab Karl Feddersen es auf. Eigentlich fühlte er sich erleichtert durch den Entschluß, noch diesen Abend abzureisen. Es war das einzig Vernünftige. Er war mit sich zufrieden, während sein Adolphe auf dem Boden des Hotelzimmers kniete und wieder die Koffer packte. Dann verschloß er seine Geschäftsbriefe in einer Mappe, da klopfte es. Der Kellner brachte eine Karte. Der Rittmeister Baron Elendt wünschte seinen Besuch zu machen. Er stand draußen im Vorraum des Hotelzimmers, trat säbelklirrend ein, schüttelte ihm die Hand und nahm Platz.
»Entschuldigen Sie, daß ich Sie des Abends überfalle, Herr Feddersen! Aber bei Tag hab' ich höllischen Dienst! Ich komme nämlich mit einer Bitte – nicht für mich, sondern für jemand anderen ... oder eigentlich mehr mit einer Anfrage ... ganz im Vertrauen ...«
»Und womit kann ich dienen?« frug Karl Feddersen kühl. Er, der reiche Mann, war diese Einleitungen schon gewohnt.
Sein Besucher sah sich in dem Gemach um und pfiff durch die Zähne.
»O weh!« versetzte er. »Mir scheint, ich komme zu spät ... gerade vor Toresschluß! ... Sie sind im Begriff, abzureisen?«
»Ja. Um zehn!«
»Gott, wie schade! ... Hätt' ich das nur vorher gewußt. Da hat es eigentlich kaum mehr Zweck, daß ich mich meines Auftrages entledige! ... Aber schließlich, ich habe es nun einmal übernommen, es auszurichten: Fräulein von Teuffern hätte Sie für ihr Leben gerne noch einmal gesprochen!«
Der Millionär hatte zerstreut zugehört. Solche Bittgesuche waren sein tägliches Brot. Er wiederholte gedankenlos:
»Fräulein von Teuffern?«
»Erinnern Sie sich nicht, neulich hier unten ... die Dame, die Ihnen gerade gegenüber saß? Sie sprachen noch so viel mit ihr ...«
Karl Feddersen wandte dem Ulanen den Kopf zu. Er hatte Mühe, sich zu beherrschen.
»Die schlanke, dunkle Dame ...? Der Bruder war auch dabei ...«
»Ja. Eben die!«
»Das ist ein Fräulein von Teuffern?«
»Der Alte ist Generalleutnant z. D. Sie wohnen draußen in Charlottenburg. Eine sehr gute Familie. Ich komme manchmal Sonntags hin. Eigentlich wollte Ihnen Fräulein von Teuffern schreiben. Aber dann fürchtete sie, das käme am Ende nur in die Hände Ihres Sekretärs und von da in den Papierkorb. Sie kriegen doch gewiß täglich massenhaft allerhand Wische. Da entschloß sie sich lieber, mich zu schicken ...«
»Ich stehe zur Verfügung!« sagte Karl Feddersen. Seine Stimme schwankte vor Erregung. Der Rittmeister achtete nicht darauf. Er spielte mit seinem Säbel, den er zwischen den Knien hielt.
»Sie mochte Sie nämlich etwas fragen!« sagte er. »Nur ein paar Minuten, aber möglichst ungestört. Das ginge nun zum Beispiel bei dem Five-o'clock da unten nicht. Da setzen sich gleich zehn, zwölf Bekannte von uns ungebeten mit an den Tisch. Aber im Tattersall in der Luisenstraße etwa ... es kommen da vormittags viele Damen hin, um zu reiten ... da geht man ganz ungeniert auf und nieder ... Es war natürlich von Haus aus unbescheiden, Ihnen den kleinen Weg zuzumuten! Und nun, wo es der Unstern will, daß Sie in wenigen Stunden schon abdampfen ...«
»Einen Augenblick, bitte!« unterbrach Karl Feddersen und griff heftig, um seine Verwirrung zu verbergen, nach einigen Depeschen, die ihm der Diener hingelegt hatte. Er riß sie auf. Zwei enthielten gleichgültige Geschäfte. Die dritte war aus Paris: »Du bist ein Deserteur! Wenn Du nicht kommst, hole ich Dich übermorgen persönlich. Sascha!« Er faltete das Blatt zusammen und sagte mit erkünstelter Ruhe:
»Das trifft sich merkwürdig, Herr Baron! ... In diesem Moment bittet mich ein Geschäftsfreund dringend, nicht abzureisen. Er sei im Begriff, mich hier aufzusuchen. Ich muß wohl oder übel bleiben!«
»Ah famos! ... Mir fällt förmlich ein Stein vom Herzen! ... Die Sache ist natürlich für Sie nicht wichtig, aber für die anderen sehr. Haben Sie denn auch wirklich morgen ein paar Minuten Zeit?«
»Viel nicht!« Karl Feddersen gab sich den Anschein eines von Arbeit überhäuften Mannes. »Aber es läßt sich schon machen. Würde es wohl um elf Uhr passen?«
»Wann Sie bestimmen! Also um elf im Tattersall. Und inzwischen herzlichen Dank!«
Der Ulan klirrte händeschüttelnd hinaus. Der andere schloß die Türe hinter ihm, setzte sich an den Schreibtisch und drahtete an seinen Bruder. »Bin mündig. Bleibe Du in Paris. Gruß. Charley.«





























