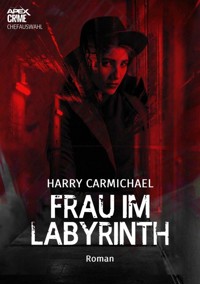5,99 €
Mehr erfahren.
Drei Menschen im Dreieck des Todes: Einer muss sterben... Der zweite wird des Mordes beschuldigt... Der dritte ist bereit, sich zu opfern und einen Mord zu gestehen, den er nicht begangen hat...
Das Opfer: Stephen Denham. Seine Frau Catherine steht als Mörderin vor Gericht. Und David, ihr Stiefbruder, ist bereit sie zu retten... um jeden Preis...
Harry Carmichael (eigtl. Hartley Howard/Leopold Horace Ognall - * 20. Juni 1908 in Montreal, Québec; † Großbritannien) war ein britischer Schriftsteller.
Der Roman Liebe, Mord und falsche Zeugen erschien erstmals im Jahr 1961; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1980.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
HARRY CARMICHAEL
LIEBE, MORD UND
FALSCHE ZEUGEN
Roman
Apex Crime, Band 286
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
LIEBE, MORD UND FALSCHE ZEUGEN
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Das Buch
Drei Menschen im Dreieck des Todes: Einer muss sterben... Der zweite wird des Mordes beschuldigt... Der dritte ist bereit, sich zu opfern und einen Mord zu gestehen, den er nicht begangen hat...
Das Opfer: Stephen Denham. Seine Frau Catherine steht als Mörderin vor Gericht. Und David, ihr Stiefbruder, ist bereit sie zu retten... um jeden Preis...
Harry Carmichael (eigtl. Hartley Howard/Leopold Horace Ognall - * 20. Juni 1908 in Montreal, Québec; † Großbritannien) war ein britischer Schriftsteller.
Der Roman Liebe, Mord und falsche Zeugen erschien erstmals im Jahr 1961; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1980.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
LIEBE, MORD UND FALSCHE ZEUGEN
Erstes Kapitel
Ich hatte Stephen Denham immer beneidet. Er schien dem Leben mehr abzugewinnen als jeder andere, den ich kannte, und in vieler Hinsicht unterschied er sich sehr stark von den anderen. Sorgen schien er nicht zu kennen, nichts erschütterte ihn in der lässigen, leicht spöttischen Art, mit der er die Probleme anging, die uns andere bedrückten. Wenn ihm überhaupt etwas naheging, so zeigte er es nicht.
Wir freundeten uns in unserem ersten Jahr in Oxford an. Sein Zimmer im Wohnheim lag einen Stock über dem meinen, es war ein Mansardenzimmer am Ende einer steilen, gewundenen Treppe, die bei Tag und Nacht nur unzulänglich beleuchtet war. Ich erinnere mich an einen Sonntagnachmittag, an dem ein Student namens Troup die ganze Wendeltreppe hinunterstürzte und sich dabei ein Bein brach.
Es hieß damals, der Unfall wäre die Folge eines ausgelassenen Gerangels nach einem Zechgelage gewesen, und Troup hätte Glück gehabt, sich nicht das Genick zu brechen. Aber ich habe mir oft meine eigenen Gedanken gemacht. Stephen mochte Troup nicht.
Später, in der Rückschau, fiel mir auf, dass ausgerechnet den Leuten, die Stephen nicht mochte, gern etwas zustieß. Möglich, dass vieles davon Einbildung war, denn bei manchen dieser Zwischenfälle konnte er wirklich nicht die Hand im Spiel gehabt haben, andere jedoch konnten sehr wohl von ihm inszeniert worden sein... (Wie der Skandal damals, als man in Boltbys Zimmer eine Frau entdeckte, und er mit Schimpf und Schande aus Oxford weggejagt wurde.)
Später stellte sich heraus, dass die Proktoren einen anonymen Hinweis bekommen hatten. Vielleicht war es Zufall, dass Boltby Stephen ein paar Tage zuvor damit gehänselt hatte, ein snobistischer Streber zu sein. Ich erinnere mich, dass er davon sprach: »Wenn der Bettelmann aufs Roß kommt...«
Stephens einzige Reaktion waren sein gewohntes spöttisches Lächeln gewesen und die Erklärung, er hätte festgestellt, es lohne sich, mit den richtigen Leuten Umgang zu pflegen. Mit affektierter Geduld legte er dar, dass dies für ihn der einzige Grund war, kostbare Jahre in Oxford zu verbringen. Wenn man weder Grips noch Geld hatte, was konnte man sich dann mehr erhoffen als einen besseren Akzent und die Gesellschaft einflussreicher Leute?
Eines habe ich bis zum heutigen Tag nicht verstanden: weshalb er gerade meine Gesellschaft suchte. Ich hatte so wenig Geld wie er und keinerlei Beziehungen, die ihm auch nur im geringsten hätten nützlich sein können. Ich war das einzige Kind meiner Eltern, bescheidener bürgerlicher Leute, die weder Rang noch Namen besaßen. Mir eine anständige Ausbildung mitzugeben, hatte sie beträchtliche Opfer gekostet.
Als ich das erste Jahr in Oxford studierte, starb meine Mutter. Achtzehn Monate später verheiratete sich mein Vater wieder. Seine zweite Frau war eine Witwe mit zwei erwachsenen Töchtern, von denen eine bald danach auch heiratete und ins Ausland ging. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen.
Die andere Tochter war Catherine. Ich mochte sie. Während der Ferien waren wir viel zusammen, und zwischen uns entwickelte sich die Art toleranter Zuneigung, die zwischen echten Geschwistern besteht. Als ich einige Jahre später Oxford verließ, war sie vielleicht der einzige Mensch, von dem ich aufrichtig sagen konnte, dass ich ihn gern hatte. Meinem Vater hatte ich seine Wiederverehelichung nie verziehen.
Drei Jahre des Jurastudiums lehrten mich eines: Ich hatte keine Zukunft als Rechtsanwalt. Als ich die Prüfung nicht schaffte, war ich, glaube ich, mehr erleichtert als enttäuscht. Nach einem kurzen Urlaub nahm ich bei einem Reisebüro eine Stellung als Reiseleiter an.
Die Ansichten meines Vaters zur Frage meiner beruflichen Karriere zählten für mich nicht. Ich glaube, ihm war es sowieso ziemlich gleichgültig, was ich tat. Er hatte mich lediglich deshalb dazu ermuntert, Jura zu studieren, weil er meinte, das entspräche meinen Plänen, und weil er wusste, dass meine Mutter ihr Leben lang den ehrgeizigen Wunsch gehabt hatte, mich eines Tages als Rechtsanwalt zu sehen. Mit ihrem Tod starb auch der raison d’etre meiner juristischen Laufbahn. Das ist mir heute klar.
Ein oder zwei Wochen, nachdem die Prüfungsergebnisse veröffentlicht worden waren, schrieb Stephen mir einen Brief:
...ich muss gestehen, ich konnte mir Dich nie so recht in Perücke und Robe vorstellen, und ich hoffe, Du hast nicht vor, es noch einmal zu versuchen. Ich wusste von Anfang an, dass Dir im Grunde gar nichts daran lag.
Geh also jetzt nicht in Sack und Asche, nur weil Du die Prüfung verpatzt hast. Überleg Dir lieber, wie viele gewinnbringende Jahre Du damit vergeudet hättest, für die Abschlussprüfungen zu büffeln, und wie lange Du Dich danach noch von den kümmerlichen Fällen hättest ernähren müssen, die so ein etablierter Geldsack von einem Anwalt Dir ab und zu hingeworfen hätte.
Für mich war, wie ich Dir ja mehrfach erklärt habe, das Geschichtsstudium nur ein Vorwand – nicht ein Mittel zum Zweck einer Akademikerkarriere. Komischerweise machte mir das Studium Spaß, ganz abgesehen davon, dass es den Zweck, den ich damit verfolgte, erfüllt hat.
Im Augenblick habe ich noch keine festen Pläne. Man hat mir bereits – so wie ich es sehe, allein aufgrund meiner Persönlichkeit – zwei Stellungen angeboten. Ich brauche nur zu sagen, dass ich gerade mein Studium in Oxford abgeschlossen habe (ohne akademischen Grad), und schon versucht der Durchschnitts-Unternehmer, mich mit Aussichten auf einen Posten in der Betriebsleitung zu locken.
Bisher hat einer mir siebenhundert pro Jahr geboten (dazu eine Altersrente), wenn ich in der Personalabteilung anfange, um nach gründlicher Einarbeitung und so weiter und so fort. Der andere meint, ich könnte ihm einen Haufen Geld machen, wenn ich teure Autos an amerikanische Touristen verkaufe, weil die einem, der gelernt hat, gebildet daherzureden, absolut alles abkaufen.
Aber die guten Leutchen begreifen nicht, dass es mir darum geht, selbst Geld zu machen. Auf eines kannst Du Dich verlassen: Ich werde gut für mich sorgen. Wer sonst soll es denn auch tun, nachdem ich keine Familie habe? Und schließlich konnte ich ja auch ein paar gute Beziehungen anknüpfen.
Unter der oben angegebenen Adresse bin ich die nächsten ein, zwei Monate zu erreichen; schreib mir also einmal, wie es Dir geht. Bei Gelegenheit müssen wir mal ein Bier zusammen trinken und die Erinnerungen an unsere vergeudete Jugend aufwärmen.
Alles Gute
Stephen
Sein Brief traf ein, während ich mit einer Reisegesellschaft in den Niederlanden unterwegs war. Als ich endlich dazu kam, ihm zu antworten, war er umgezogen. Mein Brief kam mit dem Vermerk Mit unbekannter Adresse verzogen zurück.
In den folgenden sechs Jahren dachte ich nur selten einmal an Stephen Denham. Er war ganz einfach jemand, den ich früher einmal gekannt hatte, jemand, den ich nicht wiederzusehen erwartete.
Hätte unsere fragwürdige Freundschaft damit ein Ende gehabt, so wäre das Leben vieler Menschen ganz anders verlaufen. Vielleicht war es die Schuld meines Vaters... vielleicht meine eigene. Ich neige zu der Ansicht, dass jede Tragödie einfach Schicksal ist.
Zweites Kapitel
Fast vier Jahre lang arbeitete ich als Reiseleiter. Vielleicht würde ich heute noch das Kindermädchen für reiche Amerikaner und Südafrikaner spielen, hätte ich nicht eines Tages eine schwere Grippe bekommen. Nach einer Rundreise durch Europa, die fünf Wochen dauerte, holte ich mir auf der Rückfahrt von Schweden eine Erkältung und musste vierzehn Tage lang liegen.
Catherine besuchte mich in der Pension, in der ich immer wohnte, wenn ich nicht im Ausland auf Reisen war. Im Haus meines Vaters lebte ich schon seit dem Tag nicht mehr, an dem ich die Stellung bei dem Reisebüro angenommen hatte.
Sie bedrängte mich mit Fragen nach meinem Befinden und gab erst Ruhe, als sie sich vergewissert hatte, dass ich tatsächlich nicht ernstlich erkrankt war. Danach plauderten wir eine ganze Weile über oberflächliche Dinge. Allein, sie da zu haben und ansehen zu können, tat mir wohler als alle Medizin.
Ich erkundigte mich, wie es ihrer Mutter ginge... ob es meinem Vater gutginge... was sie während meiner Abwesenheit getrieben habe. Es waren die üblichen Fragen, die ich immer stellte. Sie wusste, dass ich nur Konversation machte, weil ich sie in meiner Nähe haben wollte.
Schließlich sagte sie: »Als du im Juni zu Hause warst, hab’ ich dir doch erzählt, dass ich Feuilletonredakteurin geworden bin, nicht wahr?«
»Ja. Wie läuft’s denn?«
»Ach, ganz gut. Seit die Perrott-Gruppe uns übernommen hat, ist allerhand los.«
»Ach ja, das hab’ ich gelesen. Was ist denn dein neuer Chef für ein Mensch?«
»Nett. Gar nicht so, wie ich erwartet habe. Es heißt doch immer, diese Leute, die es vom Zeitungsverkäufer zum Pressezar bringen, interessieren sich ausschließlich für die Auflagezahlen und das Einkommen aus der Werbung – aber er ist ganz anders. Er sagt, an Gewinn will er erst denken, wenn wir Roundabout zur besten Frauenzeitschrift im ganzen Land aufgebaut haben.«
»Meinst du, er wird’s schaffen?«
»Wenn nicht, dann nicht, weil es ihm an Energie und Einfällen mangelt. Und weil wir gerade von Einfällen sprechen...« sie sah mich nachdenklich an und lächelte dann – »ich hab’ da einen Einfall gehabt, den ich dir mal unterbreiten wollte.«
»Ich dachte mir doch gleich«, versetzte ich, »dass du etwas in petto hast. Worum geht’s denn?«
Sie klappte ihre Handtasche auf und zog einen Briefumschlag heraus, der mir bekannt vorkam.
»Ich hab’ die letzten zwei Briefe aufgehoben, die du mir geschrieben hast«, bemerkte sie, »und neulich habe ich sie Mr. Perrott gezeigt. Er findet wie ich, dass sie das Gerüst für einen interessanten Reisebericht bilden könnten. Sie müssen natürlich noch ein bisschen umgeschrieben werden, aber da hast du wenigstens Beschäftigung, während du im Bett liegen musst. Nun, was meinst du dazu?«
»Du spinnst«, sagte ich. »Und dein Mr. Perrott auch. Ich hab’ so was doch noch nie gemacht. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte.«
»Ich zeige es dir. Und wir zahlen gut, vergiss das nicht. Wenn dir der Bericht gelingt, nehmen wir vielleicht auch noch andere.«
»Ja, und die Auflagenziffer von Roundabout sackt dann schnell auf Null ab.«
»Darüber zerbrich dir mal nicht den Kopf«, erwiderte Catherine. »Das kannst du uns überlassen. Du hast doch nichts zu verlieren. Außerdem verkürzt es dir die Zeit. Also, machst du es?«
Ich fand den Einfall immer noch absurd, aber als sie darauf beharrte, dass ich es doch wenigstens versuchen könnte, sagte ich schließlich ja. Wenn Catherine sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, konnte sie mich immer herumkriegen. Das war von jeher so gewesen.
Sie setzte sich also auf den Bettrand und erklärte mir, was getan werden musste, um aus dem Geschwätz in beiden Briefen einen Artikel zu machen, den man veröffentlichen konnte. Als sie fertig war, glaubte ich beinahe selbst, ich könnte es schaffen.
Dann sagte sie: »Ich lass dir etwas Papier und einen Kugelschreiber da. Kann ich dir sonst etwas mitbringen, wenn ich morgen wiederkomme?«
Ich erklärte ihr, ich hätte alles, was ich brauchte, die Leute von der Pension sorgten gut für mich. In ein paar Tagen würde ich schon wieder auf den Beinen sein, und sie sollte sich ja keine Sorgen machen, bloß weil ich eine kleine Grippe habe.
Sie drückte mir die Hand und schüttelte mir das Kopfkissen auf, damit ich bequemer liegen konnte. Dann musste ich ihr noch versprechen, dass ich gut auf mich aufpassen würde. Als sie gegangen war, fühlte ich mich einsamer denn je.
Die nächste halbe Stunde brachte ich damit zu, mich zu fragen, was wohl geschehen wäre, wenn ich Catherine unter anderen Umständen begegnet wäre. Hätte nicht mein Vater ihre Mutter geheiratet, so wären Catherine und ich ganz einfach zwei Menschen gewesen, die einander mochten, zwei Menschen, die sehr viel gemeinsam hatten. So jedoch, wie die Dinge lagen, sah sie in mir den Bruder, den sie nie gehabt hatte.
Törichte Überlegungen waren das. Es war mir direkt peinlich, als ich mir vorstellte, was sie sagen würde, wenn sie je erfahren würde, was ich dachte.
Dieser Vorschlag, einen Bericht für Roundabout zu schreiben, war ebenfalls albern. Sie hatte ihn wahrscheinlich nur gemacht, um mir etwas zu tun zu geben, womit ich mir die Langeweile vertreiben konnte, während ich ans Bett gefesselt war. Dennoch, ich hatte es ihr versprochen...
Den ganzen Nachmittag schrieb ich an jenem ersten Artikel. Bei einem mageren Abendessen las ich ihn zweimal durch, zerriß die Blätter und begann von neuem.
Das exerzierte ich dreimal durch. Als ich schließlich fertig war, fand ich ihn immer noch nicht gut. Die Vorstellung, dass man mich für so etwas bezahlen würde, war lächerlich.
Beim Einschlafen, spät an diesem Abend, sagte ich mir, dass Catherine ihre Stellung verlieren würde, wenn der Artikel gedruckt würde.
Aber Catherine gefiel er. Zwei Tage später besuchte sie mich wieder, um mir zu berichten, dass auch Mr. Perrott ihn gut fand. Er meinte, meiner Art zu schreiben sei etwas Besonderes eigen, wonach er schon lange gesucht hätte. Wenn ich zu einem Thema, das er mir vorschlug, einen weiteren Artikel machen wollte, könnte er ihn sicherlich verwenden.
In der Zeit, die ich noch im Bett verbringen musste, schrieb ich zwei weitere Artikel. Beide wurden von anderen Zeitschriften, die zur Perrott-Gruppe gehörten, angenommen.
Das war der Anfang. Ein Jahr später verdiente ich mit der Schriftstellerei mehr Geld, als das Reisebüro mir bezahlte. Ich arbeitete sogar an meinem ersten Roman.
Catherine half mir viel. Wir standen in regelmäßigem Briefwechsel, und immer, wenn ich zwischen meinen Reisen in London war, trafen wir uns, aßen zusammen, gingen ins Theater und unterhielten uns hinterher beim Kaffee eingehend über mein Buch. Wir redeten eigentlich nie über etwas anderes.
Sie wusste immer genau, was ich sagen wollte, selbst wenn ich mich schlecht ausdrückte. Immer wieder schlug sie dann das richtige Wort vor, die richtige Formulierung, die sich mir so häufig entzog. Zwischen uns bestand ein rein gefühlsmäßiges Verständnis, das der Beziehung ähnlich war, die ich mit meiner Mutter gehabt hatte. Manchmal war es beinahe, als könnte Catherine meine Gedanken lesen.
Nur eines hielt ich tief verborgen vor ihr. Ich hatte Angst davor, was geschehen würde, wenn sie jemals erfuhr, welcher Art meine Gefühle für sie waren. Wenn sie merkte, dass ich sie liebte, während ihre Gefühle zu mir nur die einer Schwester waren, würde das unsere Beziehung von Grund auf verändern. Ich brauchte aber die Wärme und die Kraft ihrer Zuneigung zu sehr, um ein solches Risiko einzugehen.
Und so verstrichen zwei weitere Jahre. Catherine war es, die meinen fertigen Roman redigierte, Catherine, die einen geeigneten Verlag vorschlug, Catherine, die mit mir an jenem herrlichen Tag feierte, als der Vertrag unterschrieben war.
Vor lauter Aufregung und von ein paar Cognacs zur Feier des Tages war ich, glaube ich, direkt beschwipst. Ich weiß noch, dass wir beide unaufhörlich redeten – närrisch und ausgelassen, größtenteils unsinniges Zeug. Das Leben war ein großartiges Abenteuer, und ich war ein ganz toller Bursche.
Als wir wieder nüchtern und vernünftig wurden, fragte Catherine: »Und was hast du jetzt vor, David?«
Ihre Augen lächelten, aber ich spürte, dass der Spaß jetzt vorbei war.
»Mit dem Reisegeschäft bin ich fertig, wenn du das meinst«, erwiderte ich. »Eine Reise mache ich noch, aber dann wird nur noch geschrieben.«
Sie spielte mit ihrer Serviette und machte ein nachdenkliches Gesicht.
»Meinst du nicht, es wäre besser, du wartest, bis der Erfolg sicher ist?«, fragte sie dann. »Es hängt doch sehr viel davon ab, wie dein Buch aufgenommen wird.«
»Der Verlag scheint ziemlich optimistisch zu sein.«
Ein, zwei Drinks zu viel, und ich wurde leicht aggressiv. Ich war ein bisschen verärgert darüber, dass sie meinen Enthusiasmus dämpfen wollte.
Vielleicht verriet meine Stimme eine Spur von diesem Ärger.
»Die Verlage sind immer optimistisch«, versetzte sie. »Du darfst dich nicht auf die Schmeicheleien verlassen, die sie dir auftischen. Die Schriftstellerei bietet keinerlei Sicherheit, und du willst jetzt aufgrund eines einzigen Buches einfach ins kalte Wasser springen.«
»Das wird nicht mein einziges Buch bleiben«, erwiderte ich.
»Ja, aber zum Schreiben braucht man Zeit. Es wird ein gutes halbes Jahr dauern, ehe dieses erste Buch von dir veröffentlicht wird. Und vergiss nicht, dass die schwierigste Hürde gewöhnlich der dritte Roman ist. Warum behältst du deine Stellung beim Reisebüro nicht noch ein oder zwei Jahre und schreibst in deiner Freizeit? Das hast du doch bis jetzt auch geschafft und...«
»Also hör mal«, unterbrach ich sie, »du bist doch diejenige, die mir unablässig Erfolg predigt, seit du mich dazu überredet hast, diesen ersten Artikel zu schreiben. Was ist denn plötzlich in dich gefahren? Was ist aus dem Vertrauen geworden, das du in mich setztest?«
»Ich habe es immer noch – mehr denn je. Aber wenn du die Dinge überstürzt, dann schadest du dir vielleicht selbst. Und...« sie senkte die Lider, so dass ich ihr nicht in die Augen sehen konnte – »...das möchte ich nicht.«
Einen Moment lang war ich versucht, meine Gefühle für sie offenzulegen. Vielleicht, wenn ich noch einen Cognac mehr hätte getrunken gehabt, hätte ich den Mut aufgebracht, all die Dinge auszusprechen, die in mir verschlossen waren. Ich wusste, dass sich die Gelegenheit vielleicht nie wieder bieten würde.
Aber Catherine ließ mir keine Chance. Während ich noch nach den richtigen Worten suchte, fuhr sie fort: »Wie alt bist du eigentlich, David?«
»Achtundzwanzig. Das weißt du so gut wie ich. Und was für eine Rolle spielt überhaupt mein Alter?«
Sie sah mich an und nickte.
»Ich habe mir nur gerade überlegt«, sagte sie in einem Ton, als wäre sie viel älter und klüger als ich, »dass es für dich allmählich Zeit wird, ein ruhigeres Leben zu führen. Irgendwann willst du sicher auch mal heiraten, und dazu braucht man Geld. Du kannst nicht den Rest deines Lebens aus dem Koffer leben.«
Die schwache, ferne Hoffnung, die ich so lange genährt hatte, erstarb. Ich war für sie nicht mehr als ein Familienmitglied, ein Stiefbruder, der sich aus der Familie gelöst hatte. Als einer Schwester lag ihr mein Wohlergehen am Herzen – einer Schwester. Das war alles.
»Ich habe keinerlei Heiratspläne«, versetzte ich.
Sie blickte auf ihre Hände nieder, dann sah sie auf, und ihr Mund verzog sich zu einem kleinen gezwungenen Lächeln. Sie war plötzlich ein völlig anderer Mensch.
In gutmütig spottendem Ton meinte sie: »Du solltest dir ein nettes Mädchen suchen und eine Familie gründen.«
»Ich kenne keine netten Mädchen«, entgegnete ich. »Und eben noch wolltest du mich dazu überreden, meinen Job zu behalten, der mich kreuz und quer durch Europa jagt.«
»Das war etwas anderes!«
»Inwiefern? Ich wollte, ich wüsste, was plötzlich in dich gefahren ist. Wir sind hergekommen, um zu feiern, und auf einmal sprichst du in Rätseln. Kein Wunder, dass es immer heißt...«
»Alles Gute hat einmal ein Ende«, unterbrach mich Catherine.
Zwischen uns stand jetzt eine Wand, die nie zuvor dagewesen war.
Sie schob ihren Stuhl zurück und stand auf. Ihr Gesicht war das einer höflichen Fremden.
»Musst du wirklich gehen?«, fragte ich. »Es ist doch noch nicht mal halb drei.«
»Ich bin um drei mit ein paar Leuten verabredet. Außerdem hab’ ich einen ganzen Stapel von Sachen auf meinem Schreibtisch liegenlassen, als ich losstürzte, um mich mit dir zu treffen.«
Worte kamen mir aus dem Mund, für die es niemals eine Erklärung geben wird.
»Das ist die Strafe«, sagte ich, »wenn man eine Karrierefrau ist. Warum beherzigst du nicht deinen eigenen Rat und suchst dir einen Mann und ein trautes Heim?«
Einen Augenblick stand sie ganz still. Dann erwiderte sie, ohne mich anzusehen: »Vielleicht werde ich das tun – ja, das werde ich vielleicht tun. Und vielen Dank für das Mittagessen, David. Wann gehst du auf deine nächste Reise?«
»Am Freitag. Ich muss am Samstagmorgen eine Gesellschaft in Amsterdam abholen.«
»Dann ruf mich doch vorher noch mal an, ja?«
»Natürlich«, versicherte ich. »Ich melde mich bei dir, ehe ich abfahre. Grüß die Familie von mir.«
»Natürlich.« Sie nahm meine Hand und drückte sie kurz. »Bleib ruhig und trink noch einen. Das ist doch ein bedeutender Moment in deinem Leben.«
Ihre Augen wichen den meinen beständig aus, und sie schien es eilig zu haben, wegzukommen. Ich hätte wissen müssen, was dahintersteckte, aber ich hatte zu viel damit zu tun, mich selbst zu bemitleiden.
Als sie ihre Handtasche nahm, bemerkte sie: »Du brauchst mich nicht zur Tür zu bringen. Ich nehme mir draußen ein Taxi.« Mit einem Gesicht, das nichts verriet, fügte sie hinzu: »Auf Wiedersehen, David... und Hals und Beinbruch, ganz gleich, wofür du dich entscheidest.«
»Danke, Catherine«, gab ich zurück, »nicht nur für die guten Wünsche. Den ganzen Erfolg schulde ich dir. Ich werde vielleicht nie eine Berühmtheit werden, aber du hast mir zumindest die Gelegenheit gegeben.«
»Sei nicht albern.« Ihre Hand berührte leicht meine Wange, und ihr Gesicht wurde weich. »Du und ich, wir müssen einander doch nach so langer Zeit nicht solche Dinge sagen. Vielleicht kommt einmal ein Tag, an dem ich deine Hilfe brauchen werde – wer weiß?«
Heute weiß ich, dass sie auf das eine Wort wartete, das alles verändert hätte. Als ich darauf schwieg, setzte sie hinzu: »Du vergisst doch nicht, mich vor Freitag anzurufen, nicht wahr?«
»Nein, das vergesse ich bestimmt nicht«, erklärte ich.
An der Tür drehte sie sich noch einmal um und winkte mir kurz zu. Dann war sie verschwunden.
Ich saß lange Zeit reglos da und starrte auf die Tür, als bestünde die Hoffnung, sie würde zurückkommen. Ein Teil von mir war mit ihr fortgegangen – etwas, das nur sie und ich geteilt hatten, war tot.
Ich hatte nie zuvor jemanden geliebt. In diesen trostlosen Augenblicken sagte ich mir, dass ich niemals eine Frau so sehr begehren würde, wie ich Catherine in diesem Moment begehrte.
Am folgenden Tag rief ich zweimal in ihrem Büro an. Beide Male war sie unterwegs.
Am Freitag versuchte ich es noch einmal. Diesmal sagte man mir, sie wäre in einer Besprechung und erst nach siebzehn Uhr wieder erreichbar. Ich hinterließ eine Nachricht, dass ich um sechzehn Uhr dreißig vom Londoner Flughafen abfliegen würde, dass ich mich aber nach meiner Rückkehr bei ihr melden würde. Ich wollte ihr etwas Wichtiges mitteilen.
Vielleicht hat sie die Nachricht nie erhalten. Vielleicht hatte sie sich da bereits entschieden. Es spielt jetzt keine Rolle mehr.
Sieben Wochen später war ich wieder in London, hatte meinen Vertrag mit dem Reisebüro gelöst, konnte mich also frei und ungehindert auf mein zweites Buch konzentrieren. Sobald ich in meiner Pension war, rief ich Catherine an.
»Wie schön, deine Stimme wieder zu hören«, sagte sie. »Warum hast du mir nicht mal geschrieben, während du weg warst?«
»Ich hatte nicht viel Zeit, immer war irgendwas los«, erklärte ich.
Wochenlang hatte ich mir überlegt, was ich ihr sage würde. Am Telefon würde es einfacher sein als von Angesicht zu Angesicht... falls ich mich lächerlich machen sollte.
»Und wie war die Reise?«, fragte Catherine. »Schön?«
»Nein, ziemlich haarig. Zwei von den Leuten, die ich zu betreuen hatte, mussten sich mit einer Magenverstimmung ins Bett legen... der Transfer zwischen Frankreich und Deutschland klappte nicht... und mit meinem neuen Buch sitze ich fest.«
»Das hört sich ja alles recht zermürbend an. War das deine letzte Reise?«
»Ja, ich hoffe es. Und wie geht es dir?«
»Ach, nichts Aufregendes... das heißt, eine Neuigkeit hab’ ich noch für dich. Erinnerst du dich an unser Gespräch, das letzte Mal, als wir zusammen beim Mittagessen waren?«
Ich spürte, wie sich im Inneren meiner Brust ein eiskalter Knoten formte. Irgendetwas in ihrem Tonfall verriet mir, dass jetzt das kam, was ich während meiner ganzen Abwesenheit befürchtet hatte.
»Ja«, erwiderte ich. »Und?«
»Also, ich hab’ mich entschlossen, meinen eigenen Rat zu beherzigen.« Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: »Hugh Perrott hat mich gebeten, seine Frau zu werden.«
Der eiskalte Kloß stieg mir in die Kehle hinauf und raubte mir die Stimme. Als es mir endlich gelang, einen Ton hervorzubringen, sagte ich wie betäubt: »Ich dachte immer, er wäre verheiratet.«
Catherine zögerte wieder, ehe sie entgegnete: »Nein, er ist Junggeselle. Er sagt, er hätte auch die Absicht gehabt, einer zu bleiben – bis er seine Gefühle für mich entdeckte.«
Jetzt, da es zu spät war, hatte ich den Mut gefunden – den Mut, das Falsche zu sagen.
»Aber du kannst ihn nicht heiraten, Catherine!«, rief ich. »Das ist doch – es ist einfach lächerlich!«
Sehr förmlich fragte sie: »Wieso ist es lächerlich?«
»Weil er viel zu alt für dich ist. Er muss doch an die Fünfzig sein.«
»Achtundvierzig ganz genau.«
»So alt, dass er dein Vater sein könnte.«
»Da hast du natürlich recht«, erwiderte Catherine. »Aber er wird mein Ehemann.«
Worte schossen mir durch den Kopf – bittere, verletzende Worte, die ihr so wehtun würden, wie sie mir wehgetan hatten. Ich hatte kein Recht, sie auszusprechen, aber sie überfluteten mich, und schwemmten meine Liebe zu ihr fort.
Wieder einmal war ich allein. Wieder einmal empfand ich die verzweifelte Einsamkeit, die mich verschluckt hatte, als meine Mutter gestorben war.
»Nun«, sagte ich, »wenn du fest entschlossen bist, werde ich natürlich nicht versuchen, es dir auszureden. Du bist ja alt genug, um zu wissen, was du vom Leben willst.«
»Ich bin sechsundzwanzig – beinahe siebenundzwanzig«, versetzte Catherine. »Und selbst meine besten Freunde würden nicht behaupten, dass ich eine Schönheit bin. Ich finde, ich kann mich glücklich preisen, einen Mann wie Hugh Perrott zum Ehemann zu bekommen.«
»Du bist eine gutaussehende Frau«, erklärte ich. »Perrott, finde ich, muss sich glücklich preisen – in seinem Alter.«
»Und...« sie stockte, als bereitete es ihr Schwierigkeiten, die Worte auszusprechen, »willst du mir nicht Glück wünschen?«
»Du weißt, dass dich alle meine guten Wünsche begleiten. Ich frage mich nur, ob du wirklich das Richtige tust.«
»Glaubst du etwa, ich hätte mir das nicht gründlich überlegt, ehe ich mich entschied? Ich musste mir völlig sicher sein, dass ich ihm gegenüber fair handelte – denn ich weiß, er sucht nicht nur eine Frau, die ihm das Haus führt. Er liebt mich.«
»Und du? Liebst du ihn auch?«
Es wurde ganz still.
Dann sagte Catherine: »Ich bewundere ihn ungeheuer.«
Bei mir war es plötzlich vorbei mit allem Taktgefühl. Heute weiß ich, dass ich in jenem Moment unser beider Leben hätte ändern können. Heute weiß ich, was ich hätte sagen sollen.
Stattdessen jedoch fragte ich: »Ihn oder sein Geld?«
Es war unverzeihlich. Ich hörte, wie sie rasch und abrupt den Atem einzog, und ich dachte, sie würde auflegen.
Dann aber sagte sie, ohne eine Regung von Gefühl in der Stimme: »Das hätte ich von dir niemals erwartet, David. Vielleicht tut es dir später, wenn du besserer Stimmung bist, doch leid.«
Die aufgestaute Bitterkeit löste sich und hinterließ in mir schmerzhafte Leere. Es war kindisch, weiterhin mit dem Kopf gegen eine Mauer des Unvermeidlichen anzurennen.
»Es tut mir jetzt schon leid, Catherine«, versicherte ich. »Ich hab’ das nicht so gemeint. Bitte, verzeih mir. Ich hoffe, ihr beide werdet sehr glücklich werden.«
Drittes Kapitel
Ein oder zwei Tage später saß ich allein in einem Lokal am Strand beim Mittagessen, als an meinem Tisch jemand stehenblieb und eine lang vergessene Stimme sagte: »Fallen Sie nicht vom Stuhl – Sie werden gleich mit einem alten Freund Wiedersehen feiern.«
Es war Stephen Denham. Er hatte seit dem letzten Mal, als ich ihn gesehen hatte, etwas zugenommen, und sein Gesicht war voller geworden, aber er war noch immer derselbe gutaussehende Stephen, gepflegt und gut gekleidet, das dunkle Haar glatt und glänzend, das alte spöttische Lächeln in den Augen.
»Das freut mich aber, Stephen«, erklärte ich. »Ich hab’ oft an dich gedacht und mich gefragt, wie es dir geht.«
Er zog auf die Art, die mir so vertraut war, einen Mundwinkel hoch und betrachtete mich. Dann schüttelte er den Kopf, und seine weißen, ebenmäßigen Zähne blitzten kurz auf.
»Sag lieber die Wahrheit und gib zu, dass du auch nicht einen Gedanken an mich verschwendet hast«, versetzte er. »Hast du was dagegen, wenn ich mich zu dir setze?«
»Aber gar nicht. Im Gegenteil, ich würde mich freuen. Das Alleinsein mit mir selber kann ich zur Zeit sowieso bis zum Überdruss genießen.«
»Das war doch immer so, alter Junge.«
Er setzte sich, winkte dem Kellner und gab seine Bestellung auf. Zwei Frauen am Nebentisch beobachteten ihn mit jenem Ausdruck in den Augen, den Frauen immer zeigten, wenn Stephen einen Raum betrat.
Nachdem er sich ganz unverhohlen umgesehen hatte, grinste er mich an und bemerkte: »Wir geben ein seltsames Paar ab, du und ich. Der Introvertierte und der Extrovertierte... Wie das Kind, so der Mann. Dein Problem liegt natürlich darin, dass du zu viel nachdenkst. Das ist eine schlechte Angewohnheit.«
»Vielleicht hab’ ich aber auch immer viel, worüber ich nachdenken muss«, konterte ich.
»Und hat es dich jemals weitergebracht? Hat das Nachdenken auch nur eins deiner Probleme gelöst?«
»Ich weiß nicht. Aber keiner kann aus seiner Haut.«
»Das stimmt nur in begrenztem Maße. Ich glaube an das Prinzip der Evolution – Pass dich an oder komm um. Als ich dich eben entdeckte, hast du wirklich ausgesehen wie ein armes Würstchen.«
Er strich sich mit einer Hand träge über das Haar, während seine Augen in meinem Gesicht forschten, als könnten sie in mein Hirn hineinsehen. Beinahe barsch fragte er: »Wo liegt denn das Problem? Geht es um eine Frau?«
»Ach, Quatsch«, versetzte ich. »Es gibt Wichtigeres im Leben als Frauen.«
»Wenn ich davon überzeugt wäre, dass du wirklich dieser Ansicht bist, würde ich dich aufgeben. Solange die Welt besteht, ist alles, was es wert war, getan zu werden – außerdem auch ein paar andere Dinge –, für die Frauen oder wegen der Frauen getan worden – entweder direkt oder indirekt. Das zu bestreiten wäre eine Verleugnung der stärksten Triebkraft des Menschen.«
»Du hast dich auch nicht geändert«, stellte ich fest.
»Oh, da irrst du dich. Ich bin erwachsen geworden, seit wir beide uns in den Bierkneipen von Oxford herumgetrieben haben. Sechs Jahre sind eine lange Zeit, David. Ich habe gelernt, mich in dem Dschungel, der außerhalb der Klostermauern der Universität wuchert, zurechtzufinden und für mich zu sorgen.«
»Du scheinst gewinnbringende Erfahrungen gemacht zu haben. Du siehst wohlhabend aus. Was treibst du denn beruflich?«
»Ach, dies und jenes. Man könnte mich als Unternehmer bezeichnen – wenn man höflich sein will.« Wieder blitzten seine Zähne in einem Lächeln, das seine Augen mit einem Kranz von Lachfältchen umgab. »Ich mache Geschäfte, alter Freund. Bei jedem geschäftlichen Unternehmen gibt es einen, der das Risiko trägt. Nun – der bin ich.«
Damals, während unserer Studienzeit, hatte er sich unter den Mädchen, welche wir kannten, diejenigen aussuchen können, die ihm gefielen. Seine Affären waren zahlreich und flüchtig gewesen. An diesem Tag beim Mittagessen wurde mir klar, dass sein männlicher Charme sich mit den Jahren noch verstärkt hatte. Er hatte eine Ausstrahlung, der sich wahrscheinlich viele Frauen nicht entziehen konnten.
Während mir dieser Gedanke durch den Kopf ging, fragte ich: »Bist du schon verheiratet?«
Er riss die Augen auf, als hätte ich ihn ungeheuer verblüfft. In theatralisch schockiertem Ton erwiderte er: »Guter Gott, nein! Das ist so ziemlich das Letzte, wonach es mich gelüstet – die Tochter irgendeines anderen Mannes zu unterhalten. Du dagegen bist genau der Typ« – seine Augen musterten mich wieder scharf –, »der sich nichts Schöneres vorstellen kann, als in Hausschuhen am Kamin zu sitzen, während das liebe Frauchen in seiner Privatkorrespondenz herumschnüffelt, um zu sehen, ob die Briefe nach Parfüm riechen. Es würde mich gar nicht wundern, wenn du schon in festen Händen wärest.«
»Noch nicht«, entgegnete ich. »Ich habe zu viel zu tun.«
»Was machst du denn?«
Ich erzählte ihm, dass ich angefangen hatte, zu schreiben, und er meinte, er hätte ja immer gewusst, dass ich ein kluger Junge sei. Dann fragte er: »Kannst du denn davon leben?«
»Das hängt zum großen Teil von meiner Produktion ab. Ich werde sicher nie zu den Schriftstellern gehören, die mit einem einzigen Buch fünfzigtausend Pfund verdienen. Aber mit Artikeln für Zeitschriften und Zeitungen und einem Roman alle zwei Jahre müsste ich eigentlich ganz bequem leben können.«
»Deine Vorstellungen vom bequemen Leben entsprechen wahrscheinlich nicht den meinen«, meinte Stephen.
Er war auf eine kühle Art belustigt. Der Ausdruck feiner Herablassung in seinen Augen erinnerte mich an jene anderen Gelegenheiten, bei denen ich mit ihm über meine Ambitionen gesprochen hatte. Ich hatte mich oft gefragt, weshalb er sich allen anderen Menschen überlegen fühlte.
»Das Wichtige im Leben ist doch«, bemerkte ich, »eine Arbeit zu tun, die einem Freude macht, und gleichzeitig sein eigener Herr zu sein.«
»Kein Mensch ist je sein eigener Herr. Wir alle müssen auf lange Sicht irgendjemandem oder irgendetwas Rechenschaft ablegen. Es gibt Menschen, die einem Chef oder einer Frau und Kindern dienen; andere sind an ein Bankkonto gefesselt. Du wiederum« – er schluckte einen Löffel voll Suppe und betrachtete mich kritisch – »bist der Typ, der ein Sklave seiner eigenen Hemmungen ist. Vielleicht ist das der Grund, weshalb du angefangen hast zu schreiben.«
»Und was für ein Typ würdest du sagen, dass du bist?«
Darüber brauchte Stephen gar nicht nachzudenken.