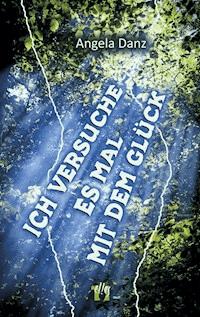8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: édition el!es
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachdem die Finanzfirma ihres Vaters durch Betrug ruiniert und er dafür verantwortlich gemacht wurde, quartiert sich Debra in einem heruntergekommenen Strandhaus in North Carolina ein, das sie von ihrer Großmutter geerbt hatte. Es ist Winter, es ist kalt, die Heizung ist kaputt, Wände und Türen sind undicht, Sand überall. Daher fragt Debra die Maklerin, die das Haus früher vermietet hat, ob sie einen Handwerker besorgen kann. Der steht prompt am nächsten Tag in Form der attraktiven Sydney, genannt Syd, vor der Tür. Die Arbeiten am Haus kommen flott voran und Debra und Syd sich beim Anstreichen schnell näher. Währenddessen versucht Debra, in alten Aktenordnern ihres Vaters den Firmenbetrug aufzuklären – und herauszufinden, warum Syd sich ebenfalls heimlich für die Akten interessiert ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Angela Danz
LIEBE WAR NICHT EINGEPLANT
Roman
© 2021édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-95609-345-6
Coverillustration:
1
Die Strahlen der untergehenden Sonne ließen die schmutzigen Fenster noch undurchsichtiger erscheinen. Genauso trüb wie ihre Stimmung.
Doch Debra hatte zu viel hinter sich, als dass es sie noch störte. Was machte das jetzt noch aus, wo sowieso alles den Bach runtergegangen war?
Aber was beklagte sie sich? Sie hatte ein Dach über dem Kopf – wenn auch eins, das nicht ganz dicht war –, ein Bett, in dem sie schlafen konnte, und die Packung Toastbrot plus einem Plastikbecher Peanut Butter, die sie auf dem Weg hierher gekauft hatte, würde sie wahrscheinlich ein paar Tage am Leben erhalten.
Verwundert über sich selbst schüttelte sie den Kopf. Weißes Brot. Weizenmehl. Wie lange hatte sie das nicht mehr gegessen? Zu viele Kohlenhydrate. Darauf verzichtete sie normalerweise, außer vielleicht in Form von Alkohol.
Aber wann hatte sie das letzte Mal Alkohol getrunken? Das wusste sie ganz genau. An ihrem Geburtstag vor zweieinhalb Monaten. Eine Flasche Champagner, die ihr Vater für ihren so bedeutsamen Dreißigsten gekauft hatte.
Sie hatten den Abend ausnahmsweise einmal allein verbringen wollen. Nur sie beide, Vater und Tochter. Und dabei hatte sie ihn fragen wollen, was ihn so bedrückte.
Denn dass ihn etwas bedrückte, das hatte sie schon bald gemerkt, nachdem sie nach ihrem Collegeabschluss wieder in das Haus in Connecticut gezogen war, in dem sie aufgewachsen war.
Ihr Vater war alt geworden in den paar Jahren, in denen sie auf dem College gewesen war. Die Falten in seinem Gesicht, zuvor kaum sichtbar, hatten sich zu tiefen Furchen eingegraben. Als wäre jemand mit einem Pflug darübergegangen.
Zuerst war sie so sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt gewesen, dass ihr das nicht so aufgefallen war, wie es ihr vielleicht hätte auffallen sollen. Aber kurz vor ihrem dreißigsten Geburtstag hatte sie es nicht mehr übersehen können.
Und dann war alles zusammengebrochen. Denn als sie sich gerade zu ihrem Geburtstagsdinner hinsetzen wollten, waren zwei Polizisten in Zivil erschienen, die ihren Vater baten, sie in die Stadt zu begleiten. Verwundert, nein eigentlich sogar verärgert hatte sie die Polizisten aus dem Haus weisen wollen.
Sie hätte sie vielleicht gar nicht erst hereingelassen, aber ihre Hausangestellte Belinda war gerade dabei gewesen zu gehen, nachdem sie das Dinner zubereitet und serviert hatte, sodass sie an der Tür praktisch in die Polizisten hineingelaufen war. Und natürlich hatte sie sie dann Debras Vater gemeldet.
Das Gesicht ihres Vaters, das ohnehin schon besorgt aussah, war aschfahl geworden, aber er hatte Debra beruhigt, hatte den Polizisten zugestimmt, dass sicher nur ein paar Fragen zu klären wären. Er wäre bald wieder da.
Das war leider ein Irrtum gewesen. Er war verhaftet worden, und bevor eine Kautionsvereinbarung getroffen werden konnte, war er einem Herzinfarkt erlegen.
Debras ganzes Leben wurde dadurch auf den Kopf gestellt, denn plötzlich war sie die Tochter eines Verbrechers. Wenn auch nur eines Wirtschaftsverbrechers. Aber das hatte gereicht, dass sie ihren Job verlor. Das Haus war mit Hypotheken belastet, und wenn die Bank es verkauft haben würde, würde kaum etwas übrig bleiben.
Da hatte sie sich an das kleine Häuschen ihrer Großmutter erinnert, das sie vor Jahren von ihr geerbt hatte. Seither hatte sie es jedoch nie mehr besucht. Es lag auf einer North Carolina vorgelagerten Insel, am Ende der bekannten Welt, hatte sie als Kind immer gedacht, wenn sie ihre Ferien dort verbracht hatte. Damals hatte ihr das gefallen. Es war ein Abenteuerspielplatz gewesen.
Heute war sie nicht mehr so sicher, ob ihr das gefiel. Sie war die Clubs und das Nachtleben von New York gewöhnt, gutbezahlte Jobs, die hohes Prestige verliehen, ein Leben, das keine Beschränkung kannte.
Hier auf der Insel gab es noch nicht einmal Handyempfang, wie sie hatte feststellen müssen. Das Telefon im Haus funktionierte auch nicht. Also Internet und Netflix ade.
Wie konnte man in so einer Einöde überhaupt leben, abgeschnitten von allem, was wichtig war? Oder auch nur unterhaltsam?
Tränen traten ihr in die Augen, als sie wieder an ihren Vater dachte. Nie zuvor hatte sie sich so allein gefühlt. Oder sogar einsam.
Ein leises Kratzen hinter der Tür des Schlafzimmerschranks ließ sie hochschrecken. Die Tür stand halb offen, weil sie sich nicht schließen ließ. Wie überall im Haus war auch hier das Holz verzogen.
Was bei einer Schranktür nicht so furchtbar schlimm war, machte sich bei Zimmertüren, die schief in den Angeln hingen, oder Fenstern ziemlich schmerzlich bemerkbar. Besonders durch die Fenster zog es kalt herein.
Sie war immer nur im Sommer hier gewesen, und auch das war schon sehr lange her, und deshalb hatte sie es damals wohl nie bemerkt. Außerdem hatte sich das Haus in einem sehr viel besseren Zustand befunden, davon konnte man wohl ausgehen.
Jetzt aber war Januar, und auch wenn es hier nie Frost gab, fröstelte sie. Zwar war sie aus Greenwich andere Temperaturen gewöhnt – jeder kannte ja die Winter in New York und Connecticut –, aber in North Carolina waren sieben Grad schon mit Frosttemperaturen zu vergleichen. Denn durch den Wind und die Feuchtigkeit wurde die gefühlte Temperatur als wesentlich kälter empfunden als die gemessene. Ihr kam es jedenfalls viel kälter vor als jeder Winter, den sie je erlebt hatte.
Das Kratzen wiederholte sich. Sie blickte zur Zimmerdecke. Konnte das eventuell auf dem Dach sein? Es stürmte draußen, und ein Zweig konnte dort oben etwas gestreift haben.
Erneut fröstelte sie und blickte zum Fenster hinüber, das ihr einen weiteren kalten Luftzug schenkte.
Dieses Kratzen machte sie verrückt. War sie etwa nicht allein im Haus? Das konnte doch gar nicht sein. Die Maklerin hatte ihr den Schlüssel übergeben und gesagt, die letzten Mieter wären schon lange ausgezogen, das Haus stände schon eine Weile leer. So sah es auch aus.
Da erhaschte sie eine Bewegung aus dem Augenwinkel. Eine Maus, die kurz innehielt, sie mit klugen Knopfaugen musterte, aber offenbar nicht bedrohlich fand. Sie kam aus dem Kleiderschrank heraus, als lebte sie dort. Dann lief sie die Scheuerleiste entlang und verschwand in einem kleinen Loch in der Zimmerecke.
Hatte sie sich doch nicht geirrt. Sie war nicht allein. Durch diese kleine Maus wurde ihr ihre Einsamkeit jedoch vielleicht sogar noch mehr bewusst. Der Kummer um ihren Vater, die Wut auf ihre sogenannten Freunde, die sie sofort fallengelassen hatten, als sie ihrer Meinung nach nicht mehr gesellschaftsfähig war, und ihre Hilflosigkeit, an dem allen nichts ändern zu können, überwältigten sie auf einmal.
Ein Schluchzer entrang sich ihrer Kehle, und das altersschwache Eisenbett quietschte, als sie sich darauf niedersinken ließ. Sie setzte ihren Tränen keinerlei Widerstand mehr entgegen.
Die ganze Zeit hatte sie sich sehr beherrschen müssen, um die Fassade aufrechtzuerhalten, aber hier bröckelte nicht nur die Fassade des Hauses, sondern auch ihre eigene.
2
»Ich habe das Schild in Ihrem Garten gesehen.« Syd wies mit einer Hand lässig nach hinten.
Die Frau, die ihr die Tür geöffnet hatte, schüttelte bedauernd den Kopf. »Das Haus ist nicht mehr zu vermieten.«
»Das Zimmer auch nicht?«, fragte Syd.
Sie stutzte. »Oh, das Zimmer . . .« Es schien, als hätte sie ganz vergessen, dass da zwei Schilder im Garten standen, eins, das behauptete, das Haus wäre zu vermieten – was offensichtlich nicht stimmte –, und eins, das ein Zimmer mit eigenem Bad und einem separaten Eingang anbot.
»Sie vermieten es nicht mehr?«, hakte Syd noch einmal nach.
»Doch. Doch, eigentlich schon.« Mit einer Verlegenheitsgeste, die jedoch nicht sehr geübt erschien, strich sie sich die Haare hinters Ohr.
Seidenweiche Haare, so erschien es Syd, und sie spürte fast schon ihre Fingerspitzen kribbeln. Graugrüne Augen mit mehr Tendenz ins Grau als ins Grün sahen sie leicht hilflos an.
Auch diese Hilflosigkeit wirkte fast wie einstudiert. Diese Frau strahlte nicht viel Hilfloses aus. Syd hatte eher das Gefühl, sie war es gewöhnt, dass sie in jeder Situation wusste, was zu tun war.
»Und uneigentlich?« Syds Lippen verzogen sich zu einem leichten Schmunzeln.
»Oh ja, natürlich, entschuldigen Sie.« Die dezent geschminkten Lippen ihres Gegenübers wussten nicht so genau, wohin sie sich verziehen sollten. »Es wäre schon zu vermieten«, fuhr sie zögernd fort, »wenn es in Ordnung wäre.«
Syd hob die Augenbrauen. »Was heißt in Ordnung?«
»Sehen Sie selbst.« Die Frau trat einen Schritt zurück und hielt Syd die Tür auf. »Dann können Sie selbst entscheiden, ob Sie so ein Zimmer mieten wollen.«
»Es hat ein separates Bad und einen separaten Eingang, oder?«, erkundigte Syd sich, während sie die Veranda des Hauses betrat und einen Schritt an der Frau vorbeiging, um dann wieder stehenzubleiben.
»Das schon«, gab die Frau beinah etwas widerwillig zu. »Aber das Zimmer selbst ist . . . hm . . . in keinem guten Zustand. Da hat schon lange niemand mehr gewohnt.«
»Oh, ich bin handwerklich begabt«, sagte Syd. »Ich kann schon das eine oder andere in Ordnung bringen.«
Die Augen der Frau öffneten sich weit, als hätte Syd da gerade etwas ganz Erstaunliches von sich gegeben. »Sie können Sachen im Haus reparieren?«
Syd zuckte die Schultern. »So für den Hausgebrauch reicht’s. Ich muss selten einen Handwerker holen.« Sie lachte leicht. »Eigentlich nie.«
»Sie sind ein Geschenk des Himmels«, sagte die Frau, und sie schien es auch so zu meinen. Ein erfreuter Ausdruck legte sich über ihr Gesicht. »Kommen Sie bitte. Hier entlang.« Sie wies mit einem Arm an Syd vorbei, folgte dem Arm, und Syd folgte ihr.
Sie sah sofort, was die abgeneigte Vermieterin in spe gemeint hatte, als sie das winzige Zimmer betrat. Offenbar hatte hier jemand die hintere Veranda zu einem Zimmer mit eigenem Bad umgebaut, obwohl dafür kaum Platz war. Das Zimmer wurde von einem schmalen Bett und einem Schrank schon fast ausgefüllt, und das Bad war mehr eine Nasszelle.
An der schon lange keine Reparaturen mehr vorgenommen worden waren, so wie es aussah. Die Dielen im Zimmer selbst schienen bereits ein wenig brüchig, und sie hätten sowieso einmal wieder einen neuen Anstrich vertragen können. Ein Zimmer, das tatsächlich zuerst einmal hätte renoviert werden müssen, bevor man es vermieten konnte, da hatte die Dame recht.
»Ich nehme es.« Syd nickte ihr zu. »Wenn Sie nichts dagegen haben, dass ich keine Miete zahle, es dafür aber renoviere. Da ist ja einiges zu tun.« Sie lächelte die Frau an. »Ich werde nicht dauerhaft hierbleiben, habe hier nur einen Auftrag zu erledigen.«
Es schien, als hätte sie die Lady damit sprachlos gemacht, denn sie starrte Syd nur an, als hätte sie in einer fremden Zunge mit ihr gesprochen.
»Ich bin Taucherin«, erklärte Syd. »Meeresarchäologin eigentlich.« Sie lachte. »Und Sie wissen ja, hier vor der Küste liegt der größte Schiffsfriedhof.«
»Ich dachte, Sie wären Handwerkerin«, bemerkte die Dame mit den graugrünen Augen leicht verwirrt. Wenigstens hatte sie ihre Sprache wiedergefunden.
Syd schüttelte den Kopf. »Nur in meiner Freizeit, wie ich schon sagte. Und wenn es nötig ist.«
»Hier ist es nötig«, murmelte die andere, als könnte sie ihr Glück kaum glauben. »Mehr als nötig.«
Sie straffte ihre Schultern und schaute Syd jetzt beinah etwas kühl an, so wie man es von einer Lady ihrer Herkunft erwartete. Vermutlich hatte sie ein sauteures College besucht und auch sonst alles erhalten, was man für ein gutes Leben brauchte. Man sah ihr an, dass sie garantiert keine Handwerkerin war.
»Dann werde ich der Maklerin Bescheid sagen«, bemerkte sie, »dass sie nicht mehr nach einem Handwerker suchen muss. Ich hatte sie nämlich gebeten, mir einen zu schicken.«
»Ach so«, entgegnete Syd und runzelte die Stirn. »Das hat sie gemeint.« Sie lächelte ihre neue Vermieterin und auch Mitbewohnerin an. »Ich habe nämlich mit Ihrer Maklerin gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass hier ein Zimmer zu vermieten ist. Hat auch irgendwas von einem Handwerker und Renovierung gemurmelt. Das hatte ich schon wieder vergessen.«
Kurz musterte die Frau mit den graugrünen Augen und den seidenweichen dunklen Haaren sie. »Dann sind wir uns einig?«, stellte sie fest. »Sie machen das jetzt?«
Syd nickte. »Ich muss mir dann allerdings noch ein bisschen Werkzeug besorgen. Dabei kann ich auch gleich Ihrer Maklerin Bescheid sagen, dass sie niemand anderen mehr schicken muss.« Sie streckte der Dame die Hand hin. »Da, wo ich herkomme, wird so etwas mit Handschlag besiegelt. Ich bin Sydney Amos.«
»Debra McFadden«, stellte die elegante Lady, die jetzt nur ein bisschen so aussah, als hätte sie etwas aus einem Regal mit Spinnweben herausholen müssen, die noch fast unsichtbar in ihrem Haar hingen, sich ebenfalls vor. Sie gab Syd die Hand, zog sie aber sofort wieder zurück, als hätte sie sich verbrannt.
»Dann hole ich mal Werkzeug, Ms. McFadden«, nickte Syd und verabschiedete sich zu ihrem Truck hin, der vorn an der Straße stand. »Bin bald wieder da.«
»Ähm . . .« Ein Räuspern hielt sie auf. »Falls Sie etwas essen wollen . . . Ich habe nichts im Haus außer ein bisschen Toastbrot und Peanut Butter.«
Syd drehte sich zu ihr zurück und grinste. »Wie? Keine Jelly?« Als sie sah, dass das Debra McFadden verwirrte, fügte sie schnell hinzu: »Kein Problem. Wenn die Küchenbenutzung inklusive ist, kann ich ein paar Sachen einkaufen und etwas kochen.«
»Sie können kochen?« Debra McFadden schien von einer Überraschung in die andere zu fallen.
»Nicht so gut wie Tauchen.« Syd lachte. »Aber man kann es essen.« Sie legte fragend leicht den Kopf schief. »Wollen Sie mitessen? Oder soll ich etwas Spezielles an Lebensmitteln für Sie mitbringen, was Sie selbst kochen möchten?«
»Oh . . . ähm . . . Wenn Sie kochen würden . . .« Debra räusperte sich ziemlich umständlich. »Ich könnte helfen. Und dann könnten wir zusammen essen.«
Syd nickte. »Sicher. Warum nicht? Also dann . . .« Sie hob die Hand, verabschiedete sich leicht winkend und stieg in ihren Truck. »Bis später.«
3
Debra blickte dem sich entfernenden Truck hinterher und rieb sich die Hand, als müsste sie etwas davon abstreifen. Sie kam sich fast so vor, als hätte dieser Truck, der sehr alt aussah und zu wenigstens der Hälfte aus Ersatzteilen zu bestehen schien, die vom Schrottplatz stammten, sie gerade überfahren.
Diese blauen Augen . . . Wann hatte sie zuletzt solche blauen Augen gesehen wie bei dieser Sydney Amos? Noch nie eigentlich. Denn diese Augen blickten so klar und durchdringend, wie wahrscheinlich das Wasser war, in dem sie tauchte.
Eine Taucherin. Meeresarchäologin. Was war das überhaupt? Das hatte sie ja noch nie gehört.
Sie hatte unter anderem Kunstgeschichte studiert, und da war auch einiges zur Sprache gekommen, was bei archäologischen Ausgrabungen zutage getreten war, was man irgendwo im alten Ägypten oder sonst wo ausgebuddelt hatte. Sie hatte Bilder davon gesehen, aber bei keiner der Ausstellungen, die sie schon oft organisiert hatte, war so etwas Thema gewesen.
Sie stand mehr auf Gemälde. Und sie wäre auch nie auf die Idee gekommen, so einer Ausgrabung beiwohnen zu wollen. Im Dreck buddeln, nur um dann irgendetwas genauso Dreckiges herauszuziehen, das noch nicht einmal gut aussah, wenn man es in eine Vitrine stellte? Nein, danke.
Aber das war bisher ihre Vorstellung von Archäologie gewesen. Sand, Dreck, Staub und Hitze. Trockenheit und Dürre rundherum. Nun ja, sie hatte auch schon einmal gehört, dass man unter Umständen etwas aus dem ewigen Eis herausholen konnte, das Tausende von Jahren alt war. Aber Archäologie im Meer? Was buddelte man denn da aus?
Schiffsfriedhof. Ja, sie erinnerte sich. Davon hatte auch ihre Großmutter erzählt, als Debra einmal im Sommer hier gewesen war. Aber sie hatte sich nicht so richtig etwas darunter vorstellen können.
Sicherlich, jeder hatte wohl schon einmal von Schatzsuchern gehört, die Golddublonen aus irgendwelchen Schiffswracks unter Wasser holten. Aber nannte man das Archäologie? Die taten das doch nur des Geldes wegen.
Und Sydney . . . ihr Blick schweifte die Straße entlang, auf der der Truck nun aber selbstverständlich nicht mehr zu sehen war . . . sah nicht besonders reich aus. Dann hätte sie sich wohl ein besseres Gefährt leisten können. Aber vielleicht hatte sie bisher einfach nur Pech gehabt und keine Golddublonen gefunden.
Hoffte sie, die hier zu finden? Vor der Küste North Carolinas? Damit sie sich ein Zimmer leisten konnte, das sie nicht erst noch renovieren musste, um es benutzen zu können?
Auf einmal fiel ihr auf, dass sie immer noch ihre Hand rieb. Abrupt beendete sie das und starrte die Hand an. Sie juckte doch gar nicht.
Aber Sydney hatte mit einem Handschlag ihre Vereinbarung besiegelt. Und Debra hatte das Gefühl gehabt, als hätte sie ein elektrischer Schlag getroffen. Deshalb hatte sie ihre Hand schnell zurückgezogen.
An der Hand war jedoch nicht die kleinste Verletzung zu sehen. Keine Rötung, wie sie vielleicht von der Verbrennung eines elektrischen Schlages hätte stammen können. Dennoch schien die Oberfläche noch immer leicht zu brennen. Vielleicht hatte Sydney kurz zuvor irgendeine Chemikalie berührt . . .
Was für ein Unsinn! Ärgerlich schüttelte Debra den Kopf. Die Luft war wahrscheinlich elektrisch gewesen.
Bei dieser Feuchtigkeit? Gab es da Statik in der Luft?
Mit was für Gedanken beschäftigte sie sich da eigentlich? Sie zog die sorgfältig gezupften dunklen Augenbrauen zusammen, fast noch dunkler als ihr Haar. Sie hatte anderes zu tun. Die Akten ihres Vaters . . .
Die Akten ihres Vaters. Beim letzten Mal, als sie sich gesehen hatten, im Verhörraum der Polizei, hatte er ihr schnell zugeflüstert, sie sollte die Akten, die nicht beschriftet waren, sofort aus seinem Büro holen und in ihrem eigenen Zimmer im Haus verstauen. Bevor die Polizisten kamen, die mit einem Durchsuchungsbefehl alles auf den Kopf stellen würden.
Debras Zimmer würden sie jedoch nicht betreten dürfen. Nur die Zimmer ihres Vaters, sein Büro, sein Schlafzimmer und die Räume, die gemeinschaftlich genutzt wurden. So war das Gesetz. Also waren die Akten dort sicher.
Sicher wovor? fragte Debra sich. Und hatte es sich schon die vergangenen zweieinhalb Monate über gefragt, in denen sie von Polizisten, die Spezialisten für Wirtschaftskriminalität waren, von der Steuerbehörde des Finanzamts und sogar vom FBI immer wieder verhört worden war. Wo war das Geld geblieben, das ihr Vater veruntreut hatte? war sie immer wieder gefragt worden.
Aber ihr Vater hatte kein Geld veruntreut, davon war Debra überzeugt. Ihr Vater war ein ehrlicher Mann gewesen, nie etwas anderes. Er hatte die Rentenfonds kleiner Firmen betreut und immer dafür gesorgt, dass die Einlagen eine gute Verzinsung abgaben. Damit die Angestellten, wenn sie sich dann einmal zur Ruhe setzten, ihren Ruhestand auch mit einem sicheren Gefühl genießen konnten. Das war sein Ziel gewesen, nicht persönliche Bereicherung.
Aber jetzt warfen ihm die Anleger vor, er hätte ihre Renten zu seinem eigenen Vorteil verbraten. Debra hatte schon gar nicht mehr ans Telefon gehen können, weil sie immer nur beschimpft wurde. Insofern war es ganz gut, dass sie hier niemand erreichen konnte. Denn diese Anrufe hatten sie fertiggemacht.
Sie verstand die Leute ja. Genauso wie ihr Vater sie verstanden hätte, hätte er das noch erlebt. Aber er hätte wenigstens gewusst, was geschehen war. Oder was vielleicht geschehen sein konnte. Warum kein Geld mehr da war.
Die Akten mussten irgendeinen Hinweis darauf enthalten, aber leider hatte Debra den bisher nicht gefunden. Sie hätte besser Betriebswirtschaft studieren sollen wie ihr Vater. Aber das hatte sie nie interessiert. Deshalb konnte sie keine Bilanzen lesen, keine Buchhaltung entschlüsseln und auch den Akten, die fast nur solche Dinge enthielten, nichts Brauchbares entnehmen.
Wahrscheinlich müsste sie dafür einen Buchhalter engagieren. Aber was die kleinen Leute, die sie am Telefon beschimpft hatten, sicher nicht wahrhaben wollten: Sie hatte selbst kein Geld mehr. Das Einzige, was ihr geblieben war und wovon sie jetzt lebte, war der Restbetrag, der sich ergeben hatte, als sie ihr Mercedes Cabrio verkauft hatte, um sich einen billigen japanischen Gebrauchtwagen zuzulegen, mit dem sie sich selbst und die paar persönlichen Sachen, die sie mitgenommen hatte, hier nach North Carolina auf die Outer Banks befördert hatte. Und dieser Restbetrag schrumpfte immer mehr.
Sie musste sich wohl einen Job suchen. Aber wer würde sie einstellen hier mitten im Nirgendwo? Sie hatte ein tolles und sehr teures Studium absolviert, aber eigentlich nichts gelernt. Nichts, was man in einem normalen Job gebrauchen konnte. Ihre Jobs hatten immer aus irgendwelchen Tätigkeiten bestanden, die viele Mitglieder der arbeitenden Klasse wahrscheinlich gar nicht als Job bezeichnet hätten.
Sie war gut darin, Veranstaltungen zu organisieren. Das konnte sie wirklich. Aber was konnte man hier in den Südstaaten des ländlichen North Carolina schon für Veranstaltungen organisieren? Den Samstagabendtanz der bäuerlichen Jugend in einer Scheune?
Maklerin. So wie die Maklerin, die dieses Haus hier bis vor einiger Zeit vermietet hatte. Das konnte Debra sich vielleicht vorstellen. Aber sie hatte nicht den Eindruck gehabt, dass es da viel zu tun gab. Die Maklerin wirkte nicht gerade überarbeitet.
Sie hatte über den Mangel an Handwerkern gejammert. Als Handwerkerin hätte Debra vermutlich jederzeit einen Job finden können. Aber sie war keine Handwerkerin.
Was sie wieder den Blick die Straße hinunterwandern lassen ließ. Kam Sydney Amos bald zurück?
Der Ärger schwappte erneut in ihr hoch. Warum sollte sie das überhaupt interessieren?
Aber sie musste zugeben: Sie hatte Hunger.
4
Debra McFadden. Der Name klang ziemlich gut, dachte Syd, als sie die Straße zurückfuhr, auf der sie gekommen war. Mehr Möglichkeiten gab es hier nicht. Eine Straße, ein Postamt, eine Kirche. Ein paar kleine Geschäfte. Das war alles.
Aber es war ja auch nur eine kleine Insel. Die Outer Banks waren eine Gruppe von kleinen Inseln vor der Küste North Carolinas, einige waren noch nicht einmal bewohnt, so klein waren sie. Die hier gehörte zu denen, die bewohnt waren, aber auch das war relativ. Eine Großstadt hätte hier keinen Platz gehabt. Noch nicht einmal eine normale Stadt.
Syd mochte das. Sie mochte es, in einem Haus am Strand zu wohnen wie in dem von Debra McFadden. Sie mochte es, in der Nähe von Wasser zu sein. Schon als Kind hatte man sie kaum davon wegbekommen können, insbesondere nachdem sie das Schnorcheln gelernt hatte. Und sobald sie groß genug dazu war, hatte sie Tauchen gelernt.
Den Grund des Meeres zu erforschen, das hatte sie schon als Teenager gemocht. Es gab dort so viel zu entdecken. Fische, Muscheln, Korallen – eine Unterwasserwelt ganz für sich, abgeschlossen von allem, was oberhalb der Wasseroberfläche war.
Manchmal hatte sie es sehr bedauert, wenn sie dann die Sonne wieder sehen konnte. Wenn sie nach oben aufstieg, und die Dunkelheit der Tiefsee von Strahlen des Lichts durchbrochen wurde, bevor sie überhaupt oben angekommen war.
Es gab wunderschöne Farbspiele dadurch, aber es bedeutete eben auch, dass man bald wieder Land betreten musste. Am liebsten hätte sie Kiemen gehabt, um diese Besuche unter Wasser länger ausdehnen zu können, als ein Sauerstofftank hielt.
Sie lachte über sich selbst, wenn sie solche Gedanken hatte, denn sie nahm sich nicht immer unbedingt ernst. Außerdem musste sie zugeben, dass das Leben als Mensch doch einige Vorteile gegenüber dem als Fisch hatte. Frauen wie Debra McFadden zum Beispiel.
Frauen wie Debra McFadden . . . Ihr Gesicht wurde etwas weniger fröhlich. Wenn das alles so einfach gewesen wäre. Diese Damen der besseren Gesellschaft hatten nichts mit ihr, Sydney Amos, gemeinsam. Und normalerweise hatte sie auch wenig mit ihnen zu tun. Aber in diesem Fall . . .
Sie sah das heruntergekommene Strandhaus in der Ferne auftauchen. Das passte wirklich nicht zusammen. Das passte einfach nicht zu einer Frau wie Debra. Sie konnte es sich nicht erklären. Sollte eine Debra McFadden, so wie sie aussah und sich benahm, nicht in einem Palast wohnen? Man sah ihr deutlich an, dass sie es gewöhnt war, Leute zu haben, die ihr alles Grobe abnahmen.
Ihre Überraschung darüber, dass Sydney handwerkern konnte und sogar kochen, hatte das gezeigt. Eine Frau, die in einem normalen Haushalt aufgewachsen war, konnte zumindest Letzteres. Aber Debra McFadden hatte das nie nötig gehabt. Eine Köchin zu Hause oder der Chefkoch eines Restaurants hatte das für sie erledigt.
Aber warum setzte sie sich dann einem solchen Leben hier aus? Das war schon merkwürdig. Es gab Strandhäuser, die den Komfort boten, den jemand aus der Stadt, jemand aus besseren Verhältnissen gewöhnt war. Man musste auf nichts verzichten, wenn man in einem solchen Haus wohnte. Warum wohnte Debra McFadden nicht in einem solchen Haus? Sie konnte es sich doch leisten.
Obwohl Syd ihr das nicht gesagt hatte, wusste sie, wer Debra McFadden war. Es war ja alles durch die Zeitungen gegangen, durchs ganze Internet. Der Finanzskandal mit ihrem Vater, die Empörung der Anleger, die nun mit nichts dastanden. Die Suche nach einem Schuldigen, den sie vor Gericht stellen konnten, nachdem der Hauptschuldige, Daniel Leon McFadden, kaum verhaftet einem Herzinfarkt erlegen war.
Dadurch waren Leute in das Visier der Ermittler geraten, die völlig unschuldig waren, deren Leben durch diese Untersuchungen aber trotzdem schwer belastet wurde. Auch Debra war monatelang verhört worden, immer wieder. Und trotzdem hatte sich das Geld nicht gefunden.
Syd war neugierig gewesen, wie die Tochter des Mannes, der so viele Menschen ins Unglück gestürzt hatte, sein würde. Was sie hier vorgefunden hatte, hatte sie jedenfalls nicht erwartet.
Einerseits war Debra McFadden genauso, wie man sich eine reiche Tochter vorstellte, eine Frau, die niemals wirklich für ihren Lebensunterhalt hatte arbeiten müssen. Die nur mit dem Finger zu schnippen brauchte, und alles wurde für sie erledigt.
Aber andererseits hatte sie auch etwas . . . Verletzliches, das Syd überrascht hatte. Sie schien so hilflos, allein schon bei der Renovierung eines Zimmers. Beim Kochen! Syd lachte. Immer wieder brachte sie dieser Teil der Geschichte zum Grinsen. Eine Debra McFadden, die sich von Toastbrot und Peanut Butter ernährte . . . Nicht unbedingt das Leben einer verwöhnten Upper-Class-Lady.
Nun würden sie sich ja näher kennenlernen, und Syd würde herausfinden, was mit ihr los war. Sie hatte die Augen einer Schottin – wie es ja auch ihrem Namen entsprach –, aber offenbar hatte die Familie McFadden den sprichwörtlichen Geiz der Schotten nicht zu ihrem Motto gemacht.
Dennoch waren diese Augen ausgesprochen schön, das musste Syd zugeben. Sie hatten nicht die blaue Klarheit von Meerwasser oder die unergründliche Tiefe dunkler Augen, von denen man wie in eine versunkene Welt hineingezogen wurde, sie hatten etwas Verschleiertes, Rätselhaftes, das man nicht so leicht deuten konnte. Was lag hinter diesen Augen, welche Gedanken, welche seelischen Abgründe?
Warum wirkte sie einerseits hilflos und doch wie jemand, der gar keine Hilflosigkeit kannte? Der sie bisher im Leben jedenfalls niemals kennengelernt hatte. Das war leicht zu erklären, denn niemand, der immer Hilfe hatte, konnte hilflos sein.
Aber jetzt war die einzige Hilfe Syd? Das verwunderte sie doch sehr.
Warum war Debra hergekommen? Ein Leben wie dieses hier konnte für sie nicht sehr entspannend sein. Und Entspannung war doch sicher das, was sie sich wünschte nach den letzten Monaten.
Oder hatte sie das gar nicht so mitgenommen? War es alles an ihr abgeperlt wie Regenwasser an einem imprägnierten Trenchcoat?
Dieser kühle Gesichtsausdruck, den sie Syd zum Schluss geschenkt hatte . . . Das war geradezu erschreckend gewesen, obwohl Syd sich nun wirklich nicht leicht erschrecken ließ.
Als sie diese distanzierte Miene sah und die Augen, die gleichzeitig fast zu Eis wurden, hatte Syd sich vorstellen können, dass sie, Debra, diejenige gewesen war, die ihrem Vater geholfen hatte, all diese Leute zu betrügen.
Aber jetzt knurrte erst einmal ihr Magen und verlangte sein Recht.
5
Debra betrachtete Sydney Amos’ muskulöse Schultern, als sie sich nun vorbeugte und konzentriert Zwiebeln schnitt. Was für eine sonderbare Frau. Ehrlich gesagt konnte Debra sich nicht erinnern, je so eine Frau getroffen zu haben. Nicht in ihren Kreisen jedenfalls.
Aber was waren schon Kreise? Die, in denen sie sich bewegt hatte, waren nicht sehr beständig gewesen. Das hatte sie bei der leisesten Störung zu spüren bekommen. Es war alles oberflächlicher Small Talk, Partys, Tennisspielen, Tanzveranstaltungen der edleren Art, für die man ein Ballkleid anziehen musste oder zumindest ein Cocktailkleid. Nichts davon schien hier noch eine Bedeutung zu haben.
Hier und jetzt. Das war eine ganz andere Welt.
»Haben Sie die Pfanne –?« Sydney Amos blickte von ihren Zwiebeln auf, und wenigstens da war sie wie jeder andere Mensch: Es standen Tränen in ihren Augen vom Zwiebelschneiden. »Sie haben die Pfanne noch gar nicht herausgeholt?«
Debra hob die Augenbrauen. »Hätte ich das tun sollen?«
»In was braten Sie normalerweise Zwiebeln?«, fragte Sydney mit zuckenden Mundwinkeln.
Gar nicht, hätte Debra eigentlich antworten müssen, aber es ärgerte sie, so etwas zugeben zu sollen, obwohl ihr das bis vor Kurzem niemals wichtig erschienen wäre, also setzte sie eine hochmütige Miene auf. »Sie hätten mir ja auch sagen können, dass Sie eine Pfanne brauchen.«
Sydneys Mundwinkel zuckten noch mehr, sie konnte sie offensichtlich kaum mehr beherrschen. »Ja, das hätte ich wohl tun sollen«, antwortete sie versöhnlich. »Könnten Sie jetzt bitte . . .?« Sie wies mit dem Messer, das sie immer noch in der Hand hielt, auf die Schränke.
Irgendwo musste wohl eine Pfanne sein, aber Debra hatte sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt, also wusste sie nicht, wo sie suchen sollte. Sie befreite ihre bisher vor der Brust verschränkten Arme aus ihrer Fesselung und ging zu einem der Schränke, die hier in dieser Küche alles bereithalten mussten, was man so zum Kochen brauchte. Wenn die letzten Mieter es nicht mitgenommen hatten. Zumindest hatte sie Besteck in einer der Schubladen gefunden, um sich ein Peanut-Butter-Sandwich schmieren zu können.
Sie öffnete den ersten Schrank, aber dort fand sie nur Gläser. Das hatte sie schon gewusst, denn davon hatte sie schon eins benutzt. Auch eine Kaffeetasse und die Kaffeemaschine, die hier auf einem der Schränke standen. Alles zusammen mit einem Rest Kaffeepulver. Instant.
»Töpfe und Pfannen sind meistens eher unten«, schmunzelte Sydney. »Rechts oder links vom Ofen.«
Woher soll ich das denn wissen? Debra grummelte innerlich, wollte sich aber keine Blöße geben. »Ich bin noch nicht lange hier«, sagte sie mit einer so distanzierten Stimme, wie sie konnte, beugte sich hinunter und öffnete den Unterschrank rechts neben dem Herd. Tatsächlich. Pfannen und Töpfe.
Sie nahm eine der Pfannen heraus und stellte sie auf den Herd.
»Sie müssen das Gas anzünden. Von selbst wird sie nicht heiß«, sagte Sydney.
Das Gas anzünden. Wie machte man so was? Debra blickte sich nach einem Feuerzeug oder einer Streichholzschachtel um.
»Der Anzünder liegt da«, erklärte Sydney und wies wieder mit dem Messer darauf. Dann legte sie das Messer ab, kam herüber und nahm das, was sie Anzünder genannt hatte, Debra aber nie als einen solchen erkannt hätte, selbst in die Hand. Sie drehte an einem Knopf, hielt das Gerät an eine der schwarzgebrannten Feuerstellen oder wie immer das hieß, und ein Funken sprang heraus. Das wiederholte sie ein paarmal, aber nichts sonst geschah.
»Hm.« Stirnrunzelnd legte sie das Gerät zur Seite und beugte sich über den Herd, dann öffnete sie die Schranktür auf der linken Seite und lachte plötzlich. »Haben Sie den Herd noch nie benutzt, seit Sie hier sind?«
»Ich bin noch nicht lange hier«, wiederholte Debra und presste die Lippen zusammen.
»Ja, natürlich«, sagte Sydney. »Dann müssen wir das Gas an der Flasche wohl erst einmal aufdrehen.«
Debra betrachtete die bullige Kanne, die da im Schrank stand, misstrauisch. »Ist das denn in Ordnung? Da gibt es keine Gasexplosion, oder?«
Sicherheitshalber überprüfte Sydney kurz die Anschlüsse, wackelte und zog. »Nein, sieht nicht so aus.« Dann drehte sie an einem kleinen Rad. »So, jetzt kann’s losgehen.«
Sie schloss den Schrank, und als sie kurz darauf die zuvor erfolglose Prozedur am Herd wiederholte, sprang nicht nur ein Funken aus dem Anzünder, sondern auch eine Flamme aus der anvisierten Feuerstelle.
»Was für Fett haben Sie? Butter? Schmalz?«, fragte Sydney.
Schmalz? Debra wusste noch nicht einmal, wie das aussah. Aber Butter . . . Butter musste doch eigentlich im Kühlschrank sein. Sie öffnete ihn, doch nur gähnende Leere starrte ihr entgegen.
»Dachte ich mir schon«, stellte Sydney anscheinend belustigt fest.
Aber sie war ja die ganze Zeit schon belustigt. Debra hätte sie gern geschlagen. Na ja, zumindest geschubst.
»Ich habe was mitgebracht.« Die Frau, die anscheinend alles konnte und an alles dachte, wies auf die große braune Papiertüte, aus der sie die Zwiebeln genommen hatte.
Weiter hatte sie sie nicht ausgepackt. Hatte sie etwa angenommen, Debra würde das tun?
Aber jetzt blieb ihr wohl nichts anderes übrig. Sie schaute hinein und sah eine Ölflasche, nahm sie heraus. »Meinen Sie das hier?«
»Ja.« Sydney schmunzelte. »Geben Sie etwas davon in die Pfanne.« Warnend hob sie die Augenbrauen, als sie nun selbst in die Tüte griff und ein größeres, in Wachspapier eingeschlagenes Päckchen herauszog. »Aber vielleicht benutzen Sie einen Löffel zum Abmessen. Zwei, drei Esslöffel Öl reichen.«
Dachte sie etwa, sie würde die ganze Flasche in die Pfanne entleeren? Debra war beleidigt. Was bildete diese Frau sich eigentlich ein?
Trotzdem war es beruhigend, so jemanden im Haus zu haben. Auf der einen Seite beruhigend. Auf der anderen eher beunruhigend, denn das Haus war klein, und auch wenn Sydney Amos hier unten praktisch eine separate Wohnung haben würde, waren die Wände so dünn, dass man sich vielleicht sogar gegenseitig atmen hören konnte bei Nacht, wenn draußen alles still war.
Die Stille hier war fremd. Debra hatte in der ersten Nacht kaum schlafen können, weil es so still war. Sie war das nicht gewöhnt. Keine Autos, die spätnachts noch durch die Straßen donnerten, keine angetrunkenen Nachtschwärmer, die am frühen Morgen laut singend oder kichernd heimschwankten.
Dafür aber durchaus mal der Motor eines Allrad-Trucks, der zu einer nachtschlafenden Stunde vorbeifuhr, mit langen Angelruten, die vorn an der Stoßstange befestigt waren. Die Leute hier gingen um dieselbe Zeit angeln, zu der die Leute in New York erst von einer feuchtfröhlichen Nacht nach Hause kamen.
»Kein Löffel da?«, fragte Sydney, weil Debra nur sinnierend dagestanden, sich aber nicht bewegt hatte. »Wissen Sie nicht, wo die sind?«
»Natürlich weiß ich, wo die Löffel sind!«, fuhr Debra ärgerlich auf. Das zumindest hatte sie schon entdeckt, als sie gleich zu Anfang die Peanut Butter sofort mit dem Löffel aus der Dose gegessen hatte, weil ihr vor Hunger fast schwindlig geworden war.
Wütend stampfte sie zu der Schublade hin, in der das Besteck lag, machte sie auf und nahm einen Esslöffel heraus. »Sehen Sie?« Sie fuhr mit dem Löffel durch die Luft, wackelte praktisch damit vor der Nase dieser anmaßenden Frau herum. »Oder ist das die falsche Art Löffel? Haben Sie sich was anderes vorgestellt?«, fragte sie schnippisch.
Sydney lachte leicht. »Nein, der ist schon richtig. Zwei, drei Löffel Öl damit wie gesagt.«
Musste sie sie noch einmal daran erinnern? Als ob sie kein Gedächtnis hätte oder nicht zuhören könnte?
Debra schäumte innerlich. Aber sie beherrschte sich. Das hatte sie in den letzten Monaten so oft tun müssen, dass es ihr zur zweiten Natur geworden war.
So ruhig, als wäre gar nichts geschehen, als hätte nichts sie berührt, ging sie zum Herd und maß zwei Esslöffel Öl ab, um sie zu erhitzen.
Aber wenn diese Sydney sie jetzt noch einmal kritisierte, würde sie das heiße Öl ins Gesicht kriegen.
6
Syd merkte sehr wohl, wie angespannt Debra McFadden war, aber es amüsierte sie mehr, als dass es sie beunruhigte. Es freute sie eigentlich sogar, denn Leute, die beunruhigt waren, machten Fehler. Und auf einen solchen hoffte sie.
Hier im Moment ging es nur ums Kochen – von dem Debra offensichtlich nichts verstand, was sie ärgerte –, aber zum Schluss ging es um wichtigere Dinge. Doch wenn sie schon allein durch ihre Unfähigkeit in der Küche aus der Balance gebracht werden konnte, versprach das einen guten Ansatzpunkt.
Syd hätte sie jetzt noch weiter auf die Palme bringen können, indem sie sie gefragt hätte: Können Sie Eier braten? Dann können Sie ja schon einmal mit den Spiegeleiern anfangen, aber aus irgendeinem Grund unterließ sie es dann und sagte nur: »Können Sie das Hackfleisch hier vielleicht mit den Zwiebeln und einem Ei mischen? Dann kümmere ich mich schon mal um die Röstkartoffeln.«
Über Debras Kopf stand immer noch eine leichte Rauchwolke, aber sie riss sich zusammen und nickte. »Nur mischen?«, fragte sie mit einer Stimme, als wäre sie das Entgegennehmen von Befehlen gewöhnt. Was sie garantiert nicht war.
Auch Syd nickte. »Da kommt dann nur noch ein bisschen Salz und Pfeffer dran, um es zu würzen, dann können wir die Hacksteaks braten.«
Ohne einen großen Aufstand zu machen, ging Syd selbst zu einem der Schränke und nahm eine Schüssel heraus, wickelte das Hackfleisch aus dem Wachspapier und gab es hinein, obendrauf die Zwiebeln. Sie nahm ein Ei und wollte es aufschlagen, da lachte Debra leise auf.
»Lassen Sie mich das machen. Sie werden es vielleicht kaum glauben, aber ich habe schon mal ein Spiegelei gebraten.«
Syd musste schmunzeln. »Sie haben recht. Das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Aber dann können Sie vielleicht noch zwei Spiegeleier braten, wenn Sie mit dem Fleisch fertig sind. Die Kartoffeln zuzubereiten dauert länger.«
Außerordentlich friedfertig nahm Debra die Anweisungen entgegen und begann, das Hackfleisch mit den Zwiebeln und dem Ei zu mischen, fügte sogar ein wenig Salz und Pfeffer hinzu.
Syd begab sich an die Kartoffeln, nahm eine zweite Pfanne heraus und füllte sie zur Hälfte mit Öl. Als das Öl heiß war, gab sie die Röstkartoffeln hinzu, die sie gefroren gekauft hatte.
»Zuerst das Fleisch braten oder die Spiegeleier?«, fragte Debra jetzt.
»Zuerst das Fleisch«, antwortete Syd. »Das gart dann noch ein bisschen nach, dadurch wird es zarter. In der Zeit kann man dann die Spiegeleier machen.«
Sie teilte die Hackmasse in zwei etwa gleich große Stücke auf, probierte noch einmal und gab noch ein bisschen Salz hinzu. Erst nachdem sie das getan hatte, sah sie Debra fast um Entschuldigung bittend an. »Oh, tut mir leid. Ich hätte fragen sollen. Mögen Sie nicht so viel Salz?«
Debras Mundwinkel zuckten. »Jetzt ist es ohnehin zu spät, denn rausholen kann man es ja jetzt nicht mehr«, bemerkte sie beinah so amüsiert, wie Syd es zuvor gewesen war. »Aber es ist okay. Ich fand es vorher auch noch ein bisschen fade.«
Fand sie das? Hm. Syd war überrascht. Frauen von der Sorte Debra McFaddens gaben normalerweise nicht so leicht etwas zu, was man auch als ein Defizit hätte auslegen können.
Sie schaute kurz nach den Kartoffeln, drehte sie um und prüfte dann die Hitze in der Pfanne für das Fleisch. »Perfekt«, sagte sie, nahm ein Hacksteak und legte es hinein. Es spritzte etwas, und sie wich zurück.