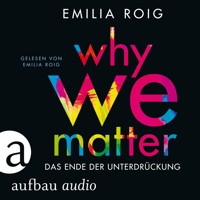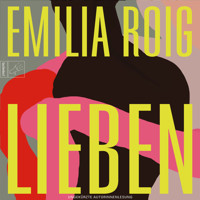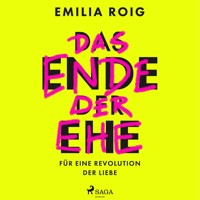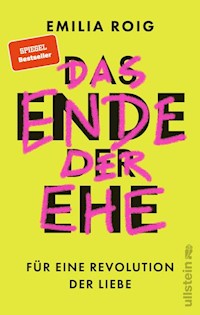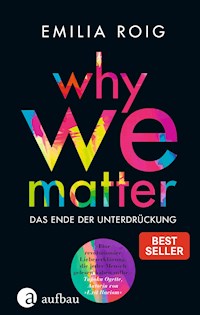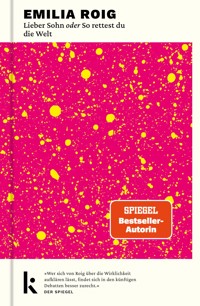
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kjona Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Trumps menschenverachtender Turbokapitalismus und die faschistischen Politiken von AfD, Le Pen, Meloni zielen darauf ab, dass wir uns gegenseitig ausbeuten und unterdrücken. Aber was können wir dagegen tun? In einem Brief an ihren Sohn entwirft Emilia Roig eine kühne neue Ethik des Seins in Krisenzeiten. Sie plädiert dafür, in die Mitte unseres Selbstverständnisses und Wertesystems eine radikale Fürsorge zurücken – physisch, intellektuell, spirituell und emotional. Es braucht keine Helden, um die Welt zu retten. Es braucht eine Umwertung unserer Werte. 80 Seiten raus aus der Komfortzone und auf in die Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
EMILIA ROIG
Lieber Sohn oder So rettest du die Welt
Briefe an die kommenden GenerationenBAND 6
INHALT
Kindheiten im Wandel der Welt
Von Rettungsfantasien zu radikaler Fürsorge
Fürsorge – das wahre Heldentum
Anarchie der Fürsorge
Heilsamer Ungehorsam
Jenseits des Widerstands
Selbstfürsorge und Vereinzelung
Wahnsinnige Empfindsamkeit
Wissenschaft und Magie
Fürsorgliche KI
Animus und Tod
Anmerkungen
Literatur
There was a boy
A very strange, enchanted boy
They say he wandered very far
Very far, over land and sea
A little shy and sad of eye
But very wise was he
And then one day
A magic day he passed my way
And while we spoke of many things
Fools and kings, this he said to me
»The greatest thing you’ll ever learn
Is just to love and be loved in return«
The greatest thing you’ll ever learn
Is just to love and be loved in return.
Nat King Cole, Nature Boy (1948)
Mon cher fils –
bevor du geboren wurdest, glaubte ich, die Welt ließe sich mit Argumenten retten. Ich war überzeugt, dass man Macht mit Wahrheit brechen kann – mit Analysen, Büchern, Demonstrationen, Wut und Klarheit. Ich habe gegen Ungerechtigkeit gearbeitet, auf Demos Mottos skandiert, auf Podien gestritten. Ich habe Organisationen gegründet, Kampagnen mitgetragen, Texte geschrieben. Und dabei dachte ich: Wenn ich nur laut genug, präzise genug, radikal genug bin, wird sich das System verändern.
Aber irgendwann begann ich zu begreifen, dass das System nicht nur in Gesetzen, Institutionen und Diskursen wohnt – sondern in Körpern, Beziehungen, Erinnerungen. In Ängsten, Traumas und Sehnsüchten. Ich merkte, dass Wandel nicht nur im Außen geschieht, sondern auch im Inneren. Und dass politische Kämpfe ohne Herz, ohne Heilung, ohne Fürsorge oft nur neue Gräben ziehen.
Als du geboren wurdest, hat sich nicht sofort alles verändert. Es war nicht deine Ankunft, sondern dein Wachsen, das mich verändert hat – langsam, widerständig, manchmal schmerzhaft, immer ehrlich.
Ich habe dir beim Atmen zugesehen. Beim Stolpern. Beim Staunen. Und irgendwann habe ich verstanden: Die Rettung beginnt in der Art, wie wir leben. Wie wir zuhören. Wie wir uns kümmern. Wie wir lieben.
Du wächst in einer Welt auf, die im Umbruch ist. Die Erde brennt, aber auch unsere Seelen tun es. Weil wir in einem System leben, das Trennung zur Norm gemacht hat: Trennung zwischen Mensch und Natur. Zwischen Arbeit und Leben. Zwischen Herz und Verstand. Zwischen den »Starken« und den »Schwachen«. Kapitalismus, Patriarchat, Kolonialismus – das toxische Dreieck, das uns glauben lässt, dass Kontrolle wichtiger ist als Verbindung, Profit wertvoller als Mitgefühl und Individualismus edler als Gemeinschaft.
Ich habe lange selbst in diesen Logiken funktioniert und dachte, ich müsste stark sein, schneller, klüger, unangreifbar. Aber meine Kraft kam ins Wanken, als ich begann zu spüren, wie müde mein Herz geworden war. Ich bin in dieser Zeit innerlich zerbrochen – mehr als einmal. Und ich habe neu angefangen. Mit Tränen, mit Stille, mit Wut. Ich habe gelernt, dass Heilung nicht bedeutet, dass alles wieder »gut« wird. Sondern dass wir unsere Augen offen halten, selbst wenn es weh tut.
Dieses Buch ist kein Ratgeber. Es ist eine Spur aus Brotkrumen. Es ist ein Brief an dich – und zugleich ein Gespräch mit mir selbst. Ich erzähle dir, was ich gelernt habe. Und was ich noch lerne. Denn ich bin nicht am Ende dieses Weges, sondern mittendrin. Offen, neugierig, und manchmal auch ratlos. Aber ich gehe weiter.
Ich schreibe dir, weil ich glaube, dass du – dass wir alle – einen anderen Weg wählen können. Einen, der nicht auf Beherrschung, sondern auf Beziehung beruht. Einen, auf dem wir die Welt nicht retten wie ein passives Objekt, sondern wie ein Wesen, das lebt. Mit dem wir in Verbindung stehen. Für das wir Verantwortung tragen. Weil wir selbst Teil davon sind.
Vielleicht wird man dich eines Tages fragen, was du getan hast, als alles zu kippen drohte. Und vielleicht wirst du antworten: Ich habe mich erinnert. Ich habe mich geöffnet. Ich habe mich gekümmert. Und ich habe nie aufgehört, zu lieben.
Wenn das der Anfang ist – dann gibt es Hoffnung.
Komm, ich erzähle dir, was ich verstanden habe. Und ich höre dir zu, wenn du mich über das hinausführst.
In LiebeMaman
KINDHEITEN IM WANDEL DER WELT
Ich frage mich oft, wie es sich für dich anfühlt, in dieser Zeit Kind zu sein. In einer Welt, die gleichzeitig brennt und blinkt. Pandemien, Klimakrise, Kriege, KI, Bildschirmsucht, soziale Kälte, Faschismus – und darunter ein ständiges Beben. Wir, eure Eltern, versuchen, unsere Angst zu verbergen. Aber ihr spürt sie trotzdem. Ihr wachst damit auf. In euren Körpern, euren Gedanken, euren Träumen hat sich etwas eingenistet – kollektive Erschöpfung, diffuse Unruhe, eine Ahnung davon, dass etwas Grundsätzliches wankt.
Vielleicht lebt ihr mit dieser Unsicherheit anders als wir. Vielleicht gehört sie für euch einfach dazu, und es ist gerade euer Vorteil, dass ihr nie an eine heile Welt geglaubt habt.
Ich bin in den Neunzigern aufgewachsen. Es war nicht alles gut – in meiner Familie gab es Gewalt, die niemand sehen durfte. Aber draußen schien die Welt stabil. Das Fernsehen sendete, der Kalender lief weiter, Erwachsene machten Pläne. Ich hörte Kassetten, telefonierte stundenlang mit meiner besten Freundin und stellte mir nie die Frage, ob die Welt in Ordnung war – sie war es einfach. Selbst die Kriege, die es gab, fühlten sich weit weg an. Die Welt wirkte wie ein Gerüst, das nicht zusammenbrechen konnte.
Erst später begriff ich, dass diese Sicherheit eine Illusion war. Dass das, was uns ruhig schlafen ließ, oft auf Kosten anderer geschah – auf anderen Kontinenten, in anderen Körpern. Wir wuchsen mit dem Privileg auf, nicht hinschauen zu müssen. Und nannten das Frieden.
Heute ist die Welt nicht weniger grausam – aber die Schleier lichten sich. Die Krisen sind nicht mehr »woanders«. Sie sind hier. Sie sind miteinander vernetzt wie ein unsichtbares Wurzelwerk. Und das verändert alles.
Manche Menschen entscheiden sich heute gegen Kinder, aus Angst vor der Zukunft und aus Verantwortung. Ich kann das verstehen, aber du bist – zum Glück – geboren. Und ich glaube fest daran: Du bist nicht zufällig hier. Wie Clarissa Pinkola Estés sagt: »Wir sind für diese Zeiten gemacht.«
Vielleicht liegt in deiner, in eurer Wachheit die Chance, die die meisten von uns verpasst haben. Ihr spürt die Risse. Ihr könnt entscheiden, ob ihr das Alte weiterführt oder ob ihr etwas Neues wagt. Das ist nichts weniger als revolutionär.
VON RETTUNGSFANTASIEN ZU RADIKALER FÜRSORGE
Muss die Welt gerettet werden – oder meinen wir in Wahrheit die westliche Moderne?
Die Apokalypse ist kein Ereignis, das erst bevorsteht – sie ist für viele längst Realität. Indigene, Schwarze und kolonisierte Menschen haben den Untergang ihrer Welten bereits erfahren: durch Landraub, Versklavung, Extraktivismus und die Zerstörung von Kulturen. Was im globalen Norden als bevorstehender Kollaps beschrieben wird, findet weiterhin statt – durch Genozid, Umweltzerstörung, Vertreibung und strukturelle Gewalt. Die Klimakrise ist kein imminenter Bruch, sondern eine Fortsetzung kolonialer Zerstörung. Der europäische Imperialismus und somit das westliche Projekt der »Menschwerdung« ist tief mit Ausgrenzung, Entmenschlichung und Gewalt verknüpft – was als Fortschritt gilt, war für viele, inklusive unserer Ahnen, immer schon das Ende.
Die Vorstellung, die Welt müsse gerettet werden, setzt voraus, dass sie noch intakt sei oder je für alle lebenswert war. Es geht daher nicht um Rettung, sondern um Erinnerung, Trauer und Wiederverbindung. Die Frage sollte umformuliert werden, von wie wir die Welt retten zu welche Welten wir nähren wollen, während die alten vergehen.
Wir brauchen also eine radikale Neuorientierung: weg von der vermeintlichen Rettung der Welt durch technologische Lösungen hin zu dekolonialen Ökologien, die Beziehung statt Beherrschung ins Zentrum stellen. Wenn wir das Ende anerkennen, wie viele es bereits erfahren haben, eröffnet sich vielleicht kein Neuanfang – aber ein anderes Fragen, ein anderes Hören, ein anderes Sein. Die Risse und Ränder des Systems brauchen wir dabei nicht zu fürchten, wir können sie als Orte der Fürsorge, der Fluchtlinien und des Atmens neu bewohnen.
Wenn wir von der »Welt« sprechen, geht es selten um den Planeten, sondern um unsere gewohnte Ordnung. Es ist gar nicht die Erde, die wir retten wollen, sondern unser Gefühl von Kontrolle. Aber die Erde ist kein passives Objekt, das auf unsere Hilfe angewiesen ist. Sie ist eine uralte, mächtige Intelligenz, die Wandel, Zerstörung und Erneuerung in sich trägt. Sie braucht uns nicht. Sie hat Eiszeiten, Meteoriteneinschläge und Massensterben überstanden. Die Frage ist nicht, ob sie uns überlebt – sondern ob wir lernen, uns wieder als Teil von ihr zu begreifen. Die eigentliche Krise ist unsere Entfremdung. Wenn wir das Lebendige als beseelt und bewusst erkennen, handeln wir nicht mehr aus einem Retterkomplex heraus – sondern aus Verbundenheit.
Fürsorge ist tief in uns angelegt. Unser Gehirn ist auf Empathie, Kooperation und soziale Verbundenheit ausgerichtet. Doch der Kapitalismus hat unsere Fürsorge fehlgeleitet: weg vom Leben, hin zu Märkten, Macht und Effizienz. Wir kümmern uns um Produktivität statt um Lebendigkeit. Unsere Aufmerksamkeit wurde gekapert – durch Medien, Konsum, Ablenkung und Kontrolle. Die Folge: eine kollektive Erschöpfung, eine Welt am Rande des ökologischen Kollapses, durchzogen von Einsamkeit, Entfremdung und Verlust.
Die Umweltkrise ist nicht nur eine ökologische, sondern eine existenzielle: Sie spiegelt unsere wirtschaftliche Ungleichheit, unsere psychische Leere, unser verlorenes Gefühl für Bedeutung. Wir haben unsere Fürsorge Dingen anvertraut, die uns schwächen. Radikale Fürsorge bringt uns zurück ins Leben. Sie bedeutet, uns dem zuzuwenden, was organisch wächst, was fragil und unmessbar ist. Wie es schon Maria Mies in Patriarchy and Accumulation on a World Scale beschreibt, liegt die Kraft der Fürsorge gerade darin, dass sie dem kapitalistischen Zugriff entzogen wird. Ähnlich verweist Vandana Shiva auf die unersetzliche Rolle von Care-Arbeit für das Überleben aller Lebewesen – jenseits ihrer ökonomischen Verwertbarkeit.
Das erfordert einen Bruch, denn wir leben nicht trotz, sondern durch die Krise. Der Kapitalismus nährt sich aus seinem eigenen Chaos. Krisen sind in diesem Sinne keine Fehler. Sie erzeugen Dringlichkeit, lähmen Reflexion, zwingen uns, den Status quo zu stabilisieren, statt ihn infrage zu stellen. Stabilität ist in diesem System nicht vorgesehen. Was wir »Normalität« nennen, ist ein dauerhafter Ausnahmezustand, der uns in ständiger Anpassung hält. Reformen können daran nichts ändern, denn Pflaster genügen nicht, wenn die Wunde faul ist. Wer heute den Kapitalismus »grüner« oder »sozialer« gestalten will, verkennt, dass seine Grundfesten auf Trennung, Ausbeutung und Hierarchie beruhen – so, wie auch einst die Sklaverei nicht reformierbar war, weil sie auf Entmenschlichung basierte.
Der Kapitalismus ist nicht nur ein Wirtschaftssystem, sondern eine Weltsicht. Eine, die uns glauben lässt, dass die Natur ein Produkt ist, dass unser Wert sich in Leistung bemisst, dass endlose Akkumulation (wir nennen es »Wachstum«) gut und Wettbewerb heilig sei. All das sind Konstruktionen und keine Naturgesetze. Und weil sie gemacht sind, können sie auch gebrochen werden. Was wir brauchen, ist keine Verbesserung des Alten – sondern seine Überwindung. Eine neue Welt, die auf Fürsorge statt auf Kontrolle, auf Verbundenheit statt auf Dominanz basiert. Auf einem Verständnis von Wert, das nicht in Zahlen, sondern in Leben gemessen wird.
Aber du fragst dich vielleicht, wie wir ein System hinter uns lassen können, von dem wir abhängig sind – und das viele von uns sogar privilegiert. Der Griff dieses Systems ist so verderblich, dass ein Leben außerhalb des Kapitalismus praktisch unmöglich ist. Aber genau darin liegt unsere Aufgabe: Wir können Risse schaffen im Beton des Bestehenden. Das kann unter anderem durch unsere Aufmerksamkeit geschehen, denn sie ist Energie – was wir nähren, wächst. Veränderung beginnt, wenn wir sie umleiten: weg vom Alten, hin zum Lebendigen.
Unsere moderne Gesellschaft ist süchtig nach Kontrolle, besonders in Deutschland, wo Sicherheit und Vorhersehbarkeit vergöttert werden – es gibt kaum ein Risiko, das nicht von einer Versicherung abgedeckt ist. Doch Kontrolle ist eine Illusion. Der Kapitalismus stirbt – und wir wissen nicht, was danach kommt. Das Wissen um das, was als Nächstes kommt, würde uns vor dem Unbehagen der Veränderung jedoch nicht bewahren. Und was, wenn das Loslassen dieses Bedürfnisses der Schlüssel zu unserer kollektiven Entwicklung ist?