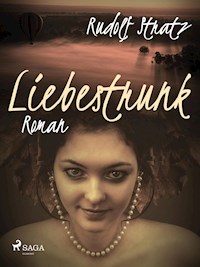
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Vielleicht ist es ein Unrecht, einen Menschen ganz für sich haben zu wollen, ohne Rücksicht auf ihn selber, so wie ich Paul als Freund und Sie ihn als Mann! ... Wenn es ein Unrecht war, dann hat es sich an uns gerächt ..." An ihrem siebenundzwanzigsten Geburtstag zieht die junge Witwe Gabriele Lünhardt nach dreijähriger Trauerzeit zum ersten Mal wieder bunte Kleider an. Ihre Mutter hegt schon Pläne, sie neu zu verkuppeln, doch Gabriele lebt noch immer ganz in der Erinnerung an die große, glückliche Liebe ihres Lebens. Doch noch am gleichen Tag holt sie auch die Vergangenheit ein, in Gestalt des afrikanischen Plantagenbesitzers Werner von Ostönne, bester Freund ihres verstorbenen Mannes Paul und nun ihr erbitterter Feind. Über Ostönne, der ihr die Briefe Pauls an ihn zukommen lässt, erfährt sie, dass ihr Eheglück, zumindest was ihren Mann anging, nur ein scheinbares war, auf dem täglichen Seelenleid und Unglück ihres Mannes aufgebaut, der für seine geliebte Frau das Leben als Afrikaforscher und Plantagenbesitzer in Deutsch-Ostafrika an der Seite seines Freundes Werner aufgegeben hat und mit zerrissener Seele, dem Selbstmord nahe, verstarb ... Als Gabrieles bisheriges Leben unter ihr zusammenbricht, ringt sie verzweifelt nach Neuorientierung, für die schließlich sogar der Feind von Ostönne zur Schlüsselfigur wird. Ein psychologisch durchdrungener und einfühlsam erzählter Roman über den Konflikt zwischen Liebe und Lebensberufung.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rudolf Stratz
Liebestrunk
Saga
LiebestrunkCopyright © 1910, 2019 Rudolf Stratz und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711507162
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmontwww.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
1
Gabriele Lünhardt hatte eine eigene Empfindung, als sie an diesem Berliner Herbsttag zum erstenmal wieder ein farbiges Kleid anzog. Der dichte Flor vor den Augen, der lange Schleier, dann das Grau und Weiss der Halbtrauer um ihren verstorbenen Mann, die schwarzen Schleifen waren ihr durch die Gewohnheit dreier Jahre etwas Selbstverständliches geworden, was sie von ihrer Persönlichkeit kaum mehr trennen konnte. Nur zu dem dunklen Lila der Witwen hatte sie sich nie entschliessen können. Ihr schien: es machte sie zu alt — sie, die heute ihren siebenundzwanzigsten Geburtstag feierte.
Sie war schlank gewachsen. Überreiches, aschblondes Haar wuchtete in einem schweren Knoten in ihrem Nacken und überkräuselte das schmalwangige Gesicht mit den klaren, grauen Augen. Sie sah ernst, fast schuldbewusst aus, während sie mit Hilfe ihrer Kammerjungfer sich in das enganliegende Prinzesskleid hüllte — ein Unterkleid von kupferfarbener Seide, darüber in etwas hellerem, zartem Kupferton ein Spitzenstoff, mit Kupfer und Gold in eigenartigem Schlangenmuster überstickt — ein Anblick, der die Jungfer entzückte. Sie war schon im Elternhaus Gabrieles in Westdeutschland bei dem verstorbenen Kommerzienrat Weiferling in Stellung gewesen und hatte die Tochter bei ihrer Heirat vor sechs Jahren nach Berlin begleitet. „Gnädige Frau sehen wunderschön aus!“ sagte sie, neben ihr am Boden kniend.
Die junge Witwe erwiderte nichts. Sie stand in ihrem grossen, hellen, ganz Weiss in Weiss gehaltenen Ankleidezimmer, vor dessen Scheiben das bunte Herbstlaub des Berliner Tiergartens schimmerte. Hier, mitten in der Hauptstadt und doch fast im Walde, nahe der Lichtensteinbrücke, hatten sie und ihr Mann sich ihre reiche Villa gebaut. Nur drei Jahre hatte er sie bewohnt. Dann hatten sie ihn hinausgetragen.
„Gnädige Frau sind in der Toilette noch jünger!“ erklärte die Zofe. Sie kauerte noch da unten und zupfte geschäftig die Falten zurecht. „So waren gnädige Frau als Mädchen!“
Und ihre Herrin dachte sich, ohne hinzuhören: ,Ja — da haben sie ihn hinausgetragen. Nicht an einem trüben Oktobermorgen wie heute, sondern an einem klaren, frostigen Wintertag. Er hat sich nur ein paar Tage unwohl gefühlt. Und dann plötzlich . . . Blinddarmentzündung . . . Warum nur, du grosser Gott? Und wir hier unten falten die Hände und weinen . . . weinen . . .‘
„Was nehmen gnädige Frau für einen Schmuck?“
„Noch keinen!“
Sie dachte wieder, was sie tausendmal gedacht: ,Warum musste es sein? Ich habe ihn doch so geliebt . . .‘
Das Mädchen war aufgestanden. Es bat: „Gnädige Frau sollten sich doch einmal vor dem Spiegel betrachten! . . . Gnädige Frau sind so entzückend! . . . Es wird alles paff sein!“
Sie tat ihr den Gefallen und erstaunte selbst vor der schönen fremden jungen Frau, die ihr im Glase gegenüberstand und ernst, forschend ihren Blick erwiderte. Diese farbenfrohe Eleganz verwirrte sie. War sie das? Durfte sie das sein? Ein Mensch wie andere? Draussen das Leben? . . . Dabei gefiel sie sich. Sie war schön. Schöner noch als bisher in der trüben Verpuppung des Witwenstandes. Zu ihrer gleichmütigen, blonden, klaren Art passte Trauer nicht so gut wie diese zarten, kühlen Farben, die in leisen Seidenwellen an ihr herniederrieselten. Aber sie schaute gleich wieder weg; seufzte, strich sich ihrer Gewohnheit gemäss mit der schmalen, weissen Hand über den Scheitel und frug: ,,Sind meine Mutter und meine Schwester drüben?“
„Jawohl, gnädige Frau! . . .“
Gabriele Lünhardt nickte und ging von ihrem Ankleidezimmer in das anstossende Boudoir und durch die Flucht der Empfangsräume weiter. Sie hatte einen leichten, wiegenden Schritt — ein Gleiten in Hüften und Schultern. Den Kopf trug sie etwas vorgeneigt. Eine sanfte Halslinie wölbte dabei den weissen Nacken, in dem das goldene Flaumhaar schimmerte. Um sie war der schwere, gediegene Reichtum, den der verstorbene Kommerzienrat Weiferling, der Inhaber der grossen Pianofortefabrik Weiferling u. Co., seiner Witwe und seinen beiden Töchtern hinterlassen hatte. Und überall in diesen Prunkgemächern traf Gabrieles Auge auf Andenken von ihrem Mann. Er hatte als Afrikaforscher viel die Öffentlichkeit beschäftigt. Dort das grosse Ölbild von ihm, das seinem Maler seinerzeit auf der Kunstausstellung im Glaspalast den zweiten Preis eingetragen, war oft reproduziert worden. Da wieder hing ein Pastell Dr. Paul Lünhardts noch aus seinen Junggesellenjahren, in der Uniform eines Stabsarztes in der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika. Und hier die Bronzestatuette eines auf einem Sockel ruhenden Löwen war die Nachbildung seines Grabmals draussen vor den Toren Berlins. Nur der kleine runde, mit Oberlicht in Weiss und Gold gehaltene Musiksaal wies keine Erinnerung an ihn auf. Er enthielt nichts als den auserlesenen, fast immer zu Gabrieles Gebrauch aufgeschlagenen kostbaren Flügel aus der Werkstatt ihres Vaters. Er war der Mittelpunkt des Hauses. In seiner strengen Schmucklosigkeit feierlich gleich einer kleinen Kirche.
Am Eingang zu diesem Allerheiligsten hielt eine alabasterne Herme Gabriele Lünhardts auf hohem Sockel Wacht, von der von oben strömenden Tageshelle durchsonnt und belebt, mit offenen Augen und sprechenden Lippen, gesammelte Ruhe auf den klaren Zügen. Es war ein schöner, jugendlicher Kopf, im Profil herbe und fest, von vorne mehr frauenhaft weich und lächelnd. Er glich ihr wie aus dem Gesicht geschnitten. Gabriele blieb vor ihm stehen und fuhr ihm zerstreut, wie sie es bei sich selber tat, glättend mit der Hand über das Haupt. Es war eine Bewegung, mit der man eine Schwester liebkost. Es lag Wohlwollen darin. Stille Liebe trotz allen Summers. Freude an sich selber . . .
Zwei Zimmer weiter warteten die verwitwete Kommerzienrätin Weiferling, eine rundliche, etwas zu jugendlich hell gekleidete Matrone, und ihre jüngere, zu Anfang der Zwanzig stehende Tochter auf Gabriele, die Mutter und Schwester nach dem Tode ihres Mannes zu sich nach Berlin in ihr Haus genommen hatte. Der Geburtstagstisch stand leuchtendweiss gedeckt, mit Blumen und Geschenken überladen. Es war das erste Mal seit drei Jahren, dass die junge Witwe die Feier des Festes duldete. Das heute sollte ein Sinnbild sein, das Wiederhinaustreten in das Leben, unter die anderen Menschen statt der Trauer um den Einen . . .
Sie hatte die Ihren, die ihr glückwünschend bis zur Schwelle entgegenkamen, geküsst und betrachtete nun stumm, mit gefalteten Händen den Gabenbau. Es blühte und duftete ihr von da unten entgegen, Orchideen und Rosen, Kallas und Lilien rankten sich schmeichelnd zu ihr empor, Briefe, Glückwunschtelegramme, Visitenkarten schimmerten weiss in der farbigen Wildnis. Mama hatte sich gewaltig angestrengt mit ihrem Smaragdarmband, auch die Schwester Gisela hatte das Ihre getan . . . Gabriele gab ihnen die Hand und dankte ihnen, aber sie blieb dabei ernst und still. Auf einmal drangen ihr die Tränen unaufhaltsam in die Augen. Sie ging in das Nebengemach, um allein zu sein. Die weichen Perserteppiche dämpften ihren Schritt, die schweren Portieren schlugen hinter ihr zusammen, um sie standen steif, unbenutzt in diesen reichen Räumen, die seit Jahr und Tag keine grössere Gesellschaft mehr gesehen hatten, die geschnörkelten Tische und Stühle, Prachtwerke lagen umher — Musikmappen — Kupferstiche — überall waltete ein kühler, freisinniger und verwöhnter Geschmack, Vergeistigung in den Dingen. Alles Grelle, Schroffe, allzu Wirkliche war vermieden.
Und dort am Fenster stand ein Rokokorahmen mit Photographien ihres Mannes. Die hatte sie sich, noch als Braut, der Reihe nach gesammelt. Da war er als ganz kleines Kind im Röckchen — als kurzhosiger Sextaner und schon mit dem Zwicker bewaffneter, flaumhaariger Abiturient, als Studio, Stirne und linke Wange zerhauen, als Einjähriger, als Assistenzarzt — erst daheim, dann im Tropenhelm und Kaki der Schutztruppe, endlich, nachdem er drüben den Abschied aus dem Dienst genommen, als der weitbekannte Afrikaforscher — von einem Franziskanermissionar in der Buschsteppe photographiert — die Elefantenbüchse in der Hand, sonnenverbrannt, verwildert, lachend, dass die Zähne unter dem regellos gewachsenen Vollbart blitzten.
Die letzten Aufnahmen aber waren nach seiner Heirat in einem Berliner Modeatelier entstanden, der Urwaldbart war geschwunden. Ein eleganter, korrekter, schnurrbärtiger Herr schaute scharf aus dem Rahmen und sass, ein Buch in der Hand, in sinnender Haltung am Schreibtisch und trug auf dem Frack eine prunkende Ordensreihe zur Schau. Das war er, so wie sie ihn gekannt und geliebt hatte. So hing auch oben an der Wand in dunkler Eichenfassung seine lebensgrosse Sepiaphotographie — ein getreuer Spiegel der Wirklichkeit — ein schweigsames, mageres Gesicht, in den durchdringend durch die Zwickergläser forschenden Augen noch der Ernst des einstigen Arztes, um die schmalen Lippen ein sonderbarer Zug von stillem Humor . . .
Kaum siebenunddreissig Jahre war er alt geworden. Er hatte es als Arzt gewusst, dass er sterben musste — schon zwei Tage zuvor. Sie wunderte sich manchmal, dass in jenen Wochen ihr aschblondes Haar nicht aschgrau geworden war. Sie stand und schaute zu dem Bild hinauf wie zu einem Heiligtum. Sie hatte darunter eine Art Tempel zurechtgemacht — einen Tisch mit Palmen und exotischen Blattgewächsen, die wie ein Gruss der fernen afrikanischen Sonne schirmend mit ihrem tiefen Grün den Rahmen umrankten. Vorn war zwischen ihnen ein Raum frei. Da legte Gabriele still eine Handvoll roter und weisser Rosen nieder, die sie von ihrem Gabentisch mitgebracht. Das hier — das war ihre eigentliche Geburtstagsfeier — eine Totenfeier. Sie lehnte sich an die Wand, das Tuch vor den Augen, und schluchzte in sich hinein.
Sie hörte Schritte. Ihre Mutter war ihr gefolgt. Die junge Witwe drehte sich um und schaute an ihrem Kleid hernieder.
„Es war ein Unsinn, Mama!“ sagte sie kurz. „Diese Idee . . . Was soll ich in den bunten Lappen? In mir schreit es dagegen! Von morgen ab trag’ ich wieder Trauer!“
„Man kann nicht sein ganzes Leben lang trauern, Kind! Man bereut es zu spät!“
„Ich nie!“
Die Matrone hatte sich gesetzt und gleichmütig ihre kurzen, fleischigen, mit schweren Ringen geschmückten Hände verschränkt. Auf ihrem verschwommenen Gesicht war ausdrucklose Gutmütigkeit. Sie sprach infolge ihrer Körperfülle kurzatmig.
„Man muss nichts übertreiben, Goldkind! . . . Alles ändert sich im Leben . . . Jeder Schmerz hat seine Zeit . . .“
„Mama . . . ich kenn’ die Fibersprüche auswendig . . .“
„Du bist doch nicht die einzige Witwe auf der Welt. Ich hab’ deinen guten Papa doch auch hergeben müssen . . .“
Die alte Dame seufzte und schnupfte dabei wie ein Mensch, der eine innere Rührung zurückdrängt. Ihre Tochter schüttelte ungeduldig den Kopf.
,,Mama . . . ich hab’ dich schon oft gebeten, das beides nicht zu vergleichen . . .“
,,Kind . . . spricht man so zu seiner Mutter?“
„Du hast seinerzeit Papa geheiratet, weil alles gut passte — hier eine Pianofortefabrik, da eine Seidenweberei — ihr habt euch auch schliesslich vertragen — das war ja soweit alles schön . . .“
Und während sie sprach, dachte sie sich: ,Nein — das nicht einmal! . . .‘ Er war eigentlich gar nicht zum Philisterium veranlagt gewesen, der lustige, kleine dicke Papa — dies grauköpfige joviale Kind — trotz seiner Geschäftschlauheit — von dem sie ihre musikalische Leidenschaft geerbt hatte. Sie fuhr fort: ,,Dagegen ich . . . Nach dem, was Paul und ich uns waren, begehe ich einen Verrat an ihm, wenn ich so tue, als wäre ich wieder wie andere Leute, sei es auch nur durch ein Lachen oder durch eine bunte Schleife am Kleid . . . Ich war so glücklich . . . er hat mich so geliebt . . .“
,,Angebetet hat er dich . . .“
„Und das muss man heilig halten! Das kommt nie wieder . . . nie im Leben . . .“
Die Kommerzienrätin Weiferling legte ihrer schönen Tochter die Hand auf den Arm. Die zuckte bei der Berührung zusammen. Mama lächelte so vielsagend und mütterlich. Sie hatte dann etwas so Listiges und Molliges an sich — förmlich etwas Kupplerisches. Im Hintergrund ihrer Rede lauerten dann die Männer. Der neue Mann. Der Unbekannte . . .
„Da dich Paul so geliebt hat,“ begann die Matrone behutsam, „so würde er, wenn er noch reden könnte, nur das eine wünschen, dass du glücklich bist! Das kann man aber doch nicht, wenn man ewig in Sack und Asche geht. Auf einmal ist Jugend und Schönheit weg und dann sitzt man da und die Bewerber sind über alle Berge!“
„Und jetzt hab’ ich noch an jedem Finger zehn!“ sagte die junge Witwe melancholisch. „Siehst du, Mama: das ist ja das Grässliche, was du nicht verstehst . . . weswegen ich wie eine Nonne in meinen vier Wänden lebe! Saum tret’ ich hinaus, um nur ein bisschen Mensch unter Menschen zu sein, so sind sie schon hinter mir her! Sie lassen einem keine Ruhe! . . . Aber du hast mich jetzt in die rechte Stimmung gebracht, um reinen Tisch zu machen!“
Sie ging in das Geburtstagszimmer zurück. Ihre Schwester Gisela stand da, hatte ihren zartblonden Kopf, der an sich feingeschnitten war und nur neben der Schönheit der Älteren verblasste, über die Blumen gebeugt und besprengte sie hausmütterlich mit Wasser. Sie fühlte sich am Arm zurückgezogen. „Lass das nur gut sein!“ sagte Gabriele Lünhardt. „Der Aufbau hat ja nun seine Schuldigkeit getan!“
Damit griff sie in das Blühen und Duften hinein, zog die Sträusse aus ihren Gläsern, trennte die Karten und Briefe von ihnen ab, riss sie durch und warf sie zur Seite. Nur eine Visitenkarte und einen Busch roter und weisser Rosen — dieselben, von denen sie vorhin eine Handvoll unter das Bild ihres Mannes gelegt, liess sie auf ihrem Platz. Sie leuchteten einsam über den fast leeren Tisch, auf dem nur noch die Geschenke ihrer Angehörigen prangten. Dann klingelte sie dem Diener.
„Johann . . . nehmen Sie die Blumen und tragen Sie sie hinüber in das Elisabethkrankenhaus. Man möchte sie den Kranken auf die Betten legen! Dann find sie doch zu etwas gut!“ . . .
Der Diener ging. Sie atmete auf.
„So! Nun ist die Luft rein! Sie sollen nicht so plump nach mir greifen! Ich bin keine Ware auf dem Markt . . . Was hast du denn, Gise?“
Sie schaute ihrer Schwester über die Schultern, die tränenschluckend die beiden Hälften einer eben durchsgerissenen Visitenkarte zusammenpasste, und las:
„Bankholtz
Hauptmann in der Kaiserlichen Schutztruppe
in Südwestafrika.“
„Verzeih!“ sagte sie. „Deinem Bräutigam wollt’ ich nicht zu nahe treten! . . .“
„Die Orchideen waren von Koschel, Gabriele! Die haben ihm so eine Masse Geld gekostet . . .“
„Sei mir nicht böse . . .“
Die beiden Schwestern küssten sich. „Ich wünsche dir doch weiss Gott alles Gute, Gise!“ versetzte Gabriele Lünhardt, sich freimachend. „Werde du glücklich mit deinem Bankholtz! Liebe ihn nur nicht zu sehr!“
„Meinst du denn, dass man zu sehr lieben kann?“
„Das weiss ich eben nicht! Man gewinnt so viel und verliert so viel! Hinterher ist man so arm! . . . Man findet sich gar nicht mehr in das gewöhnliche Leben zurecht! Aber es muss ja nicht jedem so gehen . . .“
Ihre Stimme war immer auffallend hell und stark, durch die Gewohnheit des Singens gestählt. Sie nickte den beiden Damen zu: „Ich gehe jetzt wieder zu mir hinüber, Mama! Ich tauge nicht zum Geburtstagskind! Für mich ist’s immer Allerseelen! . . . Da müssen wir uns schon darein finden und mit mir Geduld haben — nicht wahr?“
Langsam schritt sie durch die Zimmerflucht zurück. In der wurde jeden Morgen abgestaubt und aufgefegt. Aber trotzdem war ihr, als hingen Spinnweben in den Ecken der hohen Räume — ein Hauch der Vergangenheit und der Vergänglichkeit überall . . .
Sie blieb stehen und dachte sich: ,Sonst warnt man alte Männer, sich noch Häuser zu bauen, damit das Schicksal nicht gereizt wird und sie belehrt, dass wir nur Gäste auf der Erde sind. Aber er war doch noch jung! Wir hatten doch noch ein Recht auf Glück . . .‘
Es schien ihr so lang, diese drei Witwenjahre. Und doch: es war nichts in dieser Zeit verblasst. Sie hatte seine Gestalt festgehalten. Sie sah ihn vor sich, an ihrem letzten Geburtstag, den sie zusammen feierten. Da waren nicht so viele Blumen auf dem Tisch wie heute. Keine Fremden drängten sich heran. Aber seine Gaben lagen auf dem weissen Tuch. Er war da und seine Liebe . . .
Dies Schweigen umher . . . Draussen die tiefe, vornehme Stille dieses letzten Ausläufers des Tiergartenviertels. Sie wollte ja nichts von der Welt da draussen. Sie verschloss sich vor ihr. Aber sie fröstelte doch. Ein Gefühl unendlicher Einsamkeit durchkältete sie. Der Anblick dieser vielen toten, meist von Licht und Lachen erfüllt gewesenen Räume lastete auf ihr. Sie musste sich zu sich flüchten. Dort, am Eingang zu dem kleinen weissen Musiksaal, stand ihr alabasternes Ebenbild und lud sie ein, und sie ging und betrat ihr Reich.
Ihre Stimme, dieser glockenhelle, machtvolle Sopran, hätte ihr mit Leichtigkeit den Weg in den Konzertsaal geebnet, wenn sie, die Tochter aus reichem Hause, darauf angewiesen gewesen wäre. Das ganze Elternhaus lebte ja von Musik, sie selber auch. Sie setzte sich an das Klavier, träumerisch verschlungen klangen die Weisen. Sie sang halblaut mit, die Augen geschlossen, den Kopf zurückgelegt. Ihr Antlitz sah auch jetzt, bei geöffnetem Munde, schön aus. Die Züge hatten nun etwas Leidendes, Sehnsüchtiges, Weltentrücktes. Sie glichen denen einer jugendlichen Mater dolorosa. Aus ihrer Stimme sprach ein anderer Mensch als sonst im Leben. Leidenschaft statt der Kühle.
„Was weckst du der Wala Schlaf . . .?“
Es klang wie eine Klage. Geheimnisvoll. Bang abwehrend . . . Was drang da alles von aussen herein, rüttelte an den Pforten der Seele, begehrte Einlass? Und innen stand doch nur ein Sarg. Begrabene Liebe . . .
Sie trieb im Meer der Töne wie ein Schwimmer draussen auf den weiten Wellen. Das war dies wunderbare Gefühl der Uferlosigkeit, der Abgrundtiefe unter sich — ein Selbstvergessen. Sie wunderte sich nicht, als sie endlich die Hände von den Tasten sinken liess, dass der halbe Vormittag vergangen war. Sie stand auf. Sie war jetzt ganz gefasst. Aus ihrem Musiksaal kam sie beruhigt, wie aus der Kirche.
An dem grossen Empfangszimmer vorbeigehend, hörte sie innen die Stimme ihres künftigen Schwagers. Sie kannte dies heitere Lachen. Sie hörte, wie der Hauptmann Bankholtz zu ihrer Schwester sagte: „Ja natürlich, Maus . . . in den nächsten Wochen werde ich ja mit Gottes Hilfe in die preussische Armee zurückversesst . . . ich hab’ die Sandbüchse da unten in Südwest nach vier Jahren nu auch allmählich dicke . . .“
„Dann wollen wir jedenfalls noch vor Weihnachten heiraten!“
„Hoffentlich, ich kann mir nur die neue Garnison nicht herzaubern!“
„. . . wir heiraten doch vor Weihnachten!“
„Sobald wir ein Heim haben! Du hast hier eines! Ich hab’ es vorläufig noch nicht!“
„Ich noch weniger! Ich will hier heraus!“
Das klang heftig und entschlossen, ganz anders, als die heitere blonde Gisela sonst sprach. Ihre Schwester wollte eben aus dem Nebengemach zu ihr hinein, da hörte sie ihren eigenen Namen: „Du weisst nicht, was das heisst, mit Gabriele zusammenleben!“
„Na — sie beisst doch nicht!“
„Das nicht! Sie ist in ihrer Art immer gut und nett. Sie meint es nicht so. Aber sie erdrückt einen förmlich. . . .“
„Wieso denn?“
„Ja, nicht mit Gewalt! Ganz unmerklich! . . . Du siehst es ihr so nicht an, aber sie ist ein ganz unbeugsamer Mensch — war’s immer. Sie gibt anderen nicht ein Haarbreit nach! Also müssen wir fortwährend Opfer bringen . . .“
„Zu mir ist sie immer liebenswürdig!“
„Freilich! Wen sie gern hat . . . Sie hat auch mich gern — Mama — jedermann! Sie ist gar kein böser Charakter. Sie biegt sich die Leute nur eben in aller Sanftmut zurecht, wie sie sie haben will . . .“
„Komisch!“
„Sie weiss es immer durchzusetzen, dass sich alles um sie dreht! . . . Ganz lächelnd, ganz selbstverständlich! Ich glaub’, es kommt ihr gar nicht voll zum Bewusstsein. Aber ich hab’ das satt! . . . Ich will jetzt einmal etwas für mich sein . . .“
Gabriele Lünhardt wandte sich ab, um nicht mehr zu hören. Auf ihrer niederen weissen Stirne standen drei unmutige Querfalten zwischen den dichten, dunkelblonden Augenbrauen. Sie war eigentlich mehr erstaunt als erzürnt. Was war das für ein dummes Gerede? Sie, die keiner Fliege etwas zuleide tat — die jeden Menschen nach seiner Fasson selig werden liess — und nun dies alberne Mädel . . .
,Die war eben verliebt! Wer da nicht ewig mit ihr mithimmelte, erschien ihr teilnahmlos.‘ Die junge Witwe war schon wieder versöhnlich gestimmt. Sie war von Natur weitherzig. Sie trug nicht leicht etwas nach, am wenigsten dem blonden Schaf da drüben. Durch die Türe vernahm sie, wie der Hauptmann vergnügt sagte: „Warum seid ihr denn dann zu ihr ins Haus gezogen, du unkluger Schatz?“
„Weil sie’s so gewollt hat!“
„Aber du und die Mama hättet es doch gar nicht nötig gehabt!“
„Wenn Gabriele was will, dann geschieht’s! Sie möchte als Witwe nicht allein sein. Also mussten wir kommen! Das verstehst du eben nicht . . .“
„Nun — weiss Knöppchen nicht!“ lachte der Schustztruppler und sprang bei Gabrieles Eintritt eilig auf. Sein krebsrot gebranntes, lustiges Gesicht mit dem weissblonden Schnurrbärtchen und dem stoppelkurzgeschnittenen Haar war rundlich, die breitschultrige Gestalt beinahe zu voll für die kleidsame graue Felduniform. Er strotzte von Gesundheit und Lebenslust.
„Guten Tag! Und herzlichen Glückwunsch, liebe Schwägerin!“
„Guten Tag!“ sagte die junge Frau kühl. „Schönen Dank für die Blumen!“ Sie hatte sich noch nicht entschliessen können, den demnächstigen Verwandten ,Du‘ zu nennen. Sie war abwehrend gegen ihn wie gegen alle Männer, obwohl doch gerade dieser am allerwenigsten Absichten auf sie hatte. Immerhin gab sie ihm freundlich die Hand. Das Konventionelle in ihrem Dasein trat jetzt deutlich hervor. Man fühlte, dass sie dieses etwas leere und zerstreute Lächeln für jeden übrig hatte. „Sie wollen schon gehen?“ frug sie im Ton oberflächlichen Bedauerns.
Der Hauptmann Bankholtz hatte seiner breitrandigen Schlapphut ergriffen.
„. . . Höchste Zeit, dass ich mich beurlaube! Wir zanken uns schon seit einer Stunde, mein künftiges Hauskreuz und ich . . . aber alles in Liebe und Güte, wie der Pastor sagt . . . ich habe nur noch eine dringende Bestellung auszurichten: Herr von Ostönne ist zurzeit im Lande, hier in Berlin . . . Sie kennen ihn . . .“
„Persönlich nicht!“
„Freilich: er war ja nun sieben Jahre ununterbrochen drüben in Ostafrika . . . gesegnete Konstitution . . . na . . . seine Plantagen liegen ja auch oberhalb der Fieberzone . . .“
„Mein seliger Mann hat mir natürlich viel von ihm erzählt!“
„Ja! Man wird selten zwei so dicke Freunde finden, wie die beiden waren! Na . . . Ostönne ist nun also mit Gottes Hilfe hier . . . hat mich auch aufgesucht . . . als alten Zeltkameraden von Anno Tobak. Und wie er hörte, dass ich Ihr Schwager in spe sei, hat er mich gebeten, bei Ihnen anzufragen, ob er Ihnen seine Aufwartung machen darf . . .?“
„Wenn er will — gewiss!“
Es klang zurückhaltend. Sie setzte hinzu: „Es ist übrigens komisch: Ich erinnere mich genau . . . ich habe ihm vor drei Jahren ausführlich alles über den Tod meines Mannes nach Ostafrika geschrieben — ich hielt es für meine Pflicht, da ich wusste, wie befreundet die beiden zusammen waren — aber ich habe nie eine Zeile Antwort bekommen . . .“
„Wahrscheinlich ist der Brief verloren gegangen. Denn wenn ich ihn recht verstanden habe, wollte er jetzt gerade über Pauls letzte Zeit näheres von Ihnen hören . . . Wann darf er denn antreten?“
„Irgend einmal des Nachmittags zur Teezeit!“
„Schön! Ich esse jetzt mit ihm! Da werde ich es ihm gleich bestellen! . . . Empfehle mich gehorsamst! . . . Adieu, Maus!“
Der Schutztruppler zog sich sporenklirrend zurück, von seiner Braut in die Vorhalle begleitet. Ihre Schwester sah den beiden gedankenvoll nach. Was waren das für sonderbare Reden hinter ihrem Rücken gewesen? Sie, Gabriele Lünhardt, die immer nachgab, die nie heftig wurde, eine Tyrannin? Sie sollte den anderen das Zusammenleben mit ihr so schwer machen, ihnen ihre Persönlichkeit verkümmern? Sie schüttelte den Kopf. Nicht im Traum war ihr je so etwas eingefallen. Sie war sich wirklich keiner Schuld bewusst. Sie sorgte sich doch kaum um andere, und wenn ja, dann doch nur, um ihnen zu helfen. Sie hatte, als sie bald nachher alle drei bei Tisch sassen, eigentlich Lust, die glückliche Braut zur Rede zu stellen, Aber dann liess sie es.
Es war ihr schliesslich gleichgültig, dies Geschwätz. Es lag zu weit von ihr ab. Am besten, man vergass es.
Sie hörte mit halbem Ohr auf die eifrigen Ausstattungs- und Hochzeitsreisepläne der blonden Kleinen an ihrer Seite. Schwermut lastete auf ihr, die für ihr Teil das alles längst hinter sich und begraben wusste. Sie dachte sich: ,Nun geht Gisela weg. Ich bin mit Mama allein. Einmal wird auch die abgerufen. Dann habe ich niemanden mehr auf der Welt . . .‘
Die Vorstellung dieser kommenden Einsamkeit zog ihr das Herz zusammen. Wenn das doch zuviel für sie würde — wenn sie sich in schwachen Stunden nach einer Menschenseele sehnte und es zu spät war? — Dann lieber gleich den Entschluss . . . heute noch . . . und zugleich wusste sie auch wieder: Nein! Es war unmöglich . . .
Das Frühstück ging zu Ende. Sie erhob sich und sagte zu dem Diener: „Johann . . . ich bin nicht zu Hause! Nur wenn Herr von Wingerow kommen sollte . . .“
„Herr Major sind eben in den Vorgarten getreten!“
Draussen brummte der tiefe Klang eines kupfernen Gongs im Flur. Ein Hausmädchen kam und brachte die Karte des Besuchs. Die Züge der jungen Witwe wurden sehr ernst. Sie kümmerte sich nicht darum, dass Mutter und Schwester sie von der Seite gespannt ansahen. Sie sagte kurz: „In den blauen Salon! Ich komme gleich!“
Die Mitte dieses Raumes nahm eine Staffelei mit einer lebensgrossen Ölskizze Gabrieles ein. Das Werk war von Lenbachs Hand. Darum hatte es diesen Ehrenplatz gefunden. Aber eigentlich liebte sie das Bild nicht. Das war nicht sie, ein seltsamer, fremder Zug um den Mund, ein ihr unbekannter Ausdruck in den Augen. Vor diesem flüchtig und genialisch mit raschen Farbenstrichen hingewischten Profil stand, als sie eintrat, der Major von Wingerow, auf seinen Säbel gestützt, und musterte es mit tiefem Interesse.
Er war ein schöner Mann, in altpreussischer Art, den dunkelbraunen Vollbart zu beiden Seiten des Kinns ausrasiert, wie es einst Kaiser Wilhelm der Erste getragen und es jetzt in der Armee wenig mehr üblich war. Das war ein Anklang an Potsdam — an die Garde, in der er einst seine Dienstzeit begonnen. Der Johanniterstern funkelte an seinem Hals. Er war jung für seine Charge, erst zu Ende der Dreissig. In Blick und Sprache hatte er etwas Bestimmtes, in sich Zusammengefasstes, dessen Härte durch die Ritterlichkeit seiner Formen gemildert wurde. Er zog Gabrieles Hand, sich tief verbeugend, an die Lippen. „Nochmals herzlichsten Glückwunsch, meine verehrte gnädige Frau!“ sagte er lebhaft und überreichte ihr ein paar Blumen. Es war ein kleines Veilchensträusschen, wie man es an den Strassenecken in Berlin kaufte, ein alltägliches Ding. Er wollte bloss nicht ganz mit leeren Händen kommen. Er lachte selbst dazu. Das war bei ihm selten. Er war verwitwet wie Gabriele. Vor fünf Jahren hatte er seine Frau begraben. Sie schüttelte ihm stumm die Rechte und tat den Strauss in das Glas mit den roten und weissen Rosen, die drüben in der Fensterecke dufteten.
Sein Auge folgte ihr. „Ist denn das Ihr ganzer Geburtstagstisch, gnädige Frau?“ frug er. „So wenig Blumen?“
„Es waren eine Masse da. Ich hab’ sie weggetan!“
„Und meine armseligen paar Rosen von vorhin?“
„Die hab’ ich gelassen! Um die wäre es mịr schade gewesen!“
Eine jähe Röte überflog das männliche, nervöser als bei Frontoffizieren durchgearbeitete Antlitz ihres Besuchers. Er trat auf Gabriele zu. Es schwebte ihm etwas auf den Lippen, es war, als wollte er den Augenblick benutzen. Aber sie liess ihn nicht dazu kommen. Sie setzte sich, bat ihn mit einer flüchtigen Handbewegung, ihr gegenüber Platz zu nehmen, und meinte, so freundlich-höflich, wie sie es gegen jeden anderen auch gewesen wäre: ,,Bitte — machen Sie es sich doch bequem, Herr von Wingerow!“
Er stellte seinen Helm auf ein Taburett, warf die weissen Handschuhe daneben, presste unwillkürlich die Hände auf den Knien ineinander, um seine Aufregung niederzukämpfen, und begann: „Gnädige Frau . . . ist die Frage zu unbescheiden . . . aber ich habe jetzt den Mut dazu . . . darf ich hoffen, dass wir in der nächsten Viertelstunde nicht gestört werden . . .?“
„Es wird niemand kommen! Ich habe ausdrücklich Befehl gegeben!“
Er nickte hastig, beistimmend. Er wurde abwechselnd rot und blass. Es machte sich seltsam bei dem grossen, stattlichen Mann, dem Energie und Selbstbewusstsein aus dem Gesicht sprachen. Die junge Witwe vor ihm blieb ruhig. Ihre schönen grauen Augen musterten ihn gelassen. Sie hatte noch Zeit, sich dabei zu denken: ,Wie er es nur fertig bringt, immer noch tadelloser angezogen zu sein, als andere Offiziere, vom Scheitel bis zu den Lacktiefelspitzen . . .‘
,,Gnädige Frau . . .“ sagte der Major von Wingerow entschlossen. „Heute ist kein Tag wie andere . . . ich meine, für Sie . . . Sie feiern Ihr Wiegenfest . . . Sie haben sich, wie ich mit Freuden sehe, dazu überwunden, endlich die Trauer abzulegen . . .“
„Ich weiss nicht, auf wie lange!“ sagte sie düster.
„Immerhin . . . ich darf in dieser Äusserlichkeit doch wohl nicht nur einen Zufall sehen — sondern ein Zeichen — ein Sinnbild gewissermassen, dass nun manches hinter Ihnen liegt . . .“
Sie hob kühl den Kopf. Ihre Haltung verwirrte ihn. Er sammelte sich.
„Verstehen Sie mich nicht falsch, meine liebe, verehrte gnädige Frau! . . . Es gibt unvergessliche Dinge . . . heilige Schmerzen . . . Das weiss niemand besser als ich . . . ich hab’ es ja selber durchgemacht! Ihnen brauch’ ich nichts zu sagen . . . Uns beiden hat Gott seinen Finger gezeigt . . .“
Es war still zwischen ihnen. Draussen hielt ein Coupé vor der Villa. Die Kommerzienrätin und Gisela stiegen ein und fuhren nach der Stadt zu davon. Der Major von Wingerow beugte sich in seinem Stuhl vor, den Säbel zwischen den Beinen, die Hände auf den Knauf gestützt, einen gespannten Ausdruck in den glänzenden, klugen hellbraunen Augen.
„Nun seh’ ich meine Blumen da auf dem Tisch . . . meine allein . . . das scheint mir ein Geheiss, endlich einmal das Unausgesprochene in Worte zu fassen . . .“
„. . . Sie sind mein Freund, Herr von Wingerow!“ sagte die junge Witwe. „. . . Das wollte ich damit zeigen . . .“
„Ihr Freund?“
Es klang unschlüssig. Er wusste nicht recht, was er daraus machen sollte. Er wollte wieder anfangen, aber sie unterbrach ihn.
„Nein . . . bitte . . . lassen Sie mich reden . . . ich weiss, was Sie sagen wollen . . . aber ich habe Ihnen vorher manches zu erklären . . . ich glaube, ich bin es Ihnen schuldig. Denn Sie sind anders wie die anderen . . . auch für mich. Mit den anderen habe ich gleich reinen Tisch gemacht. Das kommt für mich nicht in Betracht. Ich bin mir selber genug!“
„Und doch steht geschrieben: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei!‘ . . .“
„Es steht auch geschrieben: „Heiraten ist gut, aber Nichtheiraten ist besser!‘ . . . Hören Sie einmal zu, Herr von Wingerow . . . Ich muss Ihnen einiges über meine erste Ehe sagen . . . dann werden Sie begreifen, warum ich so bin, wie ich bin . . .“
Der Major von Wingerow sass straff aufrecht da, mit einem gespannten und gesammelten Gesicht wie beim Empfang eines wichtigen Befehls im Dienst. Seine Rechte spielte nervös mit dem silbernen Portepee am Säbelgriff.
Die junge Witwe fuhr fort: „Ich führte schon als Mädchen mein Eigenleben, sehr beeinflusst von meinem Vater, der nicht nur ausserordentlich musikalisch veranlagt, sondern überhaupt ein ungewöhnlicher Mensch war . . . Ich führe mein Eigenleben auch jetzt. Es war stets meine Sorge, dass es mir in der Ehe genommen werden könne, dass mein Mann mich nicht verstehen würde. Deswegen hatte ich immer den Traum, irgendeinen grossen Künstler oder Komponisten zu heiraten. Nun lernte ich zufällig in einer Gesellschaft meinen künftigen Mann kennen . . . Ein Afrikareisender . . . das dünkte mir anfangs unmöglich!“
Oben von der Wand sah das schnurrbärtige, hagere und energische Antlitz des Dr. Paul Lünhardt auf die beiden hernieder. Es erschien auf den ersten Blick streng und scharf, aber um die Mundwinkel lag ein seltsamer, halb versteckter wilder Humor.
Seine Witwe fuhr fort: ,,Aber es kam der Tag, wo seine ausdauernde, grosse Liebe mich besiegt hatte. Liebe ist eigentlich viel zu wenig. Es war eine Leidenschaft, wie ich nie geglaubt hätte, dass ein Mensch sie dem anderen einflössen könne. Und Gott sei Dank, so ist sie geblieben, bis in seine letzten Stunden! . . . Er, der so viel in der Welt herumgetrieben worden war und so viel durchgemacht hat, hat in mir sein volles Glück gefunden und ich ebenso in ihm. Sicher ist eine Ehe wie die unsere selten, ohne einen Vorbehalt . . . Einer ganz im anderen . . .“
,,Das heisst, Ihr Gatte ist in Ihnen aufgegangen, gnädige Frau!“
Sie zögerte ein wenig mit der Antwort.
„Ich weiss nicht, ob das das rechte Wort dafür ist, Herr von Wingerow! Ich sagte Ihnen ja: As er mir nähertrat, hatte ich anfangs eher Angst vor ihm . . . Angst vor Afrika. Ich kann mich nicht ändern. Man kann nicht von mir verlangen, dass ich mich für Kriegszüge unter den Wilden und Expeditionsgeschichten und Kolonialsorgen interessiere. Aber auf seiner Seite ist das Wunder geschehen, dass er angefangen hat, meine Interessen zu teilen, ganz der Mensch zu werden, den ich mir immer als Lebensgefährten ersehnt hab’, voll Verständnis für mich — für die Kunst — für die Art, wie ich die Dinge anseh’! Ich habe nichts dazu getan! . . . Das geschah alles durch seine Liebe. Mir zuliebe hat er Afrika ganz aufgegeben! Und wie glücklich hat ihn das gemacht, diese Ruhe und dieser Frieden! Und wie glücklich war ich, dass er es war . . . durch mich! . . .. Es war zu viel! Und es ist einem nur einmal im Leben beschieden, solch ein Hand-in-Hand-gehen, in einer Liebe, die alles in einem, von der Freundschaft bis zur Leidenschaft, einfasst! Das kann sich nicht in einem armen kurzen Menschendasein wiederholen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals imstande sein sollte, wirklich noch zu lieben . . .“
„Anderseits — warum soll ich mich vor den Menschen verschliessen?“ fuhr sie fort. „Die Menschen haben mir ja nichts getan! Ich habe mich darum entschlossen, aus meiner Zurückgezogenheit herauszutreten. Und wie das nun einmal das Schicksal für uns Frauen ist, dass wir alles äusserlich dokumentieren müssen, was wir innerlich erleben — unsere Kleider sind nun einmal unsere Aushängeschilder . . . so bin ich heute in einem farbigen Gewand!“
,,Und Sie entsinnen sich vielleicht, gnädige Frau, was ich bei Gelegenheit sagte: ich würde den Tag, wo ich Sie einmal nicht mehr in Trauer sähe, als die Ermutigung zu einer Frage betrachten . . .“
„Bitte — lassen Sie mich ausreden, Herr von Wingerow! Es ist besser! Ich habe mir alles genau überlegt, was ich Ihnen sagen muss! Sie haben Ihre erste Frau geliebt!“
„Sehr!“
„Und doch glauben Sie wieder lieben zu können . . .?“
„Ich tu’ es! . . . Und tu’ damit kein Unrecht!“
„Sehen Sie . . . das begreife ich eben nicht! Mir erscheint ein solcher Gedanke wie eine Entweihung meines Mannes — meiner selbst — und schliesslich — und das ist ja der Grund, weswegen ich mit Ihnen darüber rede — als ein Unrecht an einem Dritten . . . ich habe das Gefühl, dass ich Ihnen allein Rechenschaft schuldig bin — nach der Art, wie wir seit einem Jahr miteinander stehen. Wenn überhaupt, dann wären nur Sie der Mann, zu dem ich Zutrauen und Achtung empfinden könnte . . .“
„Gnädige Frau . . .“
„. . . Wenn es mir eben möglich wäre, mit der Liebe zu einem Toten im Herzen einem Lebenden die Hand zu reichen! Andere mögen ja so etwas können! Mir scheint es Verrat an allem!“
„Es würde schon gehen, gnädige Frau!“
Sie schüttelte den Kopf.
„Vergessen Sie nicht, wie ich vom Schicksal verwöhnt worden bin! Wie sollte ich wieder auf der weiten Welt einen Menschen finden, der so ganz auf mich und mein innerstes Wesen eingeht, wie es mein Mann tat? Sie haben Ihren Beruf und können und werden ihn nicht missen! Ein jeder hat ihn. Er hat seinen Beruf an den Nagel gehängt, wenn man das Umherwandern in Afrika überhaupt Beruf nennen will — und hat nur mir gelebt. Das Opfer hat sich ihm und mir überreich gelohnt. Er hat es nie eine Sekunde lang bereut, sondern den Tag gepriesen, an dem er es brachte. Aber das kann nur einmal geschehen! Es müsste so viel Hohes und Heiliges in mir zerstört werden — gerade das, was mir die Kraft zum Weiterleben und eine gewisse Ruhe gegeben hat — ehe da etwas Neues entstünde — und Gott weiss was! . . . Auch die vernünftigste Vernunftehe ist immer ein grosses Wagnis . . . und eine Sünde wider den heiligen Geist . . .“
Ein Lächeln überflog ihr schönes blasses Gesicht. Sie streckte die Hand aus.
„Und darum, lieber Herr von Wingerow — lassen Sie uns Freunde sein — ein für allemal — wenn Sie es können! . . . nicht mehr . . .“
Er legte zögernd und widerstrebend seine Rechte in die ihre. Sie merkte, dass seine Fingerspitzen ganz kalt waren. Doch im Gesicht bewahrte er die Selbstbeherrschung.
„Sie sagen, Sie wollen in das Leben zurück, gnädige Frau!“ versetzte er trocken. „Wie denken Sie sich das? Glauben Sie, dass eine beliebige Anzahl anderer Menschen Ihnen wirklich da auf die Dauer viel sein können?“
„Ich verlange von den einzelnen nicht viel — nur eine Seite ihres Wesens — das, was sich mit meinen künstlerischen Neigungen deckt, die ich nicht gut allein pflegen kann. Ich bin an sich eine gesellige Natur. Ich finde schon meinen Kreis nach aussen hin, so dass ich mich nicht allein fühle. Und nach innen — das habe ich Ihnen ja erklärt. Da will ich ja allein sein — mit meinem lieben Mann . . .“
Der Major von Wingerow hatte sich rasch und brüsk erhoben, dass Säbel und Sporen klirrten. In seiner stattlichen Länge stand er vor der jungen Witwe.
„Dies Gefühl ehrt Sie, gnädige Frau!“ sagte er gedämpft. „Möchte es sich nur nicht eines Tages an Ihnen rächen! . . . Man kann seiner Trauer auch zu viel zumuten!“
„Ich nicht!“
„Jetzt vielleicht nicht! Aber kein Mensch bleibt, wie er ist!“
„Das weiss ich nicht! . . . Davon kann ich jetzt meine Entschlüsse nicht abhängig machen! . . . Ich kann nur so Handeln, wie ich in dieser Stunde bin und mich fühle! Und da kann ich nur immer wieder sagen: Ich habe zu Tiefes erlebt! . . . Ich kann es nicht eintauschen gegen das, was viele andere auch erleben! . . . Damit gebe ich mich selbst preis! Und ich halte etwas von mir, Herr von Wingerow!“
Ihr Besucher hatte Helm und Handschuhe in die Rechte genommen. Mit der Linken hielt er den Säbel, so dass er Gabriele nicht die Hand zu geben vermochte.
„Ich bin mit anderen Hoffnungen gekommen, gnädige Frau!“ sagte er. „Aber das alles steht ja freilich bei Ihnen! Ich danke Ihnen ehrerbietig für Ihr Vertrauen! Und nun gestatten Sie mir, mich aus Ihrem Hause zu beurlauben!“
„Sie wollen wirklich nicht wiederkommen?“
„Dann, gnädige Frau, wenn ich ein Zeichen von Ihnen erhalte, das mich Besseres hoffen lässt als heute! . . . Dann bin ich sofort zur Stelle! . . . Ich werde warten!“
Sie schüttelte stumm den Kopf.
„Doch, gnädige Frau — ich werde warten! . . . Und trotz Ihrer Worte sagt mir meine Ahnung: ,nicht umsonst!‘“
,,Lassen Sie nur inzwischen das Glück nicht an sich vorübergehen, lieber Herr von Wingerow!“
„Ich kenne nur eines . . .“
Der Major von Wingerow verbeugte sich auf der Schwelle und wandte sich um. Die Türe schloss sich hinter ihm.
2
Einige Zeit nach dem Major von Wingerow verliess auch Gabriele Lünhardt ihr Haus. Sie machte regelmässig in den ersten Nachmittagsstunden einen einsamen Spaziergang in den letzten, zwischen Spreekanal und Neuen See gelegenen Teilen des Tiergartens. Dies Bedürfnis des zeitweiligen Alleinseins mit sich hatte sie immer gehabt, auch während ihrer Ehe. Sie war eigentlich nicht gern in Berlin. Aus dem Gesellschaftstreiben und Nerbengehetze der Weltstadt machte sie sich, in ihrer ruhigen, gleichmütigen Art, nichts. Sie schätzte daran nur die Opern, die Konzerte, die Musikabende daheim, diese künstlerischen Genüsse, die man anderswo nicht haben konnte. Sonst hätte sie lieber auf dem Lande gelebt, in der freien Natur, in die man sich hineindenken, aus der man sich herausnehmen konnte, was gerade der augenblicklichen Seelenstimmung entsprach. Dann war zwischen ihr und der Welt ein Zusammenhang, wie zwischen Bild und Rahmen, so auch jetzt, hier an der Grenze von Häusermeer und Waldstille, im kühlen Hauch des Herbstes.
Sie war gar nicht gedrückt oder erregt. Sie schritt frei und leicht, schlank aufgerichtet ihres Wegs, auf dem sie schon längst jedes Brückchen und jede Bank kannte. Sie liebte dies Gewohnheitsmässige in ihrem Tun. Es war das etwas Philiströses in ihr, über das sie selbst lächelte. Ihr Gesicht war gleichmütig, trotz der ernsten
Aussprache von vorhin. Sie atmete ruhig im raschen Gehen die frische, herbe Luft ein. Sie lebte eigentlich sehr gern, auch nach dem bitteren Verlust, der ihr Dasein geknickt hatte. In diesem war nun wenigstens die Ruhe. Man hatte das Schwerste überstanden. Die Sorgen, Nöte, Kümmernisse, die andere Menschen quälten, lagen endgültig hinter einem, die konnten nicht wiederkehren. Der Tod hatte einen Riegel davor geschoben.
Freilich dachte sie sich auch jetzt wieder ein paarmal: ,Heute bin ich siebenundzwanzig geworden. Für viele fängt da das Leben erst an!‘ Dann schien es ihr selber unwahrscheinlich und unbegreiflich, dass das immer so weitergehen könne. Es musste einmal etwas dazwischen treten. Die Zeit, die noch vor ihr lag, war noch viel zu lang. Aber sie vermochte sich nicht vorzustellen, wie das kommen könnte. Es war nichtig, über Möglichkeiten des Schicksals zu grübeln. Sie gestand sich schliesslich auch ehrlich: ,Ich bin feige geworden! Das Schicksal hat mir zu weh getan! Ich will keine weiteren Berührungen. Ich zittere davor. Ich möchte bleiben, wie ich bin. Schmerzlosigkeit ist auch mir gut.‘
Sie dehnte heute ihren Spaziergang weiter als sonst aus. Es war schon nach vier Uhr, als sie jugendlich frisch, mit geröteten Wangen, von der Luft belebt, in den Vorgarten ihrer Villa trat. Im Hause war zur Rechten der Halle ein Garderobenraum. Da hing zu ihrem Erstaunen ein dickwattierter, dunkler Herrenpaletot, wie man ihn wohl im strengen Winter, aber nicht jetzt im Frühherbst trug. Darüber ein starkes, weissseidenes Cachenez. Ein Paar schwere Gummigaloschen standen am Boden. Welchem Nordpolfahrer gehörte denn das? Es waren doch nur Damen im Hause. Sie frug den Diener, und der erwiderte, verwirrt durch ihren strengen Blick: „Jawohl, gnädige Frau! . . . Der Herr sitzt im blauen Salon!“
„Welcher Herr?“
Der Diener wusste nicht Bescheid. Das Mädchen hatte die Karte angenommen. Sie erschien aus dem Souterrain herauf.
„Der Herr hat bestimmt erklärt, er wäre zur Teezeit bestellt!“ sagte sie verlegen. „Da glaubte ich . . .“
„Durch wen denn bestellt, um Gottes willen?“
„Durch den Herrn Hauptmann Bankholtz. Der habe es ihm heute mittag im Auftrag der gnädigen Frau ausgerichtet . . .“
Die junge Witwe nahm die Karte, die auf dem silbernen Tablett lag. Sie las:
„Werner Freiherr von Ostönne
Plantagendirektor
Deutsch-Ostafrika.“
„Mein Gott . . . hat der Eile!“ sagte sie unwillkürlich vor sich hin. Er musste sich gleich nach dem Frühstück mit ihrem künftigen Schwager umgezogen haben und hierhergefahren sein.
„Richtig! Ich hatte ganz vergessen!“ sagte sie zu dem Diener. „Es stimmt schon! Bitten Sie den Herrn, noch einen Augenblick zu warten!“
Als sie fünf Minuten später mit leichten, auf dem dicken Teppich kaum hörbaren Schritten in den Salon trat, entdeckten ihre schönen, grauen, etwas kurzsichtigen Augen erst nach ein paar Sekunden den Besucher. Er sass, auf ein Taburett geduckt, fröstelnd vor dem Kaminfeuer und rieb sich über der schwachen, eigentlich nur für das Auge bestimmten Kohlenglut die Hände. Wie sie dicht hinter ihm war und er sie im Spiegel sah, sprang er rasch empor und verbeugte sich. Er trug schwarzen Besuchsrock und scharf in die Falte gebügelte taubengraue Beinkleider. Es war alles, wie es sich gehörte. Und doch machte er einen exotischen Eindruck. Sein Gesicht war sonnenbraun, finster, mit einem dunklen Schnurrbart. Von ebensolcher Farbe sein Haar. Gabriele wusste, dass er ungefähr dasselbe Geburtsjahr wie ihr verstorbener Mann haben musste. Aber er sah älter aus. Er war hager gewachsen, mittelgross, mit sehr breiten Schultern und starkem Brustkasten.
„Verzeihung, gnädige Frau!“ sagte er. „Ich fror hier ein wenig. Ich friere immer, seitdem ich in Deutschland bin! . . . Wenn man so lange unter dem Äquator war . . .“
Daher die Wintersachen im Flur! . . . Der Fremde machte nicht viel Umstände. Es schien ihr, als habe er einen beinahe brutalen Zug der Rücksichtslosigkeit um die Lippen. Er gefiel ihr nicht. Aber sie lächelte höflich-kühl und sagte: „Kommen Sie, Herr von Ostönne . . . wir wollen uns recht nahe an das Feuer setzen, damit Sie die Sonne Afrikas nicht zu sehr entbehren! . . . So . . . Sie bekommen auch gleich Tee . . .“
Gabriele Lünhardt hatte, liebenswürdig wie sie von Natur war, leicht etwas in Sprache und Gesichtsausdruck, was wie vertraulich aussah — auch weniger nahen Bekannten gegenüber. Es klang dann, als redete sie mit einem guten Freund, und wurde so aufgefasst, auch wenn sie es gar nicht so meinte. Aber Herr von Ostönne zeigte keine Spur von Verbindlichkeit. Er räusperte sich nur — er war offenbar stark erkältet und vielleicht klang seine Stimme deswegen so rauh, als er kurz sagte: „Danke sehr!“
Dann schwieg er und sah sie unverwandt, sonderbar prüfend an. Sie dachte sich: „Komischer Kauz! . . . Wenn er auch ein früherer Offizier und Freiherr ist — man merkt doch, dass er lange draussen im Urwald war!‘ Sie begann, konventionell, wie eine Dame die Unterhaltung mit einem Besucher einleitet: „Sie sind schon länger zurück, Herr von Ostönne?“
„Seit vorgestern abend!“
„Und da sind Sie gleich zu mir?“
„Ja. Das ist mir sehr wichtig!“
Wieder eine Pause. Sie ärgerte sich über die starre Art, mit der sein Blick an ihr hing.
„Und gedenken Sie lange in Deutschland zu bleiben?“
„Die Frage legt mir jeder hier vor! Die scheint unvermeidlich! . . . Ich kann nur antworten: Ein Vierteljahr wird man mich wohl ertragen müssen! Dann gehe ich wieder hinüber . . .“
Sie war unter seiner Unhöflichkeit zusammengeschreckt. Sie dachte sich: ‚Da hat mein Mann ja einen netten Busenfreund gehabt! Da könnte er nun sehen, wie die Leute drüben verwildern! Er war selber auch schon auf dem Weg dazu, wenn ich ihn nicht zurückgehalten hätte . . .‘ Merklich frostiger frug sie: „Da sind Sie wohl in Geschäften in Berlin?“
„Ja. Ich will mein Plantagenunternehmen vergrössern. Endlich fängt die Geschichte an, zu gehen. Namentlich der Hanfbau schlägt ein!“
„Das ist ja sehr schön!“
Gabriele Lünhardt hatte keine Ahnung, dass in Ostafrika Hanf gedieh. Es interessierte sie nicht im geringsten, was man da drüben trieb. Darum fand sie auch so schwer eine Anknüpfung für ein Gespräch.
„Sie waren von Hause aus Artillerist, sagte mir mein Mann einmal . . .“
„Jawohl!“
„Und dann in der Schutztruppe?“
„Jawohl!“
„Da haben Sie sich dann dem Zivilberuf als Plantagenleiter zugewandt?“
„Jawohl! Vor sieben Jahren . . .“
„Und diese ganze Zeit haben Sie sich keinen Urlaub gegönnt?“
„Nicht eine Stunde, sonst wäre der Karren stecken geblieben! Man muss bei der Stange bleiben, wenn man sich einmal etwas vorgenommen hat!“
Er sagte das sonderbar hart und feindselig und schwieg mit einem kurzen, verächtlichen Achselzucken. Gabriele wusste nicht recht, wem das galt. Der Ärger stieg immer mehr in ihr empor. Wozu war dieser Afrikaner eigentlich gekommen, wenn er nur dasass und sich die Antworten silbenweise herausquetschen liess? Sie wurde nicht klug aus ihm, aber immerhin, diesem einstigen Intimus ihres verstorbenen Mannes war sie jede Rücksicht schuldig. Sie nahm sich zusammen und forschte weiter: „Sie haben wohl eine Menge Bekannte hier?“
„Gott . . . ja . . .“
„Und Angehörige?“
„Meine alte Mutter!“
Es war keine Unterhaltung in Gang zu bringen. Sie versuchte noch einen Anlauf.
„Da sind Sie also immer noch nicht verheiratet, Herr von Ostönne?“
„Nein!“
Nun wusste sie nicht mehr, was mit dem steinernen Gast anfangen. Den schien das Schweigen zwischen ihnen nicht zu stören. Er hing seinen Gedanken nach und sagte endlich: „Ich hab’ jetzt nach Europa zurück müssen! . . .“
„Ihrer Gesundheit wegen?“
„Die ist in Ordnung! . . . Aber es ist hier so dummes Gerede über mich im Umlauf . . . Sie haben jedenfalls auch davon gehört . . .“
Es schwebte Gabriele Lünhardt dunkel vor, dass sie unlängst in einer Zeitung etwas überflogen hatte, was sich auf ihren Besucher bezog. Was, war ihr entfallen. Es hatte sie nicht interessiert.
Er fuhr fort: „Aber ich werde der Bande das Vergnügen versalzen! Alles Schwindel! Dabei acht Jahre her. Damals war Paul noch mit mir in Afrika!“
Paul . . .! Sie sah befremdet auf. Dann begriff sie, dass er ihren Mann meinte. Über den hätten sie überhaupt von vornherein sprechen sollen — sie dachte es sich im stillen — dann wäre ihr Zusammensein nicht so sonderbar feindselig wortkarg ausgefallen. Er war ja das einzige Bindeglied zwischen ihnen beiden. Aber Gabriele Lünhardt hatte nicht von ihm angefangen — aus einer Scheu und Abwehr, die sie jedesmal gegen seine früheren Gefährten überkam. Diese Leute aus Afrika hatten vor ihr sein Leben mit ihm geteilt. Diese Eifersucht war ja grundlos — sie hatte ihn ja schliesslich gehabt — aber trotzdem: es kostete sie immer eine Überwindung . . .
Gerade diesem braungebrannten, ein paarmal rätselhaft und düster vor sich hin lächelnden Mann gegenüber. Sie wusste nicht, was er im Schilde führte. Sie blickte ihn misstrauisch an. Er hatte noch etwas vor. Warum harrte er sonst so stumm und steif auf seinem Sessel aus? Da kam endlich der Tee. Es war eine Erlösung. Sie machte die Tassen zurecht und reichte ihm eine, während der Diener wieder ging. Er führte sie an die Lippen, setzte sie aber sofort wieder ab und frug unvermittelt: „Paul ist hier im Hause gestorben?“
Wieder fühlte sie einen Stich bei dem Wort: Paul. Aber sie zwang sich, freundlich zu antworten.
„Nicht hier, Herr von Ostönne! . . . Er hatte den schrecklichen Fehler begangen, dass er gar nicht auf die ersten bedrohlichen Symptome achtete — er als früherer Arzt! . . . aber er war doch immer so sorglos mit sich, ritt noch aus, obwohl er schon starke Schmerzen hatte. Mittags wurde es ganz schlimm . . . abends brachten wir ihn in die Klinik . . . aber es war zu spät . . .“
Die junge Witwe atmete schwer auf und legte die Hände im Schoss zusammen. „Ich habe Ihnen das übrigens ja alles seinerzeit nach Afrika geschrieben!“ sagte sie.
„Wenigstens das meiste!“
„. . . Also haben Sie den Brief bekommen?“
„Ja. Aber nicht beantwortet! Es gibt Sachen — die kann man nur sagen . . . geschrieben machen sie sich schlecht . . . ich habe lieber damit gewartet, bis mich mein Weg wieder einmal nach Europa herüberführte! Nun war ich ohnedies dabei, um dieser Ehrabschneiderbande, die sich hier gegen mich etabliert hat, das Handwerk zu legen . . .“
Er stellte die Teetasse, die er immer noch unberührt in der Hand hielt, vor sich auf den Tisch. Sie sah etwas Versonnenes, in sich Gekehrtes in seinen schwarzen Augen. Die Wildnis draussen hatte ihn, allein unter seinen Negern, das Schweigen gelehrt. Er hob den Kopf zu dem Bild seines Freundes hinauf. Dann schaute er wieder dessen Witwe an. Und diesmal so kalt und schonungslos, dass es ihr graute. Sie sagte, mit der Selbstbeherrschung einer Frau von Welt: „Man macht sich hinterher natürlich die verzweifeltsten Vorwürfe! Hätte man am Ende doch operieren sollen? . . . Wäre das besser gewesen? . . . Es haben mich ja freilich alle Autoritäten beruhigt. Es wäre doch so gekommen, so oder so . . .“
„Nein — die Ärzte haben ihn nicht umgebracht!“ versetzte Werner von Ostönne.
„Nicht wahr? . . . das sage ich mir auch immer!“ „Sondern Sie selber, gnädige Frau . . .“
Das Teezeug klirrte. Gabriele Lünhardt war jählings aufgesprungen. Sie traute ihren Ohren nicht. Sie starrte ihren Besucher an. War er am Ende wahnsinnig? Hatte er den Tropenkoller von drüben mitgebracht? Ihre erste Regung war, auf den Klingelknopf zu drücken. Aber sie hielt an sich.
„Was sagen Sie?“ frug sie, immer noch atemlos vor Schrecken.
Er war gleichgültig sitzen geblieben.
„Ich sage, dass Paul nicht an irgend solch einer zufälligen, dummen Geschichte gestorben ist, sondern an Ihnen!“
Das kam klar und langsam zwischen seinen wessen Zähnen unter dem dunklen Schnurrbart hervor. Sie trat vor ihm zurück. Sie konnte nur wiederholen: „. . . an mir . . . gestorben . . .? Ich glaube, Sie sind verrückt . . .“
Nun hatte auch er sich erhoben.
„Gott . . . Ich bin’s nicht mehr als andere . . .“ sagte er. „Jedenfalls nicht ärger, als es Paul in seiner letzten Zeit war . . .“
Die junge Witwe fuhr sich mit der Hand über die Augen.
„Ich weiss immer noch nicht, ob ich wache oder träume . . .“ versetzte sie. „Da steht jemand und behauptet mir ins Gesicht, ich hätte . . . bitte . . . Herr von Ostönne . . . dort drüben liegt Ihr Hut . . . wollen Sie ihn sofort nehmen und Ihrem Besuch ein Ende machen . . .“
Er achtete nicht auf ihre Worte, sondern kam auf sie zu.
„Herr von Ostönne . . . Sie haben gehört . . . zwingen Sie mich nicht zu einem Auftritt vor der Dienerschaft . . .“
„Ach . . . lassen Sie doch Ihre Leute unterwegs!“ Er zuckte die Achseln und blieb stehen. „Wenn ich sage ‚umgebracht‘, so meine ich damit natürlich nicht, dass Sie ihm Rattengift in die Suppe getan haben! An die Blinddarmentzündung glaube ich! Aber der Mensch hat auch eine unsterbliche Seele . . . sozusagen sein besseres Teil . . . was hat denn Paul in diesem Hause damit angefangen? Wo ist denn die hier schliesslich geblieben? . . . he?“
Er frug es herausfordernd. Sie bebte am ganzen Leibe vor Empörung.
„Ich begreife nicht, woher Sie den Mut nehmen, so zu mir zu reden! . . . Ich kann nur glauben, dass Sie in den Tropen zuviel an Gesundheit und Erziehung zugesetzt haben. Aber nun ist’s genug!“
Er überhörte das wieder. Er meinte: „Sie bedauerten doch eben, dass ich Ihnen auf Ihren Brief nicht geantwortet habe. Nun bringe ich Ihnen die Antwort persönlich. Die müssen Sie hören. Sie würden ja doch keine Ruhe haben, wenn ich jetzt ginge, ohne weitere Erklärung . . . Sie würden sich hinterher den Kopf darüber zerbrechen! Denn ich glaube wirklich, wie ich Sie jetzt so vor mir sehe: Sie sind ganz ahnungslos! . . . Sie begreifen noch gar nicht, was Sie für eine Schuld auf sich geladen haben . . .“
Vor Gabriele Lünhardt drehte sich das Zimmer im Kreise. Sie konnte kaum herausbringen: „Was haben Sie für ein Recht, so mit mir zu sprechen . . .?“
„Als Pauls Freund! Das war keine Freundschaft, wie wenn sie hier auf der Bierbank Schmollis machen . . . wir haben uns als Männer getroffen . . . draussen . . . wo man bald weiss, was ein Mann wert ist, das war wie eine Blutsbrüderschaft!“
„Und daraus leiten Sie die Mission her, mich nach Jahren hier zu beleidigen?“
Er liess sich nicht beirren.
„Ein Mann ist dazu da, dass er auf der Welt nach aussen hin etwas vor sich bringt! Das wollten wir beide, Schulter an Schulter. Ich hatte mein Leben darauf aufgebaut, nach schweren Enttäuschungen, die mir widerfahren waren. Wir hatten gemeinsam das Stück Urwald in Angriff genommen, aus dem inzwischen meine Plantage entstanden ist. Die Arbeit war viel zu viel für einen einzigen Mann. Es musste sich einer auf den anderen verlassen. Kaum aber hatten wir angefangen, so ging Paul vor sieben Jahren, um mehr Geld aufzutreiben, auf ein Vierteljahr nach Europa, und kam nicht wieder, sondern blieb bei Ihnen. Und ich konnte schauen, wie ich allein mit allem fertig wurde.“
Es war nicht Gabriele Lünhardts Absicht gewesen, überhaupt noch mit ihrem Gast zu sprechen. Sie stand da, zitternd vor Zorn, und wartete nur, bis er zu Ende sein und freiwillig gehen würde. Aber angesichts seiner letzten Ungerechtigkeit konnte sie sich nicht enthalten, zu erwidern: „Hat er sich Ihnen denn etwa verschrieben, mit Leib und Seele? . . . Er hat hier eben Besseres gefunden! . . . Er hat sein Glück gefunden! . . . Es war ein Zufall, dass er und ich uns trafen — aber dann war er auch entschieden! . . . Von da ab gehörte sein Leben mir und nicht mehr Ihnen! Und im übrigen . . . Sie sagten, er habe hier Geld aufbringen sollen! Hat er Ihnen denn nicht reichlich Geldmittel zur Verfügung gestellt, auf meinen eigenen Wunsch?“
„Ich hab’ sie aber nicht genommen! . . .“
„Warum nicht?“
„Weil sie von Ihnen kamen! . . .“
Seine gelassene Todfeindschaft erfüllte sie mit Grauen. Das war ihr noch nie widerfahren im Leben, dass jemand sie so hasste! . . . Sie dachte sich: ,Er wird mir doch nicht plötzlich an die Gurgel springen oder ein Messer hervorziehen? Fähig scheint er zu allem! Und warum ist er denn eigentlich überhaupt hier, wenn er mich so verabscheut? Er muss doch einen Grund haben! . . .ʻ Dann versetzte sie kühl, unwiderruflich dem Gespräch ein Ende zu machen: „Das sind geschehene Dinge. Der Tod ist dazwischen. Wir haben keine Macht mehr, etwas zu ändern! Also beruhigen Sie sich! Sie müssen sich doch selber sagen, dass einem Mann die Frau mehr ist als der Freund. Sie hätten im gleichen Fall genau so gehandelt . . .“
„Ich beklage auch nicht, dass ich meinen Freund verloren habe, sondern dass er sich verloren hat!“
„. . . sich verloren hat!“
„Mit Haut und Haar! Und das darf ein Mann nicht! Er soll schaffen . . . schaffen . . .“
Auf einmal verstärkte er seine bis dahin gedämpfte Stimme: “Aber da lebt ein Herr in Berlin — reitet spazieren — läuft in Gesellschaften — sitzt in der Oper — kurzum, stiehlt unserem Herrgott nach Noten den lieben langen Tag — und das ist Paul Lünhardt — mein Paul Lünhardt, der wirklich einmal etwas Gutes und Nützliches war und tausendmal zu schade dafür, Ihren Schleppträger zu machen . . .“
„Herr von Ostönne! Jetzt ist aber meine Geduld zu Ende! . . .“
„Ein ganzer Kerl war er da drüben! Ein Deutscher von dem Schlag, der uns so bitter nottut . . . und der hält Ihnen nun das Strickgarn!“
„Herr von Ostönne: Sie waren doch früher Offizier! Ich weiss wirklich nicht, wo Sie Ihre Erziehung gelassen haben!“
„Meinetwegen draussen im Vorzimmer. Auf schöne Worte kommt’s jetzt nicht an! . . . Mein armer Paul! . . . Dies verfluchte Drohnenleben! Und nichts dagegen zu machen! Er blieb nun mal hier im warmen Nest. Ich verachte die Leute, die zu was Besserem geboren sind und sich dann von ihrer Frau durchfüttern lassen!“
Sie richtete sich empört auf. „Das . . . das sagen Sie von meinem Mann?“ stammelte sie.
„Ist’s denn nicht wahr? Er hatte nichts . . . seine paar Kröten waren auf den Forschungsreisen draufgegangen und Sie . . .,“ er streifte mit einem spöttischen Rundblick die kostbare Wohnungseinrichtung, “Sie sind doch reich! . . . Sehr sogar! Man sieht’s! Ich hab’s ihm seinerzeit geschrieben: Eine reiche Heirat — das ist der Traum von Barbiergesellen! . . . Ein Mann erwirbt! Der lässt sich nichts schenken!“
„Wenn Sie ihn deswegen verachten, dann haben Sie ihn nie gekannt! Als ob es Berechnung gewesen wäre, dass er mich geheiratet hat, und nicht reinste Liebe . . .“
„Das weiss niemand besser als ich!“





























