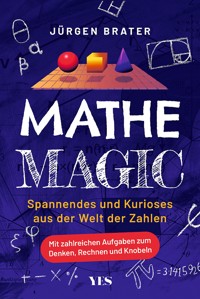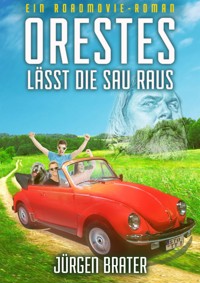10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hubertus Humpff ist sechsundsiebzigeinhalb Jahre alt und seit elf Jahren mit seiner zweiten Frau Hulda verheiratet. Und obwohl sich die beiden im Grunde gut verstehen, gibt es zwischen ihnen doch so manche Reiberei. Immer häufiger finden sie sich in Situationen wieder, die es so früher nicht gegeben hätte. So steht Hubert schlimme Ängste aus, wenn seine Frau mit seinem Uralt-Mercedes über die Autobahn rast, Hulda hat sich angewöhnt, das Wechselgeld beim gemeinsamen Einkauf stets centgenau abzuzählen, Hubert versucht, das gemeinsame Liebesleben mithilfe von Tabletten anzukurbeln, und beide trauen sich nicht, dem jeweils anderen zu sagen, dass sie in einem eigenen Bett viel besser schlafen würden. In diesem Buch erzählt Jürgen Brater von den Tücken des Seniorendaseins und den herrlich schrägen Momenten einer nicht mehr ganz jungen Beziehung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hubertus Humpff mit
JÜRGEN BRATER
LIEBLING,hast du meineZähne gesehen?
Hubertus Humpff mit
JÜRGEN BRATER
LIEBLING,hast du meineZähne gesehen?
Aus dem Alltag eines nichtmehr ganz jungen Paares
riva
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Originalausgabe
2. Auflage 2022
© 2019 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
D-80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Petra Holzmann
Umschlaggestaltung: Isabella Dorsch
Umschlagabbildung: shutterstock.com/oneinchpunch, Christopher Elwell
Satz: Helmut Schaffer, Hofheim a. Ts.
ISBN Print 978-3-7423-0912-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-0576-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-0577-7
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter: www.m-vg.de
Inhalt
Vollsenior mit H
Auf der Straße
Dr. House sei Dank
Spiegeleier-Bauch
Kluger Körper
Sich bewegen bringt Regen
Sidestep, Liegetritt
Angenehme Ruhe
Nervige Marotten
Einkaufen kann so schön sein
Ein Abend mit Freunden
Der 90. Geburtstag
Dame mit Dackel
Auf der Golden Age
Aktiver Demokrat
Aller Ehren wert
Tibetanische Grunzochsen
Blaues Wunder
Ein Locus nach dem anderen
Dem Gedächtnis Beine machen
Das Teufelsding
Miteinander
Klassentreffen
Little risk, much fun
Totenmesse
Was sich liebt …
Vollsenior mit H
»He, lasst doch mal den Opa durch!«
Dieser schlichte Satz, von einem Halbwüchsigen auf einem überfüllten Bahnsteig seinen Altersgenossen zugerufen, war für mich der endgültige Beweis: Ich war definitiv zum »Vollsenior« geworden.
Was das ist? Nun, es gibt Deppen – und deren verschärfte Ausprägung, die Volldeppen. Das ist wie bei den Pfosten und Vollpfosten. Und eben auch bei den Senioren. Zu denen gehört man spätestens mit 65. Und hat man dann die 75 erreicht, ist man – ob es einem nun passt oder nicht – eben ein Vollsenior. Man könnte auch »Erzsenior« sagen. So wie »Erzbischof«, »Erzengel« oder »Erzgauner«. Aber das missfällt mir mindestens so sehr wie »Greis« – obwohl ich mir vollkommen bewusst bin, dass Angehörige meiner Altersgruppe noch zu Zeiten meiner Eltern und vor allem Großeltern so genannt wurden. Da klingt doch »Vollsenior« wesentlich sympathischer.
Doch erlauben Sie mir zunächst einmal, dass ich mich vorstelle. Das hat man in meinem Alter nämlich verinnerlicht, das haben einem die Eltern seit früher Jugend wieder und wieder eingetrichtert: Man stellt sich jemandem, mit dem man es zum ersten Mal zu tun hat, formvollendet vor. Macht heutzutage ja kaum noch jemand. Wird meine Enkelin Hilaria zum Beispiel bei einem Familienfest mal wieder von einem neuen Freund begleitet, bequemt sie sich, wenn sie mich sieht, allenfalls zu einem knappen »Das ist mein Opa«, wobei sie mit dem Kopf kurz in meine Richtung nickt. Woraufhin der junge Mann mit ziemlicher Sicherheit »Hallo« murmelt. Oder vielleicht auch nur »Hi«. Mehr jedenfalls nicht.
So etwas hat es in meiner Jugend nicht gegeben. Da hätte man dem Älteren mit einer tiefen Verbeugung – seinerzeit Diener genannt – beziehungsweise als Mädchen mit einem Knicks die Hand gereicht und etwas in der Art gesagt wie: »Guten Abend. Mein Name ist Sowieso Sowieso. Ich bin der Freund oder die Freundin Ihrer Enkelin oder Ihres Enkels …« Dazu noch ein paar ergänzende Worte zu Herkunft und Eltern. Aber heute! Mehr als ein genuscheltes »Hallo« oder »Hi« ist bei den jungen Leuten nicht mehr drin.
Aber lassen wir das. Ich stelle mich Ihnen jetzt jedenfalls so vor, wie es sich gehört. Also, mein Name ist Hubertus Heinrich Humpff. Wobei ich das -us von Hubertus und den Heinrich nur beim Ausfüllen offizieller Dokumente und merkwürdigerweise auch beim Buchen von Flugtickets verwende. Weil das eben so Vorschrift ist. Sonst heiße ich einfach Hubert. Hubert Humpff. Ich bin 76 1/2 und habe bis vor elf Jahren auf dem hiesigen Humperdinck-Gymnasium Deutsch und Geschichte unterrichtet. Dort, genauer gesagt bei meiner Abschiedsfeier, habe ich meine jetzige Frau – es ist schon meine zweite – kennengelernt. Na ja, gekannt habe ich sie natürlich schon vorher, schließlich war sie die Leiterin des Schulsekretariats. Aber bei besagter Feier und vor allem in der Zeit danach sind wir uns – wie sagt man so schön? – nähergekommen. Und ein knappes Jahr später waren wir ein Ehepaar.
Wesentlich vereinfacht wurde das für mich durch die Tatsache, dass sie Hulda heißt. Dazu müssen Sie wissen, dass ihr Vater Pfarrer war und seine drei Kinder allesamt nach irgendwelchen obskuren Bibelgestalten benannt hat. Ich kenne mich da nicht so aus. Der Name Hulda hat jedenfalls den entscheidenden Vorteil, dass er mit H beginnt. So wie meiner und der meiner ersten Ehefrau Henriette, genannt Henni. Mit vollem Namen hieß meine jetzige Frau vor unserer Ehe Hulda Rümeling-Dumpf. Rümeling war ihr Mädchenname und Dumpf derjenige ihres ersten Ehemannes. Deshalb hat sie kurz erwogen, künftig Hulda Rümeling-Dumpf-Humpff zu heißen, doch das klang ihr dann doch zu abgehoben. So hat sie schweren Herzens sowohl auf den Rümeling als auch auf den Dumpf verzichtet und sich für den schlichten Namen Hulda Humpff entschieden.
Doch noch mal kurz zurück zu Henni. Weil sie und ich die zwei Anfangs-H in Hubert und Henriette seinerzeit als gutes Omen für eine glückliche Beziehung werteten, haben wir auch unseren Kindern Hannes und Hanna ein identisches Initial auf ihren Lebensweg mitgegeben. Das hat sie offenbar so geprägt, dass sie sich, als sie begannen, sich nach einem Lebenspartner umzusehen, ebenfalls nur Hs in die engere Auswahl zogen. So hat Hanna – sie ist mittlerweile 48 – nach etlichen Beziehungen mit diversen Herberts, Hugos und einem Hakim schließlich einen Herwig geehelicht. Von dem hat sie sich nach der Geburt der Töchter Hilaria und Helmine allerdings ziemlich schnell wieder getrennt und ist seitdem alleinerziehende Mutter zweier heute 19 und 17 Jahre alter Mädchen.
Und Hannes? Der hat während eines längeren Aufenthalts in England seine Frau Helen kennengelernt, die ihm zwei Söhne, den mittlerweile 14-jährigen Horatio und als Nachzügler den nun siebenjährigen Harvey, geschenkt hat. Da lebten sie aber schon eine ganze Weile wieder in Deutschland, wo Hannes als Physiotherapeut und Helen als Englischlehrerin an einer Realschule tätig ist.
Meine erste Frau, Henni, hat leider schon mit 62 Jahren das Zeitliche gesegnet, nachdem ihr ein Gehirntumor die letzten Jahre zur Hölle gemacht hatte. Drei Jahre später war dann besagte Abschiedsfeier, und seither sind Hulda und ich ein Paar. Sie ist erst 73, also noch recht jung. Deshalb kann sie manches, was mich bewegt oder mir Sorgen macht, nicht verstehen. Selbst wenn ich mit erhobenem Zeigefinger sage: »Warte nur, bis du in mein Alter kommst«, macht sie das nicht einsichtiger. Aber was soll’s.
Womit ich mir den lieben langen Tag die Zeit vertreibe? Nun, zum einen lese ich gerne, vorzugsweise deutsche Romantiker. Heinrich Heine hat es mir besonders angetan. Kein Wunder, bei dem Namen! Von dem kenne ich die meisten Gedichte sogar auswendig. Oder kannte sie zumindest mal. Zum anderen bin ich leidenschaftlicher Sammler – und in dieser Eigenschaft ständig auf allen möglichen Flohmärkten unterwegs, auch auf weiter entfernten. Da halte ich dann eifrig Ausschau nach Büsten bedeutender Persönlichkeiten. Büsten von Staatsmännern und -frauen, Dichtern und Musikern, aber auch von Schauspielern, Sportlern, Wissenschaftlern und anderen Berühmtheiten beiderlei Geschlechts. Große Büsten, kleine Büsten, Büsten aus Gips, Holz und Metall, mit und ohne Sockel, einfarbig und bunt. Und die trage ich dann freudig nach Hause. Im Keller unserer Doppelhaushälfte habe ich mir extra einen Raum eingerichtet, in dem ich meine Schätze in Glasvitrinen dekorativ zur Schau stelle. Cäsar und Goethe etwa, von denen habe ich jeweils acht unterschiedliche Versionen. Aber auch Charlie Chaplin, Königin Victoria und Max Schmeling. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werde ich wohl der Vollständigkeit halber sogar gezwungen sein, meine Sammlung mit Büsten von Heino, Lothar Matthäus und Dieter Bohlen zu komplettieren. Aber die muss ich dann ja nicht in die vordere Reihe stellen. Doch nicht nur in meinem Kellerraum, also gleichsam im Verborgenen, sondern im ganzen Haus blicken honorige Persönlichkeiten – heute würde man Promis sagen – mehr oder minder würdevoll auf uns und unsere Gäste herab.
Hulda hat übrigens keine Kinder. Irgendein Problem mit der Eileiterschleimhaut, hat sie mir mal erklärt. Das habe sich erst während ihrer ersten Ehe herausgestellt und sei der Grund gewesen, weshalb sich ihr damaliger Mann von ihr getrennt habe. Seither sei sie sich immer wie eine Frau zweiter Klasse vorgekommen. Aber das ist ja jetzt vorbei. Denn nun hat sie auf einmal zwei Stiefkinder und vier Stiefenkel – sagt man das so? – am Hals, mit denen sie sich irgendwie arrangieren muss. Was sie bemerkenswert gut hinbekommt. Dazu noch meinen Hund, ein zotteliges Kerlchen, das ich mir nach Hennis Tod angeschafft habe, um nicht gar so allein zu sein. Ich habe ihn in München aus dem Tierheim geholt und, da es sich angeblich um einen »Oberpfälzer Waldspitzterrier« handelt, auf den bayerischen Namen »Herr von Hinterhuber« getauft. Auf den hört er erstaunlich gut, wenn auch nur in der Komplettversion. Ohne den »Herrn« vor dem »Hinterhuber« tut er dagegen so, als hätte er keine Ahnung, wer gemeint ist. Na ja, wenn er darauf besteht. Mir ist das letztlich egal.
Er ist ein wirklich lieber Hund mit nur einer einzigen Macke: Er rastet total aus, wenn er ein kleines schwarzes Tier, etwa ein Eichhörnchen, aber auch eine Katze oder eine Krähe sieht. Ja, er muss sie nicht mal sehen, es reicht, dass er sie wittert. Dann knurrt er wie eine Sibirische Bulldogge, fletscht die Zähne und reißt an seiner Leine, dass ich jedes Mal Angst habe, das teure Stück könnte reißen. Wie er es schafft, geruchlich zwischen schwarz und anderen Farben zu unterscheiden, bleibt sein Geheimnis. Fest steht jedenfalls, dass ihm weiße, graue, braune oder irgendwie gesprenkelte Kleintiere ganz und gar schnuppe sind.
So muss ich halt, wenn ich ihn bei unseren Spaziergängen von der Leine lasse, die ganze Zeit aufmerksam in die Gegend spähen, um ihn, sobald ich auch nur von fern irgendetwas kleines Schwarzes sehe, sofort anzuleinen. Das ist manchmal ganz schön mühsam, aber ich habe mich daran gewöhnt. Irgendeine Sorge muss man ja haben.
Tatsächlich wäre ich froh, wenn das mein einziger Kummer wäre. Doch das ist leider mitnichten so. Denn mit jedem Jahr, das ich älter werde, macht mir mein Leben als Vollsenior mehr und mehr zu schaffen. Obwohl ich, verglichen mit etlichen Altersgenossen, die mir pausenlos ihr Leid klagen, eigentlich noch ganz gut klarkomme. Aber urteilen Sie selbst.
Auf der Straße
Seit über 30 Jahren fahre ich einen Mercedes 190 Diesel, Baujahr 1983. Weinrot und mit H-Kennzeichen. Sieht man von der fehlenden Servolenkung ab, die ich aber auch erst seit einigen Jahren vermisse, ist das wirklich ein prachtvolles Auto. Robust, geräumig, elegant. Sogar mit rechtem Außenspiegel, seinerzeit eine ebenso kostenpflichtige Sonderausstattung wie das abschließbare Handschuhfach. 212 000 Kilometer hat das Gefährt mittlerweile auf dem Buckel. Und fährt immer noch wie eine Eins.
Allerdings ist es seit ein paar Jahren vor allem Hulda, die die Karosse lenkt. Zumindest auf der Autobahn. Denn da geht es mir viel zu hektisch zu. Da bekomme ich als Fahrer feuchte Hände, Magenkrämpfe und Knieschlottern. Das muss ich mir nicht antun. Zum Glück macht Hulda der irrsinnige Verkehr nichts aus. Im Gegenteil. Sie hält nicht nur munter mit, sondern bemüht sich oft sogar noch, die anderen Fahrer in puncto Dynamik zu übertrumpfen.
So wie letzten Mittwoch, als wir zur Geburtstagsfeier eines ihrer Neffen eingeladen waren. Der wohnt mit seiner Frau und den Kindern rund 120 Kilometer weit weg. Da kommt man zwar auch über Bundes- und Landstraßen hin – ich persönlich würde diese Strecke bevorzugen –, aber Hulda meint, das nervige Gekrabbel hinter irgendwelchen Brummis, die dicke Abgaswolken aus dem Auspuff blasen, gehe ihr so was von auf die Nerven. Will heißen: Sie besteht auf das Fahren auf der Autobahn. Und da lässt sie dann, wie mein Enkel Harvey sagen würde, »voll die Sau raus«.
»Musst du so rasen?«, frage ich mit zittriger Stimme, während ich mich mit beiden Händen am Griff über der Beifahrertür festklammere.
»Ich rase nicht«, kommt es spitz von links. »Ich passe mich dem Verkehrsfluss an und fahre gerade mal 130.«
»Mit 90 kämen wir genauso gut an. Wir haben doch Zeit.«
Hulda schnaubt genervt. »Blödsinn! Ich will doch nicht den ganzen Verkehr aufhalten.«
Ich würde mir gern den Schweiß von der Stirn wischen, traue mich aber nicht, den Griff zu lockern. »Wozu gibt es denn eine linke Spur? Sollen die lebensmüden Chaoten, die hier unterwegs sind, doch an uns vorbeirasen.«
Doch Hulda denkt gar nicht daran, auf meine Einwände zu hören. Vielmehr schert sie unvermittelt nach links aus und überholt drei Autos, die keineswegs krabbeln, sondern selbst auch ganz schön flott unterwegs sind. Wobei sie zwischen denen gnadenlos auf der linken Spur bleibt. Hat sie noch nie vom Rechtsfahrgebot gehört?
Bundes- und Landstraßen prescht Hulda, wenn es der Verkehr zulässt, mit mindestens 100 Sachen entlang. Als müsste sie einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Wenn ich fahre – das heißt, wenn ich allein unterwegs bin –, steigt der Tacho nie über 70. Damit bin ich noch überall hingekommen. Und zwar rechtzeitig. Wie hat mir doch mein Vater immer eingebläut? »Es gibt kein Zu-spät-Kommen, es gibt nur ein Zu-spät-Losfahren.« Und wenn sich hinter mir eine Schlange bildet, sollen die doch froh sein, dass ich nicht mehr Gas gebe. Schließlich können sie mich doch umso leichter überholen, je langsamer ich bin.
Nein, dass ich bereits 32 Jahre unfallfrei fahre, hat schon seinen Grund. Und auch, dass ich seit ewigen Zeiten keinen Strafzettel mehr bekommen habe. Zum Beispiel in der Stadt: Da gibt es mittlerweile so viele 30er-Zonen, dass man ständig Gefahr läuft, wegen zu schnellen Fahrens geblitzt zu werden. Das kann mir nicht passieren. Denn seit einigen Jahren habe ich mir angewöhnt, die 30 innerstädtisch prinzipiell nicht zu überschreiten. Sicher ist sicher. Die Langsamfahr-Zonen können mir seither vollkommen gleichgültig sein.
Oder an der Ampel. Da kann mir ein Unfall wie der unseres Bekannten Uwe nicht passieren. Der wollte nämlich, als das Licht vor ihm von Grün auf Gelb umschaltete, noch schnell über die Kreuzung zischen. Doch im letzten Moment hat er sich’s anders überlegt und vorschriftsmäßig gebremst. Und zack, kracht ihm sein Hintermann, der wohl auch noch mit rüber wollte, mit Karacho hinten rein. Ich dagegen nähere mich einer grünen Ampel immer bewusst so langsam, dass ich, sollte sie plötzlich auf Gelb umschalten, nur leicht bremsen muss, um ganz gemütlich zum Stillstand zu kommen. So was nennt man defensives Fahren. Und wenn dann wieder Grün kommt, schaue ich zuerst gründlich nach links und rechts, bevor ich losfahre. Hört und liest man nicht immer wieder von Verkehrsrowdys, die in der Stadt Privatrennen veranstalten und dabei hemmungslos rote Ampeln überfahren? Klar, hin und wieder kommt es vor, dass jemand hinter mir hupt. Aber das ist mir egal. Zahlt der mir etwa den Schaden, wenn es kracht?
Das einzige echte Problem, das ich ab und zu beim Autofahren habe, ist, dass ich den Mittelstreifen doppelt sehe und dann dummerweise nicht weiß, welcher der richtige ist. Die ersten Male, in denen mir das passiert ist, habe ich mich sicherheitshalber für den rechten entschieden. Aber das ist spätestens dann problematisch, wenn sich am Fahrbahnrand ein markierter Fahrradweg entlangzieht. Tatsächlich hätte ich durch meine Entscheidung für den rechten Streifen einmal fast einen Radler über den Haufen gefahren, und ein andermal bin ich versehentlich auf den Gehsteig geraten, was ich, ehrlich gesagt, erst gemerkt habe, als die Leute schreiend zur Seite hechteten. Aber das waren die einzigen Zwischenfälle, an die ich mich erinnere. Und die sind ja zum Glück beide gut ausgegangen. Hulda habe ich davon natürlich nichts erzählt. Wenn ich allerdings heute an die Sache mit dem Gehsteig zurückdenke, muss ich zugeben, dass ich dabei ganz schön Glück gehabt habe. Denn wenn ich einen oder gleich mehrere Passanten erwischt hätte, hätte man mich bestimmt für einen arabischen Terroristen bei der Ausführung eines mörderischen Anschlags gehalten.
Zu meiner Ehrenrettung muss ich allerdings sagen, dass beim ersten Mal, als ich versehentlich auf den Gehsteig gefahren bin, die Sonne schuld war. Denn die schien mir, nachdem ich an einem Kreisverkehr abgebogen war, plötzlich mit solcher Wucht ins Gesicht, dass ich total geblendet, will heißen praktisch blind war. Und was tut man in einem solchen Fall ganz automatisch? Na klar, Sonnenblende runterklappen, und zwar schleunigst! Doch fatalerweise habe ich beim Griff nach der blöden Klappe zweimal ins Leere gefasst, und das hat mich so abgelenkt, dass ich mich plötzlich auf dem Gehsteig wiedergefunden habe. Doch wie heißt es so schön? Man darf ruhig Fehler machen, bloß keinen zweimal. Deshalb habe ich aus dem unerfreulichen Vorfall Konsequenzen gezogen: Ich fahre seitdem grundsätzlich mit Hut auf dem Kopf. Mit einem breitkrempigen Exemplar im Stil von Indiana Jones, der mich vor überraschenden Sonnenattacken viel besser und vor allem schneller schützt als jede Sonnenblende.
Von den Gehsteigausflügen abgesehen, hat es mit mir auf der Straße keine bemerkenswerten Zwischenfälle gegeben. Ich bin zwar vielleicht nicht so schnell unterwegs wie die jugendlichen Raser heutzutage, aber doch noch immer dort angekommen, wo ich hinwollte. Weder habe ich jemals den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt noch bin ich statt auf die Bremse aufs Gaspedal getreten.
Und die Bundesstraße, die sie vor ein paar Jahren vierspurig ausgebaut haben, habe ich bisher auch nur ein einziges Mal in verkehrter Richtung befahren. Das wäre mir, ehrlich gesagt, nicht einmal aufgefallen, hätten mich die entgegenkommenden Autofahrer nicht allesamt so hektisch angeblinkt. Zuerst habe ich gedacht, da kommt gleich eine Radarfalle, und bin bewusst langsam gefahren. Selbst als der Sprecher im Autoradio für den Streckenabschnitt, auf dem ich gerade unterwegs war, eine Warnmeldung verkündet hat, habe ich mich nicht betroffen gefühlt. Ich bin lediglich seiner Empfehlung gefolgt und schön brav rechts geblieben und habe nicht überholt. Was ich ja eh so gut wie nie tue. Gewundert habe ich mich erst, als ich mehr als eine halbe Stunde früher am Ziel war als sonst. Aber darüber habe ich mir seinerzeit keine großen Gedanken gemacht.
Erst als ich beim Frühstück am nächsten Tag in der Zeitung von dem Vorfall auf der Schnellstraße gelesen habe, ist mir plötzlich ein Licht aufgegangen. Zum Glück habe ich den Lokalteil an diesem Tag als Erster durchgeblättert. So hatte ich mich, als Hulda eine Viertelstunde später die Seite aufschlug und verständnislos den Kopf schüttelte, schon wieder so weit von dem Schrecken erholt, dass ich mit halbwegs fester Stimme behaupten konnte, so etwas könne mir nie und nimmer passieren. »Ist doch unglaublich«, habe ich geschimpft, »was für Deppen auf unseren Straßen rumfahren. Denen sollte man allesamt den Führerschein abnehmen!«
»Wahrscheinlich wieder so ein alter Knacker«, hat Hulda brötchenkauend zugestimmt. »Der’s nicht mehr peilt.«
Dabei ist sie selbst es, die beim Autofahren Etliches nicht kapiert. Beispielsweise die Sache mit dem Gang. Hulda bringt es glatt fertig, im vierten durch die Stadt zu rollen. Mit 50, das müssen Sie sich mal vorstellen!
»Wenn du weiter so fährst, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn der Motor seinen Geist aufgibt«, habe ich erst neulich wieder geschimpft.
»Warum denn das?«, hat sie schnippisch zurückgegeben. »Mit so einer Fahrweise spart man eine Menge Benzin. Haben sie erst letzte Woche im Fernsehen gebracht.«
»Blödsinn!«, habe ich gefaucht. »Wenn der Motor hinüber ist, brauchst du überhaupt kein Benzin mehr.«
Aber sie hat sich um meine doch weiß Gott berechtigten Einwände mal wieder nicht geschert und ist die Gartenstraße weiter mit 50 im vierten Gang stadteinwärts gerollt. Ich habe den Motor regelrecht stöhnen gehört!
Mir passiert so etwas nicht. Innerstädtisch lege ich grundsätzlich den zweiten Gang ein, und nur wenn auf einer breiten Ausfallstraße mal 70 Sachen erlaubt sind, schalte ich in den dritten. Nicht ohne Grund hat mein 190er mittlerweile mehr als 200 000 Kilometer auf dem Buckel. Das sagt doch alles.
Als Hulda und ich noch kein Paar waren, hat sie noch ihr eigenes Auto besessen. Einen von diesen kleinen Japanern oder Koreanern, die kein Mensch auseinanderhalten kann. Aber den habe ich ihr schnell ausgeredet. Wozu brauchen wir zwei Autos? Bei den horrenden Benzinpreisen heutzutage! Das heißt doch, das Geld zum Fenster rausschmeißen. Und dann auch noch einen Asiaten! Der reinste Schrott, wenn Sie mich fragen. Mit jeder Menge unnützem Schnickschnack. Was sollen wir zum Beispiel mit so einem neumodischen Navigationsgerät? Also, ich traue den Dingern prinzipiell nicht. Erst neulich stand wieder in der Zeitung, dass so ein Teil eine Frau nicht nur in einen kaum befahrbaren Waldweg, sondern am Ende sogar in einen Tümpel gelotst hat – in dem ihr Auto dann kopfüber stecken blieb.
So was kann mir nicht passieren, das können Sie mir glauben. Bis heute habe ich mein Ziel noch so gut wie immer gefunden. Und die paar Male, in denen ich woanders gelandet bin, habe ich auf diese Weise reizende Gegenden kennengelernt, wo ich sonst nie und nimmer hingekommen wäre. Hat doch auch was. Nein, auf ein Navi – ich glaube, so nennt man die Dinger – kann ich wirklich verzichten. Wozu gibt es Straßenkarten? Aber die kann halt von den jungen Leuten heute keiner mehr lesen. Was allerdings auch für Hulda gilt. Wenn ausnahmsweise einmal ich fahre und sie den Shell-Atlas auf dem Schoß hat, kann ich sicher sein, dass sie auf meine Frage »Bei der Abzweigung da vorne rechts oder links?« allenfalls hilflos stammelt oder, wenn sie sich nach endlosem Nachdenken schließlich für eine der beiden Möglichkeiten entschieden hat, mich grundsätzlich in die falsche Richtung schickt. Aber zum Glück ist es ja meistens sie, die links sitzt. Dann kann sie sich hundertprozentig auf mich als Navi-Ersatz verlassen. Weil ich nämlich mit Straßenkarten noch nie Probleme hatte und bis heute nicht habe. Was machen die vielen technikgläubigen Autofahrer denn, frage ich mich oft, wenn das blöde Navi mal ausfällt? Bleiben Sie dann ratlos stehen und lassen sich vom ADAC zu ihrem Ziel schleppen? Inzwischen habe ich mich mit Hulda auf einen Kompromiss geeinigt: Wenn sie mit dem Mercedes allein unterwegs ist, klebt sie ein mobiles Gerät, das sie sich im Internet gekauft hat, an die Frontscheibe. Aber nur dann. Sitze ich dagegen neben ihr, liegt die Karte griffbereit.
Ein einziges Mal, als Hulda und ich uns gerade näher kennengelernt hatten, hat sie mir ihren Kleinwagen geliehen. Weil mein Mercedes gerade in der Inspektion war. Blöderweise habe ich das akzeptiert. Einmal und nie wieder, sage ich Ihnen! Bis zum Schluss war mir schleierhaft, wie man das klobige Teil, das links aus der Lenksäule herausragt und mit dem man laut Hulda nicht nur das Licht, sondern auch den vorderen und hinteren Scheibenwischer einschließlich der Waschfunktion bedient, kippen, drehen und schwenken muss. Selbst das Radio kann man damit angeblich lauter oder leiser stellen. Was für ein umständliches Ding! Aber am schlimmsten war, dass der Motor an jeder Ampel, kaum hatte ich den Leerlauf eingelegt, ausgegangen ist. Jedes Mal habe ich, während ich auf Grün wartete, Blut und Wasser geschwitzt, ob er wohl wieder anspringen würde. Was er – das zuzugeben gebührt der Anstand – erstaunlicherweise immer tat. Trotzdem war ich, als ich schweißgebadet wieder zu Hause ankam, fix und fertig.
Zum Glück hat Hulda sich nach langem Gemecker schließlich überzeugen lassen, die Karre zu verkaufen. Von dem Geld haben wir uns eine zehntägige Bildungsreise zu den antiken Stätten Kleinasiens geleistet. Mit dem Flugzeug nach Istanbul, dann weiter mit dem Bus. Dessen Fahrer – auch er nicht mehr der Jüngste – brauchte zu meiner stillen Genugtuung kein Navi, um die diversen Ziele sicher anzusteuern. Und der Motor blieb die ganze Fahrt über an.
Wie bei meinem 190er.
Dr. House sei Dank
Den Ruhestand erreicht zu haben, hat einen enormen Vorteil: Man kann sich endlich intensiv um seine Gesundheit kümmern. Wie oft bin ich früher mit Kopfschmerzen, Schniefnase, dumpfem Bauch- und brennendem Halsweh in die Schule gegangen, nur um mir ja nicht nachsagen zu lassen, ich würde bei jedem kleinen Zipperlein krankfeiern. Wie oft habe ich mich leidend durch die Unterrichtsstunden gequält und dabei nur den einen Wunsch gehabt: möglichst bald nach Hause ins Bett zu kommen.
Damit ist seit meiner Pensionierung Schluss! Seither habe ich viel mehr Zeit, in meinen Körper hineinzuhören, um beizeiten zu erspüren, woran es ihm fehlt. Und wenn ich daraufhin den Verdacht habe, bei mir sei irgendetwas nicht so, wie es sein sollte, rufe ich umgehend beim Arzt an. Einen Termin bekomme ich als Privatpatient in der Regel schon am nächsten oder übernächsten Tag und bei Schmerzen sogar auf der Stelle. Wenn ich dann im Wartezimmer sitze, fühle ich mich gleich besser. Denn den größten Teil der Männer und Frauen, die dort auf den schäbigen Stühlen hocken, kenne ich mittlerweile sehr gut. So wird für mich jeder Arztbesuch zu einer Art Wiedersehensfeier mit lieben Freunden. Wir begrüßen uns mit lautem Hallo, umarmen uns innig und bequatschen ausgiebig, was es Neues gibt. Wobei sich unser Gespräch keinesfalls auf unsere jeweiligen Beschwerden beschränkt, auch wenn die natürlich im Mittelpunkt stehen. Denn schon seit Längerem beglückwünschen wir uns gegenseitig auch zu unseren Geburts-, Namens- und sonstigen Festtagen; und wenn es etwas zu feiern gibt – etwa die Ankunft eines neuen Enkels oder einer Enkelin –, spendiert der Jubilar schon mal ein Fläschchen Schampus.
Wenn uns dann die Helferin aufruft, lassen wir an solchen Tagen gerne anderen, uns weniger bekannten Patienten den Vortritt.
Neben dem geselligen Aspekt bietet unsere stets wechselnde Wartezimmerrunde aber auch noch einen entscheidenden Mehrwert: Man erfährt dabei eine Menge über den menschlichen Körper und seine Krankheiten. Wenn Frau Mörbeling ihren Rock hebt und uns stolz den nässenden Ausschlag auf der Innenseite ihrer Oberschenkel zeigt oder wenn Herr Rückert den Auswurf, den er vor unser aller Augen mit zwei, drei beherzten Hustenstößen aus seiner Lunge katapultiert, anschließend auf einer eigens mitgebrachten Untertasse von Hand zu Hand gehen lässt, hat das schon einen hohen didaktischen Effekt. Fakt ist daher, dass ich von jedem Arztbesuch nicht nur bestens gelaunt, sondern auch um einiges schlauer nach Hause gehe. Ob der Doktor mir persönlich geholfen hat, ist dabei fast zweitrangig. Zumal mir ein ärztlicher Misserfolg ja einen willkommenen Anlass liefert, in den nächsten Tagen gleich noch einmal in der Hausarztpraxis vorzusprechen. In den Wartezimmern der Fachärzte, die ich naturgemäß seltener aufsuche, kenne ich dagegen nur den einen oder anderen Patienten näher, mit dem es in der Regel bei einer unverbindlichen Unterhaltung bleibt.
Wenn man wie ich zwei- bis dreimal pro Monat beim Doktor erscheint, zu dem man – ebenfalls wie ich – irgendwann ein mindestens ebenso inniges Verhältnis entwickelt wie zu seinem Ehepartner, wird man mit der Zeit zwangsläufig zu einem medizinischen Experten par excellence. So kenne ich etwa sämtliche relevanten Laborwerte des menschlichen Körpers auswendig und weiß genau, was es bedeutet, wenn sie nicht so sind, wie sie sein sollen. Und natürlich, was dann jeweils zu tun ist. Deshalb ist mir oft schon – bevor der Arzt mich auch nur angesehen hat – vollkommen klar, worunter ich momentan gerade leide und was er gleich unternehmen wird. Eigentlich könnte ich ihm in solchen Fällen die präzise Diagnose gleich mitliefern, aber das wäre natürlich nur der halbe Spaß. Schließlich ist es jedes Mal wieder spannend, ob er auch ohne mein Zutun darauf kommt, woran es bei mir aktuell hapert, oder ob ich ihm erst mit gezielten Informationen auf die Sprünge helfen muss, bis ich ihm schließlich zu seiner finalen Schlussfolgerung gratulieren kann.
Ein nicht zu unterschätzendes Problem bei meinen häufigen Arztbesuchen in wechselnden Praxen sind die Tabletten, Dragees und Kapseln, die mir der Arzt oder die Ärztin jedes Mal verschreibt. Sie glauben ja nicht, was da so alles zusammenkommt. Würde ich die alle schlucken, wäre ich danach erst richtig am Hund. Deshalb habe ich die Rezepte eine Zeit lang einfach nicht eingelöst, aber das bringt es irgendwie auch nicht. Schließlich muss ich für meine Krankenversicherung jeden Monat eine Menge Geld berappen. Da sehe ich gar nicht ein, warum ich ihr die Arzneikosten schenken soll. Dann mache ich es lieber wie mein Freund Erwin, der die ihm verordneten Medikamente im Zoo an die Tiere verfüttert. Das macht wirklich einen Riesenspaß. Zu beobachten, wie der Löwe plötzlich scheinbar grundlos auf den Hinterbeinen Pirouetten dreht oder das Zebra meint, es sei ein Braunbär, und laut brummend versucht, einen Baum hochzuklettern, ist schon großes Kino. Vor allem, wenn man dabei den Kommentaren anderer Zoobesucher lauscht, die versuchen, ihren Kindern das merkwürdige Verhalten der Tiere mit abstrusen Theorien zu erklären. So habe ich einmal feixend mit angehört, wie ein junger Vater seiner kleinen Tochter erzählte, die Pinguine würden vor lauter Lebensfreude Walzer tanzen, nachdem ich ein Fläschchen mit antidepressiven Tropfen in ihr Becken gekippt hatte.
Dass ich mich mit Hulda so gut verstehe, hat sicher auch entscheidend damit zu tun, dass sie in puncto Körper und Gesundheit genauso tickt wie ich. Sie war es, die die Apotheken-Umschau mit in die Ehe gebracht hat. Eine komplette Sammlung sämtlicher Hefte seit 1962, säuberlich etikettiert in Sammelboxen verwahrt. Diejenigen ab 1990 habe ich inzwischen allesamt von vorne bis hinten durchgelesen, und alle zwei Wochen freuen wir uns schon auf die neue Ausgabe, die unsere Apothekerin immer zuverlässig für uns zurücklegt. Und zwar gleich doppelt, damit es zwischen uns keinen Streit gibt, wer zuerst mit Lesen dran ist. Kein Wunder daher, dass auch Hulda ohne Probleme eine Arztpraxis eröffnen könnte. Ja, ich wage sogar zu behaupten, dass sie manch greisen Hausarzt zwar nicht in puncto Erfahrung, aber allemal hinsichtlich ihres profunden medizinischen Wissens locker in den Schatten stellen würde.
Außerdem bemühen wir uns nach Kräften, auch nicht eine einzige Folge von Visite, Hauptsache Gesund, rbb praxis und wie die einschlägigen Fernsehsendungen alle heißen, zu verpassen. Auch wenn uns das, was da gezeigt und besprochen wird, natürlich zum größten Teil längst vertraut ist. Aber irgendetwas lernt man ja bekanntlich immer dazu. Und wenn es nur der eine oder andere neue Fachausdruck ist, mit dem man dann im Freundes- und Bekanntenkreis, wo Krankheit das mit Abstand beliebteste Unterhaltungsthema ist, mächtig Eindruck schinden kann. Bezeichnungen wie Globoidzellen-Leukodystrophie, Ductus epididymidis, Pseudohypoparathyreoidismus und Choledochojejunostomie gehen uns schon nach wenigen Übungseinheiten lässig über die Lippen. Und oft müssen wir herzhaft lachen, wenn ehemalige und aktuelle Fernsehärzte wie Dr. Brinkmann, Dr. Sommerfeld oder Dr. House beziehungsweise ihre Synchronsprecher mit derlei Zungenbrechern ihre liebe Müh und Not haben.
Fakt ist jedenfalls, dass wir beide dank unserer herausragenden medizinischen Kenntnisse bei den Vollsenioren in der Altenbegegnungsstelle ausgesprochen gern gesehen sind. Wenn die greise Frau Hüttel darüber klagt, dass ihr vor allem bei Südostwind und nach einem heftigen Gewitter ein quälendes Zucken in ihrem rechten Ringfinger zu schaffen macht oder der nicht minder betagte Herr Ludewig berichtet, er verspüre beim Stuhlgang oft ein heftiges Brennen im linken Gehörgang, freuen sich alle über unsere kundigen und zudem noch kostenfreien Ratschläge. Und wenn es um künstliche Hüften, Knie und Schultern oder andere körperliche Ersatzteile geht, können wir sogar aus eigener Erfahrung mitreden. Zwar halten Hulda mit ihrer einseitigen Hüftprothese und ich mit meiner neuen Augenlinse sowie dem herausnehmbaren Zahnersatz bei Weitem nicht mit anderen Kaffeekränzchen-Teilnehmern mit, aber gänzlich unerfahren sind wir jedenfalls auch nicht. Stolze Rekordhalterin ist in dieser Beziehung Frau Pümmerl-Grimm, die gleich mit zwei künstlichen Hüften, einem künstlichen Knie und einem Cochlea-Implantat im Innenohr aufwarten kann. Was sie auch bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit lautstark kundtut.
Apropos Zahnprothese: Seit man mir vor drei Jahren mehrere lockere Beißer ziehen musste, bin ich Träger einer solchen. Die ist mit sogenannten Teleskopkronen an den Nachbarzähnen befestigt und sitzt eigentlich tadellos. Jedenfalls konnte ich schon nach erstaunlich kurzer Eingewöhnungszeit prima damit essen. Und die Befürchtung, man sähe die Prothese beim Sprechen, weshalb ich anfangs krampfhaft vermied, meinen Mund weit zu öffnen, mir beim Gähnen schamhaft die Hand vors Gesicht hielt und sicherheitshalber lieber »Ho-ho-ho« statt »Ha-ha-ha« lachte, erwies sich zum Glück ebenfalls als unbegründet.
»Gewöhn dir unter allen Umständen an, das Teil, wenn du es nicht im Mund hast, immer an derselben Stelle zu deponieren«, hat mich mein Freund Josef seinerzeit ernsthaft ermahnt. »Es sei denn, du willst unbedingt in Schwulitäten kommen.«
Ich habe mir seine Worte wirklich zu Herzen genommen. Doch dann erreicht mich eines Tages ein dringend erwartetes Telefonat ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als ich gerade beim Prothesenputzen bin. Ohne lange zu überlegen, lege ich das Ding auf den Klodeckel und eile zum Apparat. Und als ich zurückkomme, sind meine Zähne weg. Einfach verschwunden. Als hätten sie sich in die sprichwörtliche Luft aufgelöst. Nachdem ich zigmal »SO EINE SCHEISSE! DAS GIBT’S DOCH NICHT!« geflucht habe, mache ich mich daran, das Teil überall zu suchen. Kremple alle meine Taschen um und stelle sogar den Behälter mit der Schmutzwäsche auf den Kopf. Selbst im Papierkorb, im Kühlschrank und in der Spülmaschine sehe ich gründlich nach. Doch die teure Prothese ist und bleibt verschwunden.
»Liebling«, nuschle ich in meiner Not schließlich Hulda an, »hast du vielleicht meine Zähne gesehen?«