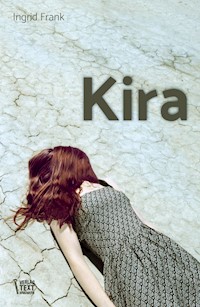Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Hummeln sind im Ei mit einer Wachsschicht umgeben. Irgendwann verlassen sie diesen Zustand", erklärt der etwas hypochondrische Gunnar seiner Frau Fine bei einem Abendessen, bei dem die beiden gründlich aneinander vorbeireden. "Ich werde verreisen. Ich krieg keine Luft mehr", sagt Fine, die sich seit geraumer Zeit von ihm unverstanden und selbst sprachlos fühlt. "Würd' gern mit dir nach Sardinien fahren." Der durch und durch gefrustete aber lebenshungrige Heiner schreibt Fine eine SMS. Drei Menschen spüren: Unter der Oberfläche ihres Alltags stimmt etwas nicht. Eigenwillige Aufbrüche beginnen. Beziehungen sortieren sich neu. Es ist eine Geschichte über das Leben und das Lieben, über tastendendes Suchen und ungewöhnliches Finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Und es kam der Tag
Da das Risiko
In der Knospe zu verharren
Schmerzlicher wurde
Als das Risiko zu blühen.
(Anaiis Nin)
Ingrid Frank, Jg. 1964, lebt in Hannover und arbeitet seit 2007 in einer Jugend- und Familienberatungsstelle. Sie hat vielseitige Berufserfahrungen in der Jugendbildung, der Sozialpsychiatrie, im Justizvollzug und einem Taxiunternehmen.
Schreiben ist für sie lange schon eine Ausdrucksform, die inneres und äußeres Erleben verbindet. Es wird zunehmend wesentlicher.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Fine
Gunnar
Heiner
Fine
Gunnar
Heiner
Fine
Heiner
Gunnar
Fine
Heiner
Fine
Gunnar
Fine
Heiner
Gunnar
Fine
Gunnar
Fine
Gunnar
Heiner
Fine
Gunnar
Fine
Heiner
Gunnar
Fiene
Heiner
Statt eines Epilogs
Prolog
Fiene mit i-e
„Wenn Sie einen Reisepass haben möchten, brauche ich aber Ihre Geburtsurkunde.“ Der Beamte der Stadtverwaltungsfiliale, Zimmer 312A, schaut über den Rand seiner Brille.
„Aber reicht der Personalausweis nicht?“
„Nicht, um einen Reisepass zu bekommen. Aber für Italien braucht man den nicht unbedingt, Italien gehört zur EU. Sie sagten doch Italien?“
„Ja schon …“ Fine schaut erst ihn, dann den Gummibaum in der Ecke des Raumes an. „Überlebenskünstler, diese Art Pflanzen, nicht wahr? Pflegeleicht, robust, anpassungsfähig …“
Der Beamte schaut hoch. „Keine Ahnung …“
„Ja, man übersieht so praktische Pflanzen gerne. Sie blühen so gut wie nicht, eher nach innen. Brauchen ganz spezielle Wespen, um sie zu bestäuben … also alles andere als unkompliziert … Ich kriege Allergie von dem weißen Saft in den Blättern, wissen Sie, deshalb hab ich mich damit beschäftigt …“
Er schaut jetzt zu dem Gummibaum, als nehme er erst jetzt wahr, dass er in der Ecke seines Büros steht. „Hm … ja also, ich denke Sie wollen einen Reisepass?“
„Jaaa … Also, ich will monateweise in Italien leben, und das fühlt sich so an, als braucht man dazu einen Reisepass, so etwas wie eine zweite Existenz will abgesichert sein. Vielleicht irgendwie antiquiert, aber … für mich ist es eine große Reise, wissen Sie? Ich möchte einen Reisepass!“
Man weiß nie, würde Gunnar sagen. Wer weiß, was ihr in Italien einfällt …
„Ungewöhnlicher Auftrag, braucht man nicht, aber ich stelle Ihnen gerne einen aus. Kostet allerdings 60 €.“ Gleichermaßen verbindlich ergänzt er: „Solche Pflanzen sorgen für gute Luft, glaube ich.“
„Ein gutes Klima ist wichtig … sehr wichtig sogar.“ Fine schaut ihn ernst an. „Meine Geburtsurkunde liegt zu Hause im Schrank bei den Dokumenten. Dann hole ich sie eben. Bin ungefähr in einer Stunde wieder da.“ Sie steht auf.
Was für eine Rennerei für eine Urkunde, die sie eigentlich nicht braucht. Es gibt immer irgendeinen Grund etwas sehr wohl zu brauchen.
Sie geht mit dem Papier noch einmal zur Behörde, zieht im Wartebereich eine Nummer und wartet geduldig, bis sie erneut dran ist.
„Fiene mit i-e … Aha …“ Der Verwaltungsangestellte, Herr Schoneke, so steht es an der Tür, betrachtet ihr Dokument. „Seltene Schreibweise.“
Das „i-e – Aha“ ist ihr vertraut. Zum Führerschein, zur Hochzeit, zu Antonias Geburt: „Aha … i-e“. Sie hat es so hingenommen. Sonst ist sie Fine, ohne i-e. Einfach Fine. Das ist schon immer so gewesen. Keiner im Leben, abgesehen von den Verwaltungsbeamten auf Behörden, wo sie vermerkt, in Listen eingetragen wird, einen Personalausweis braucht, eine Heirats- oder Geburtsurkunde, keiner sonst merkt, dass ihr etwas fehlt.Dieses i-e-Falschsein gab es schon, als sie dreizehn war. Sie wollte zum Schüleraustausch nach Großbritannien.
„Die Urkunde liegt im Familienstammbuch.“ Der Vater holte das mit goldenen Buchstaben verzierte Plastikbuch aus der Klappe des Wohnzimmerschranks. „Hier haste, was du brauchst.“ Er legte das Dokument auf den Tisch.
„Äh …, Fine ist da mit i-e geschrieben.“ Fine schaute fragend vom Vater zur Mutter.
„Joah, das hat der Standesbeamte wohl so gemacht. Macht ja nix.“ Der Vater zuckte die Schulter.
Die Mutter schaute auf das Papier, als sähe sie es zum ersten Mal. „Fiene, Fine, Fiene, klingt doch gleich, alles dasselbe oder? Macht doch nix!“
Fine hatte das „Macht doch was!“ immer runter geschluckt.
Sie hat sich daran gewöhnt. All die Jahre. 53 Jahre. Jetzt, in diesem Moment entscheidet sie sich das ‚i-e‘ und das ‚Aha‘ zu sich zu nehmen:
„Ja, I-E!“ Fiene hebt die Brust, ganz aufrecht steht sie da und schaut dem Beamten direkt ins Gesicht. „Die ungewöhnliche Variante ist die richtige!“
„I-e!“, wiederholt sie und lächelt ihn an. „Doch gut einen Reisepass zu beantragen!“
Er schüttelt leise den Kopf. „Hartnäckig sind Sie! Sie werden benachrichtigt, wenn er fertig ist. Hier Ihre Antragsformulare. Zahlen bitte heute ein Zimmer weiter. Hab vorhin erst mal den Gummibaum gegossen, den hab ich schon lange nicht mehr beachtet. Auf Wiedersehen und alles Gute für Ihre Reise!“
Sie summt auf dem Nachhauseweg vor sich hin. Fiene wird sie jetzt schreiben – auf Briefumschläge, Einladungen, Teilnehmerlisten ... überhaupt immer. Und alle anderen werden sich daran gewöhnen müssen!
Sie schaut an den Häusern der Bremer Reihenhaussiedlung entlang. Viele Jahre wohnen sie schon hier, in einem der schmalen Häuschen mit einem Stück Hintergarten. Sie konnten es einem entfernten Verwandten von Gunnar günstig abkaufen. Hat sich so ergeben. Wie so viel in ihrem Leben.
„Ich habe mich an viel zu viel gewöhnt!“, sagt sie, als sie die Wohnung betritt. Gunnar schaut irritiert auf. Bevor sie die Geburtsurkunde wieder in den Ordner im Wohnzimmer legt, hält sie sie Gunnar hin und zeigt mit dem Finger auf ihren Namen:
„I-e! Fiene … Ich bin jetzt Fiene mit i-e. Ich bin Ich. Ich, die ich von Anfang an bin, ungewöhnlich vielleicht, aber richtig so …“ Und mit Blick auf Gunnar ergänzt sie: „Ab sofort!“
Sie zeigt ihm die Antragsformulare für den neuen Reisepass.
Fine
Ein nicht enden wollender Ton durchschneidet ihren Traum, durchdringt ihre schlafenden Glieder, grell, bis ganz ins Innere. Schrill füllt er das gesamte Schlafzimmer. Die Schwingung kommt irgendwo aus dem Raum ihres Häuschens, fünf Zimmer auf zwei Etagen, dazu ein Dachboden, insgesamt etwa 120 Quadratmeter.
Fines Körper erstarrt, er stellt sich tot. Sie ist alleine. Gunnar hat ausgerechnet jetzt diese Tagung außerhalb, eine absolute Ausnahme in dem sonst so geregelten Arbeitsrhythmus.
Sie schaut auf das Bett neben sich. Es würde sie beruhigen, wenn er da liegen würde. Er wüsste, was zu tun ist, oder würde so tun, als wisse er es. Beides wäre ausreichend.
Das durchdringende Fiepen hält an. Still liegen und es ignorieren ist unmöglich. Ihre Ohren ertragen diese manische Frequenz nicht, sie muss aufstehen und schauen, woher das irre Geräusch kommt. Vor was warnt es? Woher kommt der Ton?
Sie muss etwas unternehmen. Sie steht auf. Auf dem breiten Stuhl vor dem Schrank liegt Gunnars Strickjacke. Die dunkelblaue Wolle riecht nach Essen, Garten und Gunnarhaut. Sie zieht sie über und geht durch die noch müde Wohnung, tastet sich von Raum zu Raum.
Alles ist wie immer. Der einsame Stuhl, Bett, Schrank, ein paar verlorene Kleider, der erbarmungslose Spiegel im Schlafzimmer, die Einbauküche mit der immer bereiten Spüle, ungehörte Bücher, tröstende Blumen, sprachlos gewordene Bilder, Tisch, Sofa und Sessel im Wohnzimmer, gelangweilt: eine durchschnittliche Wohnung mit gewöhnlichen Einrichtungsgegenständen, bis auf die italienische Saftpresse auf der Anrichte in der Küche und die mit verspielten Ornamenten versehene Nähmaschine der Großmutter im Flur. Diese zwei Gegenstände heben sich ab, machen die Wohnung zu ihrer Wohnung. Das vor allem, wenn man noch den schmiedeeisernen Stuhl dazu zählt, dessen hellblau lächelnder Lack bereits abblättert. Der steht auf der Terrasse, die in den Garten übergeht. Gunnar hat ihn ihr vor ein paar Jahren mitgebracht. „Der stand da wie für dich“, hat er gesagt und sie geküsst. Ein erwartungsfroher Stuhl, wie die in Griechenland oder Italien, ihr persönlicher Sehnsuchtsort, neben all den anderen Dingen, die neu, praktisch, pflegeleicht dastehen, letztlich austauschbar.
Der Ton reißt nicht ab. Er breitet sich offensichtlich von der Mitte des Wohnzimmers im Parterre aus. Fine schaut sich dort um. In der rechten Zimmerhälfte stehen Stühle da, als warteten sie auf etwas oder jemanden, an der linken Wand hängt ein Druck mit bunten Häusern darauf; ihr Blick geht über den frisch gesaugten Teppichboden, nach oben an die Decke bis zu dem Plastikrund: Rauchmelder! Daher kommt der Ton. Aber da ist keine Kerze, kein Feuer, nirgends brennt etwas, es gibt keinen Hinweis auf eine Rauchentwicklung. Grundlos und grundunverschämt geht von diesem Gerät der gellende Ton aus.
Die Leiter ist im Keller. Sie hat Angst nachts alleine in den Keller zu gehen. Räuber, Ungeheuer, eklige Tiere könnten dort sein – sie ist kein kleines Mädchen mehr – und sie fröstelt doch.
Sie haben keine Leiche im Keller. Nicht weiterdenken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 – rückwärts zählen beruhigt. Die Taschenlampe findet sie auf dem Regal im Flur, damit leuchtet sie sich den Weg frei. Eine Leiter lehnt an der Wand neben dem Wäscheständer; die trägt sie hinauf, stellt sie auf und klettert die Sprossen hoch. Sie ruckelt und zieht an dem weißen Plastikmantel des Rauchmelders. Der ist schwer von der Decke zu entfernen. Sie steigt die Leiter wieder hinab, holt einen Löffel und hebelt den Mantel weg. Die Apparatur darunter ist ihr fremd, sie haut mit dem Löffel darauf, stochert darin herum und konzentriert sich darauf, den Kontakt zu unterbrechen. Kontaktlos ist reizlos. Also raus mit der Batterie! Der ausufernd wollende Alarm hört auf. Vielleicht ist die Batterie leer. Deswegen Alarm. Könnte Sinn ergeben. Gunnar würde es ihr erklären, wenn er wiederkommt.
Fine geht nach oben in die erste Etage zurück ins Schlafzimmer und legt sich wieder ins Bett. Gunnars Schlafanzug liegt gefaltet auf seinem Kissen. Er riecht wie seine Strickjacke, wie seine Haut. Fine drückt ihre Nase in den Stoff.
Sie selbst riecht nach Schweiß. Fineschweiß. Sie befühlt ihren Körper, tastet an sich entlang, schaut auf den Schlafanzug, den sie ihm geschenkt hat: graue Streifen auf Dunkelblau, ein langweiliger Schlafanzug. Langweilig! Sie sind sich langweilig geworden. Ihr Leben ist belanglos, unbedeutend. Alles ist unerheblich und zufällig, keine Wahrnehmung besonders. Das ist Gift in den Adern. Gift kann töten.
Sie wälzt sich im Bett hin und her und steht schließlich auf. Im Bad findet sie ein Fläschchen Nagellack, das Antonia beim letzten Besuch stehengelassen hat. Fine lackiert sich die Fußnägel. Dunkelviolett glänzend winken sie ihr zu. Der Lackgeruch sticht in der Nase. Fine schaut erst auf ihre Füße, dann auf die Uhr. Es ist halb sechs am Morgen, es lohnt sich nicht mehr noch einmal einzuschlafen, sie geht runter in die Küche, brüht sich eine Tasse Kaffee auf und nimmt ihn mit nach oben ins Schlafzimmer. Nicht wieder ins Bett legen.
Laufen, sie muss laufen! Jogginghose und Sweatshirt anziehen und dann los. Sie stellt den noch fast vollen Becher Kaffee an die Seite, kramt in einer Schublade nach der lange nicht benutzten Sporthose.
Der Anrufbeantworter im Flur blinkt. Er hat Gunnars routinemäßigen Gute-Nacht-Anruf gespeichert. „Wo willst du hin?“, würde er sagen, wäre er jetzt zu Hause.
„Laufen.“ Sie lächelt dem Anrufbeantworter zu. „Die Lähmung weglaufen. Die Batterie aufladen. Ich bin alarmiert.“
Das Joggen über den weichen Waldboden belebt. Fine atmet tiefe lange Züge. Ein und Aus und Ein und Aus. Obwohl sie unregelmäßig läuft, kennt ihr Körper die immer gleiche Strecke in- und auswendig. Am liebsten würde sie weiter und weiter laufen. Aber sie muss sie sich beeilen, Mona will zum Frühstück kommen. Sie schlägt den Weg zurück ein, stellt die Schuhe im Hausflur ab, macht noch ein paar Dehnungsübungen im Badezimmer, wirft die Sportsachen in die Ecke und stellt die Dusche erst einmal auf kalt, dann wärmer, um darunter ihren Körper ausgiebig einzuseifen. Fine sieht an sich herunter: splitternackte Fine …
Mona sieht gut aus. Mona mit dem weichen Busen, dem sinnlichen Lachen und den ausgefallenen Kleidern. Mona mit ihrem speziellen Augenaufschlag und ihrer etwas exaltierten Art zu sprechen. Mona war auf gewisse Weise schon immer mutiger.
Fine stellt das Wasser ab und nimmt sich ein Handtuch. Sie rubbelt ihre Haut so fest trocken, dass überall rote Flecken entstehen.
Mona ist anziehend. Wenn das doch ansteckend wäre … Ist es leider nicht. Fine sucht ein Sommerkleid aus dem Kleiderschrank nebenan und geht in die Küche – sie würden zusammen genießen können!
Sie presst ein paar Orangen aus, stellt Butter, Käse und Marmelade auf den Tisch und holt die Packung Lachs, die sie gestern gekauft hat, aus dem Kühlschrank. Als Mona klingelt, ist der Kaffee noch nicht ganz fertig.
„Hi! Schön, dass du da bist!“ Fast glaubt sie sich.
„Guten Morgen, Cherie!“ Mona geht direkt in die Küche durch. „Lachs, o là là.“ Sie stellt eine Tüte mit Brötchen auf den Tisch.
„Ich liebe Lachs. Wenn Gunnar nicht da ist, genieß‘ ich das, die kleinen Extras meine ich. Verstehst du? – Ebenfalls guten Morgen!“
„Großartig! Ich würde da keine Rücksicht drauf nehmen. Und nachher musste arbeiten? Ich könnte das so nicht: mal frei, mal arbeiten, so regellos, dauernd woanders. Viel zu stressig, oder?“ Mona schüttelt den Kopf.
„Manchmal … aber auch frei – ich kann improvisieren. Leg dein Zeug draußen auf die Garderobe und komm erst mal an. Ich mag diese Spontaneinsätze. Das Leben ist langweilig genug geworden. Regelmäßig jeden Tag Kindergarten will ich nicht mehr. Ich kann ja Nein sagen, wenn mir alles zu bunt wird. Das ist das Schöne, seit ich Springerin bin: Abwechslung, was die Einrichtungen und Teams angeht, und diese Unregelmäßigkeit. Passt grade! Also greif zu, Mona! Und … hast du ein Ohr für mich?“
„Zwei sogar, wie auch zwei Brötchenhälften.“ Mona belegt eine dick mit Streichkäse, die andere mit Erdbeermarmelade. „Fisch ist nicht mein Ding, sorry.“
Fine tunkt ein Stück Lachs in das daneben stehende Schälchen Meerrettich. Sie leckt sich die Lippen, dann erzählt sie von dem Rauchmelderalarm in der Nacht zuvor. „Also weißt du, es ist weniger dieser Schreck und das Geräusch als eben das, was dabei mit mir passiert. Also …“ Fine fixiert die Kollegin. Sie ist keine wirkliche Freundin. Deshalb vielleicht die Anspannung, das bemühte Lächeln, das anstrengt.
„Also, was passiert mit dir? Hast du die Marmelade selbst gemacht?“ Mona hält das Glas hoch. „Marmelade kochen … weißt du, da muss ich an meine Großtante denken: Helene aus Schlesien. Jede Menge Erdbeermarmelade und jede Menge Sprüche.“ Versonnen schaut sie in die Weite. „Ein silberner Knopf auf der Fenster- oder Türschwelle des Schlafzimmers vertreibt Alp und Hex, hat sie mir immer gesagt, wenn ich nicht schlafen konnte. Helene hätte dir gefallen mit ihren Einfällen … diese alte Nähmaschine bei dir in der Ecke erinnert mich an sie.“
„Die hat meiner Oma gehört, Katharina hieß die.“ Von Monas Großtante hat Fine noch nie gehört. „Bisschen kauzige Frau, diese Helene, oder?“
„Ja, irgendwie schon. Ich habe ihre Knopfsammlung geerbt und weitergeführt. Sie liebte Knöpfe – Ich liebe Knöpfe!“
„Knöpfe?“ Fine fasst unwillkürlich an einen der Perlmuttknöpfe ihrer Strickjacke.
„Ja! Mittlerweile sammle ich sie leidenschaftlich, Knöpfe aller Art und Herkunft: Glasknöpfe, Holzknöpfe, Silberknöpfe, Militärknöpfe, Münzknöpfe, grüne, blaue, rote, bunte Knöpfe, Wäscheknöpfe usw. Ich kann mich in dieser Vielfalt verlieren und verlieben auch natürlich. Ich sammle sie mit immer größerer Leidenschaft, kaufe welche bei Knopf Paul in der Zossenstraße in Berlin, wenn ich da mal bin. Übrigens, irgendwo bei Prag in Waldes gibt’s ein Knopfmuseum. Lass uns da mal hinfahren – wie wär’s, Fine?“
„O man, Mona, Leidenschaft pur für Knöpfe. Knopfmuseum! Apropos Leidenschaft …“
„Ja, ich weiß, du willst mir was erzählen … nur eins noch: Tante Helene meinte, es bringe Glück, wenn man einen Hemd- oder Hosenknopf findet, aber Ärger, wenn man ihn aufhebt. Echt abergläubisch. Ich bin es mittlerweile auch, also bei mir liegt so ein Silberknopf auf dem Fenstersims im Schlafzimmer, wie bei ihr …“
„Also, Mona … Verstehe, jetzt bin ich aber dran. Mein Gefühl ist, um beim Thema zu bleiben: es steht gerade Spitz auf Knopf. Es fühlt sich so an, als sei der Alarm für mich angegangen. Etwa, um mir zu sagen, dass ich quasi eingeschlafen bin, etwas versäume, na ja, um mich zu erinnern …“
„Erinnern an was?“ Mona kaut weiter.
„Na ja, seit Antonia ausgezogen ist, fühl ich mich vollends leer. Lustlos, langweilig, leer. Innendrin furchtbar leer.“
„Okay.“ Mona schaut auf. „Das ist wie ‘ne zweite Abnabelung, sagt man ja, haste vielleicht nicht verkraftet? Hamm viele …“
„Keine Ahnung. Wir haben doch alles hier, die nette Wohnung, Garten, genug Geld. Ich hab diesen Springerjob, muss also nicht den ganzen Tag und auch nicht jeden Tag arbeiten, aber trotzdem: irgendwas stimmt nicht.“
„Woran merkst du das?“ Mona hört tatsächlich zu.
„Na ja, ich spüre das Neue nicht. Es sich zu zweit neu schön machen, so hat Gunnar es genannt, ist nicht schön. Das ist jetzt schon seit drei Jahren so. Ich träume mich weg und … ach, keine Ahnung, Mona. Ich hab vor zwei Monaten ‘nen Italienischkurs gemacht, einfach so. War mal ein Anfang. Italienisch wollte ich schon immer mal lernen. Eine Sprache wie Musik. Sie lässt mich träumen, macht sehnsüchtig … Seitdem merke ich noch mehr als davor, dass ich ebenso unruhig wie gelangweilt bin und dass irgendwas passiert oder so …“
„Ach Fine, wie empfindlich du bist und um die 50 eben. Das ist, glaube ich, alles ganz normal, genauso normal wie ein Rauchmelderfehlalarm. Ich versteh dich schon, aber wer ist nicht gefrustet? Hast es doch nett hier. Dein Gunnar ist wie er ist, nimm‘s halt nicht so tragisch. Lern weiter Italienisch oder so. Ich mein … was soll ich dazu sagen?“ Mona wechselt das Thema. „Thermomix solltest du mal probieren. Klasse Investition. Koch ich jetzt nur noch mit. Mensch Fine … probier einfach mal was Neues aus, so schwer is‘ das doch nicht.“
„Hm … vielleicht ja.“ Das Frühstücksgespräch wird einsilbig.
„Teilste dir noch dieses Körnerbrötchen mit mir?“ Mona scheint das nichts auszumachen.
Fine schiebt ihren Teller von sich weg. „Keine Ahnung, Mona, was, aber irgendwas ist los mit mir. Außerdem muss ich gleich arbeiten, also, der Job ist dran. Susanne, die Leiterin der Rumpelstilzchen-Kita hat mich vorgestern angerufen. Is mal wieder Notstand – ob ich einspringen kann. Ich hab zugesagt. Ich kann Susanne schlecht etwas abschlagen. Aushelfen ist halt mein Job. Tut mir leid.“
Sie bringt Mona zur Tür. „Schön, dass du gekommen bist. Ciao bella.“ Sie umarmen sich routinemäßig.
Erleichtert räumt Fine alles weg und packt hastig ihre Tasche.
‚Die Rumpelstilzchen‘ sind ganz in der Nähe ihrer Wohnung, sie wird da bis auf weiteres aushelfen. Drei Tage oder drei Wochen, sie weiß es nicht. Sich auf die Bedürfnisse anderer einstellen ist ihre Stärke – genau wie zu improvisieren. Sie stellt die gerade gepackte Tasche wieder hin. Genau das ist es, was sie nicht mehr will. Obwohl sie knapp dran ist, diesem Gedanken muss eine Entscheidung folgen – jetzt sofort: sie scrollt in ihren Handy nach der Nummer der Koordinatorin für ihre Kita-Einsätze; der Satz, den sie sagen muss, steht ihr glasklar vor Augen, sie verzichtet auf einleitende Smalltalk-Sätze und bringt ihn vor: „Nach dieser Runde bei den Rumpelstilzchen werde ich für die nächsten drei Monate nicht arbeiten! Nein, kein Urlaub. Ich möchte einfach nicht. Danke.“ Sie betrachtet die Tastatur ihres Handys: roter liegender Hörer – beenden. Erleichtert berührt sie das Symbol. Sie hat sich freie Zeit geschaffen.
Die Vertretung dauert 14 Tage. Die vergehen schnell. Morgenkreise mit den Kindern, Singen, Klatschen, Bauklötze spielen, Streithähne beschwichtigen, Tränen trocknen, das Spielen im Außengelände beaufsichtigen und sich zwischendurch mit den Kolleginnen über dieses und jenes austauschen. „Ja, der kleine Kevin wird immer nur von der Oma abgeholt“, „Rosa hat gar kein Gefühl für Gefahren, wir müssen gut auf sie aufpassen!“, „Zum letzten Elternabend waren kaum Leute da …“ Sie trinkt viel Kaffee mit Kolleginnen. Es langweilt sie.
„Ich hab mir ‘ne Auszeit genommen, ab morgen drei Monate …“ Erst nach dem letzten Tag in der Kita teilt sie Gunnar ihre Entscheidung mit.
Er sitzt vor dem Fernseher, zappt durch die Programme, wartet auf die Abendnachrichten. „Hm … Ja … und ist das gut für dich?“
„Ich glaub schon. Es fühlt sich so an.“
Er fragt nicht weiter nach. Sie gießt ihre Enttäuschung darüber mit dem Blumenwasser in den Kübel mit Begonien auf der Terrasse. Begonien sind beständig.
Sie schauen fern, der Krimi hat bereits angefangen. „Diese Kommissarin … irgendwie unkonventionell. Gefällt mir – souverän und stark …“
Gunnar unterbricht sie. „Fine, doch nicht mitten im Film …“ Er steht abrupt auf. „Ich schau das nicht mehr zu Ende. Ich muss früh raus morgen, viel zu tun. Es geht auch nicht in erster Linie um die Kommissarin. Aber wenn sie dich beeindruckt, bitteschön …“
„Na dann … Gute Nacht.“ Sie schaltet den Fernseher aus, bleibt aber noch eine ganze Weile sitzen, holt sich ein paar Salzstangen. Sie schmecken fad.
Sie hat Gunnar noch nie gefragt, ob er seine Arbeit liebt, ob er eine Leidenschaft dafür entwickelt hat. Leidenschaftlich arbeiten, leidenschaftlich leben – sie weiß nicht einmal, ob er sich danach sehnt.
Überhaupt weiß sie wenig von dem, was er macht. Jeden Tag geht er in die städtische Behörde. Vor zwei Jahren ist er zum Katasteramt versetzt worden. ‚Vermessung von Grundstücken‘ war seine Erklärung, als sie ihn irgendwann einmal gebeten hatte seine Arbeit vorzustellen. Sie hat nie weiter nachgefragt.
Sie geht auch ins Bett, schaut ihn an, wie er da liegt und schläft, streichelt vorsichtig seinen Kopf und schläft neben ihm ein.
Dass Gunnar sie in der Nacht mehrmals rüttelt und „Fine, alles gut“ sagt, kriegt sie nicht mit. Erst als sie schweißgebadet aufwacht und sich zwischen Schlaf und Wachsein orientiert, merkt sie, dass sie wild geträumt hat.
Es ist, als habe sie lange in einem Türrahmen gestanden und auf die Tiere geschaut. Katzen. Viele, viele Katzen. Die Traumbilder steigen auf:
Sie will eine Wohnung betreten. Als sie die Haustür aufschließt, schreckt sie zurück: vom Fußbodenfurnier starren aus fellgepflastertem Boden Augen über Augen herauf zu ihr. Sie schaut genauer hin: Katzenbabys. Viele kleine Katzenbabys liegen da, starr, unbeweglich, tot; und es ist offensichtlich, dass der Strom toter Kätzchen sich bis in die angrenzenden Räume erstreckt: die Küche, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer – überall liegen die Kadaver, wie es scheint, graumelierte Pelzhäufchen aneinandergereiht. Diese Wohnung ist zu einem Friedhof geworden, zu einem Katzenfriedhof, einem Katzenbabyfriedhof.
Neben ihr ist Gunnars Bett leer. Er ist zur Arbeit gegangen. So lange hat sie also geschlafen. Sie duscht ausgiebig, zieht Jeans und Bluse an, geht nach unten in die Küche und kocht Kaffee. Mit dem dampfenden Becher steht sie auf der Terrasse und atmet die morgendliche Frühlingsluft, in die sich der schale Nachgeschmack der Nacht mischt.
Dann schließt sie die Glastür von der Terrasse zur Wohnung von außen und geht durch den Garten. Die gelben Mahonienblüten riechen süß, ihr Staub legt sich wie ein Teppich über die Steine, die als Befestigung dienen.
„Sie vermehren sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit.“ Die Nachbarin schaut über den Zaun. „Berberitzengewächse eben.“
Fine ignoriert den Tonfall und nickt ihr zu. „Sie sind schön, so fein. Guten Morgen, Silvi!“
„Aber sie vermehren sich, wie gesagt, und ruck zuck ist der ganze Garten voll.“ Silvia schaut sie von oben bis unten an. „Ich würde sie lieber ausreißen.“
„Mal sehen, ich glaube eher nicht. Schönen Tag dir.“ Fine bückt sich und zieht ein paar Grasbüschel aus den Steinritzen.
‚Besser Ausreißen.‘ Grob, ja brutal klingt es nach. In der Zeitung hat sie vor ein paar Tagen gelesen, dass der Wunderlauch alles überwuchere, die öffentlichen Parks seien befallen, man müsse die Gärten schützen, ausreißen sollte man ihn. Die Gartenkennertipps stimmen sie misstrauisch. Sie fühlt die heimliche Freude darüber, dass sie bereits ein paar dieser Pflanzen aus dem Park mitgebracht und unter die Johannisbeerstaude gesetzt hat. Wunderlauch klingt ebenso verheißungsvoll wie Mahonie – beides asiatische Einwanderer, sie muss lachen. Sie streicht über eine der Mahonienblüten. Ihre Hand färbt sich gelb. Wunderschön. Wie bei den Frauen in Indien. Sie wird weder das Wunder noch die Schönheit ausmerzen!
Fine sieht an sich herunter, wie sie da im Garten steht in Jeans, beiger Bluse und den bunt gemusterten Strümpfen, die sich abheben. Sie schaut auf ihre blütenstaubbenetzte Hand. Sie könnte heute Wunderlauchpesto zubereiten. Sie geht noch einmal zurück, zieht ihre Jacke über, steckt ein Messer ein und nickt hinüber zum Garten der Nachbarn.
Die Erde riecht feucht und frisch. Außer ihr ist niemand im Wald unterwegs. Die Bäume starren sie an, große weise Baumaugen, manche von weiter oben, manche in Augenhöhe. ‚Fine!‘, scheinen sie zu sagen, ‚Fine, wir sehen dich. Du bist schön. Du bist da. Du bist. Wunderlauch, Wunderwald, Wunderleben ...‘ Fine läuft weit in den Wald hinein, so weit, dass sie nicht mehr weiß, wo sie ist. Hier und dort schneidet sie etwas von dem Wunderlauch ab. Ihre Hand ist noch immer leicht gelb. Die grünen Blätter leuchten darauf. Der Zwiebelgeruch dringt in die Poren. ‚Ich bin. Wunder. Auge. Wald. Ich gehe. Gelb. Wunder. Wundervermehrung.‘ Sie zieht ein paar der Pflänzchen aus der Erde. Sie wird sie unter die Mahonien setzen. Gartenasyl für die Exoten aus dem Osten. Sie zwinkert dem Baum zu, der auf sie runterschaut. Und jetzt, was soll sie jetzt tun? Sie schaut schweigend zu ihm hinauf, spürt die Blicke der gesamten Baumgruppe. Fine setzt sich auf die Erde.
Sie lehnt sich an einen Stamm, fühlte den Abdruck der Rinde an ihrem Rücken. Der Wunderlauch auf ihren Schoß verteilt sich über die Beine, fällt auf die Erde. Tränen fließen aus ihren Augen, sie kommen von irgendwo ganz tief drinnen.
Sie weint, während die Bäume ihr zuschauen.
Irgendwann sammelt sie das tränenbenetzte Kraut auf und gäbe etwas darum, jemand wäre da, um ihr zu helfen sich selbst zu sammeln. Sie hat keine Uhr und kein Handy dabei, um sich zu orientieren. Sie ist im Wald. Nicht erreichbar.
Sie stellt sich vor, wie es wäre, wenn Gunnar sie vermissen oder gar suchen würde. Sie würde sich freuen, wenn er sie sucht. Und wenn er das nicht tut? Sie fühlt den Unterschied.
Sie hatte sich früher manchmal versteckt, wenn ihr alles zu viel war zu Hause. Der Vater schimpfte dann, wenn sie wieder auftauchte. „Sieh dich doch mal um; sieh dich doch an … lächerlich, unsinnig dein Verhalten!“
Fine schreit. Sie schreit laut. Und dann noch ein zweites Mal. Die Bäume schauen noch immer auf sie herunter. „Ich bin Fine, und ich sammle Wunderkraut, um es unter die Mahonien zu pflanzen, und wenn es sich vermehrt, soll es mir recht sein. Die Mahonien riechen gut, und der Wunderlauch erst recht. Erst recht, erst recht“, flüstert sie hinauf. Einer der Bäume zwinkert ihr zu.
Es beginnt zu regnen. Wunderregen für das Wunderkraut, Fine lacht.
Der Weg wird matschig, es riecht nach feuchter Erde. Bunte Tropfen schimmern. Wie Seifenblasen. Fine singt. Sie erfindet die Texte ihrer Lieder auf Melodien, die ihr gerade einfallen. Ich werde weggefahren, und die Erde wird mich tragen. Fine singt lauter, denkt an die Weiten, die sie erkunden könnte, sie läuft und lacht.
Sie läuft an diesem Morgen lange, atmet Tropfen für Tropfen ein und träumt davon, eine Regentonne zu haben für ihre Wunder, um Wunderwasser zu sammeln.
„Stell dich mitten in den Regen,
glaub an seinen Tropfensegen
spinn Dich in dies Rauschen ein
und versuche, gut zu sein! ( …)“
Zeile für Zeile kommt ihr Borcherts Gedicht wieder in den Sinn. Im Deutschunterricht hat sie gelernt, sich mit Texten zu trösten … Trümmerliteratur. Sie läuft und atmet, geht absichtlich durch Pfützen, tritt mitten hinein. Sie ist Fine-Kind und Fine-Frau zugleich. Matsch spritzt bis in ihr Gesicht.
Gesichter können auch trösten. Sie sieht sie vor sich: die Freunde, Kollegen, Nachbarn, Gunnar, frühere Liebhaber, Leute.
Fine denkt an das Gesicht der Mutter früher, wie sie dalag, stöhnte und merkwürdige Dinge sagte. Wie sie mit wirren Haaren, in einem lila gepunkteten Bademantel durch die Wohnung lief, mit einem Blick, der Fine Angst machte. Ihr Gesicht war ein anderes als sonst.
„Psst, lass sie!“, hatte der Vater gesagt. „Nicht drüber sprechen, lass sie, die Leute sollen das nicht mitkriegen.“ Fine hatte sie gesehen: die Leute in der Klinik, die Verrückten überall, solche, die merkwürdig beängstigend waren, und ihre Mama mittendrin.
Spätestens da hatte sie beschlossen unsichtbar zu werden. Unauffällig, gedämpft, bescheiden, funktional, leise, einfach und blass. So würde sie durchkommen, niemanden zur Last fallen, nicht auffallen. Die Mutter nicht noch mehr verstören, nicht genauso verstört werden wie sie.
Es ist ihr gelungen. Gut sogar.
Jetzt liegt ihre Mutter in einem Pflegeheim und erkennt niemanden mehr. Fine läuft durch den Wald und verspürt eine immense Sehnsucht nach ihrer Mutter. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Wieder ein Lied, das sie unwillkürlich summt. Als sie noch sehr klein war, hat sie ihr zum Einschlafen immer etwas vorgesungen.
Fine hört ihre eigene Kinderstimme. „Mama!“ Keiner hört sie rufen. Wie damals.
Die Kätzchen fallen ihr wieder ein. In ihrem Traum liegen sie aufgereiht da, obwohl sie sich gar nicht aufreihen lassen, sie doch machen, was sie wollen.
Tote Kätzchen belegen meine Räume, möchte sie ihrer Mama sagen. Tote Spielkätzchen!
Toter Spieltrieb. Sie muss die Kätzchen wecken! Die Wucht der Gefühle ist schwer auszuhalten.
Fine legt sich auf die Erde, der Regen soll sie überall treffen. Er soll den ganzen Körper bedecken. Am liebsten würde sie sich im Schlamm wälzen.
Sie steht wieder auf, schaut in den Himmel. ‚Himmelskönigin schickt Wunderregen‘. Sie spielt mit Worten: wundersam. Wundersam schön. Sie fühlt, lacht, läuft. Vielleicht ist es so, oder anders. Sie spürt sich, fühlt das ‚Ich-bin‘ – „Ich bin. Ich bin, bin, bin ...“ sagt sie. Der Rhythmus ihres Atems trägt.
Vielleicht ist sie selbst gerade dabei verrückt zu werden.
Wenn Gunnar zurückkommt, werden sie wie immer essen, Zeitung lesen, fernsehen und dann wieder schlafen und am nächsten Tag einkaufen, arbeiten und so weiter.
Sie läuft jetzt ganz langsam bis zum Waldrand.
Als sie den Wald verlässt, ist sie am anderen Ende der Stadt. Die Ausfahrtsstraße ist nicht weit, dort gibt es eine Haltestelle. Sie kann mit der Straßenbahn zurückfahren, steigt also in die nächste Linie ein.
Ein Mann und eine Frau sitzen ihr gegenüber. Die Frau spricht laut.
„Ich plane jetzt keine Kreuzfahrt mehr, die Schiffe kentern und überhaupt, man muss viel zu lange warten, bis man die Gelegenheit hat in Ruhe im Pool zu schwimmen. Viel zu viele Leute auf so einem Kreuzfahrtschiff.“ Sie gestikuliert zu ihren Ausführungen. „Alles, was das Herz begehrt, gibt es da und manchmal sitzt der Kapitän mit am Tisch.“ Sie beschreibt das Buffet auf Kreuzfahrtschiffen. Ihr mit Pailletten besetzter Pullover glitzert. Der Mann gegenüber brummt etwas, die Frau redet weiter. „Ich würde dann schon lieber mal nach Las Vegas reisen, das wäre was anderes, aber Kreuzfahrten, nee, das hab ich mir abgeschminkt.“
Er tätschelt ihre Hand. „Las Vegas ist nicht schlecht“, pflichtet er ihr bei. Das hellblond gefärbte Haar hebt sich von seinem roten Gesicht ebenso ab wie das Weiß seiner Zähne.
Sitzt sie in der richtigen Bahn? Fine sucht nach einem Anhaltspunkt, in welcher Linie sie sich befindet.
Die beiden reden weiter. „Zum Gartenfest der Firma gibt es Medaillons und … “, die Frau zwinkert dem Mann zu, „Tanja wird wieder alle Männer über den Tisch ziehen, wenn sie trinkt. Früher hatten sie Spießchen aufgefahren und eine größere Auswahl an Salaten, und einen DJ hatten sie auch bestellt …“
Der Mann unterbricht sie. „Das ist lange her, die Firma ist auch nicht mehr das, was sie mal war.“
Es ist nahezu unmöglich nicht zuzuhören. Die makellos weißen Zähne des Mannes sind vermutlich Implantate. Gunnar hat Grauweiß gewählt, er brauchte auch welche. Seit seinem zwölften Lebensjahr seien ihm regelmäßig Zähne ausgefallen, hat er ihr erzählt, und dass Zahnoperationen sein Leben begleitet hätten, bis er diese grauweißen Ersatzzähne bekommen hat. Sie haben dafür einen großen Batzen Erspartes aufgebracht. Vielleicht träumt der gegenüber deshalb von Las Vegas? Fine sucht in ihrer Tasche nach einem Kaugummi.
Sollte sie Gunnar verlassen? Nicht der Zähne wegen.
„Fahrausweis, bitte!“ Sie schreckt auf, schaut den Mann vor ihr an.
„Oh nein. Ich hab vergessen eine zu lösen … Wirklich, normalerweise …“ Die beiden gegenüber beobachten sie.
Der Kontrolleur notiert ihren Namen, fragt nach ihrem Ausweis.
„Der liegt zu Hause, ich hab gar nichts dabei. Nur eine Tüte mit Wunderlauch.“ Sie zeigt neben sich.
Er schüttelt den Kopf. „Sechzig Euro, und ich hoffe mal, dass die Adresse stimmt und Sie zahlen!“
Fine nickt; der spontane Ausflug hat seinen Preis.
Die Reihung wundersamen Erlebens reißt nicht ab.
Es ist ein gewöhnlicher Donnerstag in der darauf folgenden Woche, als der Blutregen fällt. Roter Saharastaub bedeckt den Boden, die Scheiben der Autos, die Blätter der Bäume. Sie hatten ihn im Wetterbericht angekündigt.
Fine kommt vom Einkauf. Auf den Nudelpaketen, Tomatenkonserven und Milchtüten in ihrer Tasche liegen Apfelsinen und Bananen. Sie bricht eine ab, um sie zu essen.
Blut klebt daran, an uns allen klebt Blut, so würde Tonia das sagen und an das Blut der im Mittelmeer Ertrunkenen erinnern, sie würde sagen, das sei das Blut der Opfer einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung. Gunnar diskutiert dann mit ihr. „Wir verdienen unser Geld mit ehrlicher Arbeit. Da musst du erst einmal hinkommen, bevor du anklagst.“ Er bekommt dann ein rotes Gesicht, spricht schnell, braucht viele Worte.
Fine hält sich da raus. Irgendwie hat Tonia ja recht, Gunnar auf andere Weise auch. Also sagt sie besser gar nichts. Dabei würde sie doch auch so gerne mit Tonia diskutieren oder mit Gunnar.
Fine wirft die Banane, die sie gerade geschält hat, in die Mülltonne, setzt sich einen Moment auf die Gartenmauer und lässt die eigentümlichen Spuren des Blutregens auf sich wirken.
Sie wünscht, sie könnte Antonia näher sein. Gunnar näher sein.
Irgendwie war von Anfang an der Wurm drin. ‚Schwangerschaftsdepression‘, hatten sie im Krankenhaus gesagt, und dass das vorkäme, die Hormone und so weiter … Gunnar hatte das Baby gewiegt, beruhigt, wenn es schrie, oft gewickelt und gebadet. Ihr war all das so fürchterlich fremd. Sie hatte sich immer bemüht. Richtig tief verbunden hatte es sich nie angefühlt. Nicht mit dem hilflos quäkenden Säugling, nicht mit dem experimentierfreudigen Kleinkind oder dem bunten Schulmädchen. Nicht mit Gunnar. Oder eben nur ab und zu.
Jetzt diskutieren Vater und Tochter über Bananenkonsum, Spritverbrauch, Mülltrennung und ähnliches, als ginge es um Leben oder Tod. Vielleicht geht es darum. Die Anfang 20-jährige Antonia in DocMartens, schwarzen Baumwollkleidern und immer neuen trendigen Frisuren liebt ihren Papa genau auch wegen dieser Diskussionen.
Beide träumen von Selbstversorgung. Kartoffeln, Stachelbeeren, Möhren, Zucchini, Zwiebeln aus dem eigenen Garten. Sellerie und Bohnen, Stachelbeeren und Kirschen würden dazukommen.
Fine mag den Garten mit der Wiese und den Blumen. Fertig.
„Ich hasse einkochen!“ Gerade gestern wieder diese leidliche Diskussion. „Einmachen ist eine Strafe, eine Buße“, hat sie Gunnar erklärt. „Du übertreibst“, hat der geantwortet. Die Auseinandersetzung ist wie immer wortkarg verlaufen und ergebnisoffen geblieben. Und Gunnar ist mit seiner Stachelbeerstaude und ein paar wenigen Erdbeeren und Erbsen allein in den Garten gegangen. Allein – genauso wie sie mit ihren Einfällen und Erinnerungen: ‚Iss und trink, so lang’s dir schmeckt, schon zwei Mal ist uns das Geld verreckt‘, hatte die Oma gesagt und traurig in die Ferne geschaut. Wenn die Oma so schaute, hatte das mit dem Krieg zu tun. Fine hatte mit der Oma Johannisbeeren und Stachelbeeren geputzt, um daraus Marmelade zu kochen. Die Beeren waren sauer und piekten. Die Arbeit war langweilig. Die Oma war traurig. Mama unberechenbar sauer wie die Beeren.
„Blutregen“, sagt Fine, als sie reinkommt und die Einkaufstasche mit Bananen abstellt.
„Eine Eiszeit kann kommen“, erwidert Gunnar und gähnt.
„Quatsch, nicht Eiszeit. Blutregen …“ Sie seufzt. „Das Wort macht, dass ich mich fühle, als würde Blut an mir herunter rinnen. Dunkles, altes Blut, gefolgt von hellerem, flüssigerem.“
„Jetzt übertreib‘ mal nicht – ist schon ein bisschen arg theatralisch, oder?“ Gunnar räumt die Einkaufstasche aus, stellt die Dinge in den Schrank.
„Wunden platzen auf und bluten. Wenn alte Wunden platzen, kommt das Blut von ganz tief innen“, flüstert sie. „Herzblut. Seelenblut. Meine Seele reißt schneller, je älter ich werde, je gediegener ich lebe.“
Gunnar hört nicht zu, sondern beginnt ihr den Blutregen zu erläutern.
„Es ist eigentlich leicht zu erklären: also, wenn in der Sahara Sandstürme toben, können sie die Sandkörner da so stark aufwirbeln, dass sie in der Atmosphäre landen und sich in den Wolken festsetzen, verstehst du? Diese Staubwolke kann durch eine aktuelle Wetterlage über das Mittelmeer und die Alpen bis nach Europa ziehen. Wenn es dann bei uns regnet, färben sich die Tropfen durch den Sand rötlich und es sieht aus, als würde roter Regen vom Himmel tropfen. Das ist alles.“
„Ah, so …“ Erklärungen beruhigen. Allenfalls. Sie heilen nichts.
Es drängt Fine weiter zureden, unabhängig davon, ob Gunnar jetzt Lust dazu hat oder nicht. „Also Blut trocknet, wenn es versiegt ist. Es bildet dann eine Kruste. Eine Blutkruste. Ein bisschen ähnlich wie diese Blutregenspuren.“ Sie setzt nach: „Gunnar, du weißt, dass es eine kurze Zeit gab, da habe ich mir die Arme aufgeritzt, mit Rasierklingen. Erst, als das Blut über die Arme lief, habe ich mich lebendig gefühlt …“
„Das hat doch mit dem Blutregen jetzt nichts zu tun.“ Gunnar gähnt.
Sie redet weiter. „Erst der Schmerz hält am Leben, davon war ich damals überzeugt. Mama war bei den Verrückten in der Klinik, Papa nur schweigsam und streng und ich, 14 oder 15, hab mich gekümmert … wollt mich kümmern … nur um mich hat sich kein Schwein gekümmert.“ Sie streicht sich über die Narben. „Ich bin dabei blass geworden.“
„Fine …“, Gunnar räuspert sich, „das ist doch lange her und vorbei. Der Blutregen ist ein normales Naturphänomen und Alltag ist eben Alltag. Normal … was soll ich sagen?“
„Normal, was ist das, Gunnar? Normalität ist das Schwierigste von allem. Normalität kann ich nicht spüren! Wie erhebt man sich über die Realität? Künstler können das, glaube ich. Lebenskünstler auch …“
Gunnar zuckt zusammen. „Ehm, … also …“
Sie schaut zu ihm herüber. Wie blutet Gunnar? Blutet er?
„Die Eiszeit kommt irgendwann“, sagt er zu ihr. „Wenn der Blutregen hierzulande häufig fällt, naht vielleicht eine Eiszeit.“
Sie verzieht das Gesicht. „Du spinnst“, gibt sie zurück. „Ich werde auf jeden Fall weder Gemüse noch Früchte einkochen!“
Sie denkt an den Sand, den der Regen zurückgelassen hat. Saharasand. Sie könnte ihn auffegen und ein Bild damit kreieren, ein Bild aus blutigem Sand: Narben und Schmerz vermalen, zu etwas Neuem. Fine-Kunst gestalten. All-tags-Fine-Kunst.
Sie holt einen Besen und fegt den roten Saharastaub von den Steinplatten auf dem Zugang zum Haus.
Gunnar schaut ihr zu.
Sie schweigen.
„Hat der Blutregen jetzt erstmal aufgehört?“ Sie ist fertig mit fegen.
„Ja.“ Er drückt ihre Hand. „Aber wie gesagt, vielleicht kommt dann die Eiszeit.“
Gunnar
Routinen strukturieren das Leben.
Gunnar legt sich normalerweise im Anschluss an die Spätnachrichten schlafen. Vorher geht er einmal durch die gesamte Wohnung, das schmalgeschnittene eigene Häuschen. Kurz vor Antonias Geburt vor 22 Jahren haben sie sich für den Bremer Vorort Blumenthal entschieden. Die dicht aneinander gebauten Wände sind hellhörig. Anfangs hat Fine das gestört. Sie hat sich daran gewöhnt. Sie haben sich nie überlegt noch einmal umzuziehen.
Er schließt, wie immer, die Haustür unten von innen ab, steigt die Treppe wieder hoch und betrachtet dabei die Familienfotos an der Wand: Fine und Gunnar am Strand, Antonia mit Schultüte, Antonia und Fine bei einem Picknick im Park, Antonia bei der Abiturfeier … Antonia ist ausgezogen. Sie studiert in Freiburg. Sie fehlt ihm.
Irgendetwas tut ihm weh. Es sticht im Bauch, wenn er die Treppe hochgeht. Er fühlt sich unwohl. Fine ist überraschend früh zu Bett gegangen. „Ich lese noch“, hat sie gesagt, was auch immer sie liest. Bücher sind nicht seine Welt. Abgesehen von dem Haushaltsbuch. Er geht in die Küche, nimmt es aus der Schublade und trägt die Einkäufe des Tages ein: ein Verbindungsstück und eine Brause für den Gartenschlauch, einen Wetzstein für die ewig stumpfen Messer und je eine Familienpackung Vanille- und Schokoladeneis für die Kühltruhe. Der Sommer kann kommen! Er schreibt die Beträge in die dafür vorgesehene Spalte.
Er kann sich nicht weiter von seinem Unwohlsein ablenken, also ins Bett gehen, ungefähr 40 Minuten früher als normalerweise. Er kann sich sowieso nicht auf die Nachrichten konzentrieren.
Vielleicht wird sich sein Zustand nach dem Toilettengang verbessern. Er reibt seinen Bauch, der in den letzten Jahren runder geworden ist, und kann sich nicht entschließen den Sitz auf der Toilette zu verlassen. Wie Antonia mit 5 oder 6 Jahren. Sie hat es geliebt auf dem Klo zu sitzen und zu philosophieren. „Warum müssen Menschen schlafen?“, „Können Pferde träumen?“, „Hat der liebe Gott auch eine Frau?“ Gunnar fixiert die Kacheln an der Wand, Hellblauvariationen, die leicht ins Weißliche gehen. Nahezu das gleiche Blau hatte das elterliche Bad. Er hat die Kacheln deshalb immer schon einmal rausreißen wollen. Der Dreck, die Kosten, der Aufwand haben ihn davon abgehalten. Fines Kleider liegen wie immer auf dem Hocker neben dem Handtuchhalter. Er kann von der Toilette aus danach greifen, riecht an ihrem Shirt, betrachtet Slip und BH und legt ihre Wäsche dann wieder sorgfältig hin. Am Haken hängt ihr geblümter Bademantel. Gunnar streicht mit der Hand über den Stoff, bevor er schließlich ins Bett geht.
Er wacht in dieser Nacht häufig auf, wälzt sich hin und her. Es ist warm, nahezu stickig. Fine liegt neben ihm und schläft fest. Sie hat ihre Decke weggestrampelt. Er streicht den seidigen Stoff ihres Nachthemds über ihrem Körper glatt.