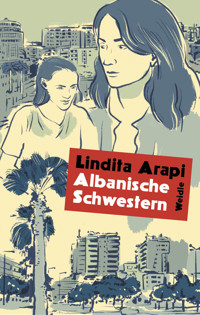Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weidle
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über Heimat, Zugehörigkeit und Chancengleichheit – und die Sehnsucht Albaniens nach Europa Ihre Kindheit in Albanien ist geprägt von dem Gefühl, gehorchen zu müssen. Lin ist eine Angepasste in einem Land voller Regeln, ein braves Mädchen: Sie fügt sich, sie errötet, wenn Erwachsene mit ihr reden. Als Bücherwurm fühlt sie sich unter Gleichaltrigen fremd. Ihre Sehnsucht nach Bildung ist groß – doch Familien wie ihrer, die mit den Kommunisten in Widerspruch geraten sind, wird Bildung verwehrt. Lindita Arapi schreibt über die albanische Diktatur, die Studentenproteste von 1990, die politische Verfolgung und den steinigen Weg Richtung Demokratie: Europa erscheint wie ein weit entfernter, unerreichbarer Planet. Erst nach der Wende 1990 hat sie die Möglichkeit, zu studieren. Es bewegt sie die Distanz, die entsteht, als sie ihr Heimatland verlässt, und sie fragt sich: Wie hängen Sprache und Heimat zusammen? Darf ich über mein Heimatland in einer fremden Sprache schreiben? Sie fängt an, zu schreiben – auf Deutsch, weil sie für diese Erlebnisse, diese Zeit, eine neue Sprache finden muss. »Lindenblüten für Bücher« ist ein zartes und nachdenkliches, ein zutiefst menschliches Buch – ein Buch über den Wunsch nach Freiheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lindita Arapi
Lindenblüten für Bücher
Weidle Verlag
Für Fiona und Floria
Eine öde Wüste war es. Traumbefreit. Keine menschenleere Gegend, keine kahle Landschaft, die Wildrosen am Zaun des Hofes ließen manchmal einen Hauch der Schönheit für einige Momente verweilen. Aber es geschah nichts.
Jeden Tag verschmolz der Alltag in diesem milchig nebligen Nichts. Inmitten des Nichts der Provinz ein Kind. Die Augen zum blauen Himmel, wartend, dass das Blaue hinabstürzt. Irgendwann wird der Himmel in Millionen blauen Glasstücken auf die Menschen herabstürzen, dachte es. Denn der Himmel schien ihm eine gigantische Glaskugel, die irgendwann fallen wird. Dahinter würde es bestimmt anderes geben, dachte das Kind, und sehnte sich so sehr nach einer Katastrophe. Einem Himmelssturz. Damit der Vorhang, dieses Hindernis zu anderen Welten, für immer zerrissen wird.
Es würde eine neue Zeit beginnen, ein anderes Leben, von dem es keine wirkliche Vorstellung hatte. Vielleicht aber hätte sich das Kind in diesem anderen Leben nicht mehr gefragt, ob es verdiente, überhaupt auf dieser Welt zu sein. Vielleicht hätte sich seine Familie nicht mehr ohnmächtig gegenüber den Behörden gefühlt. In diesem anderen Leben hätten sie dazugehört, sich frei gefühlt – auf den Straßen der Stadt.
Der Himmel blieb aber fest und meistens blau.
Eine Kindheit, die sich im Verlauf der Zeit nicht ändert, hinterlässt viele leere Stellen. Vergeblich versuche ich, an die Decke starrend, meine Erinnerungen auszuwringen. Aber nur eine Handvoll Erinnerungen sind dem endgültigen Vergessen entronnen.
Das Kind fand damals keine Ruhe. Und heute, als Erwachsene, trage ich, wohin ich auch gehe, stets jene Zeit bei mir. Ich will sie nicht mehr verstehen, ich will mich von ihr befreien.
Das erste Mal schreibe ich nicht in meiner Muttersprache. Ich borge mir Wörter aus einer anderen Sprache. Deutsch. Ich borge mir diese Sprache, im Bewusstsein, dass sie nicht meine eigentliche, meine erste Sprache ist. Sie steht mir nur zur Verfügung, und ich schaffe mir dadurch die nötige Distanz zu dieser Zeit. Denn ich fühle mich klein und wertlos, wie das Kind damals, wenn ich in meiner Muttersprache darüber schreibe. Ich fühle die Ohnmacht, wie damals, und ich will diese Ohnmacht hinter mir lassen.
Es ist ein Wagnis.
Dieser Versuch, mit den Erinnerungsfetzen, die ich einer anderen Sprache anvertraue, eine vergangene Welt wiederzubeleben, zu zerpflücken. Ein Blindflug, währenddessen ich der neuen Sprache mehr vertrauen werde, vertrauen muss, als sie mir. Es bleibt mir nur die Hoffnung, jene, die die französische Philosophin und Vertreterin der écriture féminine, Hélène Cixous, in ihrem gemeinsamen Buch mit Jacques Derrida, Die sexuelle Differenz lesen, ausspricht, als sie Antworten in der Sprache zu finden suchte. Sie war überzeugt: »Was wir nicht wissen […], das weiß die Sprache.« Dennoch ist dies eine »unermüdliche Arbeit des Entschleierns, des Aufspürens, Ortens, des Wühlens, des Grabens«, wie Cixous schreibt.
Angst einatmen
Für mich war es eine Zeit des Nichts.
Ein Leben unter einer Glocke.
Innerhalb eines gewissen Radius, der nicht erweitert werden durfte. Außerhalb der Glocke wartete der Tod.
Über dieses Nichts wachte die Angst. Die Luft war davon geschwängert.
Ich atmete sie Tag ein, Tag aus.
Ich atmete Angst ein und erstarrte.
Und es war nicht einmal ein Zustand des Leids. Ich kannte ja nichts anderes. Nur ein dumpfes Lebensgefühl, fortwährend, als Normalzustand akzeptiert. Ein Kind lebt im Heute, das ist sein Zustand und es nimmt ihn an, wenn es nichts anderes kennt. Ich war aber kein Kind, wenn man an die Kindheit als eine Zeit des Spielens und Austobens denkt. Diese Kindheit ist mir fremd geblieben. Dass mir von dieser Zeit jene Schätze fehlen, wie Astrid Lindgren sie nennt, war mir nicht bewusst. Schätze, die man mit sich herumträgt und aus denen man ein Leben lang schöpfen kann. »Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird.«
Ich war traurig, wenn ich Freundinnen nicht treffen sollte, weil ich als Kind vielleicht das Geheimnis des Hauses – wir waren verwandt mit den Feinden des Volkes – ungewollt verraten würde. Ich atmete Angst ein, auch wenn ich allein im kleinen Hof Köchin spielte und den Teig aus Matsch in gefundenen Deckeln von weggeworfenen Gläsern plattdrückte. Wenn ich in die Schule ging, mit grundlos zitternden Händen. Wenn ich, das Pummelchen, vor meinen riesig großen Eltern mit gesenktem Kopf stand, kurz vor einer Bestrafung wegen Belanglosem. Wenn ich mich allein im Dunkeln in den Gassen meiner Stadt auf dem Weg nach Hause befand. Ich atmete Angst ein und rannte nach Hause.
Nach Hause, wo die Glückseligkeit fremd war. Denn die Freude hatten meine Eltern verbannt. Man gewöhnt sich an ein Leben als eine öde Ode ohne Freude. Freunde hatte ich keine, aber viele Schwestern. Ich sollte nicht draußen spielen. Denn das Draußen bedeutete Gefahr. Die Meinung meiner Eltern wurde unmissverständlich ausgedrückt: Wehe, wenn du allein nach draußen gehst!
Draußen würde ich schmutzige Wörter lernen. Als Folge könnten schmutzige Gedanken aufsprießen. Das war das erste Gebot: Denn solchen Gedanken folgen irgendwann schlimme Taten.
Als ob sich da draußen die große, weite Welt abspielte!
Unser Haus lag in einer kleinen Gasse, mit einer kleinen staubigen Spielfläche am Ende, wo die Jungs grundlos schrien und spielten, die Schwere der Fäuste aneinander testeten, herumbalgten im Staub und Schlamm, vom Gestank des Mülls begleitet, der tagelang nicht abgeholt wurde.
Auch wenn meine Eltern es mir erlauben würden, hätte ich keine Lust gehabt, draußen zu spielen. Ich war an mein bisheriges Leben in diesem Käfig gewöhnt, und ich wusste nicht, worüber ich mit anderen Kindern hätte reden sollen. Über Bücher? Dafür war die Schule da. Ich benahm mich wie eine Stumme, als ich meine Altersgenossen traf, ich war ihnen als Bücherwurm fremd. Außerdem vererbte meine Mutter mir ihren Sauberkeitswahn. Draußen zu spielen hieß, mit schmutzigen Kleidern nach Hause zurückzukehren.
Dennoch zog das Draußen mich in gewisser Weise an mit dem Reiz des Unbekannten. Hinter dem Spielfeld mündete die Gasse in eine andere Gasse mit winzigen Häusern auf beiden Seiten, dann folgte ein breiterer, unbefestigter Weg, der einen schnurstracks auf eine asphaltierte Straße und dann direkt in die Stadtmitte von Lushnja führte.
Das war die große Welt!
So klein war meine damalige Welt!
Vorsicht! Denn auch in diesem Städtchen könnten die Geschehnisse außer Kontrolle geraten, meinten meine Eltern. Es gab ein Kino, das Exekutiv- und Parteikomitee, einen Kulturpalast, ein Restaurant, kleine Geschäfte und sogar ein Hotel. Aber es gab keinen Grund, im Zentrum der Stadt zu sein, außer man hatte, so schnell wie möglich, etwas zu erledigen, um zügig wieder nach Hause zurückzukehren.
Die Uhr wurde schon beim Hinausgehen innerlich gestoppt.
Allein im Zentrum herumvagabundieren? Ich könnte mich plötzlich frei fühlen, Sehnsüchte entwickeln, sie weiterspinnen, nicht aufhören, und am Ende würde mich eine fürchterliche Metamorphose entstellen.
Ich könnte anfangen zu wünschen! Ich würde es wagen zu wünschen! Denn ich war wunschfrei. Keine Erwartungen, keine Wünsche.
Es könnte so weit kommen, dass ich etwas wollen würde, was nicht erlaubt war. Es könnte sein, dass in mir der Wunsch keimte, eine eigene Meinung zu haben, selbst entscheiden zu können. Über den Zaun zu springen. Eigene Wege zu gehen. Wege, die mich aus der Stadt, der Hauptstadt, vielleicht auch außerhalb des Landes führen würden, obschon die Vorstellung utopisch schien. Es könnte der Wunsch keimen, das traditionelle Gehege zu verlassen. Den Eltern zu widersprechen. Den guten Ruf eines Mädchens zu zerstören. Alarmzeichen!
Falscher Alarm, wollte ich brüllen! So weit bin ich noch lange nicht. Der Käfig konnte offen sein, mir würde nicht mal in den Sinn kommen, zu fliehen.
Aber ich konnte nicht brüllen. Ich war stumm.
Lange war ich stolz auf dieses Mädchen, das niemandem Sorge bereitete, die besten Noten nach Hause brachte, im Haushalt mithalf, sich vorbildlich benahm. Das errötete, wenn es mit Erwachsenen sprach. Jahrzehntelang war ich hungrig nach dem Lob der Eltern, der Lehrer, der Verwandten. Ich dachte, ich genügte nie, um ihr Lob zu verdienen – ohne zu merken, wie sehr diese Gefügigkeit, diese Unfreiheit mich entstellte.
Am liebsten versank ich in Romanen, die ich manchmal zwischen den Schulbüchern versteckte, damit meine Mutter nicht herausfand, dass ich nicht für die Schule lernte. Die Romane machen dich verrückt, du sollst sie nicht lesen, sagte sie. Lerne für die Schule, du musst die besten Noten haben, damit du vielleicht irgendeine Chance bekommst. Sie schenken uns nichts, das weißt du. Sie, damit war die Partei, die Volksmacht gemeint.
Meine Mutter gehörte nicht dazu. Sie hat sich auch nie darum bemüht, dazuzugehören. Das wollte sie nicht. Sie sprach wenig und arbeitete viel. Sehr viel. Ruhe gönnte sie sich nie, außer wenn sie außer Atem vor Erschöpfung war. Überhaupt gönnt sie sich bis heute nie etwas. Die Arbeit als Therapie, womit man das Leiden verdrängen kann. Heute erkenne ich, dass ihre Hingabe und ihr Fleiß ungewöhnlich waren, fast pathologisch, weil sie auch die Schmerzgrenze überschritten. Unter höllischen Schmerzen wegen der vielen aufeinanderfolgenden Bandscheibenvorfälle setzte sie draußen den großen Kessel aufs Feuer, wartete, bis das Wasser kochte, benutzte das einzige zur Verfügung stehende Waschmittel, Milva, ein aggressives Pulver, das ihre Hände rot werden ließ, und wusch. Sie wusch ständig. Sie wusch draußen voller Wucht die Bettlaken unserer so großen Familie.
Erholung, Urlaub, Ausruhen waren für meine Mutter Fremdwörter. So auch Glück und Schönheit. Auf Glück pfiff sie, weil mit Glück nicht sie gemeint war. Vor der Schönheit hatte sie Angst, eine Mutter mit so vielen Töchtern konnte nicht anders. Schönheit war für sie gefährlich.
Meine Mutter hatte keine Sprache für ihr Leid gefunden: Als zweijähriges Kind war sie mit Mutter und Verwandten deportiert worden und hatte später in großer Angst und Armut gelebt. Diese Sprache suche ich heute für sie. Denn heute weiß ich, dass sie nicht nur Angst hatte, zu sprechen, auch vor uns, sondern dass sie verstummt war. Sie lebte im Bewusstsein, dass sie kein Recht hatte, zu sprechen. Vielleicht nicht mal eines, zu existieren, und nur durch einen ungewöhnlichen Arbeitsdrang fand sie für sich immer einen kleinen Platz. Nicht am Kopf des Tisches. Immer am Ende. Sie suchte nicht das Beste für sich, sondern nahm das, was übriggeblieben war. Ich spürte, dass sie unglücklich war. Sie haben meinen Vater umgebracht, sagte sie nur einmal leise. Sie – damit waren die Kommunisten gemeint.
Aber eines hat sie nie verloren. Die Würde. Die Armut, die Schmerzen, die gesellschaftliche Ausgrenzung, alles ertrug sie mit Würde. Das ist der Schatz, den sie mir mitgegeben hat.
Ein Glück widerfuhr ihr dennoch: mein Vater. Ein wunderbarer Erzähler, der nicht nur sie, sondern jeden aufheitern konnte. In jeder kleinen Alltagssituation erzählte er gern eine Geschichte. Oft waren es alte Geschichten von Brauchtum und Mahnung. Und die Mahnungen gingen natürlich immer an uns Mädchen. Er erzählte mit Leidenschaft und brachte uns Mädchen, aber auch die Gäste, zum Lachen. Ein wahrer Geschichtenspeicher.
Ansonsten wurde wenig gesprochen. Noch dazu war unsere Sprache dermaßen karg und korrekt, ja eingeengt, dass es schmerzte. Ihre Grenzen wurden immer unüberwindbarer, meine Gedanken prallten schnell an eine unsichtbare Wand, weil mir der Ausdruck für sie fehlte.
Eine Sprache unter dem Diktat der Ideologie, die auch das Denken verarmen ließ. Meine Schwestern und ich wählten unsere Worte mit großer Vorsicht. Sie mussten erlaubt sein, sollten unsere Eltern und die Welt da draußen nicht verärgern. Mit der Sprache provozieren? Soweit reichte nicht mal unsere Fantasie.
Vornehm sein! Das zweite Gebot, denn wir waren Mädchen, und eine derbe Sprache entspricht einem feinen Mädchen nicht.
Vorsichtig sein! Das dritte Gebot: Weil auch die Wände Ohren hatten, und wenn etwas laut gesagt wurde, das als Propaganda oder als Agitation hätte gelten können, wären wir alle verloren gewesen. Hätten wir laut gesprochen und uns über unser Schicksal als Nachkommen der Volksfeinde beschwert, verrieten uns vielleicht die Nachbarn. Wir befanden uns zwar nicht im Internierungslager, das hatte meine Mutter hinter sich, dennoch standen wir unter Beobachtung. Ein falsches Wort. Ein falsches Benehmen. Eine Widerrede – und das Licht wäre für alle erloschen.
Meine Eltern wiederholten es unermüdlich.
Vorsicht!
Vorsicht!
Vorsicht!
Das meistgehörte Wort meines damaligen Lebens.
Irgendwann wagte ich es vor lauter Vorsicht nicht mal mehr, mich überhaupt zu äußern. Nur den auswendig gelernten Schulstoff plapperte ich nach – für ihn brauchte ich keine eigene Meinung zu haben.
Und irgendwann entstand aus all dem auch ein Gedicht.
Vorstädter!
Hier
Wo nicht einmal Platz ist
Zum Weinen.
In Häusern wir Streichholzschachteln,
Die Wände dünn geworden vom Kindergeplärr.
Selbst deine lautlosen Schluchzer gehören nicht dir.
Hier
Leben die Leute jammernd.
Jammern einander etwas vor.
Die Mütter sind eifersüchtig auf das Geklage,
Auf das niemand hört.
Menschen am Rand
Einer vergessenen Welt.
Sie vermögen
Verwandte zu hassen,
Doch Fremde lieben sie.
Den ganzen lieben Tag, den Gott werden lässt,
Treiben die alten Weiber Magie.
Und das Glück der Mädchen ist gebunden.
Gelichtet die Reihen der Männer.
Du erstickst fast.
Den Blütenblättern im Hof stockt der Atem.
Die Nostalgie ist genauso wie ehedem,
Seit ich geboren wurde,
Nur das Laub hat sich verändert,
Je nach Jahreszeit.
Die Nacht bricht schneller an,
Schwer wie das unheilvolle Geschick der Vorstädte.
Ohne Raum.
Ich kann nie, niemals,
frei sein …
Dann würden mir die Eltern
sterben.
*
Es waren die 80er! Die gnadenlose Diktatur hatte schon angefangen zu zerbröseln, doch ich konnte es damals nicht erkennen. In meiner Familie und meiner Gegend zirkulierten keine geheimen Informationen über die Lage des Landes, der Partei. Das war ein Luxus der höher Gestellten. Auch einfache Fragen unsererseits könnten schnell als Propaganda und Agitation verstanden werden. Wer schnell hinter Gittern kommen möchte, kann gern sein Maul aufreißen, wie mein Vater zu sagen pflegte.
Lieber schweigen.