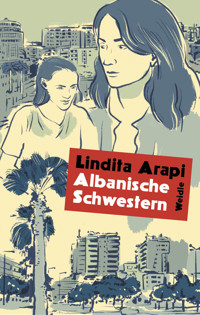12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dittrich Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer kleinen albanischen Stadt, in einer Mustergemeinde im Aufbau in kommunstischer Zeit, betrachtet das Mädchen Lodja Lemani die Welt vom Küchenfenster des kleinen Elternhauses aus. Sie darf nicht draußen mit anderen Kindern spielen, flaniert nicht, schön gekleidet wie ihre Freundinnen, auf dem ersehnten Abendgiro. Ihre Freizeit verbringt sie nur im kleinen Vorhof des Elternhauses. Und nachts setzt sich ein männlicher Schatten, finster und furchterregend auf ihre Bettkante. Die Familie Lemani lebt ausgegrenzt, weil sie eine "schwarze Biografie" hat. Lodjas Großvater wird 1952 als Großbauer vor den Augen seiner Tochter von den neuen Machthabern gelyncht. Gesprochen wird darüber in der Familie nicht. Für Lodja ist alles undurchsichtig und geheimnisvoll. Nach der kommunistischen Zeit und nach Ende der Selbstisolierung Albaniens, verlässt Lodja ihr Land und lebt als junge Frau alleine in einer westeuropäischen Stadt. Die ungewohnte Freiheit ist verwirrend für sie, vertraut ist ihr nur die Selbstisolation, in die sie sich auch hier zurückgezogen hat. Sie reist nach Albanien, um das familiäre Geheimnis aufzudecken. Eine Reise in die Vergangenheit zu den Sippen ihrer Mutter und ihres Vaters beginnt. Die archaischen Strukturen auf dem Land haben sogar den Kommunismus überlebt. Lodja trifft auf große Ablehnung bei ihrer Spurensuche, aber auch auf Menschen, die ihr helfen, sich der dunklen Vergangenheit ihrer Familie zu nähern. Und danach bricht auch Lodjas Mutter ihr Schweigen. Ein berührender Roman, der nicht nur die ungleichzeitige Entwicklung in den Ländern Europas schildert, sondern auch zeigt, dass man ohne Wurzeln keine Flügel hat, um die eigene Zukunft frei zu gestalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Lindita Arapi
Schlüsselmädchen
Lindita Arapi
Schlüsselmädchen
Roman
Aus dem Albanischen von
Joachim Röhm
Herausgegeben von
Nellie und Roumen Evert
Die editionBalkan im Dittrich Verlagist eine Gemeinschaftsproduktion mitCULTURCONmedien
Die Herausgabe dieses Werks wurde gefördert durch TRADUKI, ein literarisches Netzwerk, dem das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich, das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland, die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, Kultur-Kontakt Austria, das Goethe-Institut, die Slowenische Buchagentur JAK und die S. Fischer Stiftung angehören.
Bibliografische Information der DeutschenNationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über >http://dnb.ddb.de< abrufbar.
ISBN 978-3-937717-85-2
eISBN 978-3-943941-04-3
© Dittrich Verlag GmbH, Berlin 2012Die Originalausgabe erschien unter dem Titel»Vajza me çelës në qafë«, Botimet Ideart, Tirana 2010Lektorat: Bettina HesseUmschlaggestaltung: Guido Klütsch
www.dittrich-verlag.de / www.culturcon.de
Für Fiona und Floria
PROLOG
Ich bin ein Opfer ohne Namen und ohne Grab! Fortgegangen aus dieser Welt an irgendeinem Tag irgendeines Monats in irgendeinem Jahr. Ohne Namen, weil mein Name belanglos geworden ist. Ohne Grab, weil mein Leichnam nicht gefunden werden sollte.
Sie warfen mich an jenem Tag einfach in ein Loch wie einen verendeten Köter. Rosen zu meinem Gedenken? Welch eine Idee! Niemand weinte mir eine Träne nach.
Nun bin ich auf ewig dazu bestimmt, als Nichts im Nirgendwo zu verweilen, nach der Erde riechend, die auf mir lastet, vom Regen durchnässt, mein Leib ein Garten für die Würmer, ohne Aussicht darauf, dass jemand kommt und mich beweint. Aber was am schlimmsten ist: »Aas« plärrend, rollten sie mich mit Fußtritten zu der Grube, in die sie mich stießen. Sie gaben sich Mühe, die Erde dort zu verwischen, denn keine Spur sollte von mir bleiben auf dieser Welt, keiner, der vielleicht suchte, sollte mich finden.
Einst war auch ich einer von euch Menschen, mit Stärken und Schwächen wie alle, und wünschte mir, dass mein Ende dereinst so friedlich wie möglich sein möge. Ich habe mit den anderen gelacht, ihnen, wenn ich konnte, Gutes getan, sie gestützt, wenn ihnen das Gehen schwerfiel.
Nun nennt man mich Opfer. Und ich sage euch: Als Opfer von dieser Welt gehen zu müssen, ist das schlimmste Unglück!
Sie nehmen sich heraus, deinen Schicksalsfaden einfach durchzuschneiden, aber du nimmst das Recht mit dir fort. So, wie der Tod unwiderruflich ist, lässt sich auch Unrecht nicht ungeschehen machen.
Hier drüben kommen viele an, für die meisten war die Uhr abgelaufen, andere tötete man aus Lust am Töten. Und manchen Bedauernswerten brachte eine kleine Unaufmerksamkeit hierher, ein Fehler, über den er sich nur bei Gott beklagen kann. Aber die Unglücklichsten, die am meisten Verachteten sind wir.
Darum mögen wir das Wort Opfer nicht.
Wenn du dich als Opfer bezeichnest, gestehst du ein, dass du an jenem Tag des Jahres X zu schwach warst, um dein Leben zu verteidigen. Du weckst Mitgefühl, du tust den Leuten leid, obwohl du gar kein Mitleid möchtest.
Es ist uns bestimmt, zu vergehen, Erde zu werden. Aber ich kann nicht zerfallen, für die Blumen zur Nahrung werden. Darum seufze ich, auch wenn sie mich nicht hören. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Die über mir auf der Erde gehen, sind Lebende und Überlebende, die Sprache unserer Welt verstehen sie noch nicht.
Ich möchte endlich zerfallen. Meine Uhr ist schon vor so langer Zeit stehengeblieben, aber ich bin noch nicht verwest.
Das Pfand, das ich auf der anderen Seite zurückgelassen habe, verhindert es. Als ich meinen letzten Seufzer von mir gab, entwich es mit der Seele. Es war ein tiefer Seufzer, stellt euch nur vor, wie sich der Seufzer von jemandem anhört, der für nichts und wieder nichts eure Welt verlassen muss.
Deshalb belästige ich euch mit meinem Schwatzen und Murren. Das Pfand muss eingelöst werden.
Mehr will ich nicht. Jedenfalls mich nicht einmischen in die Geschäfte der Oberwelt. Ich weiß ja, die Erinnerungen eines Opfers sind lästig und unangenehm. Ich will nur verwesen!
Das Pfand, das ich zurückgelassen habe, geistert weiter bei euch herum. Bis es eingelöst ist, warte ich.
Ich bin nicht ruhig, so wenig wie ihr in eurer Welt. Wer es mit dem Pfand zu tun bekommt, ist nicht zu beneiden, Tag für Tag drückt es ihm mehr auf die Seele. Jeden, den es auswählt, bringt es um den Schlaf, um den Verstand, er irrt ohne Orientierung durch die Welt, ohne zu wissen, was er eigentlich sucht. Selbst die Luft wird schwer von dem Gewicht des Pfands. Es will niemanden erschrecken, die Lebenden haben einfach Angst vor Gespenstern, und das Pfand ist sprachlos, es kann dem, den es erwählt hat, nicht sagen, wie es eingelöst werden möchte.
Der Verfolgte begreift nicht, dass er erwählt ist, sondern hält sich für verflucht! Jene aber, die vom Dämon nicht besessen sind, halten den Armen für verirrt und setzen ihm übel zu.
Welch ein Durcheinander!
Aber ich kann den Knoten in der Welt dort oben nicht entwirren. Und das Pfand nicht zurückholen, ehe es eingelöst ist.
Es will keine Rache, es will kein Blut. Es verlangt nicht, dass der Mörder verurteilt wird, ob ihr es tut, bleibt euch überlassen. Aber selbst wenn man ihn zur Rechenschaft zöge, wenn dem Recht Genüge getan würde, ich hätte nichts davon. Was nützen mir Entschuldigungen? Man hat nur ein Leben.
Das Pfand will nicht die Welt verbessern, es predigt keine Brüderlichkeit und beruft sich nicht auf die zehn Gebote: Dass der Mensch keinen andern Menschen töte, dass er ihm nicht grausam und gegen alles Recht das Leben wegnehme. Doch das predigen wir schon seit zweitausend Jahren. Geändert hat sich nichts. Gar nichts. Schaut euch nur mein Beispiel an!
Was mich angeht, so steht das Pfand für meinen letzten, ganz einfachen Wunsch, der Niemandem schadet. Dort, wo der Schleier des Vergessens über die Vergangenheit gebreitet wird, wo die Tragödien unter Verschluss gehalten werden, lässt es sich nicht frei atmen, die Luft riecht nach Erde. Wir wollen, dass ans Licht kommt, was geschehen ist, dass unsere Geschichten von Generation zu Generation weitergegeben werden, dass sie nicht dem Vergessen zum Opfer fallen.
Mein Pfand wird bleiben, bis ein Mund erzählt, eine Hand aufschreibt, was damals vorfiel.
Nur wenn das geschieht, kann es verfallen. Versöhnung gibt es nur, wo eine Tat ins Gedächtnis eingeht. Das Pfand hat dann bei euch nichts mehr zu suchen. Es kehrt zu mir zurück.
Damit ich endlich zu Erde werden kann!
ERSTER TEIL
1
Die Ellbogen auf dem Sims des Küchenfensters und das Gesicht in die Handflächen gestützt, so dass die runden Wangen zusammengedrückt wurden, wartete Lodja Lemani, die Zehnjährige mit Pagenkopf und der freundlichen Miene einer Großmutter, geduldig auf die langsam eintreffende Dämmerung. Das kleine Fensterquadrat ging auf ein holpriges Sträßchen hinaus, das sich im Partisani-Viertel von D. zwischen den einstöckigen Häusern hindurchwand. Die kleine Stadt war eine der jüngsten im sozialistischen Staat, in freiwilligen Arbeitseinsätzen erbaut von der Belegschaft einer eben in Betrieb genommenen Kunstdüngerfabrik.
Das Fenster, Lodjas Verbindung zur Welt, befand sich an einer strategisch günstigen Stelle. Von dort aus, ein wenig versteckt und geborgen wie ein Kätzchen im Korb, belauschte sie voller Neugier die Gespräche der bekannten und unbekannten Passanten.
So erfuhr sie eine Menge von dem, was sich jenseits der Haustür abspielte, vor allem, wenn sich abends die Frauen des Viertels auf der Gasse versammelten: Wo der Haussegen schief hing, wer sich gerade mit wem überworfen hatte, wer von den Nachbarn für die Staatsmacht spionierte oder besonders linientreu war, bei wem die Fernsehantenne in Richtung Italien zeigte, und wer heimlich Hühner hielt. Dazu den ganzen Tratsch über Liebschaften und bevorstehende Hochzeiten im Viertel. Sie hörte das meist fröhliche, manchmal auch bedrohliche Geschrei der Kinder und versuchte daran festzustellen, welches Spiel draußen gerade gespielt wurde.
Gelegentlich gelang es ihr, aus dem Getuschel ein Geheimnis herauszufischen, doch das war schwierig, weil die Sprache oft unverständlich klang; fast hätte man glauben können, die Nachbarn wetteiferten wie Schulkinder darin, wer die Worte am schnellsten rückwärts aufsagen konnte.
Von ihrem Fenster aus unternahm sie viele Reisen zu unbekannten Orten und Ländern, die wahrscheinlich wirklich existierten, für Lodja aber so unerreichbar waren wie der Mond. Sie versuchte sich das Leben auf anderen Planeten vorzustellen, doch ihre Phantasie versagte, sobald sie bei den Grenzen der Stadt ankam. Dann blieb ihr nichts anderes übrig, als in ihrem Winkel am Fenster in Träume versunken auf die Dämmerung zu warten.
Deren Ankunft wurde von den Hausfrauen des Viertels bekannt gegeben, die nacheinander die Türen ihrer Häuser so heftig hinter sich zuschlugen, als wollten sie den ganzen angestauten Ärger bei den verblassten Flügeln abladen, die schon kaum in ihren rostigen Angeln hielten, wenn man sie offenstehen ließ.
Lodja konnte die Frauen aus der Nachbarschaft mittlerweile am Geräusch der zufallenden Haustüren erkennen und sogar sagen, welche von ihnen den schlimmsten Tag gehabt hatte.
Sie presste die Handflächen noch fester an ihre Pausbacken, pustete sich die Haarsträhnen aus den Augen, froh, keine Tür zu sein.
Sie freute sich schon auf den letzten Akt ihres allabendlichen Rituals.
In den winzigen Küchen der einstöckigen Häuschen gingen nacheinander die Lichter an, man entnahm den in Form und Farbe identischen Küchenschränken Gläser und Teller, breitete die Tischdecken aus, wies Kinder zurecht, die sich an den noch nicht aufgetragenen Speisen vergriffen, und wenn dann alles für das Mahl bereit war, wurden die letzten Säumigen barsch herbeizitiert, ehe man mit einer schroffen Bewegung die Vorhänge zuzog und Lodja aussperrte.
Der tat es weh, so ohne Gutenachtgruß verjagt zu werden, sie flehte die Hausfrauen heimlich an, die Vorhänge wenigstens einen Spalt offen zu lassen und nicht einfach ruck-zuck den einzigen Fernsehapparat, der ihr ein wenig Einblick in die Welt gab, auszuschalten.
Doch nach einigen Minuten Stille, in denen alles in der mal blauen, mal schmutziggrauen Dunkelheit versank und sie auf die Ruhe lauschte, die sich über die flachen Giebel des Viertels legte, verflog ihr Kummer und sie freute sich, dass die Nachbarsfrauen nach Stunden, in denen die Wände mit ihrem Fett und Schweiß durchtränkt worden waren, endlich die Straße draußen freigegeben hatten. Hätten ihre Eltern es erlaubt, so wäre sie hinausgerannt, um auf dem nahegelegenen Platz allein oder mit den Hunden zu spielen, die gerade dabei waren, in der Dämmerung in den Mülltonnen zu wühlen.
Doch sie hoffte vergebens, denn diese Regel wurde nie gebrochen. Lodja durfte nicht vor die Tür, um mit den anderen Kindern zu spielen, und so beschränkte sie sich darauf, die warme Sommerluft tief einzuatmen und zu überlegen, was ihr eigentlich lieber gewesen wäre: Dass die Sommerferien so rasch wie möglich vorübergingen und die Schule samt den Schwatzereien mit Genc, ihrem Klassenkameraden, wieder begann, oder dass der Winter so rasch wie möglich kam und den Nachbarinnen die Kälte in die Glieder trieb, damit das Sträßchen leer blieb.
2
Die Tratschliesen, wie Lodjas Mutter die Frauen aus der Nachbarschaft nannte, drängten mit dem anbrechenden Abend heraus auf die Gasse. Es begann ein allgemeines Zusammentrommeln, die eine schrie, die andere schlug gegen die Tür. Wenn der Haufen endlich versammelt war, glich er einer triumphierenden Heerschar, die stundenlang die Straße besetzt hielt. Im Sommer fand man sie im Freien, sobald die Hitze etwas nachgelassen hatte. Einige Minuten lang wurde heftig gezankt, bis entschieden war, an welcher Mauer sie die angenehmsten Stunden des Tages verbringen wollten, die Stricknadeln mit ihren scharfen Spitzen wurden geschwenkt wie Degen, nicht anders die ungefährlichen Häkelnadeln, Füße stießen gegen Schemel, um sie zurecht zu rücken, man ließ sich eng beisammen nieder, strich mit den Händen gemessen die bestickten Schürzen glatt, einmal, zweimal, dreimal, holte Brot hervor, dann Käse, und das große Geschnatter begann. Wer eben erst von der Feldarbeit zurückgekommen war und kein Essen vorkochen konnte, brachte Schüsseln mit Tomaten, Zwiebeln, Fleisch oder Reis mit, ein Messer, reichte herum und sammelte ein, schnitt Fleisch, ohne mit dem Plappern auch nur eine Sekunde aufzuhören.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!