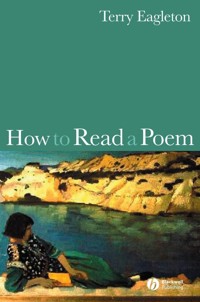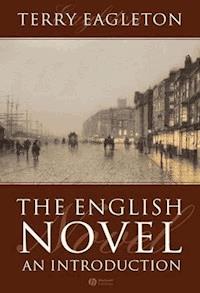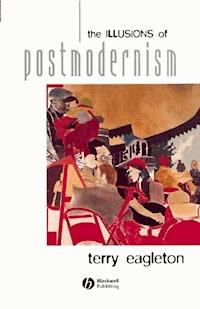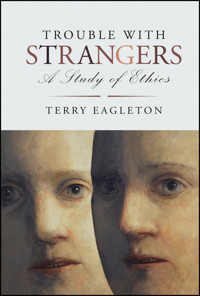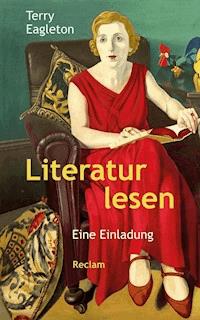
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Sprache: Deutsch
Was macht gute Romane, bedeutende Theaterstücke oder ausgereifte Gedichte aus? Die berühmten ›Bücher, die man gelesen haben muss‹ haben – wenn sie mehr sind als Modeerscheinungen, sondern große Literatur – weit mehr zu bieten als nur eine gute Geschichte. Ihre Kraft liegt ebenso in der kunstvollen Anlage von Handlung und Figuren, ja selbst von einzelnen Sätzen und Wendungen. Der renommierte britische Literatur- und Kulturwissenschaftler Terry Eagleton nutzt das Handwerkszeug der Literaturanalyse in seiner ganzen Vielfalt, er untersucht rhetorische Stilmittel, und erklärt, wie literarische Gattungen funktionieren müssen. Unterhaltsam lässt Eagleton den Leser in die vielfältigen Bedeutungsebenen literarischer Werke von Shakespeare bis J.K. Rowling eintauchen und zeigt, wie die Texte ihre Wirkung entfalten. Theoretisch versiert und scharfsinnig, dabei gewohnt unorthodox, vermittelt Terry Eagleton das Geschäft des Literaturkritikers und lädt zugleich jeden von uns ein, mit neuen Augen zu lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Terry Eagleton
Literatur lesen
Eine Einladung
Aus dem Englischen übersetzt von Holger Hanowell
Reclam
Zum Andenken an
Adrian und Angela Cunningham
Titel der englischen Originalausgabe:
How To Read Literatur.
New Haven / London: Yale University Press, 2013
Alle Rechte vorbehalten
© 2013 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Umschlagabbildung: Cagnaccio di San Pietro, Ritratto della Signora Vighi (1930/36) – © akg-images
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2013
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961075-7
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-010967-0
www.reclam.de
Inhalt
Vorwort
1 Eröffnungssätze
2 Figuren
3 Erzählweisen
4 Interpretationen
5 Werturteile
Zitierte Literatur
Register
Vorwort
Die Kunst, Werke der Literatur zu analysieren, ist beinahe genauso veraltet wie der Holzschuhtanz. Eine ganze Tradition, die Nietzsche als »langsames Lesen« bezeichnete, läuft Gefahr, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Das vorliegende Buch unternimmt den bescheidenen Versuch, dieser Gefahr vorzubeugen, indem es das Hauptaugenmerk auf die literarischen Formen und Techniken richtet. Es ist als Leitfaden für den Anfänger gedacht, aber ich hoffe, es erweist sich auch für diejenigen als nützlich, die bereits literarische Studien betreiben, oder für jene Leser, die in ihrer Freizeit gern Gedichte, Dramen oder Romane lesen. Folgende Themen versuche ich kritisch zu beleuchten: Erzählstrukturen, Plot, Charaktere, literarische Sprache, das Wesen der Literatur, Probleme der kritischen Interpretation, die Rolle des Lesers und die Frage nach dem Werturteil. Dieses Buch stellt zudem Auffassungen zu einigen Autoren und literarischen Strömungen wie der Klassik, der Romantik, dem Realismus sowie der Moderne vor, und zwar für diejenigen, die womöglich ein Bedürfnis danach verspüren.
Vermutlich bin ich vornehmlich als Literaturtheoretiker und politischer Kritiker bekannt, und manch ein Leser könnte sich fragen, was aus meinen ursprünglichen Interessen geworden ist. Die Antwort lautet, dass man keine politischen oder theoretischen Fragen an literarische Texte stellen kann, ohne einen gewissen Grad an Sensibilität für die Sprache dieser Texte mitzubringen. Mein Anliegen ist es daher, Lesern und Studenten der Literaturwissenschaft die grundlegenden Werkzeuge der Literaturkritik an die Hand zu geben, denn ohne diese Werkzeuge wird man sich wahrscheinlich keinen anderen Sachverhalten zuwenden können. Ich hoffe zudem, im Verlauf der Darstellung zeigen zu können, dass die kritische Analyse von Literatur Spaß machen kann, um auf diesem Wege mit dem Vorurteil aufzuräumen, die literarische Analyse sei der Feind des genussvollen Lesens.
TE
1 Eröffnungssätze
Stellen Sie sich vor, Sie lauschen einer Gruppe Studenten, die in einem Seminar über Emily Brontës Roman Wuthering Heights (Sturmhöhe) diskutieren. Im Laufe des Gesprächs könnte sich folgender Dialog entwickeln:
Student A: »Ich verstehe nicht, was so toll sein soll an Catherines Beziehung zu Heathcliff. Die beiden benehmen sich doch wie zwei Kinder, die sich zanken.«
Student B: »Eigentlich ist es ja auch gar keine Beziehung in dem Sinne, oder? Es ist eher wie eine Seelenverwandtschaft. Darüber kann man nicht in alltäglicher Redeweise sprechen.«
Student C: »Wieso nicht? Heathcliff umgibt nichts Mystisches, er ist ein brutaler Kerl. Der Typ ist kein Byron’scher Held, er ist einfach nur bösartig.«
Student B: »Ja, aber wer hat ihn dazu gemacht? Die Leute auf Wuthering Heights natürlich. Als Kind war er umgänglich. Aber als die anderen der Meinung sind, er sei nicht gut genug, um Catherine zu heiraten, verwandelt er sich in ein Ungeheuer. Er ist zumindest kein Feigling wie dieser Edgar Linton.«
Student A: »Sicher, Linton hat kein Rückgrat, aber er behandelt Catherine viel besser, als Heathcliff es je getan hat.«
Was fällt an dieser Diskussion auf? Einige der Standpunkte sind recht scharfsinnig. Alle Beteiligten scheinen über Seite 5 hinaus gelesen zu haben. Keiner denkt, Heathcliff sei eine Kleinstadt in Kansas. Das Problem ist nur: Würde jemand, der noch nie etwas von Wuthering Heights gehört hat, diese Diskussion verfolgen, gäbe es keinen Anhaltspunkt dafür, dass es um einen Roman geht. Der Zuhörer könnte vermuten, die Studenten unterhalten sich über einige ihrer eher seltsamen Freunde. Catherine könnte eine BWL-Studentin sein, Edgar Linton ist vielleicht Dekan der Geisteswissenschaften und Heathcliff ein psychopatischer Hausmeister. Es wird nichts zu der Erzähltechnik gesagt, mit der der Roman seine Charaktere einführt und entwickelt. Niemand wirft die Frage auf, welche Haltung das Buch selbst gegenüber diesen Figuren einnimmt. Sind die Urteile des Romans nachvollziehbar oder möglicherweise mehrdeutig und unklar? Wie steht es um die Metaphorik, die Symbolik und die Erzählstruktur des Romans? Bestärken all diese Stilmittel uns in unseren Gefühlen hinsichtlich der Charaktere, oder untergraben sie unsere Eindrücke vielmehr?
Natürlich dürfte im weiteren Verlauf der Debatte klar werden, dass die Studenten über einen Roman diskutieren. Sprechen Literaturkritiker über Gedichte oder Romane, fällt es manchmal schwer zu unterscheiden, ob sie Literatur oder das wirkliche Leben im Blick haben. Das ist nicht weiter schlimm. Doch heutzutage scheint Letzteres viel häufiger der Fall zu sein. Studenten der Literaturwissenschaft machen allzu schnell den Fehler, sofort darauf abzuzielen, was ein Gedicht oder ein Roman uns zu sagen hat, und vernachlässigen dadurch die Frage, auf welche Weise das Gedicht oder der Roman uns dies sagt. Zielt man beim Lesen nur auf die Aussage ab, vernachlässigt man die ›Literarizität‹ eines Werkes – den Umstand also, dass es sich um ein Gedicht oder Drama oder einen Roman handelt und eben nicht um einen Bericht über Bodenerosion in Nebraska. Literatur hat immer rhetorische und deskriptive Aspekte. Literatur will äußerst aufmerksam gelesen werden, und zwar im Hinblick auf Klangfarben, Stimmung, Erzähltempo, Genre, Syntax, Grammatik, Textstruktur, Rhythmus, Erzählstrategien, Interpunktion, Mehrdeutigkeit – also im Hinblick auf all das, was unter der Kategorie ›Form‹ zum Tragen kommt. Natürlich könnte man auch einen Bericht über Bodenerosion in Nebraska immer in dieser ›literarischen‹ Weise lesen. Das würde schlichtweg bedeuten, dass man das Augenmerk auf die Wirkung richtet, die die Sprache des Berichts erzielt. Für einige Literaturtheoretiker wäre dieses Kriterium bereits ausreichend, um einen solchen Bericht als literarisches Werk zu bezeichnen, auch wenn es King Lear nie Konkurrenz machen wird.
Ein Teil dessen, was das literarische Werk ausmacht, besteht darin, dass man das, was gesagt wird, im Hinblick darauf, wie es gesagt wird, auffassen muss. Wir sprechen also von einer Art des Schreibens, bei der der Inhalt nicht von der Sprache getrennt werden darf, die diesen Inhalt vermittelt. Sprache ist durchaus konstitutiv für die Wirklichkeit oder die Leseerfahrung und nicht nur ein Trägerelement dafür. Nehmen wir ein Straßenschild, auf dem steht »Straßenarbeiten: Lange Verzögerungen auf dem Ramsbottom Bypass für die nächsten dreiundzwanzig Jahre«. In diesem Beispiel ist die Sprache nur ein Trägerelement für einen Gedanken, der auf ganz unterschiedliche Weise ausgedrückt werden könnte. Eine einfallsreiche örtliche Behörde könnte diese Information in Gedichtform bringen. Wäre man sich nicht sicher, wie lange auf der Nebenstrecke mit Staus zu rechnen ist, könnte man ein ›close‹ immer mit ›God knows‹ reimen. Eine Zeile wie »Lillies that fester smell far worse than weeds« (»Wo Lilien faulen, ist der schlimmste Ruch«; Sonett 94) lässt sich im Gegensatz dazu nicht so leicht umschreiben, zumindest nicht ohne den Vers vollends zu ruinieren. Und das ist einer der Gründe dafür, warum wir eine Zeile wie diese als Dichtkunst bezeichnen.
Wenn es heißt, wir sollten bei der Frage, was in einem literarischen Werk gemacht wird, immer darauf achten, wie es gemacht wird, so bedeutet das noch nicht, dass diese beiden Herangehensweisen immer miteinander harmonieren. Man könnte zum Beispiel die Lebensgeschichte einer Feldmaus in einem Milton’schen Blankvers nacherzählen. Oder man benutzt bei der Beschreibung des eigenen Wunsches nach Freiheit ein striktes, korsettartiges Metrum. In beiden Fällen würde die äußere Form in einem interessanten Kontrast zum Inhalt stehen. In seinem Roman Animal Farm (Farm der Tiere) verwendet George Orwell zur Darstellung der komplexen geschichtlichen Entwicklung der russischen Oktoberrevolution die scheinbar simple literarische Form der Fabel, in der Tiere vom Bauernhof vorkommen. In solchen Fällen sprechen Kritiker gern von dem Spannungsverhältnis zwischen Form und Inhalt. Womöglich gehört dieses Spannungsverhältnis für sie zur Bedeutung des Werkes.
Die Studenten, von deren Streitgespräch wir gerade Zeuge wurden, vertreten unterschiedliche Ansichten zu Wuthering Heights. Das wirft eine ganze Reihe von Fragen auf, die strenggenommen eher in den Bereich der Literaturtheorie und weniger in den der Literaturkritik gehören. Was muss bei der Interpretation eines Textes alles berücksichtigt werden? Gibt es in diesem Zusammenhang einen richtigen und einen falschen Ansatz? Können wir beweisen, dass eine Interpretation mehr Gültigkeit besitzt als eine andere? Könnte es eine letztgültige Interpretation eines Romans geben, die sich noch keiner ausgedacht hat oder sich wohl nie jemand ausdenken wird? Könnten Student A und Student B beide recht haben in ihrer Einschätzung von Heathcliff, obwohl ihre Ansichten in krassem Gegensatz zueinander stehen?
Vielleicht haben sich die Leute am Seminartisch mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Leider tun das viele Studenten heutzutage nicht mehr. Denn sie gehen an den Akt des Lesens recht unbedarft heran. Ihnen ist nicht bewusst, wie bedeutungsvoll es sein kann, von ›Heathcliff‹ zu sprechen. Es gibt nämlich durchaus einen Sinnzusammenhang, in dem Heathcliff nicht existiert, und es erscheint folglich seltsam, über ihn zu sprechen, als gäbe es ihn wirklich. Es stimmt, dass einige Literaturtheoretiker der Ansicht sind, literarische Charaktere existierten tatsächlich. Einer von ihnen ist der Meinung, das Raumschiff Enterprise besitze wirklich einen Hitzeschild. Ein anderer zieht ernsthaft in Betracht, Sherlock Holmes sei ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ein anderer wiederum argumentiert, Dickens’ Mr Pickwick sei real und sein Diener Sam Weller könne ihn sehen, obwohl wir dies nicht können. Diese Leute sind nicht etwa geisteskrank im medizinischen Sinne, sie sind einfach nur Philosophen.
Ein Punkt in der Diskussion der Studenten ist allerdings zu kurz gekommen: Es besteht nämlich ein Zusammenhang zwischen ihrer Kontroverse und der Struktur des Romans. In Wuthering Heights wird die eigentliche Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Es gibt keine ›Off-Stimme‹ oder keinen vertrauenswürdigen Erzähler, der den Leser in seinen Reaktionen führen könnte. Stattdessen haben wir es mit einer Serie von Berichten zu tun, von denen einige vermutlich vertrauenswürdiger sind als andere, doch diese Berichte sind ineinander verschachtelt. Das Buch vermischt eine Mini-Erzählung mit der nächsten, ohne uns wissen zu lassen, was wir von den dargestellten Figuren und Ereignissen zu halten haben. So erfahren wir also keineswegs sofort, ob Heathcliff ein Held oder ein Dämon, ob Nelly Dean schlau oder dumm oder Catherine Earnshaw die tragische Heldin oder nur ein verzogenes Gör ist. Dem Leser fällt es daher schwer, bestimmte Aspekte der Geschichte genau zu beurteilen, und die verworrene Chronologie der Ereignisse erschwert den Zugang noch weiter.
Vergleichen wir diese »komplexe Sichtweise«, wie der Perspektivwechsel bezeichnet wurde, mit den Romanen von Emilys Schwester Charlotte. Charlottes Jane Eyre wird aus einer einzigen Perspektive erzählt, nämlich aus der Sicht der Heldin persönlich. Der Leser darf also vermuten, dass das, was Jane zu erzählen hat, vertrauenswürdig ist. Keiner der anderen Romanfiguren ist es gestattet, einen Bericht über die Vorgänge abzuliefern, der Janes Darstellung ernsthafte Konkurrenz machen könnte. Wir, die Leser, dürfen jedoch vermuten, dass Janes Berichterstattung bisweilen ein Anflug von Eigeninteresse anhaftet oder hin und wieder eine Spur von Boshaftigkeit aufweist. Der Roman selbst scheint dem nicht Rechnung zu tragen.
Im Gegensatz dazu werden in Wuthering Heights die einseitigen, voreingenommenen Berichte der Figuren in die Struktur des Buches eingearbeitet. Darauf werden wir als Leser schon früh aufmerksam gemacht, nämlich sobald wir erkennen, dass Lockwood – der eigentliche Erzähler des Romans – nicht gerade zu den hellsten Köpfen Europas gehört. Bisweilen erfasst er die unheimlichen Ereignisse in seiner unmittelbaren Umgebung nur unzureichend. Nelly Dean ist eine mit Vorurteilen belastete Geschichtenerzählerin, die Heathcliff nicht ausstehen kann und deren Darstellung man daher nicht vertrauen sollte. Die Geschichte wird in der kleinen Welt auf Wuthering Heights ganz anders gesehen als im benachbarten Thrushcross Grange. Trotzdem haben beide Sichtweisen ihre Vorzüge, auch wenn sie im Widerstreit miteinander liegen. Man kann Heathcliff als brutalen Sadisten sehen, aber auch als einen Ausgestoßenen, der schlecht behandelt wurde. Catherine mag sowohl ein trotziges Kind als auch eine erwachsene Frau sein, die auf der Suche nach Erfüllung ist. Der Roman selbst lässt uns diesbezüglich keine Wahlmöglichkeit. Stattdessen hält er diese miteinander in Widerstreit liegenden Varianten der Realität für den Leser in der Schwebe. Dieser Spannungszustand verlangt jedoch nicht notwendigerweise, einen von der Vernunft geforderten Ausgleich der Extreme vorzunehmen. In der Tragödie kommt ein derartiger Ausgleich ja auch selten vor.
Es ist daher wichtig, Fiktion nicht mit Realität zu verwechseln, aber die Studenten am Seminartisch laufen offenbar Gefahr, genau das zu tun. Prospero, der Held in Shakespeares The Tempest (Der Sturm), tritt am Ende des Stücks vor das Publikum und warnt vor diesem Fehler; er tut das auf eine Weise, die nahelegt, dass die Verwechslung von Kunst mit der wirklichen Welt die Auswirkungen der Kunst auf die Welt abschwächen kann:
Now my charms are all o’erthrown,
And what strength I have’s mine own,
Which is most faint. Now, ’tis true,
I must be here confined by you,
Or sent to Naples. Let me not,
Since I have my dukedom got
And pardoned the deceiver, dwell
In this bare island by your spell,
But release me from my bands
With the help of your good hands.
Nun ist all mein Zauber außer Kraft gesetzt, und mir bleibt nur meine eigene Stärke, die äußerst schwächlich ist. Ja, die Wahrheit ist: Ihr könnt mich hier gefangenhalten oder mir nach Neapel helfen. Laßt mich nicht, da ich doch mein Herzogtum zurückerhielt und dem Verräter Vergebung gönnte, durch euren Bann auf dieser öden Insel hausen, sondern befreit mich von den Fesseln mit Hilfe eurer freundlichen Hände.
Prospero tut nichts anderes als das Publikum um Applaus zu bitten. Das ist ein Aspekt, den er »mit Hilfe eurer freundlichen Hände« (»With the help of your good hands«) meint. Mit ihrem Beifall anerkennen die Zuschauer im Theater, dass das, was sie soeben gesehen haben, in den Bereich der Fiktion gehört. Würden die Zuschauer dies nicht erkennen, wäre es so, als ob sie und die Figuren auf der Bühne für immer in dieser dramatischen Illusion gefangen bleiben würden. Die Schauspieler wären nicht in der Lage, die Bühne zu verlassen, und das Publikum würde erstarrt auf den Plätzen verharren. Aus diesem Grund spricht Prospero von der Gefahr, womöglich »durch euren Bann« (»by your spell«) auf dieser Zauberinsel festzusitzen, sofern das Publikum sich weigert, sich von der Fantasiewelt zu verabschieden, die es genossen hat. Stattdessen sollen die Zuschauer applaudieren und Prospero dadurch befreien, ganz so, als wäre er in der imaginativen Fiktion der Leute gefesselt und könne sich nicht mehr rühren. Befolgen die Zuschauer den Rat, bekennen sie dadurch, dass sie nur ein Schauspiel gesehen haben; dieses Bekenntnis ist enorm wichtig, wenn das Schauspiel tatsächlich etwas bewirken soll. Sofern die Leute nicht applaudieren, das Theater nicht verlassen und nicht in die wirkliche Welt zurückkehren, werden sie nicht in der Lage sein, das umzusetzen, was das Stück ihnen offenbart hat. Der Bann muss gebrochen werden, wenn der Zauber wirken soll. Tatsächlich glaubte man in früheren Zeiten, man könne einen Zauberbann durch Lärm brechen, und das ist die weitere Bedeutungsebene von Prosperos Bitte an das Publikum, Beifall zu klatschen.
***
Literaturkritiker zu werden bedeutet unter anderem, dass man lernt, bestimmte Techniken anzuwenden. Viele Techniken – das Tauchen mit Flasche zum Beispiel oder Posaune spielen – erlernt man am besten durch möglichst intensives Üben, anstatt sich mit Theorie aufzuhalten. Alle Techniken erfordern, dass man die Aufmerksamkeit auf die Sprache richtet, und zwar in größerem Maße als bei einem Rezept oder den knappen Fakten eines Waschzettels. In diesem Kapitel möchte ich einige praktische Übungen der Literaturanalyse vorlegen, indem ich als Textbeispiele die Anfänge aus verschiedenen sehr bekannten literarischen Werken anführe.
Doch zunächst eine Vorbemerkung zu ersten Sätzen in der Literatur. Ein Ende in der Kunst ist unwiderruflich, mit anderen Worten: Ist eine Figur wie Prospero erst einmal von der Bühne abgetreten, ist sie für immer verschwunden. Wir können daher nicht fragen, ob Prospero je zu seinem Herzogtum zurückgefunden hat, weil er die letzte Zeile des Stücks nicht überdauert. In gewissem Sinne sind auch die ersten Sätze in literarischen Werken unwiderruflich. Das ist natürlich nicht in jeder Hinsicht so. Fast alle literarischen Werke beginnen mit Worten, die schon unzählige Male zuvor benutzt wurden, wenn auch nicht zwangsläufig in dieser speziellen Kombination. Wir erfassen die Bedeutung dieser ersten Sätze nur deswegen, weil wir innerhalb eines kulturellen Referenzrahmens an sie herangehen, der uns das ermöglicht. Wir begegnen diesen Sätzen mit einer bestimmten Auffassung von einem literarischen Werk, weil wir wissen, was zum Beispiel mit einem Romananfang gemeint ist usw. In diesem Sinne ist kein Eröffnungssatz in der Literatur wirklich absolut. Lesen erfordert immer einiges an Vorwissen über die Umstände. Soll ein Text verständlich sein, müssen bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Dazu zählen auch andere literarische Werke. Denn jedes literarische Werk greift auf andere Werke zurück, wenn auch unbewusst. Dennoch, der Anfang eines Gedichts oder eines Romans scheint aus einer Art Schweigen zu entspringen, da er eine fiktionale Welt erschafft, die bis dahin noch nicht existierte. Vielleicht kommen wir auf diesem Wege dem Akt der göttlichen Schöpfung am nächsten, wie einige romantische Künstler glaubten. Der Unterschied ist nur, dass wir uns mit der Schöpfung wohl oder übel arrangieren müssen, wohingegen wir unsere Ausgabe von Catherine Cookson jederzeit wegschmeißen können.
Beginnen wir mit den ersten Sätzen eines der berühmtesten Romane des 20. Jahrhunderts, mit E. M. Forsters A Passage to India (Auf der Suche nach Indien):
Except for the Marabar Caves – and these are twenty miles off – the city of Chandrapore presents nothing extraordinary. Edged rather than washed by the river Ganges, it trails for a couple of miles along the bank, scarcely distinguishable from the rubbish it deposits so freely. There are no bathing-steps on the river front, as the Ganges happens not to be holy here; indeed there is no river front, and bazaars shut out the wide and shifting panorama of the stream. The streets are mean, the temples ineffective, and though a few fine houses exist they are hidden away in gardens or down alleys whose filth deters all but the invited guest …
Mit Ausnahme der – ohnehin vierzig Kilometer abgelegenen – Marabar-Grotten hat die Stadt Tschandrapur dem Besucher nichts Ungewöhnliches zu bieten. Vom Ganges nicht so sehr bespült wie gesäumt, zieht sie sich ein paar Kilometer weit am Ufer entlang, kaum zu unterscheiden von all dem Unrat, den sie so großzügig ablagert. Da der Ganges an dieser Stelle nicht heilig ist, sind auf der Flußseite auch keine Badestufen zu sehen, ja, von der Flußseite ist überhaupt nicht viel zu bemerken. Das weite, wechselvolle Panorama des Stromes ist von Basaren verstellt. Die Straßen sind dürftig, die Tempel unansehnlich, und wenn es auch einzelne stattliche Häuser gibt, so liegen sie doch in Gärten versteckt oder stehen in Hintergassen, deren Schmutz nur den geladenen Gast nicht abzuschrecken vermag …
Wie bei vielen anderen Romananfängen haben wir es hier mit einer Standardsituation zu tun, da der Autor sich zum ersten Mal zu Wort meldet und den Einstieg formal vorbereitet. Zu Beginn des 1. Kapitels möchte ein Autor sich von seiner besten Seite zeigen; er ist eifrig darauf bedacht, den Leser zu beeindrucken und sich dessen Aufmerksamkeit zu sichern, ist also darum bemüht, alle Register seiner Kunst zu ziehen. Gleichwohl muss er sich in Acht nehmen, es nicht zu übertreiben, schon gar nicht, wenn er ein kultivierter Engländer der Mittelklasse wie E. M. Forster ist, der Tugenden wie Zurückhaltung und Unaufdringlichkeit schätzt. Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, dass der Absatz mit einer wie nebenbei hingeworfenen Einschränkung beginnt (»Except for the Marabar Caves«; »Mit Ausnahme der […] Marabar-Grotten«) und nicht mit einem verbalen Paukenschlag. Der Autor schleicht sich gleichsam auf Umwegen in sein Thema, anstatt es von vornherein offen anzugehen. Eine Alternative wie »The City of Chandrapore presents nothing extraordinary, except for the Marabar Caves, and they are twenty miles off« wäre viel zu plump. Auf diese Weise würde die ausgewogene Syntax verdorben, die zurückhaltend und elegant daherkommt. Sie wird geschickt eingesetzt, aber auf eine wohlerzogene Art, die sich dem Leser nicht aufdrängt. Keine Spur einer Andeutung von »feinem Schreiben« oder von übertrieben ausgeschmückter Prosa. Für eine solche Genusssucht liegt das Augenmerk des Autors zu sehr auf dem Gegenstand der Beschreibung.
Die ersten beiden Satzteile des Romans enthalten dem Leser das eigentliche Subjekt des Satzes (nämlich »the city of Chandrapore«) vor. Dadurch wird der Leser in einer gespannten Erwartung gehalten, ehe er zu dem Subjekt gelangt. Die hohen Erwartungen werden dann wiederum enttäuscht, da wir als Leser erfahren, dass die Stadt nichts Bemerkenswertes zu bieten hat. Mehr noch: Wir erfahren seltsamerweise, dass es in der Stadt nichts Ungewöhnliches zu sehen gibt, abgesehen von den Grotten, aber die liegen nicht einmal in der Stadt. Wir erfahren außerdem, dass es nicht nur keine Badetreppen am Uferbereich gibt, sondern dass es überhaupt keinen Uferbereich gibt.
Die vier Satzteile des ersten Satzes sind fast metrisch in ihrem Rhythmus und Gleichgewicht. Man kann sie tatsächlich als Trimeter (dreihebigen Jambus) lesen, oder als Verszeilen mit jeweils drei Hebungen:
Except for the Marabar Caves
And they are twenty miles off
The city of Chandrapore
Presents nothing extraordinary.
Eine ebenso austarierte Gewichtung zeigt sich in der Phrase »Edged rather than washed«, die vielleicht ein wenig zu verspielt ist. Wir haben es hier mit einem Autoren zu tun, der einen sehr kritischen Blick beweist und gleichzeitig kühle Distanz wahrt. Dem traditionellen englischen Stil entsprechend weigert er sich, zu viel Aufregung oder Begeisterung zu zeigen (die Stadt »presents nothing extraordinary«, »hat nichts Ungewöhnliches zu bieten«). Hierbei ist der Ausdruck »presents« (»bieten«) von Bedeutung. Er erweckt den Anschein, als wäre Chandrapore eine Art Showvorführung für Zuschauer anstatt ein Ort, an dem man lebt. Wem wird »nichts Ungewöhnliches geboten«? Die Antwort dürfte lauten: dem Touristen. Die Grundstimmung dieses Absatzes – desillusionierend, ein wenig hochmütig und ein bisschen zu dick aufgetragen – erinnert an einen recht versnobten Reiseführer. Er nähert sich der Stadt gerade weit genug, um anzudeuten, dass es sich buchstäblich um einen Haufen Abfall handelt.
Wie wichtig die Grundstimmung als Anzeiger für die innere Einstellung ist, wird im Roman verdeutlicht. Mrs Moore, eine Engländerin, die erst kürzlich im kolonialen Indien eingetroffen ist und sich dort der britischen kulturellen Gewohnheiten nicht bewusst ist, erzählt ihrem imperial eingestellten Sohn Ronny von ihrer Begegnung mit einem jungen indischen Arzt in einem Tempel. Ronny weiß zunächst nicht, dass seine Mutter von einem »Einheimischen« spricht, und als es ihm dann klar wird, ist er sofort verärgert und voller Argwohn. »Warum hat sie nicht schon in ihrem Tonfall zu erkennen gegeben, dass sie von einem Inder spricht?«, denkt er daraufhin.
Was die Grundstimmung dieses Abschnitts betrifft, so fällt unter anderem die dreifache Alliteration in dem Satz »happens not to be holy here« auf, der einem etwas zu glatt über die Lippen kommt. Er stellt einen Seitenhieb auf den Glauben der Hindus dar, ausgeteilt von einem skeptischen, anspruchsvollen Außenstehenden. Die Alliteration deutet »Cleverness« an, eine diskrete Freude an Wortkunst, die Distanz schafft zwischen dem Erzähler und der von Armut gebeutelten Stadt. Dasselbe trifft zu auf den Satz »die Straßen sind dürftig, die Tempel unansehnlich, und wenn es auch einzelne stattliche Häuser gibt …« (»The streets are mean, the temples ineffective, and though a few fine houses exist …«). Hier ist die Syntax ein bisschen zu selbstreflektierend geraten, zu sehr auf einen »literarischen« Effekt bedacht.
Bis hierher ist es der Textpassage gelungen, eine gewisse Distanz zu der schäbigen indischen Stadt zu schaffen, ohne zu beleidigend und überheblich zu wirken, aber der Begriff »ineffective« für die Beschreibung der Tempel lässt das fadenscheinige Spiel fast absichtlich auffliegen. Von der Syntax her verschwindet der Begriff zwar unauffällig in einem Nebensatz, aber dennoch spürt es der Leser wie einen leichten Schlag ins Gesicht. Die Wortwahl legt nahe, dass die Tempel den Einheimischen nicht zum Beten dienen, sondern nur dem Betrachter Gefallen bringen. Sie sind wirkungslos in dem Sinne, dass sie dem künstlerisch gesinnten Touristen nichts bieten. Bei dem Adjektiv denkt man vielleicht eher an platte Autoreifen oder kaputte Radios. Dies geschieht mit so viel Kalkül, dass man sich fragt – womöglich ein wenig zu wohlwollend –, ob der Begriff nun ironisch gemeint ist. Gibt der Erzähler hier seine selbstherrliche Haltung auf?
Es wird recht deutlich, dass der Erzähler – der nicht notwendigerweise identisch sein muss mit dem historischen E. M. Forster – über ein gewisses Insiderwissen über Indien verfügt. Er ist noch gar nicht von Bord gegangen. Dennoch weiß er zum Beispiel, dass der Ganges in bestimmten Abschnitten heilig ist, in anderen jedoch nicht. Vielleicht vergleicht er Chandrapore auch nur mit anderen Städten des Subkontinents. Ein gewisser Ton der Übersättigung beherrscht diesen Textauszug, als hätte der Erzähler schon zu viel von diesem Land gesehen und ließe sich daher nicht mehr leicht beeindrucken. Vielleicht zielt dieser Romananfang darauf ab, das romantisch-schwärmerische Bild von Indien als exotische und geheimnisvolle Kulisse zu korrigieren. Der Titel des Buches, A Passage to India, mag solche Erwartungen im westlichen Leser hervorrufen, die der Roman dann gleich von Beginn an auf durchtriebene Weise untergräbt. Vielleicht genießen es diese ersten Zeilen insgeheim, welche Wirkung sie auf den Leser ausüben, der mit etwas geheimnisvolleren Dingen gerechnet hat als mit Dreck und Unrat.
Da gerade die Rede von Dreck und Schmutz ist, warum halten die schmutzigen Seitengassen, die zu den feineren Häusern führen, alle Leute ab, nur die geladenen Gäste nicht? Vermutlich weil ein eingeladener Gast, anders als ein zufällig vorbeikommender Tourist, keine andere Wahl hat, als diese Gassen zu benutzen. Wir haben es an dieser Stelle mit einem versteckten Witz zu tun: Ausgerechnet die privilegierten Leute – also jene, die das Glück haben, in die feineren Wohnhäuser eingeladen zu werden – sind gezwungen, durch die schmutzigen Gassen zu gehen. Die Behauptung, diese Gäste ließen sich von dem Unrat nicht abschrecken, lässt diese Leute kühn und unternehmungslustig erscheinen. Die Wahrheit ist aber, dass ihnen aus Gründen der Höflichkeit und des Anstands – und womöglich aufgrund der Aussicht auf ein gutes Essen – keine andere Wahl bleibt.
Bleibt der Erzähler distanziert, weil er schon so viel gesehen hat, wie die Grundstimmung dieses Textabschnitts nahelegt, haben wir es mit zwei gegensätzlichen Gefühlslagen zu tun: mit Insiderwissen und einer eher hochmütigen Distanziertheit. Vielleicht hat der Erzähler das Gefühl, dass seine generellen Erfahrungen in Indien diese voreingenommene Sicht auf die Stadt rechtfertigen; dem wäre nicht so, wenn er erst kürzlich aus England eingetroffen wäre. Die Distanz zwischen dem Erzähler und Chandrapore wird noch durch den Umstand verstärkt, dass die Stadt nicht aus nächster Nähe, sondern von weitem – im Panoramablick – betrachtet wird. Zudem fällt auf, dass dem Erzähler nicht die Einwohner ins Auge fallen, sondern allein die Gebäude.
Heutzutage kommt dieser Textabschnitt eines Romans, der 1924 erschien, als Indien noch britische Kolonie war, manch einem Leser wahrscheinlich unangenehm herablassend vor. Umso überraschter ist man daher, wenn man weiß, dass Forster dem Imperialismus äußerst kritisch gegenüberstand. Tatsächlich zählte er seinerzeit zu den bekanntesten liberalen Denkern, zu einer Zeit, als der Liberalismus weitaus weniger verbreitet war als heute. Der Roman als Ganzes bleibt in Bezug auf die Einstellung zur imperialistischen Herrschaft mehrdeutig, aber es gibt genügend Stellen im Text, die bei den begeisterten Anhängern des Empires für Unbehagen sorgen dürften. Forster arbeitete drei Jahre lang für das Rote Kreuz im ägyptischen Hafen von Alexandria, wo er eine Affäre mit einem mittellosen Schaffner hatte, der später zu Unrecht vom britischen Kolonialregime ins Gefängnis geworfen wurde. Er prangerte die britische Herrschaft in Ägypten an, verabscheute Winston Churchill, hasste alle Ausprägungen des Nationalismus und war ein Freund der islamischen Welt. All diese Aspekte legen den Schluss nahe, dass die Beziehung zwischen einem Autor und seinem Werk sehr viel komplexer ist, als wir uns das vorstellen. Dieser Frage wenden wir uns etwas später noch zu. Der Erzähler dieser ersten Sätze könnte Forsters eigene Ansichten zum Ausdruck bringen, oder nur teilweise oder eben gar nicht. Wir als Leser können das nicht wissen. Außerdem ist dieser Punkt auch nicht von so großer Bedeutung.
Dieser erste Romanabschnitt ist von großer Ironie geprägt, die der Leser erst dann erfasst, wenn er sich weiter in das Buch vertieft. Der Roman fängt gleich mit einer Einschränkung an: Es gibt nichts Außergewöhnliches in Chandrapore, abgesehen von den Marabar-Grotten. Also sind die Grotten das einzig Außergewöhnliche; aber das erfahren wir in einem wie hingeworfenen Nebensatz. Die eigentliche Bedeutung der Grotten wird mittels der Syntax abgeschwächt. Die Betonung des Satzes liegt also auf »hat die Stadt Tschandrapur dem Besucher nichts Ungewöhnliches zu bieten« und nicht auf »Mit Ausnahme der […] Marabar-Grotten«. Die Grotten sind viel faszinierender als die Stadt selbst, die Syntax scheint jedoch den gegenteiligen Schluss nahezulegen. Diese ersten Sätze wecken zunächst unsere Neugierde, um sie dann zu enttäuschen. Kaum werden die Grotten erwähnt, da werden sie auch schon weggewischt, was dazu führt, dass unser Interesse an ihnen nur noch wächst. Dies ist wieder einmal typisch für die Zurückhaltung und indirekte Herangehensweise des Abschnitts. Es täte diesem Romananfang nicht gut, wenn mit übertriebener Aufregung von dieser lokalen Touristenattraktion gesprochen würde. Stattdessen wird die Bedeutung der Grotten auf indirekte Weise, sozusagen auf Umwegen, vermittelt.
Diese Mehrdeutigkeit – sind die Grotten nun etwas Besonderes oder nicht? – liegt dem Roman A Passage to India zugrunde. Andeutungsweise ist schon in den ersten Sätzen die Kernaussage des Buches enthalten – und zwar auf ironische, fast neckische Weise, da der Leser das zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht wissen kann. Literarische Werke »wissen« recht häufig Dinge, die der Leser nicht weiß oder eben noch nicht weiß oder auch nie wissen wird. Niemand wird zum Beispiel je wissen, was in dem Brief steht, den Milly Theale am Ende von Henry James’ Roman The Wings of the Dove (Die Flügel der Taube)an Merton Densher schrieb, denn eine andere Romanfigur verbrennt den Brief, bevor wir etwas über den Inhalt erfahren. Man könnte also sagen, dass nicht einmal Henry James den Inhalt kennt. Shakespeare veranlasst seinen Macbeth, Banquo an ein Fest zu erinnern, das er gibt, worauf Banquo verspricht, der Einladung nachzukommen. Das Stück, nicht aber der Zuschauer, weiß, dass Banquo tatsächlich auf diesem Fest erscheinen wird, allerdings als Geist, da Macbeth seinen Freund in der Zwischenzeit hat ermorden lassen. Shakespeare erlaubt sich also hier einen kleinen Scherz auf Kosten seiner Zuschauer.
In gewisser Hinsicht erweisen sich die Marabar-Grotten als genauso bedeutsam, wie die ersten Sätze des Romans es vermuten lassen. Denn sie sind der Schauplatz der zentralen Handlung. Aber diese Handlung könnte genauso gut eine Nicht-Handlung sein. Ob sich irgendetwas in den Grotten ereignet, ist schwer zu entscheiden. Diesbezüglich bietet der Roman unterschiedliche Sichtweisen. Grotten bzw. Höhlen sind buchstäblich hohl. Wenn die Marabar-Grotten also gewissermaßen den Kern des Romans bilden, so bedeutet das implizit, dass eine Art Leere herrscht. Wie viele andere moderne Werke in Forsters Zeit, dreht sich auch dieses Werk um etwas Schattenhaftes und schwer Fassbares. Der Roman besitzt somit einen nicht vorhandenen Kern. Gibt es tatsächlich eine Wahrheit im Kern des Werkes, so ist es beinahe unmöglich, dieser Wahrheit auf den Grund zu gehen. Daher dient gleich der erste Satz des Romans als kleines Modell für das gesamte Buch. Die Bedeutung der Grotten wird hervorgehoben, gleichzeitig jedoch von der Syntax her heruntergespielt. Doch dieses Herunterspielen dient ebenfalls dazu, die Grotten aufzuwerten. Dadurch wird die mehrdeutige Funktion der Grotten im Verlauf der Geschichte vorweggenommen.
***
Verlassen wir nun die erzählende Prosa und wenden uns dem Drama zu. Die erste Szene in Macbeth lautet wie folgt:
1 witch. When shall we three meet again?
In thunder, lightning, or in rain?
2 witch. When the hurly-burly’s done,
When the battle’s lost and won.
3 witch. That will be ere the set of sun.
1 witch. Where the place?
2 witch. Upon the heath.
3 witch. There to meet with Macbeth.
1 witch. I come, Graymalkin.
2 witch. Paddock calls.
3 witch. Anon!
All. Fair is foul, and foul is fair,
Hover through the fog and filthy air.
1. Hexe. Wann sehen wir drei uns wieder?
Bei Donner, Blitz oder bei Regen?
2. Hexe. Wenn sich der Aufruhr gelegt hat,
wenn die Schlacht verloren und gewonnen ist.
3. Hexe. Das wird vor Sonnenuntergang sein.
1. Hexe. Wo der Ort?
2. Hexe. Auf der Heide.
3. Hexe. Um dort mit Macbeth zusammenzutreffen.
1. Hexe. Ich komme, Graymalkin.
2. Hexe. Kröte ruft.
3. Hexe. Sofort!
Alle. Schön ist abscheulich und abscheulich ist schön.
Schwebt durch den Nebel und die trübe Luft!
In diesen dreizehn Zeilen werden drei Fragen gestellt, zwei davon gleich zu Beginn. Das Stück beginnt also mit einem fragenden Grundton. Tatsächlich ist Macbeth insgesamt voller Fragen, manchmal werden die Fragen mit Gegenfragen beantwortet, sodass eine Atmosphäre der Unsicherheit, der Furcht und des paranoiden Argwohns erzeugt wird. Stellt man eine Frage, erwartet man eine bestimmte Antwort, aber nicht vieles in diesem Stück ist präzise, am allerwenigsten die Aussage der Hexen. Da es sich um alte Vetteln mit Bärten handelt, ist es sogar schwer zu sagen, was für ein Geschlecht sie haben. Sie sind zu dritt, aber sie handeln auch als eine Person, daher fällt es schwer, sie als grausige Parodie der Heiligen Dreifaltigkeit auseinanderzuhalten. »In thunder, lightning, or in rain?« besteht ebenfalls aus drei Aspekten, aber wie der Kritiker Frank Kermode hervorhebt, legt diese Zeile merkwürdigerweise nahe, dass diese Spielarten des Wetters Alternativen sind (die Kommas zwischen den Begriffen heben das hervor), wohingegen diese drei Phänomene normalerweise in einem Sturm zusammen auftreten. Das Abzählen ist demnach auch hier ein Problem.
Fragen verlangen Sicherheit und klare Unterscheidungen, aber die Hexen bringen alle gesicherten Wahrheiten durcheinander. Sie verstümmeln Definitionen und stellen Gegensätze auf den Kopf. Daher »fair ist foul, and foul is fair«. Oder betrachten wir den Begriff »hurly-burly«, der jede Art von lauter, ungestümer Aktivität meint. »Hurly« klingt wie »burly«, bedeutet aber nicht dasselbe, und daher beinhaltet der Begriff ein Wechselspiel von Unterschied und Identität. Das Gleiche trifft zu auf »When the battle’s lost and won«. Dies bedeutet vermutlich »eine Armee gewinnt, die andere verliert«, aber womöglich klingt außerdem an, dass ein Sieg in Wirklichkeit eine Niederlage bedeutet, sobald es zu militärischen Unternehmungen kommt. Was ist das für ein Sieg, wenn Tausende von gegnerischen Soldaten zerhackt werden?
›Verloren‹ und ›gewonnen‹ stellt einen Gegensatz dar, aber das »und« dazwischen (von der Syntax her als Kopula bekannt) bringt die Worte auf eine gemeinsame Ebene, sodass sie so klingen, als bedeuteten sie das Gleiche. Erneut werden hier Identität und Andersartigkeit durcheinandergebracht. Ganz so, als müssten wir uns den Widerspruch vergegenwärtigen, dass eine Sache sowohl sie selbst als auch etwas anderes sein kann. Gegen Ende wird sich dies für Macbeth im Hinblick auf die menschliche Existenz bewahrheiten, denn diese Existenz sieht zunächst lebendig und vielversprechend aus, erweist sich jedoch als eine Art Nichtigkeit. Es »ist eine Geschichte, von einem Idioten erzählt, voller Schall und Raserei, ohne Bedeutung«, die nichts bedeutet (»a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing«). »Und nichts ist«, bemerkt er, »außer was nicht ist« (»and nothing is but what is not«). Das Nichts, und sei es nur eine Haaresbreite von etwas entfernt, ist ein zentrales Thema bei Shakespeare. Kaum gab es je so viel Lärm um Nichts in den Annalen der Weltliteratur.
Die Hexen werden sich als Propheten erweisen, die die Zukunft vorhersehen können. Das wird vielleicht schon in diesen ersten Zeilen deutlich, wenn die zweite Hexe erklärt, dass sie sich zu dritt wiedersehen werden, sobald die Schlacht vorüber ist. Aber vielleicht ist hier gar keine Voraussicht im Spiel; vielleicht haben sie bereits vereinbart, sich dann zu treffen, und die erste Hexe muss daran lediglich erinnert werden. Die dritte Hexe sagt, dass die Schlacht vor Sonnenuntergang beendet sein wird, aber auch für diese Aussage braucht man womöglich keine hellseherischen Fähigkeiten. Schlachten sind für gewöhnlich vor Sonnenuntergang zu Ende. Es nützt nicht viel, einen Feind zu bekämpfen, den man nicht sieht. Man könnte erwarten, dass die drei »weird sisters«, wie Macbeth sie später nennen wird, in der Lage sind, den Ausgang des Kampfes vorherzusagen, aber das tun sie nicht. Die Formulierung »Lost and won«, die für fast alle Schlachten gelten dürfte, könnte eine schlaue Art sein, in dieser Hinsicht auf Nummer Sicher zu gehen. Es ist also nicht klar, ob die Frauen Prophezeiungen machen oder nicht. Man kann ihrer Vorhersage der Zukunft nicht trauen, was Macbeth zu seinem Leidwesen erfahren wird. Die prophetischen Äußerungen der Hexen sind durchzogen von Paradoxa und Mehrdeutigkeiten, ebenso die Frage, ob sie derartige Behauptungen aufstellen. Mehrdeutigkeit kann bereichernd sein, wie alle Studenten der Literatur wissen, aber sie kann auch tödlich sein, wie der Held am eigenen Leibe erfahren muss.
Als Nächstes kommt der Allmächtige an die Reihe. Der erste Satz in der Bibel lautet: »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.« Ein großartiger, klangvoller Anfang eines der berühmtesten Texte der Welt; schlicht und Respekt einflößend zugleich. Der Ausdruck »Am Anfang« bezieht sich natürlich auf den Anfang der Welt. Von der Grammatik her wäre es zudem möglich, darin Gottes eigenen Anfang zu sehen, in der Bedeutung, dass die Erschaffung der Welt das Allererste war, was er überhaupt unternommen hat. Die Schöpfung war der erste Punkt auf der göttlichen Tagesordnung, ehe Gott sich daran machte, das schreckliche Wetter für die Engländer herbeizuführen, und es – in einem verheerenden Augenblick der Unaufmerksamkeit – zuließ, dass Michael Jackson Gestalt annahm. Aber da Gott per Definition keinen Ursprung hat, kann dies nicht der Fall sein. Wir sprechen hier vom Ursprung des Universums, nicht von der Genealogie Gottes. Da diese Aussage jedoch auch die erste Zeile des Textes darstellt, kann sie nicht dazu beitragen, diese Tatsache zu vergegenwärtigen. Am Anfang der Bibel geht es schlichtweg um den Anfang. Für einen Moment scheinen das Werk und die Welt übereinzustimmen.
Der Erzähler der Genesis bedient sich der Phrase »Am Anfang«, da dies – genau wie »Es war einmal« – eine ganz traditionelle Art ist, eine Geschichte zu erzählen. Grob gesagt, beginnen Märchen mit »Es war einmal«, wohingegen ein »Am Anfang« Mythen und Schöpfungsmythen einleitet. Viele solcher Mythen finden sich in allen Kulturen der Welt, und das erste Kapitel der Bibel ist einer davon. Ein Großteil der literarischen Werke bewegt sich in der Vergangenheit, aber man findet wohl kaum einen Text, der weiter zurückdatiert ist als das Buch Genesis. Ginge man noch weiter in der Zeit zurück, liefe man Gefahr, über die Kante zu stürzen. Die sprachliche Formel »Es war einmal« drängt eine Geschichte so weit von der Gegenwart in einen nebelhaften mythologischen Bereich, dass sie nicht mehr zur Menschheitsgeschichte zu gehören scheint. Die Geschichte kann dadurch weder einem Ort noch einer Zeit zugeordnet werden, sodass eine Aura der Zeitlosigkeit und Universalität entsteht. Womöglich wären wir weitaus weniger entzückt von »Rotkäppchen«, wenn wir erführen, dass Rotkäppchen einen Masterabschluss von Berkeley hat oder dass der Wolf eine Zeit lang in einer Strafanstalt in Bangkok gesessen hat. »Es war einmal« signalisiert dem Leser, gar nicht erst Fragen zu stellen, wie etwa »Stimmt das denn überhaupt?«, »Wo hat sich das denn zugetragen?« oder »Fand das vor oder nach der Erfindung der Cornflakes statt?«
Auf ähnliche Weise belehrt uns die formelhafte Phrase »Am Anfang«, nicht danach zu fragen, zu welchem Zeitpunkt sich dieses Ereignis zutrug, da die Phrase unter anderem bedeutet: »Von Anbeginn der Zeit«. Es ist in diesem Zusammenhang nicht ganz einfach zu verstehen, wie die Zeit zu einem bestimmten Zeitpunkt angefangen haben soll. Schwer vorstellbar also, dass das Universum um exakt 15:17 Uhr an einem Mittwoch begonnen hat. Ebenso ist es merkwürdig, wenn Leute manchmal meinen, die Ewigkeit werde beginnen, wenn sie sterben. Die Ewigkeit kann nicht beginnen. Man kann zwar aus der Zeit in die Ewigkeit übertreten, aber dieser Übertritt kann kein Ereignis in der Ewigkeit sein. Es gibt keine Ereignisse in der Ewigkeit.
Es gibt jedoch ein Problem bei diesem herrlichen ersten Satz, der uns mitteilt, dass Gott das Universum am Anbeginn schuf. Aber wie sollte es auch anders gewesen sein? Gott kann es ja nicht erst erschaffen haben, als die Hälfte der Zeit schon vergangen war. Wenn es heißt, etwas wurde am Anfang erschaffen, dann bedeutet das, dass es am Beginn begann. Das ist eine Art Tautologie. Daher könnte man die ersten drei Wörter der Bibel weglassen, ohne groß den Sinn zu entstellen. Der Verfasser, wer auch immer es gewesen sein mag, stellte sich vielleicht vor, dass die Zeit zu einem gewissen Zeitpunkt begann, und als dem so war, schuf Gott das Universum. Heute wissen wir aber, dass es ohne das Universum keine Zeit geben würde. Die Zeit und das Universum entstanden gleichzeitig.
Das Buch Genesis fasst Gottes Akt der Schöpfung so auf, dass Ordnung in das Chaos gebracht wurde. Zunächst war alles dunkel und leer, doch dann verlieh Gott den Dingen Gestalt und Substanz. In dieser Hinsicht verdreht die Geschichte die normale Erzählabfolge. Denn viele Erzählungen beginnen mit dem Anschein von Ordnung, die dann irgendwie durcheinandergebracht wird. Würde nichts durcheinandergeraten, würde die Story nicht von der Stelle kommen. Wäre Mr Darcy nicht eingetroffen, wäre Elizabeth Bennet in Jane Austens Pride and Prejudice (Stolz und Vorurteil) wahrscheinlich für immer unverheiratet geblieben. Oliver Twist hätte vermutlich nie Fagin getroffen, wenn er nicht beim Essen um einen kleinen Nachschlag gebeten hätte. Und Hamlet wäre ein weniger tragisches Ende beschieden gewesen, hätte er seine Studien in Wittenberg fortgesetzt.
Ein weiterer erster Satz in der Bibel macht der ersten Zeile der Genesis im Hinblick auf rhetorische Brillanz durchaus Konkurrenz. Er findet sich am Anfang des Johannes-Evangeliums: »Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.« Die Phrase »Im Anfang war das Wort« ist eine Anspielung auf die zweite Person der Dreifaltigkeit; aber da sie zu Beginn eines Prosaabschnitts auftaucht, müssen wir zwangsläufig an diesen Anfang denken, der ja auch eine Angelegenheit von Worten ist. Hier haben wir es also mit den ersten Worten zu dem ersten Wort zu tun. Wie bei der ersten Zeile der Genesis scheinen sich hier der Text und das, wovon er berichtet, für einen Moment zu spiegeln. Man beachte außerdem den dramatischen Effekt der Syntax. Der Satz ist ein Beispiel für die Nebenordnung von Satzgliedern, die Parataxe: Der Autor reiht Sätze aneinander, ohne anzudeuten, wie sie koordiniert werden sollen oder welcher Satz dem oder den anderen untergeordnet werden soll. (Man findet dieses Stilmittel in vielen Werken amerikanischer Prosa, die den Einfluss Hemingways zeigen: »Er ging an Ricos Bar vorbei und hielt auf den Platz zu und sah, dass noch ein paar Nachzügler vom Karneval übrig waren, und schmeckte den scharfen Geschmack des Whiskys der letzten Nacht im Mund …«). Die Parataxe läuft Gefahr, zu eintönig zu werden; die Teile eines Satzes werden gleichsam nivelliert, sodass kaum noch Varianten im Tonfall vorhanden sind. Die Worte des Johannes jedoch vermeiden diese Monotonie, indem sie sich selbst als kleine Erzählung anbieten, bei der wir begierig sind zu erfahren, wie es weitergeht.
Wie bei allen guten Erzählungen erwartet uns am Ende eine kleine Überraschung. Wir erfahren, dass das Wort im Anfang war, dann hören wir, es war bei Gott, und schließlich – recht unerwartet –, dass das Wort Gott war. Dies hat etwas von dem beunruhigenden Effekt von »Fred war bei seinem Onkel, und Fred war sein Onkel.« Wie kann das Wort bei Gott, aber gleichzeitig Gott selbst sein? Wie zuvor bei den Hexen in Macbeth haben wir es mit einem Paradoxon der Unterscheidung und der Identität zu tun. Am Anfang war das Paradoxon, das Undenkbare, das, was die Sprache bezwingt – was wiederum bedeutet, dass dieses spezielle Wort sich den rein menschlichen Worten entzieht. Dieser Überraschungseffekt wird noch durch die Syntax unterstrichen. Die Phrasen »Im Anfang war das Wort« und »und das Wort war bei Gott« haben ungefähr dieselbe Länge (fünf bzw. sechs Wörter) und besitzen dasselbe rhythmische Muster; vermutlich rechnen wir nun mit einer weiteren Phrase, die Balance bietet – etwas in der Art »und das Wort erstrahlte in Wahrheit«. Stattdessen bekommen wir das abrupte »und das Wort war Gott«. Es ist ganz so, als opfere dieser Satzteil die rhythmische Balance der Macht dieser Offenbarung. Die ersten beiden fließenden Phrasen steigern sich zu einer knappen, emphatischen Ankündigung, die so klingt, als dulde sie keinen Widerspruch. Von der Syntax her endet der Satz mit einer Art Enttäuschung, denn unsere Erwartung eines abschließenden rhetorischen Tuschs werden untergraben. Von der Semantik her (die Semantik beschäftigt sich mit der Frage der Bedeutung) landet dieser Abschluss jedoch einen mächtigen Treffer.
Einer der bekanntesten ersten Sätze der englischen Literatur lautet wie folgt: »It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife« (»Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass ein alleinstehender Mann im Besitz eines hübschen Vermögens nichts dringender braucht als eine Frau«). Dieser Anfang, der erste Satz von Jane Austens Pride and Prejudice (Stolz und Vorurteil), gilt gemeinhin als kleines Meisterwerk der Ironie, obwohl die Ironie dem Leser nicht unbedingt ins Auge springt. Sie findet sich eher in der Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wird – nämlich dass jeder zustimmen wird, dass vermögende Männer Frauen brauchen –, und dem, was eigentlich gemeint ist: nämlich, dass diese These hauptsächlich unter unverheirateten Frauen kursiert, die auf der Suche nach einem betuchten Ehemann sind. Es handelt sich um eine ironische Verkehrung, denn den Wunsch, den der Satz wohlhabenden Junggesellen zuschreibt, verspüren im Grunde nur bedürftige Jungfern.