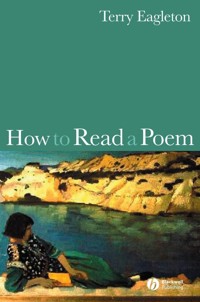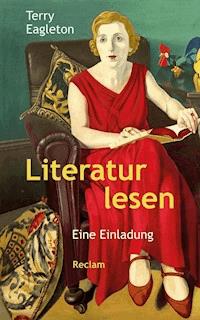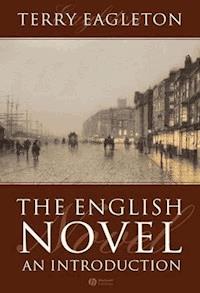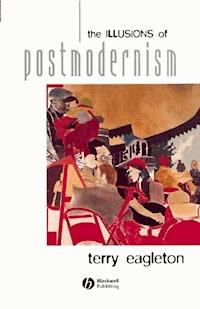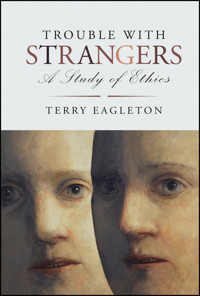10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mitten in der schwersten Krise des Kapitalismus bricht der katholische Marxist Terry Eagleton eine Lanze für Karl Marx. Streitbar, originell und mit britischem Humor widerlegt er zentrale Argumente gegen den Marxismus, wie z.B. "Wir leben doch längst in einer klassenlosen Gesellschaft", "Der Marxismus erfordert einen despotischen Staat" oder "Der Marxismus ignoriert die selbstsüchtige Natur des Menschen". Eagleton macht klar: Marx' materialistische Philosophie hat ihren Ursprung im Streben nach Freiheit, Bürgerrechten und Wohlstand. Sie zielt auf eine demokratische Ordnung und nicht auf deren Abschaffung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
TERRY EAGLETON
Warum Marx
recht hat
Aus dem Englischen von Hainer Kober
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden
Die Originalausgabe erschien 2011unter dem Titel Why Marx Was Rightbei Yale University Press, New Haven und London.
ISBN: 978-3-8437-0220-1
© 2011 by Terry Eagleton© der deutschsprachigen Ausgabe2012 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Uta RüenauverSatz und eBook: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Für Dom und Hadi
Inhalt
Vorwort
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Schluss
Vorwort
Dieses Buch entspringt einem einzigen bemerkenswerten Gedanken: Was, wenn all die sattsam bekannten Einwände gegen Marx’ Werk falsch sind? Oder, wenn nicht völlig abwegig, so doch in hohem Maße irreführend?
Was nicht heißen soll, dass Marx sich nie geirrt hätte. Ich gehöre nicht zu jenen Linken, die mit frommem Augenaufschlag erklären, alles müsse kritisierbar sein, aber in verstocktes Schweigen verfallen, wenn sie aufgefordert werden, drei Kritikpunkte an Marx zu nennen. Dass auch ich meine Zweifel an einigen seiner Ideen habe, dürfte aus dem vorliegenden Buch zur Genüge hervorgehen. Doch er hatte in so vielen Fragen recht, dass es gute Gründe gibt, sich als Marxist zu bezeichnen. Kein Freudianer wird sich einbilden, Freud hätte nie geirrt, so wenig wie ein Bewunderer Alfred Hitchcocks jede Einstellung und Drehbuchzeile des Meisters gutheißen wird. Ich will nicht beweisen, dass Marx’ Ideen vollkommen sind, sondern nur zeigen, dass sie plausibel sind. Zu diesem Zweck werde ich im vorliegenden Buch die zehn geläufigsten Kritikpunkte an Marx aufgreifen – nicht unbedingt in der Reihenfolge ihrer Bedeutung – und sie einen nach dem anderen zu widerlegen versuchen. Dabei möchte ich zugleich Lesern, die mit seinem Denken nicht vertraut sind, eine klare und verständliche Einführung in sein Werk bieten.
Das Kommunistische Manifest ist als der »zweifellos einflussreichste Text des 19. Jahrhunderts«1 bezeichnet worden. Nur sehr wenige Denker haben – gemessen an Staatsmännern, Naturwissenschaftlern, Soldaten, religiösen Führern und ähnlichen Persönlichkeiten – den Lauf der Geschichte so entscheidend und konkret verändert wie die Autoren dieses Textes. Es gibt keine kartesischen Regierungen, platonischen Guerilleros oder hegelschen Gewerkschaften. Noch nicht einmal Marx’ erbittertster Kritiker würde in Abrede stellen, dass er unser Verständnis der Menschheitsgeschichte verändert hat. Der antisozialistische Denker Ludwig von Mises beschrieb den Sozialismus als die »mächtigste Reformbewegung der Geschichte, de[n] erste[n] ideologische[n] Trend, der nicht auf einen Teil der Menschheit begrenzt ist, sondern von Menschen aller Rassen, Nationen, Religionen und Zivilisationen unterstützt wird«.2 Doch ausgerechnet im Gefolge einer der verheerendsten uns bekannten Krisen des Kapitalismus scheint sich weithin die merkwürdige Überzeugung durchzusetzen, man könne Marx und seine Theorien getrost begraben. Der Marxismus, lange Zeit die theoretisch anspruchsvollste und politisch entschiedenste Kritik dieses Systems, wird heute überheblich als Steinzeittheorie abgetan.
Wenigstens hat diese Krise bewirkt, dass das Wort »Kapitalismus«, das gewöhnlich mit einem Euphemismus wie »Moderne«, »Industrialismus« oder »der Westen« kaschiert wird, wieder in Gebrauch gekommen ist. Man darf davon ausgehen, dass das kapitalistische System in Schwierigkeiten steckt, wenn wir anfangen, über Kapitalismus zu reden. Darin zeigt sich, dass das System nicht mehr als so natürlich wahrgenommen wird wie die Luft, die wir atmen, sondern als das historisch ziemlich junge Phänomen, das er ist. Im Übrigen kann alles, was geboren wird, auch sterben, weshalb Gesellschaftssysteme sich gern als unsterblich ausgeben. Wie ein Anfall von Denguefieber uns unter Umständen eine ganz neue Körperempfindung vermittelt, so kann eine bestimmte Form des sozialen Zusammenlebens in dem Augenblick, da ihr Zusammenbruch beginnt, als das, was sie ist, wahrgenommen werden. Marx hat als Erster das historische Phänomen erkannt, das als Kapitalismus bezeichnet wird – er hat gezeigt, wie es entsteht, welchen Gesetzen es gehorcht und wie es enden könnte. Wie Newton die unsichtbare Kraft entdeckte, die er in seinen Gravitationsgesetzen darlegte, und Freud die Prozesse eines unsichtbaren Phänomens beschrieb, das er Unbewusstes nannte, so enttarnte Marx in unserem Alltag ein verborgenes Geschehen, das er als kapitalistische Produktionsweise bezeichnete.
Im vorliegenden Buch nehme ich kaum Stellung zum Marxismus als Moral- und Kulturkritik, weil diese im Allgemeinen nicht als Einwand gegen den Marxismus dient und daher nicht in den Rahmen passt, den ich mir gesteckt habe. Meiner Ansicht nach sind jedoch Marx’ vielfältige, ausführliche Schriften zu diesem Bereich Grund genug, sich zu seinem Vermächtnis zu bekennen. Entfremdung, die Kommerzialisierung des sozialen Lebens, eine Kultur der Gier, der Aggression, des geistlosen Hedonismus und wachsenden Nihilismus, der ständige Schwund von Sinn und Wert in der menschlichen Existenz: Es ist kaum eine intelligente Erörterung dieser Fragen denkbar, die nicht der marxistischen Tradition verpflichtet wäre.
In der Frühzeit des Feminismus schrieben einige ungeschickte, aber gutwillige angelsächsische Autoren: »Wenn ich men sage, meine ich natürlich men and women.« Entsprechend sollte ich darauf hinweisen, dass ich, wenn ich Marx sage, sehr häufig Marx und Engels meine. Doch die Beziehung zwischen diesen beiden ist eine andere Geschichte.
Ich bin Alex Callinicos, Philip Carpenter und Ellen Meiksins Wood verpflichtet, die eine Fassung dieses Buchs lasen und denen ich unschätzbare kritische Anmerkungen und Vorschläge verdanke.
1 Peter Osborne, zitiert in: Leo Panich und Colin Leys (Hg.), The Communist Manifesto Now: Socialist Register, New York 1998, S. 190.
2 Mises, Ludwig von, Die Bürokratie, Sankt Augustin 2004, S. 128.
Eins
Der Marxismus ist erledigt. Denkbar, dass er in gewissem Maße relevant war für eine Welt der Hochöfen und Hungerrevolten, der Kohlekumpel und Kaminkehrer, der Verelendung und einer anschwellenden Arbeiterklasse. Aber er hat ganz gewiss nichts zu tun mit den zunehmend klassenlosen, sozial mobilen, postindustriellen westlichen Gesellschaften der Gegenwart. Er ist das Glaubensbekenntnis derer, die zu verbohrt, ängstlich oder verblendet sind, um einzusehen, dass die Welt sich verändert hat – und das for good: zum Guten und in alle Ewigkeit.
Dass der Marxismus erledigt sei, wäre überall Musik in den Ohren der Marxisten. Sie könnten ihre Märsche und Streikposten vergessen, in den Schoß ihrer bekümmerten Familien zurückkehren und am Abend das häusliche Glück genießen, statt eine weitere ermüdende Ausschusssitzung über sich ergehen zu lassen. Marxisten haben keinen sehnlicheren Wunsch, als das Dasein des Marxisten hinter sich zu lassen. Insofern ist Marxist zu sein etwas gänzlich anderes, als Buddhist oder Milliardär zu sein. Es ähnelt eher der Situation des Mediziners. Mediziner sind widernatürliche, den eigenen Interessen zuwider handelnde Geschöpfe, die sich selbst um ihre Arbeit bringen, indem sie Patienten heilen, von denen sie dann nicht mehr gebraucht werden. Ganz ähnlich besteht die Aufgabe politisch Radikaler darin, an einen Punkt zu gelangen, an dem sie sich selbst überflüssig machen, weil ihre Ziele erreicht sind. Dann könnten sie sich ins Privatleben zurückziehen, ihre Che-Guevara-Poster verbrennen, sich wieder dem lange vernachlässigten Cello widmen und sich über spannendere Dinge unterhalten als die asiatische Produktionsweise. Sollte es in zwanzig Jahren noch Marxisten oder Feministen geben, wäre das eine traurige Aussicht. Der Marxismus ist als rein provisorisches Projekt gedacht, weshalb jeder, der seine gesamte Identität auf ihn gründet, einem Missverständnis erliegt. Der ganze Sinn des Marxismus besteht darin, dass es ein Leben nach dem Marxismus gibt.
Diese ansonsten verlockende Aussicht wirft allerdings ein Problem auf. Der Marxismus ist eine Kapitalismuskritik – die gründlichste, kompromissloseste, umfassendste jemals vorgebrachte Kritik dieser Art –, zugleich die einzige, die große Regionen der Erde umgestaltet hat. Solange also der Kapitalismus im Geschäft ist, muss es auch der Marxismus sein. Nur wenn er seinen Gegner in den Ruhestand schickt, kann er auch sich selbst zur Ruhe setzen. Und alles spricht dafür, dass der Kapitalismus so gesund und munter ist wie je. Das wird heute auch von den meisten Kritikern des Marxismus nicht bestritten. Sie behaupten vielmehr, das System habe sich seit den Zeiten von Marx fast bis zur Unkenntlichkeit verändert und deshalb seien dessen Ideen nicht mehr von Belang. Bevor wir diese Behauptung genauer untersuchen, sei angemerkt, dass sich Marx der ständigen Veränderlichkeit des von ihm in Frage gestellten Systems sehr wohl bewusst war. Dem Marxismus selbst verdanken wir die Begriffe für die verschiedenen historischen Formen des Kapitals: Handels-, Agrar-, Industrie-, Monopol-, Geldkapital und so fort. Warum also sollte der Umstand, dass der Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten seinen Charakter verändert hat, eine Theorie in Frage stellen, die so wesentlich auf Veränderung fußt? Übrigens hat Marx selbst den Niedergang der Arbeiterklasse und den steilen Aufstieg des Angestelltensektors vorhergesagt. Darauf kommen wir in Kürze zurück. Auch die Globalisierung sah er voraus – merkwürdig für einen Mann, dessen Denken als äußerst »archaisch« gilt. Dabei verdankt es Marx möglicherweise gerade dieser »Archaik«, dass er heute noch aktuell ist. Schließlich wird er ausgerechnet von den Befürwortern eines Kapitalismus, der gar nicht schnell genug zu einem viktorianischen Maß von Ungleichheit zurückkehren kann, der Rückständigkeit geziehen.
1976 glaubten noch viele Menschen, der Marxismus vertrete ein bedenkenswertes Anliegen. 1986 hatten viele von ihnen ihre Meinung geändert. Was genau war in der Zwischenzeit geschehen? Lag es einfach daran, dass diese Leute nun einen Haufen von Kleinkindern am Hals hatten? War die marxistische Theorie durch irgendwelche welterschütternden neuen Forschungsergebnisse als Schwindel entlarvt worden? Waren wir auf ein lange verschollenes Manuskript von Marx gestoßen, in dem er gestand, er habe sich nur einen Jux machen wollen? Jedenfalls lag es nicht daran, dass wir zu unserem Entsetzen entdeckt hätten, Marx habe im Sold des Kapitalismus gestanden. Denn das wussten wir schon lange. Ohne die Baumwollspinnerei Ermen & Engels in Salford bei Manchester, die Friedrich Engels’ Vater gehörte, hätte der unter chronischer Geldnot leidende Marx möglicherweise nicht lange genug überlebt, um seine Polemik gegen die Textilfabrikanten zu Papier zu bringen.
Allerdings war tatsächlich etwas in dem betreffenden Zeitraum geschehen. Seit Mitte der 1970er Jahre erlebte das westliche System einige tiefgreifende Veränderungen.3 Es fand eine Verlagerung von der traditionellen Industrieproduktion hin zu einer »postindustriellen« Konsum-, Kommunikations-, Informations- und Dienstleistungskultur statt. Kleine, dezentralisierte und flexible Unternehmen mit flachen Hierarchien bestimmten von da an das Wirtschaftsgeschehen. Die Märkte wurden dereguliert und die Arbeiterbewegung brutalen gesetzlichen und politischen Neuregelungen unterworfen. Traditionelle Klassenbindungen wurden geschwächt, während lokale, geschlechterbezogene und ethnische Identitäten an Bedeutung gewannen. Die Politik wurde zunehmend verwaltet und manipuliert.
Die neuen Informationstechnologien waren entscheidend an der wachsenden Globalisierung des Systems beteiligt, und eine Handvoll multinationaler Konzerne verbreiteten auf der Suche nach dem schnellsten Profit Produktion und Investition über den ganzen Planeten. Ein Großteil der Herstellung wurde in Billiglohnländer der »unterentwickelten« Welt ausgelagert, was einige kurzsichtige Westler zu dem Schluss verführte, die Schwerindustrie sei überall auf der Welt im Schwinden begriffen. Auf diese globale Mobilität folgte eine massive Migration von Arbeitskräften, und mit ihr und dem Zustrom von Armutsmigranten in die entwickelteren Volkswirtschaften kam es zu einer Renaissance von Rassismus und Faschismus. Während in den »peripheren« Ländern erbarmungslose Arbeitsverhältnisse herrschten, Produktionsstätten privatisiert, Sozialleistungen drastisch gekürzt und die Handelsbedingungen eklatant ungerecht gestaltet wurden, ließen sich die Manager in den Mutterländern einen Dreitagebart stehen, rissen sich den Schlips ab, knöpften den Hemdkragen auf und zerbrachen sich den Kopf über das spirituelle Wohl ihrer Arbeitnehmer.
Nichts von alledem geschah, weil das kapitalistische System besonders fröhlicher oder ausgelassener Stimmung gewesen wäre. Im Gegenteil, seine neuerliche Militanz entsprang wie die meisten Formen der Aggression einer tief sitzenden Angst. Das System wurde manisch, weil es unter latenter Depression litt. Hauptgrund für diesen Wandel war der plötzliche Abschwung des Nachkriegsbooms. Durch die Verschärfung des internationalen Wettbewerbs wurden Profitraten gedrückt, Investitionsquellen ausgetrocknet und das Wachstum gebremst. Selbst die Sozialdemokratie war jetzt als politische Option zu radikal und kostspielig. So waren die Voraussetzungen für Reagan und Thatcher geschaffen, die mithalfen, die traditionelle Produktionsweise zu demontieren, die Arbeiterbewegung zu knebeln, dem Markt die Zügel freizugeben, den repressiven Arm des Staates zu stärken und eine neue Gesellschaftsphilosophie zu verkünden, die man am ehesten als »nackte Gier« bezeichnen kann. Die Verlagerung der Investitionen aus dem Produktions- in den Dienstleistungs-, Finanz- und Kommunikationssektor war lediglich die Reaktion auf eine langwierige Wirtschaftskrise, kein Sprung aus einer hässlichen alten in eine schöne neue Welt.
Trotzdem ist zu bezweifeln, dass die Mehrzahl der Radikalen, die zwischen den 1970er und 1980er Jahren ihre Einstellung zum System änderten, es nur deshalb taten, weil nicht mehr so viele Baumwollspinnereien zu sehen waren. Das hat sie sicherlich nicht bewogen, den Marxismus zusammen mit ihren Koteletten und Stirnbändern abzulegen, sondern die wachsende Überzeugung, dass es zu schwer sei, das Regime, gegen das sie sich auflehnten, zu Fall zu bringen. Ausschlaggebend war nicht, dass sie sich Illusionen über den neuen Kapitalismus machten, sondern dass sie desillusioniert waren, was seine Veränderbarkeit betraf. Natürlich gab es auch eine Vielzahl einstiger Sozialisten, die ihre Trauer rationalisierten, indem sie behaupteten, wenn sich das System nicht verändern lasse, müsse es eben auch nicht verändert werden. Als entscheidend erwies sich jedoch der mangelnde Glaube an eine Alternative. Da die Arbeiterbewegung unterdrückt und aufgerieben und die politische Linke entscheidend geschwächt war, schien sich die Zukunft spurlos aus dem Staub gemacht zu haben. Bei einigen Linken vertiefte das Ende der Sowjetunion in den späten 1980er Jahren die Ernüchterung noch zusätzlich. Da war es auch nicht gerade hilfreich, dass sich die erfolgreichste Strömung der Moderne – der revolutionäre Nationalismus – zu diesem Zeitpunkt ebenfalls weitgehend erschöpft hatte. Was die Kultur der Postmoderne mit ihrem Abgesang auf die sogenannten großen Narrative und der vollmundigen Verkündigung des Endes der Geschichte hervorbrachte, war vor allem die Überzeugung, dass die Zukunft einfach mehr Gegenwart sein werde. Oder, wie es ein überschwänglicher Postmoderner ausdrückte: »Die Gegenwart plus einem Mehr an Optionen.« In erster Linie war für die schwindende Attraktivität des Marxismus ein schleichendes Gefühl politischer Ohnmacht verantwortlich. Der Glaube an Veränderung lässt sich nur schwer aufrechterhalten, wenn Veränderung nicht mehr an der Tagesordnung zu sein scheint – selbst wenn es nötiger denn je wäre, an diesem Glauben festzuhalten. Denn wenn wir uns nicht gegen das scheinbar Unvermeidliche stemmen, werden wir nie herausfinden, wie unvermeidlich das Unvermeidliche war. Wäre es den Furchtsamen gelungen, noch weitere zwei Jahrzehnte an ihren einstigen Überzeugungen festzuhalten, hätten sie 2008 einen Kapitalismus erlebt, dessen Übermacht und Unangreifbarkeit gerade noch für ein paar Geldautomaten in den Hauptstraßen der Städte ausgereicht hätte. Sie hätten einen ganzen Kontinent südlich des Panamakanals unwiderruflich nach links driften sehen. Das Ende der Geschichte wäre jetzt am Ende. Wie dem auch sei, die Marxisten müssten eigentlich an Niederlagen gewöhnt sein. Sie haben schon größere Katastrophen erlebt. Die politischen Vorteile werden immer auf der Seite des Systems sein, das an der Macht ist – und sei es auch nur, weil es mehr Panzer besitzt als seine Gegner. Doch die rauschhaften Utopien und glühenden Hoffnungen der späten 1960er Jahre machten diese Entwicklung für die Überlebenden der Epoche zu einer besonders bitteren Pille.
Aussichtslos erschien die Sache des Marxismus also nicht, weil sich der Kapitalismus von Grund auf verändert hatte. Es verhielt sich genau umgekehrt. Soweit es das System betraf, galt die Parole business as usual – und das sogar mehr als zuvor. Paradoxerweise verliehen also genau die Bedingungen, die zur Unterdrückung des Marxismus beitrugen, seinen Thesen eine gewisse Glaubwürdigkeit. Er wurde an den Rand gedrängt, weil sich die von ihm bekämpfte Gesellschaftsordnung, statt sich gemäßigter und sozialverträglicher zu verhalten, noch rücksichtsloser und extremer gebärdete als zuvor. Was die marxistische Kritik an dieser Ordnung noch triftiger machte. Global betrachtet war das Kapital konzentrierter und räuberischer als je zuvor, und auch die Arbeiterklasse wuchs unaufhaltsam an. So wurde eine Zukunft vorstellbar, in der die Superreichen in umzäunten und bewachten Wohnanlagen Zuflucht suchten, während, sagen wir, eine Milliarde Slumbewohner, von Wachtürmen und Stacheldraht umgeben, in ihren heruntergekommenen Hütten hausten. Wer unter diesen Umständen behauptete, der Marxismus sei am Ende, verhielt sich wie jemand, der die Feuerwehr abschaffen will, weil die Brandstifter immer geschickter und einfallsreicher werden.
Heute hat sich das von Marx vorhergesagte Wohlstandsgefälle dramatisch verschärft. Das Einkommen eines einzigen mexikanischen Milliardärs entspricht dem Gesamtlohn der ärmsten siebzehn Millionen seiner Landsleute. Der Kapitalismus hat mehr Wohlstand geschaffen, als es in der Geschichte jemals gab, doch der Preis – nicht zuletzt in Form fast völliger Verarmung von Milliarden Menschen – war ungeheuerlich. 2001 lebten laut der Weltbank 2,74 Milliarden Menschen von weniger als zwei Dollar pro Tag. In Zukunft ist damit zu rechnen, dass Atommächte Kriege um knappe Ressourcen anzetteln werden, wobei diese Knappheit weitgehend eine Folge des Kapitalismus selbst ist. Zum ersten Mal in der Geschichte ist unsere vorherrschende Lebensweise nicht nur in der Lage, Rassismus und flächendeckenden kulturellen Kretinismus hervorzubringen, uns in Kriege zu verwickeln oder in Arbeitslager zu stecken, sondern auch, alles menschliche Leben auf unserem Planeten auszulöschen. Wenn es Gewinn verspricht, verhält sich der Kapitalismus antisozial, was heute auf die Vernichtung von Menschenleben in unvorstellbarem Ausmaß hinauslaufen kann. Was einst apokalyptische Phantasie war, ist heute nicht mehr als nüchterner Realismus. »Sozialismus oder Barbarei« – dieser traditionelle Kampfruf der Linken – traf nie auf schrecklichere Weise zu, war nie weiter davon entfernt, eine bloß rhetorische Floskel zu sein, als heute. Unter diesen fatalen Bedingungen muss, wie Fredric Jameson schreibt, »der Marxismus notwendigerweise wieder wahr werden«.4
Spektakuläre Ungleichheiten von Wohlstand und Macht, Imperialkriege, verstärkte Ausbeutung und ein zunehmend repressiver Staat: Diese Merkmale unserer heutigen Welt sind durchweg Aspekte, die Marx’ Denken und Handeln schon vor fast zwei Jahrhunderten bestimmten. Man sollte also meinen, dass die Gegenwart einiges daraus lernen könnte. Besonders beeindruckt zeigte sich Marx von dem außerordentlich gewaltsamen Prozess in seiner Wahlheimat England, in dessen Verlauf sich aus einer entwurzelten Landbevölkerung eine städtische Arbeiterklasse bildete – ein Prozess, den gegenwärtig Brasilien, China, Russland und Indien durchleben. Tristram Hunt meint, Mike Davis’ Buch Planet der Slums5, das die Slums genannten »stinkenden Scheißehaufen« beschreibt, die wir heute in Lagos oder Dhaka finden, könne man als eine aktualisierte Version von Engels’ Schrift Die Lage der arbeitenden Klasse in England betrachten. In dem Maße, wie China zur Werkstatt der Welt werde, so Hunt, »erinnern die Sonderwirtschaftszonen Guangdong und Shanghai auf grausige Weise an das Manchester und Glasgow der 1840er Jahre«.6
Und was wäre, wenn nicht der Marxismus, sondern der Kapitalismus überholt wäre? Bereits im viktorianischen England hatte das System sich nach Marx’ Ansicht erschöpft: Nachdem es in seiner Blütezeit die soziale Entwicklung vorangetrieben hatte, erwies es sich nun als Hemmschuh. Nach Marx war die kapitalistische Gesellschaft geprägt von einem Übermaß an Phantasie und Fetischismus, Mythologie und Idolatrie – mochte sie sich selbst auch noch so sehr mit ihrer Modernität brüsten. Gerade ihre Aufgeklärtheit – der selbstgefällige Stolz auf ihre überlegene Vernunft – war eine Art Aberglaube. War sie einerseits zu erstaunlichem Fortschritt fähig, musste sie andererseits immer schneller laufen, nur um auf der Stelle zu bleiben. Die letzte Schranke des Kapitalismus, meinte Marx einmal, sei das Kapital selbst, dessen ständige Reproduktion eine Grenze sei, über die er nicht hinausgelangen könne. Insofern besitzt dieses dynamischste aller historischen Systeme einen eigentümlich statischen und repetitiven Charakter. Der Umstand, dass die ihm zugrundeliegende Logik im Großen und Ganzen unverändert bleibt, ist einer der Gründe, warum die marxistische Kritik an ihm weitgehend gültig bleibt. Das wäre nur dann nicht mehr der Fall, wenn das System wirklich in der Lage wäre, die eigenen Grenzen zu überschreiten und etwas völlig Neues zu schaffen. Doch der Kapitalismus ist nur fähig, eine Zukunft zu erfinden, die seine Gegenwart rituell reproduziert. Mit – das bedarf keiner Erwähnung – mehr Optionen …
Der Kapitalismus hat große materielle Fortschritte erzielt. Doch obwohl das System reichlich Zeit gehabt hätte, um zu beweisen, dass es alle Bedürfnisse des Menschen befriedigen kann, scheint es diesem Ziel kein Stück näher gekommen zu sein. Wie viel Zeit wollen wir ihm noch geben? Warum halten wir hartnäckig an dem Mythos fest, der fabelhafte Reichtum, den diese Produktionsweise hervorbringe, werde, wenn die Zeit reif sei, allen zugutekommen? Würde die Welt entsprechende Behauptungen der extremen Linken ebenso freundlich und gelassen aufnehmen? Rechte, die einräumen, dass es in dem kapitalistischen System immer enorme Ungerechtigkeiten geben werde und dass das zwar bitter, aber die Alternativen noch schlimmer seien, sind bei aller sozialen Kälte wenigstens ehrlicher als diejenigen, die predigen, am Ende werde sich alles zum Besten wenden. Wenn es nun einmal Reiche und Arme gebe, so wie es Schwarze und Weiße gebe, könnten doch im Laufe der Zeit die Vorteile der Besserverdienenden auf die Schlechterverdienenden übergreifen. Doch die Feststellung, dass einige Menschen arm und andere reich sind, gleicht der Behauptung, dass es in der Welt nun einmal Polizisten und Verbrecher gibt. Das ist zweifellos richtig, verschleiert aber die Tatsache, dass es Polizisten gibt, weil es Verbrecher gibt.
3 Wenn sich auch nicht alle Marxisten darüber einig sind, wie tiefgreifend sie waren. Vgl. etwa Alex Callinicos, Against Postmodernism, Cambridge 1989, Kap. 5.
4 Fredric Jameson, The Ideologies of Theory, London 2008, S. 514.
5 Mike Davis, Planet der Slums, Hamburg und Berlin 2007.
6 Tristram Hunt, »War of the Words«, Guardian, 9. Mai 2009.
Zwei
Der Marxismus mag ja in der Theorie sehr schön sein. Doch immer, wenn er in die Praxis umgesetzt wurde, war das Ergebnis Terror, Tyrannei und Massenmord unvorstellbaren Ausmaßes. Westliche Akademiker in gesicherten Verhältnissen, für die Freiheit und Demokratie eine Selbstverständlichkeit sind, können dem Marxismus vielleicht etwas abgewinnen. Aber für Millionen gewöhnlicher Männer und Frauen würde er Hunger, Not, Folter, Zwangsarbeit, wirtschaftlichen Niedergang und grausame Unterdrückung bedeuten. Wer diese Theorie trotzdem propagiert, ist entweder abgestumpft, moralisch verkommen oder betrügt sich selbst. Sozialismus heißt Mangel an Freiheit, heißt Mangel an materiellen Gütern, denn nichts anderes folgt aus der Abschaffung der Märkte.
Viele Männer und Frauen sind glühende Anhänger blutgetränkter Szenarien. Christen zum Beispiel. Auch wissen wir, dass durchaus ehrbare und mitfühlende Menschen gelegentlich Gesellschaften und Kulturen gutheißen, die tief im Blut waten. Etwa Liberale und Konservative. Moderne kapitalistische Staaten sind das Ergebnis einer Geschichte von Sklaverei, Völkermord, Gewalttätigkeit und Ausbeutung, die in jeder Hinsicht so entsetzlich ist wie Maos China oder Stalins Sowjetunion. Auch der Kapitalismus wurde unter Blut und Tränen geschaffen; er hat nur im Gegensatz zum Stalinismus und Maoismus lange genug überlebt, um einen Großteil der Schrecken zu vergessen. Wenn Marx von dieser Amnesie verschont blieb, so lag es teilweise daran, dass das System zu seinen Lebzeiten noch im Werden war.
In seinem Buch Die Geburt der Dritten Welt. Hungerkatastrophen und Massenvernichtung im imperialistischen Zeitalter7 berichtet Mike Davis von den etlichen Zehnmillionen Indern, Afrikanern, Chinesen, Brasilianern, Koreanern, Russen und anderen, die Ende des 19. Jahrhunderts infolge von Hungersnöten, Trockenperioden und Krankheiten, die mühelos hätten verhindert werden können, ums Leben kamen. Viele dieser Katastrophen ergaben sich aus dem Dogma der freien Marktwirtschaft, wenn (beispielsweise) steil ansteigende Getreidepreise Lebensmittel für die einfachen Leute unerschwinglich machten. Dabei müssen wir durchaus nicht immer bis in viktorianische Zeiten zurückgehen, um auf solche empörenden Fakten zu stoßen. Während der letzten beiden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts hat sich die Zahl der Menschen, die von weniger als zwei Dollar pro Tag leben, weltweit um fast hundert Millionen erhöht.8 Eines von drei Kindern in Großbritannien lebt heute unterhalb der Armutsgrenze, während Banker ein langes Gesicht ziehen, wenn ihr Jahresbonus auf eine armselige Million schrumpft.
Natürlich verdanken wir dem Kapitalismus neben diesen Abscheulichkeiten auch einige unschätzbare Errungenschaften. Ohne die mittleren Schichten, die Marx außerordentlich bewunderte, hätten wir nicht dieses Vermächtnis von Freiheit, Demokratie, Bürgerrechten, Feminismus, republikanischen Grundsätzen, wissenschaftlichem Fortschritt und einigem mehr – aber eben auch nicht diese Geschichte von Krisen, Ausbeutungsbetrieben, Faschismus, Imperialkriegen und Mel Gibson. Doch auch das sogenannte sozialistische System hatte seine Erfolge. China und die Sowjetunion führten ihre Bürger aus wirtschaftlicher Rückständigkeit in die moderne Industriewelt, wenn auch unter entsetzlichen Opfern – was zum Teil an der Feindseligkeit des kapitalistischen Westens lag. Diese Feindseligkeit zwang der Sowjetunion auch ein Wettrüsten auf, das ihre ohnehin schwächelnde Wirtschaft noch mehr belastete und schließlich in den Zusammenbruch trieb.
In der Zwischenzeit versorgten sie und die anderen Ostblockstaaten die Bewohner halb Europas mit Wohnraum, Benzin, Verkehrsmitteln und Kultur zu erschwinglichen Preisen. Sie gewährleisteten Vollbeschäftigung, beachtliche staatliche Sozialleistungen und ein unvergleichlich höheres Maß an Gleichheit und (letztlich) materiellem Wohlstand, als es diese Länder je erlebt hatten. Die DDR durfte sich rühmen, eines der besten Kinderbetreuungssysteme der Welt zu besitzen. Die Sowjetunion spielte eine heldenhafte Rolle beim Kampf gegen das Übel des Faschismus und beim Sturz der Kolonialmächte. Sie förderte auch jene Art von Solidarität unter ihren Bürgern, die westliche Staaten offenbar nur mobilisieren können, wenn es gilt, die Bewohner anderer Länder zu töten. Natürlich ist das alles kein Ersatz für Freiheit, Demokratie und Bananen in den Obstabteilungen der Supermärkte, aber wir dürfen es auch nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Als Freiheit und Demokratie dem Sowjetblock schließlich zu Hilfe kamen, geschah es in Gestalt einer wirtschaftlichen Schocktherapie, in Form jener Beutelschneiderei, die euphemistisch als Privatisierung bezeichnet wird; die Folge: Arbeitslosigkeit von etlichen Zehnmillionen Menschen, enorme Zunahme von Armut und Ungleichheit, Schließung der kostenlosen Kindertagesstätten, Verlust von Frauenrechten und Fast-Zusammenbruch jener Sozialsysteme, die diesen Ländern bis dahin ausgezeichnete Dienste geleistet hatten.
Trotzdem dürften die Vorteile des Kommunismus seine Nachteile kaum aufwiegen. Mag sein, dass unter den schrecklichen Bedingungen der frühen Sowjetunion irgendeine Art von Diktatur fast unvermeidlich war, sie musste aber keinesfalls auf den Stalinismus oder etwas Ähnliches hinauslaufen. Alles in allem waren Maoismus und Stalinismus stümperhafte und bluttriefende Experimente, die die grundsätzliche Idee des Sozialismus auch in den Augen derjenigen, die am meisten von ihr hätten profitieren können, in Verruf brachte. Aber wie steht es mit dem Kapitalismus? Zur Zeit dieser Niederschrift gehen die Arbeitslosenzahlen weit in die Millionen und steigen unaufhaltsam weiter, während die Implosion der kapitalistischen Volkswirtschaften nur verhindert werden konnte, indem man den ohnehin schon gebeutelten Bürgern Milliarden Dollar aus der Tasche zog. Die Banker und Börsianer, die das Finanzsystem der Welt an den Rand des Abgrunds brachten, begeben sich sicherlich scharenweise unter die Messer der plastischen Chirurgen, damit ihre wutschnaubenden Opfer sie nicht erkennen und ihnen die Glieder einzeln ausreißen können.
Gewiss, manchmal funktioniert der Kapitalismus eine Zeitlang: So hat er einigen Regionen der Erde nie dagewesenen Wohlstand gebracht. Allerdings gelang ihm das nur um den Preis, dass er – genau wie Stalinismus und Maoismus – furchtbares Leid über unzählige Menschen brachte. Wobei es sich nicht nur um Völkermord, Hungersnöte, Imperialismus und Sklaverei handelte. Wie sich gezeigt hat, ist auch das kapitalistische System außerstande, Wohlstand zu schaffen, ohne zugleich Not und Verderben über riesige Gebiete zu bringen. Gewiss, das mag auf lange Sicht keine Rolle spielen, droht doch die kapitalistische Lebensweise mittlerweile, unseren Planeten gänzlich zugrunde zu richten. Ein bedeutender westlicher Wirtschaftswissenschaftler hat die Klimaveränderung als »das größte Marktversagen der Geschichte« bezeichnet.9
Marx ging nie davon aus, dass sich der Sozialismus unter Armutsbedingungen verwirklichen lasse. Für ein solches Projekt brauchte man eine fast ebenso bizarre Zeitschleife wie für die Erfindung des Internets im Mittelalter. Bis Stalin kam, haben das auch alle anderen marxistischen Denker – Lenin, Trotzki und die restliche bolschewistische Führungsriege – nicht für möglich gehalten. Man kann keinen Wohlstand zum Nutzen aller umverteilen, wenn kaum Wohlstand zum Umverteilen da ist. Man kann soziale Klassen nicht unter Knappheitsbedingungen abschaffen, da dann Konflikte über einen materiellen Überschuss, der zu gering ist, um die Bedürfnisse aller zu befriedigen, diese Klassen wieder entstehen ließe. Wie Marx in Die deutsche Ideologie schreibt, würde eine Revolution unter solchen Bedingungen nur dazu führen, dass »dieselben Dummheiten in neuen Formen« erschienen. Auf diese Weise lässt sich nur sozialisierte Knappheit erzielen. Wenn Kapital mehr oder weniger aus dem Nichts akkumuliert werden muss, geschieht es am wirksamsten – mag es auch noch so brutal sein – durch das Gewinnstreben. Ungebremster Eigennutz kann Reichtümer mit bemerkenswerter Geschwindigkeit anhäufen, wenn auch wahrscheinlich bei gleichzeitiger Erzeugung krassester Armut.
Auch haben die Marxisten nie geglaubt, der Sozialismus lasse sich in einem Land allein schaffen. Entweder war die Bewegung international oder gar nicht. Das war eine nüchtern-materialistische These, keine fromm-idealistische. Wenn es einem sozialistischen Staat nicht gelingt, internationale Unterstützung in einer Welt zu erlangen, in der die Produktion spezialisiert und unter verschiedenen Ländern aufgeteilt ist, bleibt ihm zwangsläufig der Zugriff auf die globalen Ressourcen verwehrt, die es brauchte, um den Mangel abzuschaffen. Das Produktivvermögen eines einzelnen Staates wird kaum ausreichen. Der bizarre Begriff des »Sozialismus in einem Land« wurde in den 1920er Jahren von Stalin erfunden, zum Teil als zynische Reaktion auf die Unfähigkeit anderer Länder, der Sowjetunion zu helfen. Auf Marx konnte er sich dabei nicht berufen. Natürlich müssen sozialistische Revolutionen irgendwo beginnen. Aber sie können nicht innerhalb nationaler Grenzen abgeschlossen werden. Den Sozialismus an seinen Ergebnissen in einem hoffnungslos isolierten Land zu beurteilen, wäre so, als würde man von einer Studie an Psychopathen in Kalamazoo auf die ganze Menschheit schließen.
Eine auf niedrigstem Niveau befindliche Volkswirtschaft zu fördern und zu entwickeln, ist eine anstrengende, frustrierende Aufgabe. Es ist unwahrscheinlich, dass sich Männer und Frauen freiwillig den erforderlichen Mühen unterziehen werden. Wenn also dieses Projekt nicht allmählich, unter demokratischer Kontrolle und in Übereinstimmung mit sozialistischen Werten durchgeführt wird, kommt es unter Umständen dazu, dass ein autoritärer Staat einschreitet und seine Bürger zu dem zwingt, was sie freiwillig nicht bereit sind zu tun. So ist es durch die Militarisierung der Arbeit im bolschewistischen Russland geschehen. Was dann in fataler Ironie durch den Versuch, die ökonomische Basis zu schaffen, den politischen Überbau des Sozialismus (Volksdemokratie, echte Selbstregierung) untergräbt. Das ist so, als würden Sie zu einer Party eingeladen, auf der Sie aufgefordert würden, nicht nur den Kuchen zu backen und das Bier zu brauen, sondern auch noch die Fundamente auszuheben und die Dielenbretter zu verlegen. Es bliebe Ihnen nicht viel Zeit, sich zu amüsieren.
Im Idealfall braucht der Sozialismus eine qualifizierte, gebildete, politisch informierte Bevölkerung, funktionierende staatliche Institutionen, eine hochentwickelte Technik, aufgeklärte liberale Traditionen und fest verwurzelte demokratische Gewohnheiten. Nichts dergleichen dürfte vorhanden sein, wenn man sich noch nicht einmal leisten kann, die lächerlich geringe Zahl von existierenden Fernstraßen zu reparieren, oder wenn man außer einem Schwein im Schuppen hinterm Haus keine Versicherung gegen Krankheit oder Hunger besitzt. In Ländern, die früher unter Kolonialherrschaft standen, dürften nur selten die eben aufgezählten Bedingungen anzutreffen sein, da Kolonialmächte nicht gerade dafür bekannt waren, ihren Untertanen Bürgerrechte und demokratische Institutionen zu gewähren.
Mit Nachdruck fordert Marx eine Verkürzung des Arbeitstages im Sozialismus – zum Teil, um den Menschen die Muße zu verschaffen, die sie für ihre persönliche Entfaltung brauchen, zum Teil aber auch, um ihnen Zeit für die politische und wirtschaftliche Selbstregierung zu gewähren. Das geht aber nicht, wenn die Menschen in Lumpen gekleidet sind; und zur Verteilung von Kleidung an Millionen Bürger braucht man wahrscheinlich einen zentralistischen, bürokratischen Staat. Wenn in einen solchen Staat dann obendrein eine Reihe feindlicher kapitalistischer Mächte einmarschieren, wie es in Russland unmittelbar nach der bolschewistischen Revolution der Fall war, erscheint ein autokratischer Staat noch unvermeidlicher. Im Zweiten Weltkrieg war Großbritannien beileibe keine Autokratie, aber auch keineswegs ein freies Land, was, nebenbei bemerkt, niemand von ihm erwartete.
Um sozialistisch zu werden, muss man also einigermaßen betucht sein – in der wörtlichen wie übertragenen Bedeutung des Wortes. Kein Marxist, von Marx und Engels bis hin zu Lenin und Trotzki, hat jemals von etwas anderem geträumt. Oder wenn man selber nicht gut betucht ist, braucht man einen mitfühlenden und mit ausreichenden Ressourcen versehenen Nachbarn, der einem zu Hilfe kommt. Im Falle der Bolschewiki hätte dies bedeutet, dass auch bei solchen Nachbarn (vor allem Deutschland) Revolutionen stattgefunden hätten. Wäre es den Arbeiterklassen in diesen Ländern gelungen, sich ihrer kapitalistischen Herren zu entledigen und sich in Besitz der Produktionsmittel zu bringen, hätten sie den ersten Arbeiterstaat in der Geschichte davor bewahren können, wieder spurlos in der Versenkung zu verschwinden. Der Gedanke war nicht so unwahrscheinlich, wie er vielleicht klingt. Damals flammten überall in Europa revolutionäre Hoffnungen auf und führten in Städten wie Berlin, Warschau, Wien, München und Riga zur Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten (Sowjets). Als diese Aufstände niedergeschlagen wurden, wussten Lenin und Trotzki, dass ihre eigene Revolution in großen Schwierigkeiten steckte.
Was nicht heißen soll, dass der Aufbau des Sozialismus nicht unter Mangelbedingungen begonnen werden könnte. Aber ohne materielle Ressourcen wird er dazu neigen, zu jener monströsen Sozialismuskarikatur zu verkommen, die wir Stalinismus nennen. Die bolschewistische Revolution sah sich schon bald von imperialistischen westlichen Armeen angegriffen und von Konterrevolution, städtischen Hungersnöten und blutigem Bürgerkrieg bedroht. Sie war von einer Flut überwiegend feindseliger Kleinbauern umgeben, die nur mit Waffengewalt zu bewegen waren, ihren mühsam erwirtschafteten Überschuss an die hungernden Städte abzugeben. Mit einer schmalen kapitalistischen Basis, einer katastrophal niedrigen Produktivität, kaum vorhandenen Ansätzen bürgerlicher Institutionen, einer dezimierten, erschöpften Arbeiterklasse, Bauernaufständen und einer aufgeblähten, an zaristische Zeiten erinnernden Bürokratie war die Revolution von Beginn an in tiefen Nöten. Am Ende mussten die Bolschewiki ihr hungerndes, verängstigtes und kriegsmüdes Volk mit gezogener Waffe in die Moderne führen. Viele der politisch aktivsten Arbeiter waren in dem vom Westen geschürten Bürgerkrieg umgekommen, was die gesellschaftliche Basis der bolschewistischen Partei entscheidend geschwächt hatte. Bald darauf brachte die Partei die Arbeiterräte unter ihre Kontrolle und verbot die unabhängige Presse und Justiz. Sie unterdrückte politisch Andersdenkende und oppositionelle Parteien, manipulierte Wahlen und militarisierte die Arbeitswelt. Dieses rücksichtslos antisozialistische Programm wurde vor dem Hintergrund von Bürgerkrieg, um sich greifender Hungersnot und der Invasion ausländischer Truppen eingeführt. Die russische Wirtschaft lag in Trümmern, und das Sozialgefüge befand sich im Zustand der Auflösung. Infolge einer tragischen Ironie, die das gesamte 20. Jahrhundert charakterisieren sollte, vermochte der Sozialismus ausgerechnet dort am wenigsten auszurichten, wo er am notwendigsten war.
Der Historiker Isaac Deutscher beschreibt die Situation mit der ihm eigenen Eloquenz. Die damalige Situation in Russland »hieß, daß der erste und bis jetzt einzige Versuch, den Sozialismus aufzubauen, unter den schlechtesten Bedingungen, die möglich waren, unternommen werden sollte, ohne die Vorteile einer ausgeprägten internationalen Arbeitsteilung, ohne den befruchtenden Einfluß alter und reicher kultureller Armut, Primitivität und Rohheit; damit aber war im Keim das Verderben der sozialistischen Bestrebungen angelegt«.10 Man muss schon ein sehr verbohrter Kritiker des Marxismus sein, um zu behaupten, dass alle diese Bedingungen ohne Bedeutung seien, weil der Marxismus sowieso ein autoritäres Dogma sei. Wenn er morgen von England Besitz ergriffe, so heißt es dann gewöhnlich weiter, gäbe es noch vor Ende der Woche Arbeitslager in Dorking.
Marx selbst war, wie wir sehen werden, ein strenger Kritiker von starren Dogmen, militärischem Terror, politischer Unterdrückung und willkürlicher Staatsmacht. Er glaubte, dass politische Abgeordnete ihren Wählern gegenüber rechenschaftspflichtig seien, und prangerte die deutschen Sozialdemokraten seiner Zeit wegen ihrer starren politischen Haltung an. Er verlangte Redefreiheit und Bürgerrechte, war entsetzt über die erzwungene Schaffung eines städtischen Proletariats (wobei er England und nicht Russland im Blick hatte) und vertrat die Ansicht, der Gemeinbesitz auf dem Land müsse sich auf Freiwilligkeit und nicht auf Zwang gründen. Doch in der klaren Erkenntnis, dass der Sozialismus nicht unter Armutsbedingungen gelingen kann, hätte er auch sehr genau gewusst, warum die Russische Revolution letztlich scheitern musste.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.