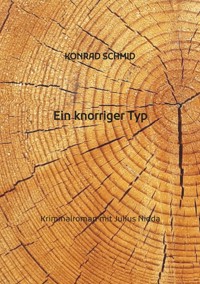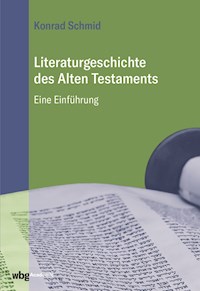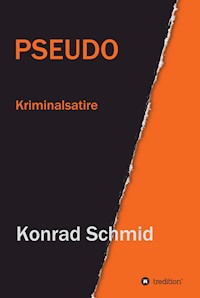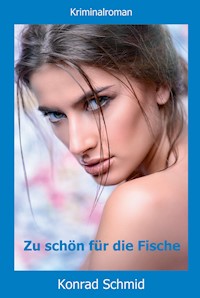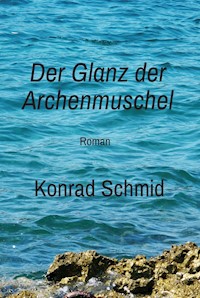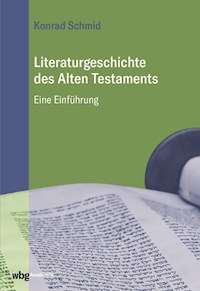
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG)
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wie können wir das Alte Testament besser verstehen? Vor dem Hintergrund einer fast unübersehbar gewordenen Forschungslage bietet Konrad Schmid hier eine zusammenfassende Darstellung der Literaturgeschichte der alttestamentlichen Texte. Dazu wird vor allem verdeutlicht, in welcher historischen Situation diese Teile der Bibel entstanden sind, wie sie sich zu den anderen Zeugnissen der Zeit verhalten und welche Entwicklungsstufen für sie beschrieben werden können. So werden die verschiedenen ›Schichtungen‹ sichtbar, und es wird nachvollziehbar, warum sich der heute bekannte Text herausgebildet hat. Der Band diskutiert die verschiedenen Forschungsansätze zum Thema und ermöglicht so eine gründliche Orientierung in Forschung und Lehre. Die überarbeitete Neuauflage wird durch ein neues Kapitel zur historischen Linguistik als Datierungsmöglichkeit biblischer Texte ergänzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
www.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
3., überarb. und erw. Auflage
wbg Academic ist ein Imprint der wbg.
© 2021 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.
Satz: Samuel Arnet, Ittigen bei Bern
Einbandgestaltung: Peter Lohse, Heppenheim
Einbandabbildung: Handbeschriebene Pergament-
Schriftrolle der Tora © Adobe Stock / Mulderphoto
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-534-27328-7
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): 978-3-534-74640-8
eBook (epub): 978-3-534-74641-5
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Zur dritten Auflage
A. Aufgabe, Geschichte und Probleme einer alttestamentlichen Literaturgeschichte
I.Weshalb eine alttestamentliche Literaturgeschichte?
1.Aufgabenstellung
2.Forschungsgeschichte
3.Theologische Einordnung
4.Das Alte Testament als Ausschnitt der Literatur des antiken Israel
5.Hebräische Bibeln und Alte Testamente
6.Das Problem eines „Urtextes“ des Alten Testaments
7.Die alttestamentliche Literaturgeschichte innerhalb der alttestamentlichen Wissenschaft
8.Grundlagen, Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen der historischen Rekonstruktion
9.Neuere Forschungstendenzen in der alttestamentlichen Wissenschaft und ihre Konsequenzen für eine alttestamentliche Literaturgeschichte
II.Sprache, Schrift, Buchwesen und Literaturproduktion im antiken Israel
1.Sprache und Schrift
2.Materiale Aspekte der Literaturproduktion
3.Literatursoziologische Aspekte der Literaturproduktion und -rezeption
4.Autoren und Redaktoren
5.Das zeitgenössische Publikum der alttestamentlichen Literatur
6.Elemente formgeschichtlicher Entwicklungen
III.Zu Vorgehen und Darstellung
1.Der Kulturdruck der Großmächte und die Periodisierung der alttestamentlichen Literaturgeschichte
2.Historische Kontextualisierungen
3.Theologiegeschichtliche Charakterisierungen
4.Sprachgeschichtliche Entwicklungen
5.Form-, traditions- und sozialgeschichtliche Differenzierungen der Überlieferungsbereiche
6.„Horizontale“ und „vertikale“ Bezugnahmen alttestamentlicher Texte und Schriften
7.Redaktion als innerbiblische Rezeption
8.Tradition und Erinnerung
B. Die Anfänge der altisraelitischen Literatur im Rahmen der syrisch-palästinischen Kleinstaatenwelt bis zum Aufkommen der Assyrer (10.–8. Jahrhundert v. Chr.)
I.Historische Hintergründe
II.Theologiegeschichtliche Charakterisierungen
III.Überlieferungsbereiche
1.Kultische und weisheitliche Überlieferungen
a)Die Literatur an den Nordreichsheiligtümern
b)Die Literatur des Jerusalemer Tempelkults
c)Weisheitliche Überlieferungen
2.Annalistische und erzählende Überlieferungen
a)Nordreichsüberlieferungen
b)Jerusalemer Hofliteratur
C. Die Literatur der Assyrerzeit (8./7. Jahrhundert v. Chr.)
I.Historische Hintergründe
II.Theologiegeschichtliche Charakterisierungen
III.Überlieferungsbereiche
1.Kultische und weisheitliche Überlieferungen
a)Psalmen
b)Ältere Weisheitsliteratur
2.Erzählende Überlieferungen
a)Die Anfänge der deuteronomistischen „Königsbücher“
b)Die Richtererzählungen (Richter 3–9)
c)Die Mose-Exodus-Geschichte
d)Der Abraham-Lot-Zyklus
3.Prophetische Überlieferungen
a)Die Anfänge prophetischer Überlieferung im Hosea- und Amosbuch
b)Die älteste Jesajaüberlieferung und ihre josianische Rezeption
4.Rechtsüberlieferungen
a)Das Bundesbuch
b)Das Deuteronomium
D. Die Literatur der babylonischen Zeit (6. Jahrhundert v. Chr.)
I.Historische Hintergründe
II.Theologiegeschichtliche Charakterisierungen
III.Überlieferungsbereiche
1.Kultische und weisheitliche Überlieferungen
a)Die Threni (Klagelieder) als Antipsalmen
b)Volksklagen und die Kollektivierung von Individualpsalmen
2.Erzählende Überlieferungen
a)Die Hiskia-Jesaja-Erzählungen
b)Die Fortschreibung von 1. Samuel 1 bis 2. Könige 23 durch 2. Könige 24–25
c)Die Entstehung des Großgeschichtswerks Exodus 2 bis 2. Könige 25
d)Die Josephsgeschichte
e)Die Erzelterngeschichte der Genesis
f)Die nichtpriesterschriftliche Sinaiüberlieferung
3.Prophetische Überlieferungen
a)Die Anfänge der Jeremiaüberlieferung
b)Die Anfänge der Ezechielüberlieferung
c)Deuterojesaja
4.Rechtsüberlieferungen
a)Der Dekalog
b)Das deuteronomistische Deuteronomium
E. Die Literatur der Perserzeit (5./4. Jahrhundert v. Chr.)
I.Historische Hintergründe
II.Theologiegeschichtliche Charakterisierungen
III.Überlieferungsbereiche
1.Kultische und weisheitliche Überlieferungen
a)Die Priesterschrift
b)Theokratische Psalmen
c)Das Buch Hiob
2.Erzählende Überlieferungen
a)Die nichtpriesterschriftliche Urgeschichte
b)Die Daniel-Legenden (Daniel *1–6)
c)Die Entstehung des Großgeschichtswerks Genesis bis 2. Könige
d)Esra-Nehemia
3.Prophetische Überlieferungen
a)Haggai/Sacharja
b)Fortschreibungen in Deuterojesaja und Tritojesaja
c)Fortschreibungen in Jeremia und Ezechiel
d)Die „deuteronomistische“ Umkehrtheologie
e)Die biblische Konstruktion der klassischen Prophetie
4.Rechtsüberlieferungen
a)Das Heiligkeitsgesetz
b)Das Numeribuch
c)Die Formierung der Tora
d)Der samaritanische Pentateuch
F. Die Literatur der Ptolemäerzeit (3. Jahrhundert v. Chr.)
I.Historische Hintergründe
II.Theologiegeschichtliche Charakterisierungen
III.Überlieferungsbereiche
1.Weisheitliche Überlieferungen
a)Proverbien 1–9
b)Hiob 28 und Hiob 32–37
c)Kohelet (Prediger)
d)Der „messianische Psalter“
Exkurs: Das Aufkommen der Apokalyptik
2.Erzählende Überlieferungen
a)Die Chronik
b)Ausgestaltungen in der Bileam-Perikope
c)Hellenistische Elemente in der Davidüberlieferung
d)Das Buch Esther
e)Die Übertragung der Tora ins Griechische
3.Prophetische Überlieferungen
a)Weltgerichtstexte im corpus propheticum
b)Die Formierung eines Großjesajabuches Jesaja 1–62
c)„Fromme“ und „Frevler“ in Tritojesaja
d)Diasporaheimkehr und Restauration des Königtums in Jeremia
e)Deutero- und Tritosacharja
f)Die redaktionelle Abgleichung von Jesaja- und Zwölfprophetenbuch
g)Die Weltreiche in Daniel 2 und 7
G. Die Literatur der Seleukidenzeit (2. Jahrhundert v. Chr.)
I.Historische Hintergründe
II.Theologiegeschichtliche Charakterisierungen
III.Überlieferungsbereiche
1.Kultische und weisheitliche Überlieferungen
a)Theokratisierung und Reeschatologisierung im Psalter
b)Jesus Sirach und Weisheit Salomos
2.Prophetische Überlieferungen
a)Die Formierung der Neviʾim
b)Das makkabäerzeitliche Danielbuch
c)Das Buch Baruch
3.Erzählende Überlieferungen
a)Die Weltzeitordnung in den erzählenden Büchern
b)Makkabäerbücher, Tobit, Judith, Jubiläen
H. Schriftwerdung und Kanonbildung
I.„Schrift“ und „Kanon“
1.Josephus und 4. Esra 14
2.Der Sirachprolog und „das Gesetz und die Propheten“
II.Die Schriftwerdung der alttestamentlichen Literatur im Rahmen ihrer Geschichte
1.Die biblische Präsentation
2.Religiöse Texte – Normative Texte – Heilige Schrift – Kanon
3.Literatur- und Kanongeschichte des Alten Testaments
Abbildungsnachweis
Literaturverzeichnis
Register
Bibelstellenregister
Sach- und Namenregister
Sicut enim a perfecta scientia procul sumus, levioris culpae arbitramur saltem parum, quam omnino nihil dicere.
Hieronymus (Patrologia Latina, 25, 380B)
Vorwort
Die nachfolgende Darstellung zu Voraussetzungen, Hintergründen, Gang und Vernetzungen der alttestamentlichen Literaturgeschichte (zum Verhältnis von „Altem Testament“ und „Hebräischer Bibel“ siehe unten S. 31–35) – gemeint ist damit eine auf vor allem auf Entwicklungslinien und Bezugnahmen achtende Geschichte der im Alten Testament enthaltenen Literatur – will entsprechend ihrem Titel nicht mehr sein als eine Einführung. Sie verfolgt nicht den Zweck, ihren Gegenstand erschöpfend zu behandeln. Das ist in der gegenwärtig weitverzweigten Forschungslage kaum zu leisten, schon gar nicht von einem Einzelnen und innerhalb eines beschränkten Darstellungsrahmens. Gleichwohl versteht sich das Nachfolgende weder als pures Wagnis noch als bloßes Fragment. Die Diffusität der Forschungslage wird heute zwar gerne heraufbeschworen, aber in bestimmter Hinsicht oft auch überschätzt: Natürlich kennt die alttestamentliche Wissenschaft eine Vielzahl von untereinander oft schwer vermittelbaren Vorschlägen zur Genese und historischen Einordnung der Bücher und Texte des Alten Testaments, auf die eine Literaturgeschichte grundsätzlich in einem gewissen Mindestmaß abstellen können muss, doch scheinen in der jüngsten Forschungsdiskussion Konturen neuer Teilkonsense sichtbar zu werden, die sich doch auf einige wichtige Grundentscheidungen erstrecken und so das Projekt einer Literaturgeschichte des Alten Testaments keineswegs von vornherein unmöglich machen, vielmehr insofern fordern, als es für das Verstehen des Einzelnen ebenso des Ganzen bedarf, wie dessen Verständnis auf dem des Einzelnen beruht. In diesem Punkt sollte die Bibelwissenschaft, zu deren Tugenden die kritische Selbstreflexion nicht immer in ausreichendem Maß gehört, nicht hinter Schleiermacher zurückfallen.
Übergreifende Perspektiven sind also auch für die Diskussion von einzelexegetischen Problemen von Bedeutung und gerade das Einbringen literaturgeschichtlicher Überlegungen kann bestimmte Entscheidungen in diesem Bereich stützen oder auch unwahrscheinlich machen. In der gegenwärtigen Forschungssituation kann die literaturgeschichtliche Fragestellung nicht einfach das Zusammentragen bereits vorliegender einleitungswissenschaftlicher Erkenntnisse bedeuten, sondern sie ist gewissermaßen auch Teil, Fortführung und Absicherung dieser selbst. Nur eine ganz positivistische Zugangsweise zur historischen Bibelwissenschaft könnte fordern, dass das Projekt einer alttestamentlichen Literaturgeschichte erst dann angegangen werden könne, wenn die einzelexegetischen Ergebnisse auf dem Tisch liegen. Denn diese Ergebnisse sind in Tat und Wahrheit zunächst einmal Hypothesen, deren Plausibilität eben nicht nur von ihnen selbst, sondern auch von den zugehörigen Referenzrahmen abhängt. Wenn man für diese nicht einfach die forschungsgeschichtliche Gewöhnung einsetzen will, dann dispensiert nichts davon, auch übergreifenden Fragestellungen wie literaturgeschichtlichen Synthesemöglichkeiten Aufmerksamkeit zu schenken. Diese wären freilich ebenso positivistisch missverstanden, wenn sie nun als Determinanten der sie nur noch illustrierenden Einzelexegese ausgegeben würden. Beide Zugangsweisen müssen grundsätzlich revisionsoffen sein und die Frage der Verbindbarkeit ihrer vorläufigen Resultate bleibt eine fortwährende Aufgabe der Bibelwissenschaft.
So versteht sich dieser Beitrag weder als ein End-, noch als ein Anfangspunkt der literaturgeschichtlichen Forschung am Alten Testament, sondern als ein erster Zwischenhalt, der die literaturgeschichtliche Fragestellung als solche und einige vorläufige Perspektiven inhaltlicher Art dazu präsentieren will. Er ist weder willens noch in der Lage, den entstehungsgeschichtlichen Forschungsstand zum Alten Testament angemessen oder gar abschließend zu würdigen und zu synthetisieren. Es geht ihm vielmehr darum, die historisch-kritische Rekonstruktion des Gesprächs zwischen den wichtigsten seiner Texte bzw. Textkorpora als historische und theologische Aufgabe der wissenschaftlichen Erforschung des Alten Testaments zurückzugeben.
Nicht unproblematisch mag manchen Leserinnen und Lesern der durch die Gliederung des Buches erkennbare literaturgeschichtliche Raster erscheinen, der in verschiedener Weise Klassifizierungen vornimmt: Auf der allgemeinsten Ebene werden literaturgeschichtliche Epochen voneinander unterschieden (vorassyrische, assyrische, babylonische, persische, ptolemäische und seleukidische Zeit), eine zweite Ebene differenziert jeweils innerhalb dieser Epochen nach unterschiedlichen Literaturbereichen (kultische und weisheitliche, erzählende, prophetische und rechtliche Überlieferungen), während schließlich auf einer dritten Ebene die konkreten literarischen Werke und Positionen besprochen werden. Am kontroversesten werden die auf dieser dritten Ebene vorgenommenen Zuordnungen sein, während über Fug und Recht der Klassifizierung der Literaturgeschichte des Alten Testaments nach den jeweils vorherrschenden Hegemonialmächten in der südlichen Levante mit dem von ihnen geprägten Kulturdruck in der gegenwärtigen Diskussionslage vermutlich nicht mehr grundsätzlich gestritten werden muss. Ebenso dürften auch die Zuteilungen zu verschiedenen Literaturbereichen wenig Widerspruch hervorrufen, zumal sie von untergeordneter inhaltlicher Bedeutung sind und eher der Übersichtlichkeit der Darstellung dienen. Was nun die konkreten literaturgeschichtlichen Einordnungen der alttestamentlichen Texte und Schriften betrifft, so bleibt – bei allen sofort zuzugestehenden Unsicherheiten in der Forschungsdiskussion – zweierlei grundsätzlich zu bedenken. Zum einen lassen sich hinter und neben allen Konfusionen und Streitigkeiten einige jedenfalls in einem solchen Maß anerkannte historische Einordnungen von Teilen der alttestamentlichen Literatur feststellen, so dass eine Rekonstruktion der Grundlinien einer Literaturgeschichte des Alten Testaments eben möglich – und nicht vielmehr unmöglich – erscheint. Dazu gehört im Bereich des Pentateuch die Ausgrenzung und Einordnung der Priesterschrift, mit Einschränkungen auch des literaturgeschichtlichen Kerns des Deuteronomiums, im Bereich der Vorderen Propheten die Identifizierung, neu aber auch der redaktionsgeschichtlichen Differenzierung der „deuteronomistischen“ Deuteperspektiven, im Bereich der Propheten die Unterscheidung von Erstem und Zweitem Jesaja sowie die Erkenntnis der langfristigen Redaktionsgeschichte der Prophetenbücher, auch im Bereich der Psalmen sowie der Weisheitsliteratur erscheint es als nicht von vornherein aussichtslos, etwa königszeitliche von nachkönigszeitlichen Positionen zu unterscheiden. Natürlich bleibt so auf das Ganze gesehen mehr umstritten als unumstritten, doch liegt dies in der Natur des Projekts einer Literaturgeschichte und kann nicht im Ernst gegen den Versuch des Unterfangens als solchen angeführt werden. Im Übrigen unterscheidet sich eine Literaturgeschichte des Alten Testaments diesbezüglich nicht grundsätzlich von der alttestamentlichen Einleitungswissenschaft, deren Legitimität ja auch nicht von den vorliegenden kontroversen Ergebnissen her bestritten wird.
Zum anderen ist hervorzuheben, dass eine bestimmte Zuordnung einer Position zu einer bestimmten Zeit in der Regel nur eine relative ist: Viele alttestamentliche Texte und Schriften verfügen ebenso über eine mündliche oder auch schriftliche Vorgeschichte, wie auch über eine Nachgeschichte bereits innerhalb des Alten Testaments, so dass ihre Besprechung im Kontext dieser und nicht jener literaturgeschichtlichen Epoche nicht heißen soll: Die hier verwendeten und verarbeiteten Stoffe und Texte sind in dieser oder jenen Schrift zum ersten Mal und von Grund auf neu konzipiert worden und danach nicht mehr verändert worden. Vielmehr ist das Alte Testament grundsätzlich als Traditionsliteratur (vgl. Schmid 2011a; Mroczek 2016; Blum 2019) zu charakterisieren, so dass etwa die Behandlung der Mose-Exodus-Geschichte im Kontext der neuassyrischen Zeit nicht aus-, sondern einschließt, dass diese Erzählung ebenso über ältere Vorstufen verfügt, wie sie später noch ausgiebig literarisch erweitert worden ist. Die neuassyrische Zeit ist aber mutmaßlicherweise die ihrer ersten literarischen Formierung. Deshalb erscheint sie an dieser und nicht an anderer Stelle.
Die der im engeren Sinn literaturgeschichtlichen Darstellung jeweils beigegebenen Notizen zu geschichtlichen und einleitungswissenschaftlichen Sachfragen sind nur so weit ausgeführt, als sie für die literaturgeschichtliche Fragestellung von Belang sind. Für weiterführende Informationen sind die neueren Darstellungen zur Einleitung in das Alte Testament und zur Geschichte Israels zu konsultieren. Die im Text angegebenen Literaturverweise mögen als nicht spärlich erscheinen, sind aber angesichts der Breite der Fachdiskussion gleichwohl nicht mehr als exemplarischer Natur.
Einige Passagen dieses Buches verarbeiten – in unterschiedlich modifizierter Form – bereits an anderer Stelle publizierte Beiträge: Der Abschnitt zur Forschungsgeschichte (I. 3.) basiert auf einer stark gekürzten Version von Schmid 2007c. In den Überlegungen zu den literatursoziologischen Aspekten der Literaturproduktion und -rezeption (II. 3.) ist die Darstellung Schmid 2004a aufgenommen und stark erweitert worden. Das Unterkapitel über die Anfänge der deuteronomistischen Königsbücher (III. 2. a) lehnt sich teilweise an Schmid 2004b an, und einige der Abschnitte zur prophetischen Literatur greifen in zum Teil verkürzender und zum Teil erweiternder Form sowie, wo immer möglich, in literaturgeschichtlich vernetzender Weise auf meine einleitungswissenschaftliche Darstellung zu den „Hinteren Propheten“ in Gertz 2019, 313–412 zurück.
Ich danke der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt, meiner Mitarbeiterin Luise Oehrli und meinen Mitarbeitern Jürg Hutzli und Martin Leuenberger in Zürich, der alttestamentlichen Sozietät in Zürich, meinen Gesprächspartnern im Fach, namentlich Uwe Becker (Jena), Jan Christian Gertz (Heidelberg) und Markus Witte (Frankfurt am Main) und vor allem Ernst Axel Knauf (Bern), der mich in vielen Fragen beraten und vor einer Reihe von Irrtümern bewahrt hat, die aber vermutlich mit der Menge der möglichen Irrtümer noch lange nicht deckungsgleich ist. Zu danken habe ich auch dem Center of Theological Inquiry in Princeton, nicht nur für die Möglichkeit eines einjährigen Forschungsaufenthalts, sondern vor allem auch für die intensive Begegnung mit einer von der deutschsprachigen Diskussion in mehreren Aspekten doch deutlich unterschiedenen amerikanischen Bibelwissenschaft.
Zürich, im Februar 2008
Konrad Schmid
Zur dritten Auflage
Für die dritte Auflage ist der Text des Buches durchgesehen, an verschiedenen Stellen erweitert und korrigiert worden und es ist wichtige Literatur aus den Jahren 2014–2020 nachgetragen worden. Für die Korrektur, Überarbeitung und Neugestaltung des Skripts sowie die Erstellung des Registers bin ich Samuel Arnet zu großem Dank verpflichtet.
Zürich, im Dezember 2020
Konrad Schmid
A. Aufgabe, Geschichte und Probleme einer alttestamentlichen Literaturgeschichte
I.Weshalb eine alttestamentliche Literaturgeschichte?
1.Aufgabenstellung
Eine Literaturgeschichte bezeichnet den Versuch, literarische Werke nicht bloß je für sich, sondern sie in ihren inneren Zusammenhängen, Vernetzungen und historischen Entwicklungen darzustellen und zu interpretieren (Köpf 2002). Diese Aufgabenstellung bezeichnet in all ihrer Knappheit bereits Problematik und Chance der Literaturgeschichtsschreibung zugleich. Durchaus zu Recht wurde in der literaturwissenschaftlichen Diskussion darauf hingewiesen, dass das synthetische Vorgehen einer Literaturgeschichte nachgerade zwingend zu einer Vernachlässigung der Einzelwerke führen muss: „Man muß zugeben, daß die meisten Literaturgeschichten entweder Sozialgeschichten, Geschichten des in der Literatur zum Ausdruck kommenden Denkens oder mehr oder minder chronologisch angeordnete Eindrücke und Urteile über einzelne Werke sind“ (Wellek/Warren 1949/1971, 276, Hervorhebung K. S.). Man kann Wellek und Warren zufolge nicht beides zugleich haben: eine systematisierende, literaturgeschichtliche Zusammenschau verschiedener Werke aus verschiedenen Zeiten, die gleichzeitig auch jedem Einzelwerk angemessen Rechnung trägt. Entsprechend wollte Wellek am Ende seines Wirkens das Projekt einer Literaturgeschichte ganz aufgeben (Wellek 1979). Auch David Perkins neigt in seinem literaturtheoretischen Buch „Is Literary History Possible?“ dazu, die Titelfrage zu verneinen (Perkins 1992, 17). Gleichwohl liegt es auf der Hand, dass historische Einordnungen bestimmter Werke innerhalb ihrer literaturgeschichtlichen Kontexte ihrem Verständnis durchaus förderlich sein können. Außerdem ist auch eine literaturgeschichtliche Zusammenschau als solche – abgesehen von der Frage nach den Einzelwerken – eine in sich legitime und weiterführende Aufgabe, auch wenn sie um den Preis einer verkürzenden Darstellung ihrer Konstituenten erfolgt.
Diese Diskussionen mögen für die nichtbiblischen Literaturen hier auf sich beruhen bleiben. Für das Alte Testament liegt es jedoch auf der Hand, dass die vielfältige Interaktion unter seinen Texten es in besonderer Weise dafür qualifiziert, literaturgeschichtlich befragt zu werden. Ja, das Alte Testament selbst entwirft sich – in seinen verschiedenen kanonischen Anordnungen in unterschiedlicher Weise (siehe unten S. 31–35) – als Literaturgeschichte (vgl. Utzschneider 2002; Bosshard-Nepustil 2015).
Wie aber ist das Projekt einer Literaturgeschichte des Alten Testaments als kritische, wissenschaftliche Disziplin anzugehen? Es kann als ein Versuch verstanden werden, herkömmliche Teildisziplinen der alttestamentlichen Wissenschaft neu zusammenzubringen – nicht als Ersatz einer bestehenden Teildisziplin, sondern als Ergänzung dazu. Die von ihrer Fragestellung her engsten Beziehungen bestehen naturgemäß zur Einleitungswissenschaft, diese aber wird zum einen integral mit Elementen einer Geschichte Israels und einer Theologie des Alten Testaments (nämlich der Eruierung der theologischen Konzeptionen in den alttestamentlichen Schriften in ihrer jeweiligen historischen Verankerung) zusammengesehen und folgt zum anderen – anders als die Einleitungswissenschaft – nicht der Abfolge des Kanons, sondern der Geschichte Israels. Dabei werden die Texte der Bibel in erster Linie historisch verstanden: Sie entstammen bestimmten Zeiten und sprechen in bestimmte Zeiten hinein, die zunächst ihre eigenen sind. Gerade im Fall der Bibel aber sind die Texte auch in sich verändernden Zeiten neu gelesen und fortgeschrieben worden (vgl. Jeremias 1996, 20–33; Steck 1996; 2001; Schmid 2016a). Das ist ein theologisch höchst bedeutsamer Vorgang, dem es zudem zu verdanken ist, dass wir das Alte Testament überhaupt kennen: Ohne den Prozess fortwährender Ab- und Fortschreibung der Texte wären die Erstausgaben alsbald verrottet. Länger als etwa 200 Jahre halten sich antike Schriftrollen unter normalen Umständen nicht.
Diesem Umstand entsprechend hat eine Literaturgeschichte des Alten Testaments nicht nur die mutmaßlichen Primärgestalten der alttestamentlichen Texte in ihren historischen Entstehungskontexten zu behandeln, sondern auch ihre Rezeptionsgestalten während der Gesamtzeit der Entstehung des Alten Testaments zu berücksichtigen. Das Buch Jesaja etwa ist für beinahe alle Epochen der alttestamentlichen Literaturgeschichte relevant – und zwar nicht nur deswegen, weil es vom 8. bis ins 2. Jahrhundert v. Chr. auf seine jetzige Gestalt hin angewachsen ist und deshalb Textanteile aus verschiedenen geschichtlichen Situationen in sich vereinigt, sondern weil auch seine älteren Bestandteile immer wieder neu gelesen und verstanden worden sind (Steck 1992b; 1996; Blenkinsopp 2002; Berges/Beuken 2016; Berges 2018). Der historische Blick auf die alttestamentliche Literatur darf sich also nicht auf punktuelle Untersuchungen und Einordnungen von Einzelperikopen beschränken, sondern muss darüber hinaus – gewissermaßen in resultativer Hinsicht – fragen: Wie sind traditionelle und redaktionelle Partien eines Textes gemeinsam in den unterschiedlichen Phasen seines literarischen Wachstums und seiner Überlieferung verstanden worden?
Die alttestamentliche Literaturgeschichte folgt mit ihrer historischen Frageausrichtung zunächst dem Einspruch der Romantik gegen die Aufklärung und hält die Bibel nicht für ein „Bilderbuch ewiger Wahrheiten“, geht aber ihrerseits auch über implizite Grundüberzeugungen der Romantik hinaus, indem sie deren Ursprungsmanie und Dekadenzmodelle nicht übernimmt, sondern versucht, ihren biblischen Gegenstand in historisch angemessener Weise zu verstehen.
Historisch zu fragen beinhaltet auch eine Wahrnehmung und literaturgeschichtliche Auswertung von Faktoren jenseits der bloßen Ereignisgeschichte, unter Einschluss von wirtschafts- und sozialgeschichtlichen bis hin zu geographischen Determinanten geschichtlicher Abläufe, wie sie etwa von der École des Annales vorgeschlagen worden ist (Mohr 1988; Burguière 2006).
Gegen den verbreiteten Trend, die Texte der alttestamentlichen Literatur zu kontextualisieren und vor allem als literarische Reflexionen historischer Konstellationen zu verstehen, ist schließlich auch philosophiegeschichtlich gewissermaßen Max Weber gegenüber Karl Marx ins Recht zu setzen (vgl. Schluchter 2006). Dabei ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Texte nicht nur geschichtliche Erfahrungen verarbeiten, sondern umgekehrt auch Texte geschichtstreibende Kräfte entfalten können: Die Bewältigung des Untergangs Judas in der babylonischen Zeit und die Entstehung des antiken Judentums als eines religiös bestimmten Ethnos (vgl. Blum 1995; Levin 2014) sind etwa ein Beispiel eines solchen Prozesses, der ohne entsprechende Überlieferungsgrundlage nicht plausibel geklärt werden kann. Umgekehrt ist etwa die vorgeschlagene Deutung der Gerichtsprophetie als vaticinia ex eventu (Kratz 1997b; 2003b.c) gerade auch aus historischer Perspektive, etwa angesichts der Bileam-Inschrift aus Tell Deir ʿAlla (TUAT II, 138–148; vgl. van der Toorn 2007, 176; Blum 2008a; 2008b), kein fraglos überzeugender Gedanke: E nihilo nihil fit. Ohne Verankerung der Gerichtsprophetie in Aussagen oder Texten vor ihrer geschichtlichen Bewahrheitung wird ihre Entstehung historisch nicht vollumfänglich erklärt. Das schließt nicht aus, sondern ein, dass in der Tat vielerorts mit Prophetentexten zu rechnen ist, deren Zukunftsperspektive literarisch ex post konstruiert ist. So erweckt zum Beispiel ein großer Teil der prophetischen Völkersprüche gegen die transjordanischen Nachbarstaaten Israels und Judas in der Tat den Eindruck, dass sie deren Untergang nachträglich geschichtsprophetisch rationalisieren wollen.
Eine Literaturgeschichte des Alten Testaments ist nicht bloß eine anders, nämlich historisch statt kanonisch angeordnete Einleitung in das Alte Testament, vielmehr muss sie deren entstehungsgeschichtliche Frage in verschiedener Hinsicht erweitern. Über die Entstehung alttestamentlicher Bücher und Texte hinaus hat sie insbesondere zu fragen, wie diese sich einerseits in geschichtliche Traditionsstränge einordnen und wie sie sich andererseits zu mutmaßlich gleichzeitigen literarischen Gesprächspartnern aus dem Alten Testament verhalten. Sie hat also die diachronen wie auch die synchronen Vernetzungen und Bezugnahmen eines Textes zu verdeutlichen. Damit versucht sie, zum einen das Profil bestimmter theologischer Positionen im Alten Testament durch den Vergleich mit konkurrierenden Positionen zu schärfen, zum anderen theologiegeschichtliche Entwicklungen zu rekonstruieren und plausibilisieren. Es ist hier schon anzumerken, dass die in den nachfolgenden Teilen B.–G. gegebenen Skizzen zu Verlauf und Entwicklung der alttestamentlichen Literaturgeschichte diesen Anspruch nicht immer material einzulösen vermögen – dazu ist die literaturgeschichtliche Forschung am Alten Testament zwar nicht zu jung, wie aus dem nächsten Abschnitt gleich ersichtlich werden wird, aber bislang zu wenig intensiv bearbeitet worden. Gleichwohl werden sich hier und dort deutlichere oder weniger deutliche Perspektiven ergeben, die die literaturgeschichtlichen Vernetzungen der alttestamentlichen Texte und Schriften in ihren historischen Kontexten darzustellen vermögen.
2.Forschungsgeschichte
Die literaturgeschichtliche Fragestellung am Alten Testament ist nicht neu. Wie ist ihre Geschichte verlaufen und welche Möglichkeiten und Probleme haben sich dabei gezeigt (vgl. Schmid 2007c; Eisen/Gerstenberger 2010)?
Literaturgeschichtlich zu fragen setzt den Beginn der historisch-kritischen Forschung am Alten Testament und damit das Bewusstsein der Divergenz zwischen biblischer Selbstdarstellung und historischer Rekonstruktion voraus. So sprach sich bereits 1670 Baruch de Spinoza in seinem Tractatus theologico-politicus für die Notwendigkeit einer literaturgeschichtlichen Behandlung des Alten Testaments aus, da dieses die nationale und natürliche Entwicklung des hebräischen Volksgeistes darstelle. Ansätze literaturgeschichtlichen Fragens finden sich auch bei Richard Simon (1685), Robert Lowth (1753), Johann Gottfried Herder (1782/83) und anderen. In der Zeit vor den vor allem mit dem Namen Julius Wellhausen verbundenen Umbrüchen verblieb die Rekonstruktion der alttestamentlichen Literaturgeschichte allerdings eng bei den biblischen Vorgaben, und es bildete sich – trotz des vehementen Votums von Hermann Hupfeld aus dem Jahr 1844 („Der eigentliche und allein richtige Name der Wissenschaft in ihrem heutigen Sinn ist demnach Geschichte der heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments, oder der biblischen Literatur, wie sie schon R. Simon nannte“, Hupfeld 1844, 12–13; vgl. Kaiser 2005) – keine eigene literaturgeschichtliche Subdisziplin der alttestamentlichen Wissenschaft heraus.
Eine eigentliche, terminologisch so angezeigte und methodisch reflektierte Literaturgeschichte des Alten Testaments legte erstmals Ernst Heinrich Meier mit seiner „Geschichte der poetischen National-Literatur der Hebräer“ im Jahr 1856 vor, die allerdings ein völliges Außenseiterwerk blieb und kaum Beachtung fand (Meier 1856). Dieses Geschick und der Umstand, dass es sich bei dieser Literaturgeschichte um das Werk eines Nichtalttestamentlers, eines Orientalisten, handelt, kann nachgerade als ein prophetischer Vorverweis auf die nahezu durchgängige Marginalität der literaturgeschichtlichen Fragestellung in der späteren alttestamentlichen Wissenschaft gedeutet werden. Entsprechend seiner Zeit ging Meier die alttestamentliche Literaturgeschichte dezidiert von der Frage nach der hebräischen „National“-Literatur her an (VI). Für ihn zerfiel die hebräische Literatur, die er bibelnah beschrieb, in drei Epochen: eine „Vorbereitungsepoche, von Mose bis zum Beginn des Königtums“, sie „bezeichnet das Werden des hebräischen Staates“, eine zweite Epoche erstreckt sich von „der Stiftung des Königthums bis zum Ende des Exils“, hier „erreicht der Volksgeist seine eigentliche Blüte“, während die dritte Epoche vom „Anfang des persischen bis ins makkabäische Zeitalter“ reicht, sie ist zugleich die Periode der „Vollendung und des Verfalls“ (24).
Noch näher am biblischen Bild der Literaturgeschichte des Alten Testaments blieb das zweibändige Werk von Julius Fürst (1867/70), das ursprünglich auch die neutestamentliche Literatur miteinschließen sollte, dann aber nur bis zur Behandlung der frühpersischen Zeit fertiggestellt wurde. Fürst folgte in der Pentateuchforschung der älteren Urkundenhypothese, die Psalmen sind für ihn davidischen und die Sprüche salomonischen Ursprungs. Die Propheten sind literaturgeschichtlich im Wesentlichen für ihre Bücher insgesamt verantwortlich. In all diesen alttestamentlichen Schriften ist aber auch älteres Quellenmaterial verarbeitet. Deshalb liest sich Fürsts Literaturgeschichte auf weite Strecken hin wie eine Darstellung der in die biblischen Bücher eingegangenen, älteren Vorgaben.
Das zweibändige Werk von David Cassel (1872/73) systematisiert sehr viel stärker nach formalen Gesichtspunkten. Der Aufriss ist nicht in erster Linie chronologisch geordnet, sondern strebt eine gattungsmäßige Sortierung an. Cassel unterschied poetische, prophetische, gesetzliche und historische Literatur. Durchgeführt ist die literaturgeschichtliche Darstellung aber nur für die beiden erstgenannten Bereiche, wobei – der Natur der Sache entsprechend – nur die prophetische Literatur in sich wirklich geschichtlich differenziert wird. Auch Cassel notierte die Kontextverflochtenheit der Hebräischen Bibel, hielt aber in der Regel die Bibel für den gebenden Teil.
Julius Wellhausen, der die historische Bibelkritik mit der Spätdatierung der Priesterschrift neu fundierte, hat keines seiner Bücher mit dem Titel „Literaturgeschichte“ überschrieben, doch tragen sowohl seine „Prolegomena“ (1883/61927) wie auch einzelne Paragraphen der „Israelitischen und jüdischen Geschichte“ (1904) Züge literaturgeschichtlicher Zugangsweisen. Man kann vermuten, dass es nicht zuletzt die historisch-synthetische Präsentation der bibelkritischen Resultate von Wellhausens Forschung war, die ihr ihren Erfolg in der alttestamentlichen Wissenschaft sicherte.
Die bekannte Synthese von Eduard Reuss (1881; vgl. dazu Vincent 1990) aus dem Jahr 1881 verstand sich programmatisch als Weiterführung der bisher erreichten Bibelkritik vor allem nach Karl Heinrich Graf, Julius Wellhausen und Abraham Kuenen. „Denn das beste was bis jetzt gethan ist, sie nennen’s die historisch-kritische Einleitung ins Alte Testament, ist nicht das Haus selber, sondern erst der statistische Bericht über die Vorarbeiten in der Bauhütte und Werkstatt“ (21). Reuss’ eigene Darstellung ist chronologisch geordnet und klassifiziert die Literaturgeschichte etwas schematisierend in vier Epochen: die „Zeit der Helden“, die „Zeit der Propheten“, die „Zeit der Priester“ und die „Zeit der Schriftgelehrten“ (XIII–XV). Immerhin aber zeichnete Reuss vor, was die in den nächsten Jahrzehnten vorgelegten Darstellungen der alttestamentlichen Literaturgeschichte dann entsprechend prägte. Er fand in den Hymnen wie etwa dem Deboralied die vorstaatlichen Anfänge der alttestamentlichen Literatur, die sich dann über die großen Schriftsteller der Königszeit wie den Jahwisten oder Jesaja fortsetzte, um dann vor allem mit der priesterlichen und gesetzlichen Literatur der nachexilischen Epoche zu enden. Dieser Dreischritt – alte poetische Einzeltexte als Anfänge der Literaturgeschichte, die klassischen Propheten und die frühen pentateuchischen Quellenautoren als ihr Kulminationspunkt und die Gesetze als ihr Ausklang – spiegelt gewissermaßen den literaturgeschichtlichen common sense des ausgehenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts.
1893 erschien Gerrit Wildeboers Literaturgeschichte in holländischer Sprache, zwei Jahre später in deutscher Übersetzung. Es handelt sich bei ihr um eine weitere synthetische Zusammenschau der Entstehung der alttestamentlichen Literatur nach den durch Reuss, Kuenen und Wellhausen verursachten Umwälzungen in der Pentateuchforschung, die auch für das Gesamtbild der altisraelitischen Literatur und ihrer Geschichte von weitreichender Bedeutung sind. So hielt Wildeboer einleitend fest: „Will man den Wert und die Bedeutung der israelitischen Litteraturgeschichte recht verstehen, so muss man vor allem von der Wahrheit durchdrungen sein, nicht nur dass es das nachexilische Judentum gewesen ist, das uns diese Litteratur übermittelt hat, sondern auch dass für einen großen Teil derselben die Verfasser in dieser Periode zu suchen sind und endlich, dass die Überlieferung älterer Schriften nicht ohne oft eingreifende Veränderungen statt hatte.“ (1, vgl. 105) Das klingt zwar programmatisch, in der Durchführung blieb Wildeboers Buch allerdings weitgehend den Datierungsansätzen der zeitgenössischen Forschung verhaftet. Wenig Gewinn zog Wildeboer zudem aus der literaturgeschichtlichen Fragestellung als solcher – seine Darstellung wirkt auf weite Strecken hin wie eine chronologisch umgeordnete Einleitung in das Alte Testament.
Eine knappe Darstellung der Literaturgeschichte des Alten Testaments findet sich dann bei Emil Kautzsch, zunächst als Beilage zu seiner Übersetzung des Alten Testaments, dann „nicht ohne anfängliche Bedenken“ als Separatdruck erschienen (1897, III). Sie periodisierte die Literaturgeschichte nach den innenpolitischen Zäsuren in der Geschichte Israels: „Die vorkönigliche Zeit“, „Die Zeit des ungeteilten Königtums“, „Die Zeit des geteilten Reichs bis zur Zerstörung Samarias“, „Von der Zerstörung Samarias bis zum Exil“, „Die Zeit des Exils“, „Die nachexilische Zeit“ (V–VI). Trotz ihrer Knappheit fixierte sie den materialen Stand der literaturgeschichtlichen Diskussion auch in einer gewissen Detailliertheit für die nächsten Jahre. Gleichwohl bleibt für das Schattendasein der literaturgeschichtlichen Fragestellung in der deutschsprachigen Wissenschaft bezeichnend, dass Kautzsch’ Darstellung als kleiner Appendix konzipiert war, während die späteren literaturgeschichtlichen Entwürfe von Hermann Gunkel, Karl Budde und Johannes Hempel als Teile übergreifender Darstellungen oder Reihen (Hermann Gunkel: „Die orientalischen Literaturen“ in „Die Kultur der Gegenwart“, I/7; Karl Budde: „Die Litteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen“, Band 7; Johannes Hempel: „Handbuch der Literaturwissenschaft“) erschienen – also gewissermaßen durch fachfremde Initiativen generiert wurden.
Wenn auch das Projekt einer Literaturgeschichte des Alten Testaments nie in das Zentrum des Faches rücken konnte, so bleibt es forschungsgeschichtlich mit dem Namen Hermann Gunkels verbunden (1906a.b; vgl. Klatt 1969, 166–192; Liwak 2004/2013, IX–XXXI; Witte 2010; Schmid 2011c), der die breitesten, originellsten und – relativ gesehen – auch folgeträchtigsten Anstrengungen zu dessen Weiterentwicklung unternahm, auch wenn er zeitlebens nur eine knappe Skizze mit 50 Seiten Umfang als material entwickelte Darstellung publizieren konnte. Eine besondere Rolle kam dabei der von ihm maßgeblich mitentwickelten (aber nicht so genannten [Blum 2006, 85]) Fragestellung der Formgeschichte zu: Die Literaturgeschichte des Alten Testaments ist bei Gunkel als Geschichte seiner Gattungen gefasst (Gunkel 1913, 31). Dahinter stand die Vorstellung, dass die alttestamentlichen Texte weithin auf mündliche Vorstufen zurückgehen und dass sich die geistige Geschichte des antiken Israel vor allem über den geschichtlichen Wandel der im Redeleben beheimateten und später auch für die Niederschrift verwendeten Gattungen beschreiben lasse. Im Grunde genommen war diese Literaturgeschichte nicht an den Texten selbst, sondern an den hinter ihnen stehenden Prägeelementen interessiert. Literaturgeschichte als Gattungsgeschichte betrieben fragte nach dem jeweiligen „Sitz im Leben“ einer Gattung und öffnete so, das war jedenfalls die Meinung Gunkels, den Blick in das religiöse Geistesleben Israels. Zu diesem methodischen Programm trat bei Gunkel eine Gliederung der altisraelitischen Literaturgeschichte, die eine charakteristische Gewichtung erkennen lässt: Gunkel unterschied drei Epochen, zunächst beschrieb er „[d]ie volkstümliche Literatur bis zum Auftreten der großen Schriftsteller (bis ca. 750)“ ([1906b] 1963, 5), dann folgten „[d]ie großen Schriftstellerpersönlichkeiten (ca. 750–540)“ (26) und schließlich „[d]ie Epigonen“ (43). Gunkel reproduzierte mit dieser Gliederung die besonders im 19. Jahrhundert geläufige Trennung zwischen dem vorexilischen, prophetischen „Hebraismus“ und dem nachexilischen, gesetzlichen „Judaismus“. Die religiösen Genies, auf die die großen geistigen Entwürfe des Alten Testaments zurückgehen, gehörten in die Zeit zwischen Jesaja und Deuterojesaja, danach folgten nur noch „Epigonen“. Gunkels Entwurf war zu seiner Zeit keine erfolgreiche Aufnahme beschert (Bertholet 1907), was mit zum weiteren Schattendasein der von ihm verfolgten literaturgeschichtlichen Fragestellung beigetragen haben dürfte. Für seine Rezipienten war offenbar vor allem das unklare Verhältnis der beiden Fragen nach den Gattungen und nach den Schriftstellerpersönlichkeiten problematisch; für Gunkel ergänzten sie sich, für seine Leser aber trat, den Besprechungen nach zu schließen, der von Gunkel eingebrachte Gattungsfokus zu stark in den Vordergrund.
Karl Buddes Darstellung der Literaturgeschichte war für ein breiteres Publikum konzipiert (1906). Doch Budde gelangte nicht über eine Zusammenfassung einleitungswissenschaftlicher Ergebnisse heraus, das Buch ist ein Abschluss seiner eigenen, entstehungsgeschichtlich ausgerichteten Arbeiten, markiert aber keinen wissenschaftsgeschichtlichen Neuanfang.
Im englischsprachigen Raum legte Harlan Creelman 1917 eine chronologisch geordnete Einleitung in das Alte Testament vor. Ihr Anspruch auf Innovation war allerdings vergleichsweise bescheiden: Sie richtete sich an ein breiteres Publikum und verzichtete weitestgehend auf historische Urteilsbildung. Sie verstand sich vielmehr als eine Synthese bisheriger Forschung am Alten Testament. Das Gesamtbild von Creelmans Darstellung blieb stark den biblischen Vorgaben verhaftet.
Die 1919 von Johannes Meinhold verfasste und in der Folgezeit mehrfach aufgelegte Einleitung verstand sich zwar nicht als Literaturgeschichte, war aber de facto doch mehr als eine herkömmliche Einleitung, da sie zum einen die Literatur des Alten Testaments nach Epochen – und nicht nach der kanonischen Abfolge – besprach und zum anderen auch jeweils eigene Abschnitte zur Darstellung der historischen Epochen selbst bot.
Recht einflussreich war die literaturgeschichtliche Darstellung von Julius A. Bewer (1922), eines in Deutschland geborenen Alttestamentlers am Union Theological Seminary in New York, der der amerikanischen Forschung wichtige Erkenntnisse der deutschsprachigen historischen Bibelkritik und der Gattungsforschung vermittelte.
Die im deutschen Sprachraum des 20. Jahrhunderts vielleicht bekannteste und ausgearbeitetste Darstellung einer Literaturgeschichte stammt von Johannes Hempel aus dem Jahr 1930. Sie gliedert sich in ein einleitendes Kapitel („Voraussetzungen“, 1–23), das die Forschungsgeschichte der Einleitungswissenschaft mit besonderer Emphase auf Wellhausen sowie die kulturgeographischen Determinanten behandelt, und zwei Hauptteile („Formen“, 24–101, und „Der Gang der Geschichte“, 102–194), die deutlich den Einfluss Gunkels zeigen: Der Untersuchungsgegenstand wird zunächst formgeschichtlich und erst in einem zweiten Schritt literaturgeschichtlich angegangen. Zunächst behandelte Hempel die Gattungen der alttestamentlichen Literatur und ihre Geschichte, dann die konkreten Texte in ihrer historischen Abfolge. Bemerkenswert ist bei Hempel die Überzeugung von der kulturgeschichtlichen Vernetzung des Alten Testaments: „Die israelitische Literatur ist weithin nur als Glied der ‚altorientalischen Weltliteratur‘ verständlich“ (11). Doch bei aller Energie und Innovativität, die diesem Entwurf innewohnt, ist er doch nicht genrebildend geworden: Die alttestamentliche Literaturgeschichte blieb nach wie vor ein Randprojekt.
Aus der Mitte des 20. Jahrhunderts ist weiter die Literaturgeschichte von Adolphe Lods zu nennen (1950). Lods stellte einleitend in seiner Darstellung fest, dass die literaturgeschichtliche Fragestellung in der alttestamentlichen Wissenschaft bislang ein Schattendasein fristete (11). Er identifizierte im Wesentlichen drei Gründe dafür. Zunächst stelle der „caractère composite des livres actuels“ (11) ein elementares Problem dar, das weiter dadurch verschärft werde, dass die Forschung den Werdegang dieser Bücher oft nur auf unsichere Weise rekonstruieren könne (13). Schließlich sei darauf hinzuweisen „que nous ne possédons de cette littérature que des fragments minimes“ (14). Doch dürften diese Aspekte nach Lods nicht dazu verleiten, die literaturgeschichtliche Fragestellung aufzugeben, denn es reiche nicht zu, den „caractère composite des livres actuels“ lediglich literarkritisch zu analysieren, sondern der literarische Werdegang der alttestamentlichen Bücher müsse auch synthetisch rekonstruiert werden. Was die Unsicherheiten in der literarhistorischen Rekonstruktion betrifft, so betonte Lods auch hier, dass bei allen Schwierigkeiten im Einzelnen die grundsätzlichen Befunde durchaus erhebbar seien, und auch die Fragmentarität der althebräischen Literatur unterscheide sie nicht grundsätzlich von jener der griechischen oder lateinischen. Literarkritisch war Lods von Wellhausen beeinflusst, religionsgeschichtlich von Greßmann, entsprechend folgte er der Neueren Urkundenhypothese im Zuschnitt Wellhausens und betont die religionsgeschichtliche Kontextualisierung der althebräischen Literatur. An Lods’ Darstellung sind drei wesentliche Eigenarten hervorzuheben. Zum einen fällt der späte Einsatzpunkt auf: Zwar mit Blick zurück auf frühe poetische Stücke und mündliche Traditionen, begann Lods erst mit der Assyrerzeit. Damit ist er eigentümlich modern, rechnet doch die neuere Forschung erst von dieser Zeit an mit einer so weit entwickelten Schriftkultur im antiken Israel, die auch größere Texte hervorbringen kann. Dann wird bei Lods, zumindest in einigen Bereichen, deutlich das Bemühen greifbar, intertextuelle Einflüsse zu thematisieren. So behandelte er etwa eigens die prophetischen Einflüsse auf Zusätze in J oder in E (305–323). Schließlich finden sich bei ihm breite Erörterungen zu Parallelerscheinungen aus der altorientalischen Literatur. Lods’ Buch war also durchaus zukunftsweisend, doch als französischsprachiger Protestant blieb Lods sowohl im eigenen Land wie auch außerhalb wenig gehört.
Vom Beginn der fünfziger Jahre bis in die achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts wurde es noch stiller um das Projekt einer alttestamentlichen Literaturgeschichte. Klaus Koch konnte 1964 feststellen, dass „das Unternehmen einer Literaturgeschichte mit Gunkels Tod sang- und klanglos unterging und gegenwärtig völlig vergessen ist“ (Koch 1964, 114). Der Begriff „Literaturgeschichte“ tauchte kaum auf, es entstanden auch keine neue Synthesen, und dies in einer Zeit, die jedenfalls in der deutschsprachigen protestantischen Theologie als eine Blütezeit der alttestamentlichen Wissenschaft gilt (Ebeling 1972, 26–27). Vermutlich sind verschiedene Faktoren für diesen doch auffälligen Befund verantwortlich: Zum einen stand die literaturgeschichtliche Fragestellung auch in den Literaturwissenschaften damals am Rande des Interesses. So hielt etwa Jauss in seiner Konstanzer Antrittsvorlesung 1967 fest:
Literaturgeschichte ist in unserer Zeit mehr und mehr, aber keineswegs unverdient in Verruf gekommen. Die Geschichte dieser ehrwürdigen Disziplin beschreibt in den letzten 150 Jahren unverkennbar den Weg eines stetigen Niedergangs. Ihre Gipfelleistungen gehören allesamt in das 19. Jahrhundert. Die Geschichte einer Nationalliteratur zu schreiben, galt zu den Zeiten von Gervinus und Scherer, De Sanctis und Lanson als das krönende Lebenswerk des Philologen … Dieser Höhenweg ist heute schon eine ferne Erinnerung. Die überkommene Form der Literaturgeschichte fristet im geistigen Leben unserer Gegenwart nur mehr ein kümmerliches Dasein. (Jauss, 21970, 144)
En vogue war vielmehr die „werkimmanente Interpretation“ etwa im Sinne Emil Staigers (1955). Weiter stand die deutschsprachige protestantische Theologie mitsamt den Bibelwissenschaften deutlich unter dem Einfluss der Kerygmatheologie, für die die literaturgeschichtliche Fragestellung von untergeordnetem Interesse war. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass nach dem Krieg eine Vielzahl von Einleitungen in das Alte Testament entstand, deren innerer, offenbar historisch inspirierter Aufbau namentlich im Bereich der Prophetenbücher leicht vom kanonischen Aufbau des Alten Testaments abwich, so dass sie gleichzeitig als Funktionsäquivalente für literaturgeschichtliche Darstellungen dienen konnten (vgl. Anderson 1957; Soggin 1968/69; Schmidt 1979). Selbst die epochemachende Theologie von Rads (1957/1960), in einer frühen Rezension sogar als Einleitung höherer Ordnung charakterisiert (Keller 1958; vgl. von Rad 1957, 7), lässt sich mit Vorbehalten hier einordnen. Ein Bedarf an einer eigenen Literaturgeschichte kam so kaum auf. Möglich und denkbar war dieses Verfahren in der Darstellung einer alttestamentlichen Einleitung allerdings nur so lange, als man von einer weitgehenden Konkordanz der biblischen Darstellung und des historischen Verlaufs der Geschichte Israels ausgehen konnte. Namentlich die Geschichtsbücher Genesis bis 2. Könige galten – vor allem was die Epochenfolge Erzväter, Exodus, Landnahme, Richterzeit, Königtum betrifft – als grundsätzlich vertrauenswürdig, so dass Einleitung und Literaturgeschichte in diesem Bereich parallel gehen konnten. Die Propheten mussten geringfügig umgruppiert werden, das betraf vor allem die Einordnung der drei „großen“ Propheten Jesaja, Jeremia und Ezechiel in ihre historischen Zeiten, während die Schriften generell als Ausdruck nachexilischer Frömmigkeit und Theologie interpretiert werden konnten. Dieses harmonistische Verständnis von Bibel und Literaturgeschichte, das sich auch in der Verhältnisbestimmung von Bibel und Geschichte Israels wiederfinden lässt, kann mit Manfred Weippert als „subdeuteronomistisch“ bezeichnet werden (1993, 73; vgl. Schmid 2018a). Vermutlich ist gerade dieses heute problematisch gewordene Konkordanzmodell für die Blüte alttestamentlicher Wissenschaft zwischen 1950 und 1980 mitverantwortlich gewesen.
Eine gewisse Ausnahme unter den literaturgeschichtlich modifizierten Einleitungen bildete Norman Gottwalds soziohistorische Interpretation des Alten Testaments 1985. Er bemühte sich zwar um eine historische Darstellung der alttestamentlichen Literatur mit breit ausladender Darstellung der vorstaatlichen Traditionen, die aber einem gewissen Biblizismus erlag und gleichzeitig aufgrund seiner eigenwilligen marxistischen Theorievorgaben wenig Wirkung entfaltete.
Eine eigentliche Literaturgeschichte ist dann erst wieder 1989 angegangen worden. Georg Fohrers knapper Abriss nannte seine Vorgänger, hielt diese aber für unzureichend: „Jedoch fehlten vor allem die Formkritik, welche die Redeformen und Gattungen untersucht, die Überlieferungskritik, die nach der Vorgeschichte der Schriften fragt, und die Redaktionskritik, die sich mit der Bearbeitung der schriftlichen Überlieferung befaßt“ (307 Anm. 2). Für Fohrer waren die bisherigen Entwürfe methodisch zu einseitig, zu sehr literarkritisch ausgerichtet – unter Ausblendung der weiteren exegetischen Methoden. Der Vorwurf ist zwar sehr pauschal formuliert, aber nicht ganz unzutreffend. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob damit das wichtigste Problem in der Geschichte der Disziplin „Literaturgeschichte des Alten Testaments“ benannt ist. Fohrers Kritik zielte allein auf die einleitungswissenschaftlichen Defizienzen der von ihm kritisierten Darstellungen, doch er formulierte für eine Literaturgeschichte des Alten Testaments keine grundsätzlich andersartigen Erfordernisse als für die Einleitungswissenschaft. Entsprechend blieb seine Literaturgeschichte eine chronologisch geordnete Einleitung in das Alte Testament, ohne diachrone und synchrone Textrelationen deutlich zu machen.
Nicht lange nach Fohrers Buch veröffentlichte Otto Kaiser seinen Artikel zur Literaturgeschichte des Alten Testaments in der Theologischen Realenzyklopädie (1991). Für ihn bildet die „Literaturgeschichte des Alten Testaments die notwendige Ergänzung der analytischen Einleitungswissenschaft, deren Ergebnisse sie aufnimmt und im organischen Zusammenhang mit der politischen, sozialen, kulturellen und vor allem religiösen Geschichte Israels und des frühen Judentums darstellt“ (306). Umso erstaunlicher ist, dass Kaiser dieses Programm in seiner materialen Skizze nicht einlöste, sondern im Wesentlichen einen Kurzabriss einer Einleitung in das Alte Testament gab, die dem Kanon entlangging. Auch in seinem Sammelband, der den Begriff der Literaturgeschichte im Titel trägt (Kaiser 2000b; vgl. auch Ruppert 1994 sowie Vriezen/van der Woude 2005), geht es hauptsächlich um einleitungswissenschaftliche Fragen.
Den bislang ambitioniertesten Versuch einer Literaturgeschichte nicht nur des Alten Testaments, sondern der gesamten christlichen Bibel hat sich das seit 1996 im Erscheinen begriffene, auf alttestamentlicher Seite von Walter Dietrich betreute Projekt „Biblische Enzyklopädie“ vorgenommen (Lemche 1996; Fritz 1996b; Dietrich 1997; Schoors 1998; Albertz 2001; Gerstenberger 2005; Haag 2003; W. Stegemann 2009; E. Stegemann/W. Stegemann 2019), das allerdings den Begriff der Literaturgeschichte nicht prominent verwendet.
Es handelt sich dabei um eine auf zwölf Bände angelegte Reihe, die in neun Bänden die Zeit und Literatur des Alten, und in drei weiteren Bänden diejenige des Neuen Testaments behandeln will. Die jeweiligen Teilbände sind nach einem einheitlichen Grundschema aufgebaut: Zunächst wird das biblische Bild der zu besprechenden Epoche dargestellt, dann folgt ein Versuch ihrer geschichtlichen Rekonstruktion sowie eine Darstellung der zeitgenössischen Literatur, den Abschluss bildet die Frage nach dem theologischen Ertrag. Schon diese Vorgabe in der Stoffdisposition zeigt, dass das Interaktionsverhältnis zwischen der Geschichte und ihrer Darstellung in der Bibel ganz im Zentrum der „Biblischen Enzyklopädie“ steht: Ausgehend von der biblischen Präsentation der Geschichte wird diese mit den historischen Erkenntnissen konfrontiert und literaturgeschichtlich sowie theologisch bedacht.
Für die historischen Fragen benutzen die Bände der Biblischen Enzyklopädie – entsprechend der hier besonders sich wandelnden Forschung – breit die neueren Ergebnisse aus der Bibelkritik, der Archäologie sowie der Altorientalistik, die allerdings nicht zu durchgängig kompatiblen Interpretationen führen. Was die Bibel von den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob oder Mose erzählt, ist für Lemche nicht Geschichte, sondern Fiktion, sind „schöne Geschichten“ (1996, 220), die nach seiner Meinung erst im „5., 4. oder sogar 3. Jahrhundert“ (217), also gut 1000 Jahre später als ihre biblische Ansetzung, entstanden sind. Schoors datiert die Anfänge der Erzelterngeschichte immerhin in das 8. Jahrhundert (176–177), während Dietrich für „Teile der Väter-, jedenfalls aber für die Mosegeschichte“ Entstehungszeiten noch vor der frühen Königszeit vermutet, „bei der Urgeschichte und erst recht beim Sinai“ seien sogar vorstaatliche Vorformen „kaum auszuschließen“ (1997, 228). Den Leserinnen und Lesern der „Biblischen Enzyklopädie“ werden so einige Kohärenzprobleme zugemutet, die zwar durchaus die Disparatheit der gegenwärtigen Diskussionslage widerspiegeln, jedoch nicht argumentativ aufeinander abgestimmt sind.
Die Aufteilung der Epochen in den Bänden der „Biblischen Enzyklopädie“ gibt eine grobe historische Leitlinie ab, die im Wesentlichen dem Geschichtsbild der Bibel selbst folgt und damit – jedenfalls für diese Epochenfolge – eine grundsätzliche Konkordanz zwischen Bibel und Historie insinuiert, die aber gerade in Frage steht: Sind etwa die Erzväter- und die Richterzeit tatsächlich zwei aufeinanderfolgende Epochen, wie es die Bibel will, oder handelt es sich, gerade historisch gesehen, nicht viel eher um zwei Darstellungen, die denselben Zeitraum, aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln betreffen?
Auch wäre zu fragen, gerade wenn man so sehr Wert auf Fragen der Entstehung der biblischen Literatur legt, ob die Gewichte in der Epochenaufteilung richtig verteilt sind: Von neun alttestamentlichen Bänden behandeln deren sechs die vorexilische Zeit. Angesichts des Befundes, dass es kein einziges Buch in der Bibel gibt, das in vorexilischer Gestalt auf uns gekommen ist, muss die relative Geringschätzung der in einem einzigen Band abgehandelten Perserzeit erstaunen, die vielleicht als die wichtigste Epoche literarischer Tätigkeit im Alten Testament zu gelten hat.
Die „Biblische Enzyklopädie“ ist ein Projekt, das zweifellos an der Zeit ist, doch der „subdeuteronomistische“ Gesamtaufriss und die mitunter fragmentarische Kohärenz der verschiedenen Bände lassen Fragen offen.
Weiter ist der kurze Entwurf von Christoph Levin (2001) zu nennen, der sich als eine integrierte Literatur-, Religions- und Theologiegeschichte versteht. Levins Credo besteht darin, dass das Alte Testament ein Literaturdokument des frühen Judentums sei; vorperserzeitliche Texte enthalte es nur noch in „Reste[n]“ (27). Die Knappheit der Darstellung und die umfassende Ausrichtung machen es dem Büchlein allerdings unmöglich, literaturgeschichtliche Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Positionen des Alten Testaments deutlich herauszuarbeiten.
Schließlich hat Reinhard Kratz (2013) eine Skizze vorgelegt, die einen früheren Entwurf (2006c) aufnimmt und ihn im Zusammenhang mit einem Abriss der Geschichte Israels und der Frage von Archiven im antiken Israel präsentiert.
Man erkennt aus diesem forschungsgeschichtlichen Überblick, dass das Projekt einer Literaturgeschichte des Alten Testaments zum einen nicht sehr häufig angegangen worden ist – für neuere neutestamentliche Gegenstücke lässt sich auf Köster (1971; 1980, eigenartigerweise unter dem Titel „Einleitung“ erschienen), Vielhauer (1975), Strecker (1992) und Theißen (2007; vgl. dazu Wischmeyer 2010) verweisen – und zum anderen in den meisten dieser Zugänge oft kaum mehr unternommen worden ist, als eine Einleitung des Alten Testaments statt in kanonischer nun in historischer Ordnung abzubilden. Eben dadurch verpasst aber eine solche Darstellung ihre genuin literaturgeschichtliche Pointe: Wie verhalten sich denn nun zeitgleiche Texte und Schriften in ihrem historischen Kontext sachlich zueinander? Nehmen sie aufeinander Bezug? Welche Positionen entwickeln sich aus welchen literaturgeschichtlichen Vorgaben? Eine Literaturgeschichte des Alten Testaments ist nur dann sinnvoll, wenn sie einen Mehrwert gegenüber der – für sich genommen vollkommen legitimen, aber eben anders perspektivierten – einleitungswissenschaftlichen Diskussion erbringt.
3.Theologische Einordnung
Die Anwendung des Begriffes einer Literaturgeschichte auf die Bibel, der mutatis mutandis für die weiteren altorientalischen Literaturen ohne weiteres geläufig ist (vgl. Weber 1907; Hallo 1975; Röllig 1978; Edzard, Röllig, von Schuler 1987–1990; Knauf 1994, 221–225; Loprieno 1996; Burkard/Thissen 2003; Veldhuis 2003, 10; Quack 2005; Haas 2006, 16–17; Utzschneider 2006; Ehrlich 2009), verdankt sich einer bestimmten theologischen Grundüberzeugung, die in den Anfängen der historisch-kritischen Bibelwissenschaft in der frühen Neuzeit wurzelt: Die Bibel ist Literatur wie jede andere antike Literatur auch (Rogerson 2001), und deshalb ist sie auch entsprechend auszulegen – unter Verzicht auf eine besondere Sakralhermeneutik (vgl. Schmid 2019, 99–101). Das heißt: Der wirkungsgeschichtlich begründete Status der Bibel als Heiliger Schrift „schützt“ sie nicht vor dem kritischen Zugriff der Vernunft, vielmehr kann und muss sie sich diesem aussetzen – gerade aus theologischen Motiven heraus, nämlich wenn ihre Ausleger einen allgemeinen Wahrheitsanspruch mit ihr verbinden und nicht im Status von Sondergruppensemantikern verbleiben wollen. Mit der Deklaration, die Bibel sei Literatur, verbindet sich also kein antitheologischer Impetus: Es geht nicht darum, die Bibel von der Heiligen Schrift zur Literatur zu „degradieren“, vielmehr im Gegenteil darum, ihren Status als Heilige Schrift aus ihren Texten selbst zwar nicht zu begründen, aber doch an diese zurückzubinden (Schmid 1999a; Schmid 2019, 96–112).
Hinzu tritt die bereits erwähnte Selbstdarstellung des Alten Testaments als Literaturgeschichte, die exegetisch und theologisch eigens zu würdigen ist. Wohl am entschiedensten hat mit dieser Eigenart des Alten Testaments Gerhard von Rad Ernst gemacht, der die Überzeugung vertrat, dass die adäquateste Form einer Theologie des Alten Testaments diejenige ist, die ihr selbst über weite Strecken hin entspricht, nämlich diejenige der Nacherzählung (von Rad 1957, 126). Eine Literaturgeschichte des Alten Testaments kann die theologische Nacherzählung des Alten Testaments vor allem um den Aspekt der Klärung seiner innerbiblischen Diskussionen ergänzen. Gerade in einer forschungsgeschichtlichen Situation, die sich von Rad in vielem verpflichtet weiß (Schmid 2019, 39–42) – aber auch gerade in der Frage der grundsätzlich heilsgeschichtlichen Prägung des Alten Testaments über ihn hinaus gegangen ist –, stellt sich die Frage immer drängender, wie das Eigenkonzept der alttestamentlichen Texte aussieht und wie deren Pluralität im Alten Testament selbst strukturiert ist.
4.Das Alte Testament als Ausschnitt der Literatur des antiken Israel
Eine am Textmaterial des Alten Testaments durchgeführte Literaturgeschichte unterscheidet sich zwar nicht in der Methode, aber doch in ihrem Gegenstand erheblich von anderen entsprechenden Zugangsweisen zu nichtbiblischen Literaturen, etwa einer Geschichte der neueren deutschen Literatur. Der Grund dafür liegt darin, dass das Alte Testament nicht die literarische Hinterlassenschaft des antiken Israel umfasst, sondern nur einen Teil daraus, der aufgrund einer bestimmten Selektion und/oder Reinterpretation zur „Hebräischen Bibel“ oder zum „Alten Testament“ geworden ist (vgl. Stolz 1997, 586; Schmid 2019, 113–122). Es wird kaum mehr möglich sein festzustellen, in welchem quantitativen Verhältnis diese nachmalig kanonischen Größen zur ehemaligen Literatur des antiken Israel stehen. Unbestreitbar ist aber, dass es diese weitergreifende Literatur gegeben hat. Man denke zum Vergleich nur an die zahlreichen antiken Schriften außerhalb Israels, von denen man lediglich durch Nennungen oder Zitate bei verschiedenen Schriftstellern Bescheid weiß.
Das epigraphische Textgut gibt, wenn man die transjordanischen Nachbarn Israels und Judas miteinbezieht, bei aller Fragmentarität noch eine recht gute Anschauung dessen, was man sich vorzustellen hat (Renz/Röllig 1995–2003; Smelik 1987). Vielleicht am eindrucksvollsten, wenn auch nach wie vor schwer verständlich ist das „Buch Bileams“ (TUAT II, 138–148; vgl. Blum 2008a; 2008b; 2019), von dem eine Abschrift als Wandinschrift im ostjordanischen Tell Deir ʿAlla erhalten geblieben ist, dessen Incipit als spr („Buch[rolle]“) darauf hinweist, dass es sich bei diesem Text ursprünglich um eine Buchrolle gehandelt hat. Die Mescha-Inschrift (TUAT I, 646–650) basiert auf Annalenexzerpten und belegt damit bereits das Vorhandensein einer auslegenden Schriftkultur (Knauf 1994, 129; vgl. Dearman 1989). Auch die Siloah-Inschrift (TUAT II/4, 555–556) ist wohl ein Exzerpt, was aus der fehlenden Dedikation und der ausgesparten Nennung des Bauherrn hervorgeht (Knauf 2001c). Aus Ammon ist auf einer Bronzeflasche ein Stück Lyrik überliefert (Thompson/Zayadine 1974; Coote 1980; Knauf 1994, 127):
Die Werke Amminadabs, Königs der Ammoniter,
Sohnes des Hassilʾil, Königs der Ammoniter,
Sohnes des Amminadab, Königs der Ammoniter:
der Weingarten und Obstgarten und die Terrassenmauer(n) und ein Wasserreservoir.
Möge er jauchzen und fröhlich sein viele Tage und lange Jahre.
Man mag allerdings zögern, bei diesen Beispielen von „Literatur“ zu sprechen, da sich mit diesem Begriff ein gewisser quantitativer Umfang sowie ein qualitativer Anspruch der entsprechenden Texte verbindet. Doch lässt sich von diesen Funden her, die aufgrund der materialen Schriftträger notgedrungen nicht sehr umfangreiche Beschriftungen bezeugen, mit Fug und Recht vermuten, dass es weitere, umfangreichere Texte auf Papyrus und Leder im antiken Israel gegeben hat. Diese haben – bis auf wenige Ausnahmen (Schmid 1996a, 36 Anm. 164) – nicht überlebt, ihr ehemaliges Vorhandensein ist aber wahrscheinlicher als ihre Nichtexistenz. Ja, das Alte Testament kennt selber einige Quellenangaben, die jedenfalls nicht in ihrer Gesamtheit fiktiv sind: So werden etwa genannt (1) das Buch der Kriege JHWHS (Num 21,14), (2) das Buch des Aufrechten (yšr) (Jos 10,13; 2Sam 1,18) (Keel 2007, 139–140), (3) das Buch des Liedes (šyr) (1Kön 8,53a LXX), (4) das Buch der Geschichte Salomos (1Kön 11,41), (5) das Buch der Geschichte der Könige von Israel (1Kön 14,19), (6) das Buch der Geschichte der Könige von Juda (1Kön 14,29) (vgl. Christensen 1998; Haran 1999; Vriezen/van der Woude 2005, 3–8; Naʾaman 2006). Das Buch des „Aufrechten“ und des „Liedes“ sind wahrscheinlich identisch: Der determinierte, aus sich kaum verständliche Titel „des Liedes“ ist vermutlich aufgrund einer Verschreibung von yšr „aufrecht“ zu šyr „Lied“ zustande gekommen (Keel 2007, 139). Ob es ein Buch der Geschichte Salomos gegeben hat, mag man aufgrund der kulturgeschichtlichen Schwierigkeiten dieser Annahme sehr bezweifeln. Immerhin wird aus dem Verweis aber deutlich, dass in den Büchern der Geschichte der Könige von Juda bzw. von Israel wohl nichts über Salomo stand.
Zusätzlich zu rechnen ist mit weiteren vorexilischen Überlieferungen, die vor allem nach der Katastrophe Jerusalems im Jahr 587 v. Chr. ausselektioniert worden sind. Besonders zu nennen sind hier heilsprophetische Überlieferungen, von denen nicht auszuschließen ist, dass sie ebenfalls schriftlich vorgelegen haben, wenn man nicht der strikten These zuneigen will, dass Schriftprophetie und Gerichtsprophetie koinzidieren (Kratz 1997b; 2003b). Die neuassyrischen Befunde zeigen jedenfalls, dass auch reine Heilsprophetie schriftlich aufgezeichnet werden konnte, auch wenn sich daraus keine Vorgänge der langzeitigen schriftgelehrten Tradentenprophetie wie in Israel ergaben (Jeremias 1994; Steck 1996). Man kann sogar erwägen, ob nicht die frappante formgeschichtliche Nähe der Heilsorakel Deuterojesajas zu den fast um ein Jahrhundert älteren neuassyrischen Prophetien (TUAT II, 56–82), die nach dem Untergang des neuassyrischen Reiches kaum mehr zugänglich gewesen sein dürften, darauf schließen lässt, dass es königszeitliche Heilsprophetien in Juda nach neuassyrischer Art gegeben hat, die die Deuterojesajaprophetie noch maßgeblich beeinflusst hatten. Diese Texte konnten dann nach der Abfassung von Jes 40–55 im Schulbetrieb ersetzt werden.
Die Literaturgeschichte des Alten Testaments betrifft also lediglich einen Ausschnitt der althebräischen Literaturgeschichte, der nur ex post beschreibbar ist: Die Literaturgeschichte des Alten Testaments behandelt diejenigen Texte, die sich als Gebrauchstexte in der Jerusalemer Tempelschule und nachher sowie deswegen als Heilige Schrift durchgesetzt haben.
Insofern bildet sie – anders als etwa eine Geschichte der deutschen Literatur – ein zwar in vielerlei Hinsicht disparates, aber doch sachlich und wirkungsgeschichtlich zusammenhängendes Korpus. Man kann sogar so weit gehen und festhalten, dass die Literaturgeschichte des Alten Testaments gleichzeitig seine nachmals orthodoxe oder zumindest in orthodoxem Sinn rezipierbare Theologiegeschichte dokumentiert. Die alttestamentliche Literaturgeschichte bildet nicht die Religionsgeschichte Israels ab, die zudem über weite Strecken hin nur über nichtsprachliche Darstellungsformen greifbar ist (vgl. Stolz 1997, 586), sondern bietet deren theologiegeschichtlich differenzierte Interpretation, die bestimmten Selektionskriterien unterworfen war.
Die aus dem ägyptischen Elephantine erhalten gebliebenen jüdischen Texte der mittleren Perserzeit zeigen mit ihrer beschränkt polytheistischen Frömmigkeit und der Erwähnung eines eigenen Tempels demgegenüber ein Beispiel einer religionsgeschichtlichen Verlängerung der Königszeit an: Die Anfänge der Kolonie gehen wahrscheinlich schon auf das 6., vielleicht sogar auf das 7. Jahrhundert v. Chr. zurück, deren Verhältnisse sie offenbar „besser“ bewahrt hat als das Judentum im Mutterland (Keel 2007, 783–784; Granerød 2016; van der Toorn 2019).
Ein literaturgeschichtlicher Zugang zum Alten Testament öffnet also ein Fenster in die zumeist elitären Segmente der religiösen Wirklichkeit des antiken Israel, in die Welt der des Schreibens kundigen Priester, Weisheitslehrer usw. Entsprechend kommt im Folgenden der religionssoziologischen Ebene des Staatskultes die größte Bedeutung zu, während Elemente der besonders in der vorpersischen Zeit weitgehend illiterat funktionierenden Familien-, Lokal- und Regionalkulte nur insofern eine Rolle spielen, als sie im Rahmen des Staatskultes rezipiert worden sind.
5.Hebräische Bibeln und Alte Testamente
Das Alte Testament gibt es ebenso wenig wie die Hebräische Bibel, sondern die jüdische und die christliche Tradition kennen unterschiedliche Anordnungen der biblischen Bücher, die christliche Tradition zudem – in den unterschiedlichen Kanons der verschiedenen Konfessionen und Kirchen – unterschiedliche Buchbestände (vgl. Lim 2013; McDonald 2017; Schmid/Schröter 2019).
Hebräische Bibeln – im Sinne der Heiligen Schrift des Judentums – in der geläufigen Standardanordnung bestehen aus den drei Teilen Tora, Neviʾim und Ketuvim und können deshalb auch abgekürzt Tanach (TNK) heißen (siehe unten S. 34). Die Tora umfasst die Bücher Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium (so die in der Bibelwissenschaft gebräuchlichen Bezeichnungen), die Neviʾim beinhalten die Bücher Josua, Richter, 1.–2. Samuel, 1.–2. Könige, Jesaja, Jeremia, Ezechiel sowie das Zwölfprophetenbuch (Hosea bis Maleachi), die Ketuvim schließlich werden gebildet aus den Büchern Psalmen, Hiob, Sprüche, Ruth, Hoheslied, Prediger, Klagelieder, Esther, Daniel, Esra-Nehemia und 1.–2. Chronik (in jüdischen Bibelausgaben ist die Standardanordnung der Bücher Psalmen bis Esther die folgende: Psalmen, Sprüche, Hiob, Hoheslied, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esther). Im Bereich der Neviʾim und der Ketuvim sind folgende Unterabteilungen geläufig: Die Bücher Josua bis Könige werden als die sogenannten „Vorderen Propheten“ zusammengefasst, Jesaja bis Maleachi als die „Hinteren Propheten“. In den Ketuvim bilden Ruth, Hoheslied, Prediger, Klagelieder und Esther die sogenannten „Megillot“, also die fünf „Rollen“, die bestimmten Festen zugeteilt sind, was allerdings erst seit dem 6. Jahrhundert n. Chr. belegt ist: Ruth gehört zu Schawuot, das Hohelied zu Pessach, Prediger zu Sukkot, Klagelieder zum 9. Av, Esther zu Purim.
In der handschriftlichen Tradition Hebräischer Bibeln sind aber auch abweichende Anordnungen der Bücher bezeugt (Beckwith 1985; Brandt 2001). Was sich allerdings immer gleich bleibt, sind die drei Kanonteile Tora, Neviʾim und Ketuvim und die darin befindliche Anzahl Bücher. Rechnet man aus, wie viele Variationsmöglichkeiten unter diesen zwei Bedingungen theoretisch möglich sind, so kommt man auf 120 Variationen für die 5 Bücher der Tora, auf 40 320 Variationen für die 8 Bücher der Neviʾim (wenn man die zwölf kleinen Propheten nach antiker Gepflogenheit als ein Buch zählt) und auf knapp 40 Millionen Variationen für die Ketuvim. Die Überlieferung hat diese Möglichkeit aber bei weitem nicht ausgeschöpft. Für die Tora gilt immer dieselbe Abfolge. Für die Neviʾim sind mindestens 9 Variationen bezeugt, die aber alle die Hinteren Propheten betreffen, da Genesis bis Könige einen narrativ chronologisch geordneten Zusammenhang darstellen und insofern inhaltlich kaum veränderbar sind. Für die Ketuvim ist die Ordnung relativ flüssig, hier sind mindestens 70 unterschiedliche Anordnungen bezeugt.
Die wichtigste Variante in den Neviʾim findet sich im babylonischen Talmud (bBB 14b–15a). Dort ist für die vier Prophetenbücher (Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Zwölfprophetenbuch) die Abfolge Jeremia, Ezechiel, Jesaja, Zwölfprophetenbuch belegt. Begründet wird dies mit einer theologischen Überlegung: Jeremia sei „ganz Gericht“, Ezechiel „halb Gericht, halb Trost“ und Jesaja sei „ganz Trost“. Nun wird allerdings schon aufgrund einer flüchtigen Lektüre dieser Bücher schnell klar, dass diese Bestimmung sachlich nicht zutrifft: Alle drei großen Prophetenbücher enthalten Gerichts- und Heilsaussagen und sind insofern gleicherweise „halb Gericht, halb Trost“. Weshalb aber kommt der babylonische Talmud dann auf diese Anordnung? Die Antwort liegt auf der Hand, wenn man auf die Buchumfänge der vier Prophetenbücher achtet: Das Jeremiabuch umfasst 21 819 Wörter, das Ezechielbuch 18 731 Wörter, das Jesajabuch 16 930 Wörter und das Zwölfprophetenbuch 14 357 Wörter (Jenni/Westermann 2004, II, 539–540 [Statistischer Anhang]). Die Anordnung im babylonischen Talmud ist also offenkundig von den Umfängen der Bücher her motiviert, und die gegebene theologische Begründung liefert eine Nachrationalisierung dieser Reihung nach Buchlänge.
In den Ketuvim variieren die Anordnungen zum Teil sehr stark. An dieser Stelle müssen folgende Beispiele genügen: Der Codex Aleppo und der Codex Leningradensis (B19A), zwei der wichtigsten alten Handschriften der Hebräischen Bibel aus den Jahren 950 und 1008 n. Chr., bieten die Chronik ganz zu Beginn der Ketuvim. Offenbar ist die Chronik, die ja breit von der Einrichtung des Tempelkults unter David und Salomo erzählt, damit als „historische“ Einleitung zu den Psalmen verstanden. Die heute geläufigen Standardanordnungen stellen die Chronik hingegen ganz an den Schluss der Ketuvim, damit die gewichtige „Exodus“-Aussage 2Chr 36,23b („Wer immer von euch aus seinem ganzen Volk ist – Jhwh, sein Gott, sei mit ihm, und er ziehe hinauf!“) den Tanach beschließt.
Eine andere, in den Handschriften häufig bezeugte Variante besteht darin, Ruth vor den Psalmen einzuordnen: Am Schluss des Buches Ruth leitet die Genealogie Davids zu den Psalmen über und bietet insofern eine alternative „historische“ Kontextualisierung dieses Buchs.
Für das christliche Alte Testament muss nach den unterschiedlichen Konfessionen unterschieden werden. In geläufigen protestantischen Bibelausgaben sieht sein Aufbau wie folgt aus: Unter einer ersten Rubrik sind die „Geschichtsbücher“ versammelt: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richter, Ruth, 1.–2. Samuel, 1.–2. Könige, 1.–2. Chronik, Esra, Nehemia, Esther. Es folgen dann die „poetischen Bücher“ Hiob, Psalmen, Sprüche, Kohelet, Hoheslied und schließlich die „prophetischen Bücher“ Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Ezechiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai, Sacharja und Maleachi.
Dieses Alte Testament kennt also ebenfalls eine Dreiteilung, die aber anderer Natur ist als diejenige in der Hebräischen Bibel. Die erste Überschrift fasst unter „Geschichtsbücher“ die Tora und die Vorderen Propheten zusammen, zusätzlich aber gehören noch die ebenfalls narrativen Bücher Ruth, Chronik, Esra, Nehemia und Esther hinzu. Das zweite Abteil („Poetische Bücher“) enthält eine wichtige Auswahl aus den Ketuvim: Hiob, Psalmen, Sprüche, Kohelet, Hoheslied. Der dritte Teil („Prophetische Bücher“) beinhaltet die Hinteren Propheten der Hebräischen Bibel, also Jesaja, Jeremia, Ezechiel sowie die 12 kleinen Propheten, zusätzlich aber noch Klagelieder, die in der griechischen Tradition aufJeremia als Autor zurückgeführt werden, sowie das Danielbuch, das entstehungsgeschichtlich in die Makkabäerzeit gehört und wohl deshalb nicht mehr im bereits geschlossenen hebräischen Kanonteil Neviʾim Aufnahme gefunden hat und in der Hebräischen Bibel als prophetisches Buch in die Ketuvim eingereiht werden musste.
Römisch-katholische Bibelausgaben kennen zwar denselben Grobaufbau, verfügen aber über sieben weitere Bücher. Nach Nehemia sind noch Tobit und Judith eingestellt, nach Esther folgen zwei Makkabäerbücher, nach dem Hohenlied finden sich noch die Weisheit Salomos und Jesus Sirach, nach Klageliedern noch Baruch. Zusätzlich sind Esther und Daniel um einige Kapitel umfangreicher (die sogenannten „Zusätze zu Esther und Daniel“).
Der größere Umfang des Alten Testaments in römisch-katholischen Bibeln rührt daher, dass die römisch-katholische Kirche auf dem Tridentinischen Konzil (1545–1547) die Vulgata in ihrem gegenüber der Hebräischen Bibel weiteren Bücherbestand als Heilige Schrift kanonisierte – im Sinne einer gegenreformatorischen Entscheidung. Es handelt sich bei diesem Konzilsbeschluss im Übrigen um das einzige Kanondekret im Christentum – oder anders gesagt: Nur die römisch-katholische Kirche hat ihre Bibel per autoritativen Beschluss auf einen bestimmten Bücherbestand festgelegt. Der weitere Umfang des Alten Testaments der Vulgata geht seinerseits auf die sogenannte Septuaginta zurück, die alte griechische Übersetzung des Alten Testaments (Tilly 2005). Aus ihr stammt auch die andersartige Reihenfolge der christlichen gegenüber den jüdischen Bibeln, wie aus der Darstellung auf der folgenden Seite ersichtlich ist (vgl. zu den einzelnen Handschriften: Swete 21914, 201–214; Beckwith 1985: Brandt 2001; McDonald/Sanders 2002, 588; McDonald 32007, 422.451; Schmid 2019, 53–76).
Wie in der hebräischen Überlieferung, so ist auch in der griechischen – allerdings nach Handschriften – zu differenzieren. Zur Bücherfolge in den großen Septuaginta-Handschriften lässt sich im Einzelnen Folgendes festhalten: Gemeinsam ist den großen Codices Sinaiticus (א), Alexandrinus (A) und Vaticanus (B), dass sie zum einen Ruth an der vom Erzählablauf her passenden Stelle zwischen Richter und 1. Samuel einordnen* und zum anderen auf Genesis bis 2. Könige nicht das corpus propheticum, sondern die Chronikbücher folgen lassen. Danach gehen א, A und B getrennte Wege: In א und B folgen auf die Chronikbücher die Bücher Esra-Nehemia, א schließt daran Esther, Tobit, Judith und 1.–4. Makkabäer an und bildet so ein großes historiographisches Korpus von der Schöpfung bis zu den Makkabäern. Darauf folgen in א die Propheten sowie die übrigen Schriften. B lässt auf Chronik und Esra-Nehemia die Psalmen, Proverbien, Kohelet, Canticum canticorum, Hiob, Sapientia Salomonis, Jesus Sirach, Esther, Judith und Tobit folgen und bietet die Propheten in Schlussposition. In A sind Esra-Nehemia
Hebräische Bibel
Septuaginta
Tora („Gesetz“)
Geschichtsbücher
Genesis
Genesis
Exodus
Exodus
Leviticus
Leviticus
Numeri
Numeri
Deuteronomium
Deuteronomium
Josua
Neviʾim („Propheten“)
Richter
Vordere Propheten
Ruth
1.–2. Basileion (= 1.–2. Samuel)
Josua
3.–4. Basileion (= 1.–2. Könige)