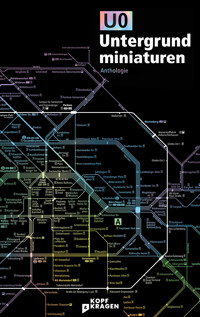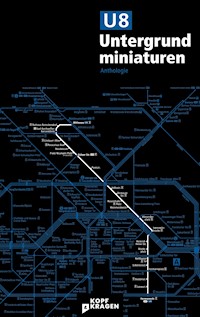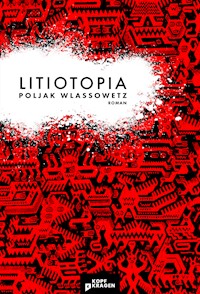
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kopf & Kragen Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin, 2029. Amaru Federmann, Sohn eines deutschen Neokolonialisten und Erbe des größten Lithium-Imperiums der Welt, kommt in seiner Wohnung zu sich. Sein Gedächtnis ist verwüstet, sein Glaube an sich und an die Zukunft ist erschöpft. Aber ein wiederkehrender Traum ruft etwas in ihm wach: Tika. Diese längst vergessene Gefährtin seiner Kindheit und Jugend lockt ihn nach Bolivien und erinnert ihn daran, wozu ein Mensch fähig sein kann. Während er nach Tika und seiner Vergangenheit sucht, begehrt sie gegen die Machenschaften der Federmänner auf und strebt mit ihrer in Europa wütenden Bewegung 3. Juli einen revolutionären Wandel an – »das gute Leben«. Dabei durchschreiten Amaru und Tika die letzten Möglichkeitsräume utopischen Denkens: Traum und Rausch. Wahn und Tod. Poljak Wlassowetz erzählt von einer existenziellen und psychedelischen Reise durch das seit Jahrhunderten ausgebeutete Bolivien und dessen Mythen. Ein Roman über die Kraft des Einzelnen, das Verlangen nach einer lebenswerten Zukunft und die Abscheulichkeit der Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LITIOTOPIA
Poljak Wlassowetz
Roman
Zitatnachweise
Eduardo Hughes Galeano – Interview; in der deutschen Übersetzung nach Buen Vivir Vom Recht auf ein gutes Leben, Alberto Acosta, oekom Verlag, München 2017, S. 188.
Miguel de Cervantes Saavedra – Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha, Projekt Gutenberg, Kapitel 11.
José María Arguedas 1 José María Arguedas 2 – Interview; Recopilación de textos sobre José María Arguedas, Havanna 1976, S. 451.
Emil Luckhardt – Die Internationale (im franz. Original von Eugène Pottier), 1910.
Erich Fromm – Haben oder Sein: Die Grundlagen einer neuen Gesellschaft, Erich Fromm Gesamtausgabe in 12 Bänden, Band II, DVA, München 1999, S. 393.
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2021 by Kopf & Kragen Literaturverlag, Berlin
Herausgeber: René Koch
www.kopfundkragen-verlag.de
Lektorat: Anke Albrecht
Satz und Korrektorat: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Umschlaggestaltung: Ruben August Fischer
Zeichnung (Landkarte): Cris Koch
ISBN (Softcover) 978-3-949729-01-0
ISBN (Hardcover) 978-3-949729-02-7
ISBN (eBook) 978-3-949729-03-4
Für Marta
›Wir sind eine Gesellschaft der Einsamkeiten, die sich begegnen und wieder verlieren, ohne sich gegenseitig zu erkennen. Das ist unser Drama, eine Welt, die für das Auflösen von Bindungen organisiert ist und in der der andere stets eine Bedrohung, nie aber ein Versprechen ist.‹
Eduardo Hughes Galeano
›Glückliche Jahrhunderte, glückliches Zeitalter, dem die Alten den Namen des Goldenen beilegten, und nicht deshalb, weil das Gold, das in unserm eisernen Zeitalter so hoch geschätzt wird, in jenem beglückteren ohne Mühe zu erlangen gewesen wäre, sondern weil, die damals lebten, die beiden Worte dein und mein nicht kannten. In jenem Zeitalter der Unschuld waren alle Dinge gemeinsam.‹
Miguel de Cervantes Saavedra
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Glossar
Kapitel 1
Europa. Berlin. 2029. Ich versinke in meinen Erinnerungen. Amaru und Tika. Ihre Wünsche. Ihre Utopien. Ihr Wahn. Alles, was ich weiß, weiß ich von ihnen. Tika und Amaru. Unteilbar. Jedes Wort und jede Lüge. Ihre Hinterlassenschaften, meine Vermutungen und Schlussfolgerungen sind nur kaleidoskopische Verwerfungen und zugleich alles, was mir von ihnen geblieben ist. Mein Körper wird schläfrig. Der fantasierende Geist erwacht.
*
Sieben Tage und sieben Nächte plagte Amaru ein wiederkehrender Traum, bis er sich dazu entschied, diese taumelnde, diese aus ihrer Bahn geglittene Welt zu verlassen. Eine mysteriöse Müdigkeit, eine fundamentale und einsame Erschöpfung hatte ihn zuvor befallen, und so hatte er sich seinem Traum, von dem er nach jedem Erwachen etwas mehr zu verstehen glaubte, wehrlos hingegeben. Erst am achten Tag war es Amaru möglich, sich von seiner Lethargie zu befreien, die Überreste seiner Existenz in seinen Manteltaschen zu verstauen und dem im Schlaf vernommenen Hilferuf zu folgen. Niemals war er sich eines Vorhabens so sicher gewesen, denn noch nie hatte er ein derartiges Verlangen empfunden.
Nachdem ihn sein Traum das erste Mal heimgesucht hatte und Amaru zu sich kam, streifte ein von Sonne und Mond geschaffener Lichtstrahl über sein entgeistertes Gesicht. Das trübe Licht, das die in Größe und Leuchtkraft sich gleichenden Himmelskörper in seine Wohnung warfen und das weder dem Tag noch der Nacht klar zuzuordnen war, hielt Amaru in einem Dämmerzustand zwischen Wachen und Träumen gefangen. Wahllos rauschten Sequenzen an ihm vorüber, Fragmente, deren Bedeutung er nicht erfassen konnte. Für gewöhnlich mochte Amaru diesen Moment der Unentschlossenheit, der vom Zwang, sich entscheiden zu müssen, befreit war, dieses für wenige Sekunden anhaltende Schweben, wenn der Körper selbst bestimmt, ob er auflebt oder der Realität fernbleibt, und das sich mit den ersten Lidschlägen oder Störgeräuschen verflüchtigt. Aber diesmal breitete sich eine Unruhe in seinem Körper aus, die ihm klar werden ließ, dass er aufwachen musste.
Vergeblich versuchte Amaru, die ihn durchdringenden Bruchstücke seines Traumes zu ordnen. Je mehr er sich bemühte, desto stärker sträubte sich sein Körper. Seine Glieder verkrampften. Sein gehetzter Atem drang durch Mund und Nase aus, wie ein wild schnaubendes Tier rang er nach Luft. Amaru spuckte und stöhnte. Er stammelte Worte in einer Sprache, die er nicht kannte, und warf seinen dröhnenden Kopf hin und her. Als es ihm gelang, die Bewegung seiner Augen zu kontrollieren und sie auf seine schmerzenden Fersen zu richten, sah er offenes Fleisch. Er spürte die Wärme des blutgetränkten Lakens, Panik befiel ihn und er betastete seinen Körper. Hämatome. Kratzer. Überall. Amaru drückte seine Handflächen auf seinen Brustkorb und dämpfte damit den Widerhall seines Herzens, das sich verlangsamte und nach einigen Schlägen stillzustehen schien. Seine Atmung verflachte. Das Sonnenmondlicht versiegte. Während er dalag, hilflos wie ein Sterbender, überfielen ihn Erinnerungen, die nicht von dieser Welt waren.
Amaru fror im Wind, der über die karge Ebene zog und unter der schwarz gewordenen Sonne zwei Menschen ausformte. Er hörte das schrille Gelächter der Gold fressenden Götter, sah ihre von Gier entstellten Gesichter. In einer weißen Salzwüste zuckte eine amputierte Zunge vor seinen Füßen und färbte die Landschaft dunkelrot. Ein Prozessionszug pilgerte einen Vulkankrater hinauf, wo eine Frau von einer Menschenmenge gesteinigt wurde und im letzten Augenblick nach ihm rief: »AMARU!«
Ihr Todesschrei, der so energisch war, dass Amaru das Zerreißen der Stimmbänder hören konnte, und der unter dem dumpfen Ton der aufschlagenden Steine hätte verstummen sollen, ließ ihn aufschrecken. Ein Echo hallte durch seine Wohnung, und Amaru drosch auf seine Ohren ein, woraufhin sein Name in ein monotones Pfeifen zerfiel. Das durch die Wucht seiner Schläge einsetzende Stechen war ihm Beweis genug, dass er wach lag. Ein verstörender Traum hatte ihn übermannt, ein willkürliches Spiel der Gedanken. Er selbst musste im Halbschlaf seinen Namen gebrüllt haben. Die übrigen Verletzungen konnten allein die Folgen eines Sturzes sein, an den er sich nicht mehr erinnerte. Womöglich hatte der zu einer Gehirnerschütterung geführt und seine körperlichen Symptome verursacht. Amaru war froh, nun halbwegs klare Gedanken fassen zu können. Er konzentrierte sich und versuchte, sich zu entsinnen, was er vor dem Schlafengehen getan hatte. Ohne Anhaltspunkt driftete er durch einen uferlosen Nebel. Das Einfühlen in seine innere Leere strengte ihn zu sehr an und deshalb gab er es in der Hoffnung, dass ihn das Geschehene von selbst einholen würde, wieder auf.
Mit der Zeit ließ der Schmerz in seinen Gehörgängen nach. Ein leichtes Schwindelgefühl blieb übrig. Amaru wollte sich aufrichten, aber sein Körper war schlaff und ausgezehrt, als ob er überhaupt nicht geschlafen hätte, sondern unablässig gerannt wäre. Er dehnte seinen Kiefer und streckte seine geschwollene Zunge heraus. Sein Mund und seine Kehle waren ausgetrocknet, zu sprechen war ihm unmöglich. Den unsinnigen Impuls, um Hilfe zu schreien, hätte er ohnehin unterdrückt. Er war ein Mann von fast 45 Jahren, der allein zurechtkam und schon lange keines anderen mehr bedurfte. Mühsam drehte er seinen Kopf zur Seite und schaute durch die offen stehende Flügeltür ins Wohnzimmer. Sein Blick verharrte minutenlang. Dann nahm er zögerlich die Bewegung eines durch den Raum gleitenden Schattens wahr.
Amaru kniff die Augen zusammen. Die Konturen verdichteten sich. Der vage Umriss gewann an Gestalt. Amaru erschrak, als er erkannte, dass jemand in seiner Wohnung umherschlich. Er war sich bald sicher, dass die Schattengestalt sich allein glaubte und nach irgendetwas suchte. Immer wieder verschwand sie aus seinem Blickfeld. Ihre Bewegungen wurden hektischer, wodurch der Holzboden laut knarrte. In Amaru stieg Zorn auf, als er sah, wie der Eindringling seine Aufzeichnungen vom Schreibtisch wischte, die Schubladen seiner Kommoden öffnete und sie auf dem Boden zertrümmerte. Amaru rief ihm zu, er solle aufhören und abhauen, doch er war bloß zu einem unverständlichen Lallen imstande, das dieser tobende Mensch nicht hörte. Ungestört riss er die Bücher und Schallplatten aus den Regalen, zerrte die Gardinen aus ihren Halterungen und ging auf den Balkon. Amaru wollte die Gelegenheit nutzen, ihn überraschen und niederschlagen, aber bevor er sich regen konnte, kehrte der Eindringling bereits zurück.
Er setzte sich aufs Parkett, lehnte seinen Rücken gegen die Wand und begann vor sich hinzureden: »Ama qhilla. Ama llulla. Ama suwa.«
Wieder und wieder flüsterte er diese Worte, deren Klang Amaru vertraut erschien, obwohl er die Bedeutung des Gesagten nicht verstand. Die Langsamkeit, mit der er sprach, und das fehlende Volumen seiner Stimme verrieten Amaru zumindest, dass dort ein alter Mann hockte. Amaru seufzte vor Erleichterung, denn er war sich sicher, dass er einen Alten, trotz seiner Erschöpfung, überwältigen konnte. Mit den Unterarmen stemmte er sich von der Matratze hoch. Mehrmals atmete er ein und aus, um dem Schwindel entgegenzuwirken. Dann wankte er auf den Alten zu, der sein Kommen nicht registrierte. Eine Armlänge von ihm entfernt, dazu bereit, über ihn herzufallen, musterte Amaru sein Gegenüber genauer.
Das ledrige Gesicht des Alten war von Furchen durchzogen. Es war abgemagert und mit den hohen Wangenknochen glich es einem Totenschädel. Ein Wollumhang bedeckte seinen buckligen Körper. In seinem Schoß lag ein entwurzelter Kaktus. Seine schmutzigen Finger umgriffen die Dornen, zupften sie heraus, und er schälte das Gewächs mit den Nägeln. Er zog Faser um Faser ab, und als er das Fruchtfleisch freigelegt hatte, biss er wie ein Ausgehungerter hinein.
Dies war nur ein verwirrter Greis, und Amaru empfand Mitleid mit ihm, der taub und blind zu sein schien. Nachsichtig strich er ihm über die pochenden Adern auf seinen Handrücken.
Der Greis hob den Kopf. In seinem Mund hechelte ein Zungenstumpf. Er stierte Amaru an, fletschte die Zähne und stürzte auf seine Kehle zu.
Knöcherige Finger quetschten Amarus Luftröhre zusammen. Überrumpelt ging er zu Boden. Unter der Wucht des Aufpralls und dem nicht nachlassenden Würgegriff des Alten verlor er das Bewusstsein.
Am Ufer einer öden Insel kam Amaru zu sich. Er war von einem See umgeben, den schneebedeckte Berge am Horizont begrenzten. Kein Wesen kreuzte den dämmrigen Himmel oder kroch über den steinigen Grund. Nichts verleitete das Wasser zu einer Regung. Amaru war, als hielte die Natur inne, als nähme sie sich eine Auszeit von der Last, ständig sein zu müssen. In der Annahme, er könnte diesen Ort durch sein Handeln wiederbeleben, stieg er die Böschung hinauf. Aber diese Welt verlangte nach keiner Reanimation. Ihr lag vielmehr daran, aus dem Zustand der Reglosigkeit heraus, in jenem Moment Neues zu gebären.
Jenseits des Ufers erblickte Amaru eine Ebene, auf der sich Sonne und Mond, in ihrer Mächtigkeit gleichend, einander näherten und sich Seite an Seite niederließen. Ein grelles Licht blendete Amaru. Die Gluthitze der Sonne vermengte sich mit der trockenen Kälte des Mondes, der einen verführerischen Duft verbreitete. Das Aroma von verbranntem Schießpulver lag in der Luft. Sein Gegenüber konnte nicht anders, als ihm zu verfallen. Die Sonne schlang ihre Plasmastrahlen um ihn, zog den Trabanten zu sich heran, sodass sie aufeinanderlagen und eins wurden. Der Himmel verdunkelte sich. Die Welt geriet in Bewegung. Der scharfkantige Fels erzitterte und schlitzte Amaru die Fersen auf.
Kosmisch kalte Böen rauschten über das Land. Auf dem in Erregung geratenen See türmten sich Wellen auf, rollten heran, schlugen gegen das Ufer und ihr Schaum spritzte über die Insel. Wo der glühende Kranz der schwarzen Sonne die Erde berührte und auf die Gischt traf, erhoben sich zwei Felsen, die der Wind zu Menschen ausformte. Ihre im Schein der Korona glänzende Haut schmiegte sich um ihren vollkommenen Körper, sinnlich und rein. In ihrer Haltung drückten sich eine Erhabenheit und eine Zuversicht aus, die Amaru kaum ertragen konnte. Sein Glied schwoll an und er lechzte danach, mit diesen Menschen zu verschmelzen. Mit ihm. Mit ihr. Gemeinsam. Sich seiner Lust schämend presste er die Handflächen auf seine Augenhöhlen. Doch seine Begierde zwang ihn dazu, dieses orgastische Ereignis zu betrachten. Seine Finger schoben sich auseinander.
Die neuen Menschen sahen sich an, neugierig, was ihre Schöpfer mit ihnen vorhatten. Sonne und Mond verströmten im Gleichklang Worte, die Amaru nicht einschätzen konnte, da er die Sprache dieser Welt nicht beherrschte. Die von den Urgewalten Gezeugten, Mann und Frau, Bruder und Schwester, Liebender und Liebende zugleich, verstanden hingegen und unterwarfen sich den Weisungen. Sie wagten erst aufzustehen und sich in Bewegung zu setzen, als sich die Himmelskörper aus ihrer Umschlingung gelöst und einen ebenbürtigen Platz am Himmel eingenommen hatten. In ihren Händen hielten die Menschen einen goldenen Stab, mit dem sie die Festigkeit des Untergrunds prüften. Nach drei Schritten wiederholten sie diesen Akt, nur um festzustellen, dass der Boden zu hart war und ihr Stab nicht eindringen wollte.
Amaru folgte ihnen im Abstand eines Ergebenen, und so liefen sie über die Insel, bis sie irgendwann müde wurden und am Eingang einer Erdspalte rasteten. Eine Wolkenwand rauschte vom Himmel herab. Unter ihrem Donnern schliefen sie ein. Der Andenwind peitschte über die Hochebene und über Amarus spröde Lippen. Auch er war erschöpft. Er schlich zu ihnen und zwängte sich zwischen die beiden nackten Körper. Haut an Haut. Die Umgebung zerrann im Regen, und Amaru fiel in einen Traum.
Vom Balkon blies ein Luftstrom in die Wohnung herein, der Amaru weckte. Auf dem Boden liegend griff er sich an den Hals. Die Atemnot und die ihn erdrückende Schwere hatten sich gelöst. Er stand wie ein Neugeschaffener auf und durchsuchte seine verwüstete Wohnung nach dem Einbrecher. Das Ausmaß seiner Zerstörungswut war irrsinnig. Die Bilder waren von den Wänden gerissen, eine einzige Malerei hing noch an ihrem Platz. Der Greis hatte alle elektronischen Apparaturen in ihre Einzelteile zerlegt und das Badezimmer zerschmettert. Amaru betrat die demolierte Küche. Ein Fliegenschwarm schwirrte ihm entgegen. Irgendetwas Fauliges verpestete die Luft, und Amaru trank unter dem lästigen Surren der Insekten am Wasserhahn. Fassungslos und den Alten verfluchend eilte er zur Wohnungstür. Die Kette war eingehängt, das Schloss von innen zugesperrt. Wie immer. Sicherheitshalber lugte er durch den Türspion. Der rote Samtteppich und das Geländer des Treppenaufgangs füllten seinen gewölbten Blick. Sonst war nichts und niemand zu sehen.
Amaru boxte gegen die Tür und beschimpfte sich als weltentrückten Schwachkopf, weil er den Überfall des Greises für real gehalten hatte. Er öffnete das Schloss, um in die Wirklichkeit zurückzukehren, ging einen Schritt nach draußen und stolperte über ein auf der Schwelle liegendes Paket. Ein Wachssiegel hielt den vergilbten Einband zusammen, der mit Amarus kalligrafisch gezeichnetem Namen versehen war. Mit dem Paket unter dem Arm verriegelte er die Tür und setzte sich an seinen Schreibtisch.
Was hatte ihn nur dazu getrieben, seine Wohnung kurz und klein zu schlagen? Hatte er getrunken? Seine Notizen waren zu Schnipseln zerkleinert. Was er noch lesen konnte, erschien ihm bedeutungslos. Ein paar Zahlenreihen und Graphen, bezeichnet mit Wasserstoff, Erdgas, Gold und Lithium. Mehr war von seinen Papierstapeln nicht übrig. Amaru durchstöberte die Unordnung und fand zwei Schatullen mit Rauchutensilien und Medikamenten. Er drehte sich eine Zigarette, nahm ein paar Züge und schaltete die Tischlampe ein, die nicht aufleuchtete. Sämtliche Glühbirnen in seiner Wohnung lagen in Scherben.
Über sich selbst im Halbdunkel den Kopf schüttelnd inspizierte Amaru das Paket. Das silberne Siegel hatte die Form eines Berggipfels, darunter stand eine Inschrift. Amaru schwenkte sein Feuerzeug, um die Buchstaben zu entziffern. »Ich bin das reiche Potosí, Schatzkammer der Welt, den Königen diene ich zum Neide«, las er mit schwacher Stimme vor. Potosí wusste er nicht zu verorten. Er bezweifelte sogar, wie er es immer tat, wenn er etwas nicht kannte, dass es existierte. Amaru wendete das Paket und begutachtete die Rückseite. In feinen Linien, als hätte man sie mit einer Tintenfeder aufgetragen, standen dort Worte aneinandergereiht, dicht an dicht, unzertrennlich, in sich geschlossen: »Ama qhilla. Ama llulla. Ama suwa.«
Amaru stieß das Paket von sich, rieb über sein kurz geschorenes Haar und kam zu dem Schluss, dass er träumte. Anders war dies alles nicht zu erklären. In der Erwartung, dass irgendetwas passieren würde, saß er da und rauchte. Das Chaos in seiner Wohnung löste sich nicht auf, noch geschah sonst etwas, also verwarf er diesen Gedanken wieder. Sein Körper fühlte sich sowieso viel zu lebendig an. Zu deutlich atmete er den hereinwehenden Wind ein, als dass er nicht wach sein konnte.
Amaru trat auf den Balkon. Seine Pflanzen waren allesamt entwurzelt. Beim Hinübergehen weichte die nasse Erde den Schorf an seinen Fersen auf. Er beugte sich über das Geländer und besah die totenstille Stadt. Die ihm vertrauten Plätze und Kreuzungen, an denen sich üblicherweise Menschen und Straßenlärm ballten, waren leer gefegt, die Laternen und Ampeln erloschen. Die Stadt war wie ausgestorben, die Fenster der Nachbarhäuser mit Dunkelheit verbarrikadiert. Amaru legte den Kopf in den Nacken. Noch nie hatte er Sonne und Mond derart nah beisammenstehen sehen. War es Tag oder Nacht? Hypnotisierend leuchteten ihn die Himmelskörper an. Die Luftfeuchtigkeit stieg, ihm wurde es schwüler. Schweißperlen umflossen seine Augenhöhlen. Seine Pupillen schrumpften zusammen. Sein Sehfeld verzerrte sich. Amaru blinzelte, aber die sich vor seine Augen schiebenden Fragmente vervollkommneten sich und vereinnahmten ihn ganz. Ohne es zu wollen, glitt er von sich und vor ihm öffnete sich eine andere Welt. Eine Welt, die bedrohlich und finster war.
Von Moskitos umschwirrt quälte sich Amaru durch den Dschungel, dessen feuchtwarmer Atem aufstieg. Überall schrie, pfiff, zischte und fauchte es. Die schrille Sinfonie des Waldes schwoll an und Amaru zwängte sich durchs Dickicht. Nur fort. Mit jedem Schritt schnitt das Gestrüpp tiefer in seine Haut hinein. Er schlug um sich und schrie seinen Schmerz und seine Verlorenheit heraus, bis sich der Wald seinem Klagen beugte und verstummte. Die Blätter wurden durchlässiger, das Gehölz weicher und er gelangte an eine Lichtung, die ein Rinnsal durchfloss. Durch das seichte Wasser watend, rieb er sich mit dem schwarzen Uferschlamm ein, um sich vor den Stechmücken zu schützen. Schrittweise verbreiterte sich das Rinnsal zu einem Bach, der in Stromschnellen mündete. Sie gruben sich durch den Dschungel und wiesen Amaru den Weg.
Nach etlichen Biegungen kam er an einer Sandbucht an. Ein Krächzen war zu hören, und Amaru vermutete, ein Raubtier würde sich über seine Beute hermachen und sie zerfleischen. Als er vorsichtig herantrat, vermengten sich die Laute mit menschlichen Stimmen. Amaru warf sich auf den Boden, denn diese Stimmen verhießen Unheil. Er schlängelte sich vorwärts und verschanzte sich hinter einem Baumstumpf. Unweit vor sich sah er ein improvisiertes Lager. Pferde tranken am Ufer. Zelte waren aufgespannt. Feuerstellen glommen. Ihr Leuchten spiegelte sich in den Rüstungen von Dutzenden, langbärtigen Männern. Sie begafften einen Gefangenen und bohrten ihm einen glühenden Eisenstab durch die Wange. Seine Haut und sein Fleisch verschmorten und seine Zahnreihen kamen durch das Loch zum Vorschein.
Seine Begleiter, die wie er in Fesseln lagen, begriffen, dass die anderen nach dem an seinem Handgelenk schimmernden Armreif verlangten. Sie beschworen die neuen Götter, dass der aus den Bergen kommende Fluss Urubamba die Geschenke der Sonne immerzu an die Strände spüle und sie zwar schön seien, jedoch den Hunger nicht stillen könnten. Wenn die Götter sie gehen ließen, brächten sie ihnen kraftspendende Pflanzen, nach deren Verzehr sie friedfertiger sein würden.
Was sie sagten, konnte Amaru genau verstehen, doch den Folterern blieben die Worte der Gefangenen rätselhaft und sie erzürnten darüber. Sie trommelten gegen ihre Brustpanzer und die metallische Vibration kroch zu Amaru.
»Reicht mir mein Eigentum und lasst mich sehen, ob es auch in seinen offenen Adern fließt!«, befahl einer, den sie ehrfurchtsvoll mit Don Federmann ansprachen.
Zwei Männer folgten seinem Befehl. Sie zogen ihre knurrenden Bluthunde mit sich und packten die zusammengebundenen Hände ihres Opfers. Da es ihnen zu mühselig war, die Knoten zu lösen, hackten sie ihm mit ihren Schwertern beide Unterarme ab. Der Armreif fiel auf den Boden und die losgelassenen Hunde zerfleischten den Amputierten. Unter dem Kreischen seiner Sippe krepierte er jämmerlich. Sogleich stürzten sich die Gepanzerten auf die Beute. Sie wälzten sich auf der Erde und prügelten sich darum. Laut grölend strömten immer mehr von ihnen herbei, und als sie wieder auseinandergingen, war außer aufgewirbeltem Sand nichts übrig.
Der Federmann forderte einen von ihnen, der ein Holzkreuz um seinen Hals trug, mit einem Fingerwink dazu auf vorzutreten. Sich sein schmieriges Haar von der Stirn wischend kniete sich der auserwählte Fettwanst vor seinem Herrn nieder, der Amaru den Rücken zuwandte. »Niemand bestiehlt die Gemeinschaft!«, mahnte der Federmann und zog sein Folterinstrument durch den zischenden Sand. Hastig fingerte der andere in seinen Lederstiefeln und übergab seine Beute. Den Goldreif in die Höhe haltend geriet der Federmann in Zorn. »Ihr Narren, das Land, das vor uns liegt, ist mit goldenen und silbernen Straßen gepflastert. Wenn wir zusammenhalten, werden unsere Nachfahren für Jahrhunderte darüber gehen. Dies hier ist die Neue Welt und in ihr beraubt man einander nicht, denn sie ist gerecht und alles ist im Überfluss vorhanden. Ihr seid keine Schweine, die Abfälle fressen und sich im Dreck suhlen, sondern Konquistadoren!«
Seine Anhänger murmelten beifällig und schleiften den nächsten Gefangenen heran, der wild strampelte, zum Nachthimmel zeigte und schrie, dass sie nur dem Rücken des Lamas folgen müssten, um den Nabel der Welt zu erreichen. Qusqu. Die Hauptstadt ihres Reiches Tawantinsuyu. Ein Ort, wie er sonst nirgends auf dieser Welt existiere. Dem Leib einer Raubkatze nachempfunden, prachtvoll und heilig, und selbst wenn sie als mächtige Götter die Stadt betreten wollten, bedürften sie einer Handvoll Erde, um sie auf dem Platz der Tränen und dem der Freude niederzulegen. Wenn sie der Herrlichkeit Qusqus nicht verfielen, würden sie nach vielen Tagesmärschen gen Süden die weiße Wüste durchqueren und dort die Berge finden, wo die Tränen des Mondes und der Schweiß der Sonne das Gestein nicht mehr durchdringen konnten. Mit seinen Augen deutete er zum Sternbild hinauf, das sie zum Nabel der Welt leiten würde. Daraufhin riss ihm der Federmann seinen funkelnden Ring aus der Nasenscheidewand.
In Amaru schwelte der Drang, ihm den Brustkorb aufzureißen und sein Herz zu zerdrücken. Leider war er allein und hatte der Überzahl nichts entgegenzusetzen. Aber als er sah, wie die Konquistadoren einen Vater von seinem Kind trennten, der Priester das Kind lüstern beäugte und die anderen die mit Goldstaub bestrichenen Lider des Vaters von seinen Augen abzogen, entschied er sich, lieber zu sterben, anstatt alles apathisch hinzunehmen. Amaru schlich heran. Seine mit Uferschlamm bedeckte Haut war in der Dunkelheit eine gute Tarnung. In Sprungweite lauerte er auf die passende Gelegenheit zum Angriff.
Der Federmann streifte sich gerade den Armschmuck über, als die Konquistadoren entsetzt aufschrien. Etwas war über Amaru hinweggeglitten und hatte sich auf sie geworfen. Schüsse lösten sich. Rauch stieg auf. Ehe sie nachladen konnten, knackte ein schwarzer Jaguar die Schädeldecke des Priesters und sprang fauchend auf den Federmann zu. Mit dem Eisenstab wehrte er Krallen und Reißzähne ab. Das Tier wich zwischen seinem und Amarus Körper aus und verschwand in der Finsternis.
Amarus und Federmanns Augen trafen sich und konnten sich für einen Moment nicht voneinander lösen. Was Amaru erblickte, war das Gesicht eines ihm Bekannten, der ihn fixierte und zum Morden bereit war. Allerdings erfasste Amaru nicht, wer wirklich vor ihm stand, er erinnerte sich allein an die ihm vertraute Physiognomie. Die unsymmetrische Augenpartie, die schmale Nase und die hochragende Stirn, die seinem eigenen Aussehen glichen.
Um nicht in die Fänge seines Ebenbilds zu geraten, tat es Amaru dem Jaguar gleich und flüchtete. Instinktiv sprang er über Unebenheiten hinweg, fand weich landend festen Halt. Sein Atem war ausdauernd, sein Puls schlug im Rhythmus des Waldes und schon bald hatte er den Jaguar eingeholt. Das Tier leckte sich, im Dunkel fast unsichtbar, eine offene Wunde an einer seiner Pranken. Aus zwei Kiefern schoben sich zwei speichelnde Zungen und Amaru erkannte, dass dem Hinterkopf des Tieres ein weiterer Schädel entwachsen war. Die beiden Mäuler brüllten ihn an.
»Warum bin ich hier?«, brüllte Amaru seinerseits aus voller Kehle, und der Jaguar machte sich auf, um ihm die Antwort zu zeigen. Amaru folgte ihm wie sein Schatten, bis sich am Ende des Waldes eine Schlucht ausbreitete, die zu tief war, als dass ein einfacher Mensch ihren Grund hätte sehen können, und die von einer Seilbrücke überspannt wurde. Die Raubkatze scheute vor dem strahlenden Weiß, das sich jenseits der Brücke erstreckte und für das sie nicht geschaffen war. Nervös umkreiste das Tier Amaru. Es witterte sein Wesen, erachtete ihn der bevorstehenden Aufgaben für würdig und huschte durch das Geäst zurück in den Dschungel.
Von jetzt an musste Amaru allein gehen und er ergriff, ohne zu zögern, das schaukelnde Geländer, das aus Menschenhaar geknüpft war. Über die weichen Planken schreitend näherte er sich der Klippenkante, wobei ihn die dahinterliegende Salzwüste zunehmend blendete. Licht, alles durchdringend. Es wurde so gleißend, dass Amaru das Sehen selbst sah. Geometrische Formen entwickelten sich, hafteten aneinander und zerfielen wieder. Die Muster kopierten sich in Endlosschleife und bildeten ein in sich verdrehtes Fraktal, das ausuferte und sich vervollständigte.
Die totschweigende Stadt lag vor Amaru. Sein Oberkörper war über die Balkonbrüstung gelehnt, seine Rippen gestaucht. Er wischte sich den Schlafsand aus den Augen und bemerkte dabei den Schmutz unter seinen langen Fingernägeln. Seit wie vielen Tagen ihn sein Traum plagte, ließ sich für Amaru nur an dem in ihm aufkommenden Ekel abschätzen, den er immer empfand, wenn seine Nägel über die Fingerkuppen hinauswuchsen. Die frischen Fasern des San Pedro, die sich darunter angesammelt hatten und die er mit seinen Zähnen herausholte, schmeckten bitter. Er konnte die Pflanze benennen, ohne zu wissen, weshalb.
Amaru ging ins Badezimmer, um sich das Gesicht zu waschen, in der Hoffnung, er würde zu sich kommen und diesen andauernden Albtraum endlich loswerden. Zwischen den zersplitterten Fliesen hob er eine Spiegelscherbe auf und besah sich. Der, der sich ihm zeigte, war ihm fremd. Die Nase war breiter und kürzer, als er sie in Erinnerung zu haben glaubte. Die Wangenknochen weicher. Schwarzes Haar lag über einer flachen Stirn. Sein Teint war dunkler, fast bronzefarben, als hätte sich der Anteil des schwefelhaltigen Melanins in seiner Haut reduziert. Amaru schwenkte die Scherbe. Seinen Hals säumten Würgemale, und Amaru fürchtete, er hätte den Verstand verloren. Sein Abbild entglitt ihm und beim Versuch, es zu fassen, schnitt ihm die Scherbe beide Handflächen geradlinig auf.
Amaru stillte die Blutung, torkelte zu seinem Schreibtisch und schnappte sich das Paket. Mit zittriger Stimme übersetzte er die Worte auf dem Einband und ergänzte sie: »Ama qhilla. Sei nicht faul. Ama llulla. Sei kein Lügner. Ama suwa. Sei kein Dieb. Und führe ein gutes, harmonisches und nobles Leben.« Er zerriss das Papier und wickelte eine Ledermappe aus. In ihrem Inneren durchblätterte er ein Geldbündel Bolivianos, ein Flugticket nach La Paz und einen Reisepass. Die Datenseite war größtenteils geschwärzt und trotz intensiven Nachdenkens brachte er es nicht fertig, sich seinen kompletten Namen zu vergegenwärtigen. Amaru. Das war alles, was ihm zu seinem Passbild einfiel.
Um seine neuerlichen Kopfschmerzen zu mäßigen, kramte er eine Tablette aus seiner Medikamentenschatulle. »Hypnorex-Litio?«, rätselte er über die Aufschrift und schluckte die Pille schnell hinunter. Danach widmete er sich wieder der Mappe. Er entleerte aus einem beiliegenden Beutel ein paar Münzen, deren Prägung mit dem Wachssiegel identisch war, und begutachtete einen geflochtenen Wollring. An ihm hingen verschieden geknotete, farbige Fäden. Amaru schob die Sachen weg, tunkte seine Fingerspitzen in einen zweiten Beutel, hob ein braunes Pulver heraus und streute es sich auf seinen Handrücken. Die fein geriebenen Samen ähnelten Schnupftabak. Amaru führte seine Hand zur Nase und sog das Yopo ein. Während sich das scharfe Pulver durch seine Schleimhäute fraß und die sich freisetzenden Basen seine Blut-Hirn-Schranke überwanden, entfaltete es unverzüglich seine Wirkung. Amaru verfiel in Trance und halluzinierte mit geöffneten Lidern.
In einer flachen Salzwüste irrte er umher. Sonne und Mond warfen ein so helles Licht auf den reflektierenden Boden, dass er kaum aufschauen konnte und mit gesenktem Kopf vorwärtsging. Kein Wunder, dass der zweiköpfige Jaguar dieses Land gemieden hatte, verdammte es doch jeden Eindringling dazu, ohne seinen Schatten gehen zu müssen. Amaru geisterte über die unwirtliche Ebene, bis er auf dem weißen Grund dunkle Schlieren ausmachte. Er bückte sich, zerrieb die rot getränkten Salzkristalle, die seine Finger einfärbten, und folgte der immer deutlicher werdenden Spur.
An ihrer Quelle kroch der Greis in einer Lache, die sein Mund mit dickflüssigem Blut nährte. Seine Gichtfinger, die Amarus Kehle fest umschlossen hatten, tasteten kraftlos über den Boden. Er suchte seine Zunge, die einen Meter von ihm entfernt lag und deren letzte Nervenbahnen zuckten.
Mit dem Fuß schob ihm Amaru die Zungenspitze hin. »Es lohnt sich nicht, sich dagegen zu wehren. Das Leben gehört den Lebenden. Sag mir, wo ich Tika und die anderen finde!«, appellierte er an den Sterbenden und tätschelte den Kopf des Alten, der Amarus Hände packte und sie verlangend an seinen Hals führte. Aber Amaru, der noch nicht dazu fähig war, einen anderen Menschen zu töten, selbst wenn dieser es wünschte, riss sich los und rannte davon.
Am flirrenden Horizont rückten die Himmelskörper zusammen. Unter ihnen rekelte sich eine Rauchwolke, und Amaru wusste, wohin er zu gehen hatte. Mit der Gewissheit, dass es an ihm lag, vor den Gold fressenden Göttern zu warnen, hastete er über die knirschende Fläche und holte das Ende eines Prozessionszuges ein. Die singenden Menschen trugen Sänften mit getrockneten Leichnamen. Ihre mit goldenen Scheiben behängten Ohren reichten bis zu den Schultern. Auch die Rücken der Lamas waren so schwer mit Kostbarkeiten beladen, dass die ächzenden Tiere fast zusammenbrachen. Nur das Nachschieben ihrer Begleiter hielt sie auf den Beinen. Amaru reihte sich ein und fasste mit an, doch als ihn die Menschen bemerkten, traten sie zur Seite und senkten ihre Köpfe. Niemand wagte es, ihn anzusehen. Stattdessen zupften sie sich ihre Wimpern heraus und bliesen sie ihm zu. Einige Männer lösten sich von ihren Tieren und fegten mit ihren Händen die Salzwüste zu seinen Füßen. Erst als der Untergrund nachgiebiger wurde und sich zu einem warmen Aschehaufen auftürmte, gaben sie es auf.
Amaru schritt durch die von ihm weichende Menschentraube, die sich am Vulkankegel aneinanderdrängte. Vom Rand des brodelnden Kraters aus richtete er sich an das Volk. Mehrmals musste er des aufsteigenden Schwefelgestanks, den die geöffnete Unterwelt freigab, und des grollenden Berges wegen innehalten. Nachdem er den Menschen erzählt hatte, was am Ufer des Urubambas geschehen war und wer ihn durch den Wald geführt hatte, winselten sie. Sie warfen sich auf die Erde und füllten ihre Münder mit Asche.
Aus der Menge traten zwei Priester hervor. Der eine trug das schwarze Federkleid eines Kondors. Seinen Kopf umgab eine feinfiedrige Halskrause. Über sein Nasenbein ragte der Schnabel des Vogels hinaus. Die gefächerten Flügel hingen von seinen Schultern herab. Der andere hatte sich das Fell eines Jaguars übergeworfen. Seine Eckzähne waren spitz geschliffen. In seinen Wangen steckten Grashalme, dünn wie Schnurrhaare. Die beiden Priester nickten verständnisvoll und erbaten vom Volk ein Opfer. Zügig wurde ein Lama herbeigeschafft und der Jaguarpriester rammte seine Fingernägel in die Bauchdecke des Tieres, durchwühlte die Innereien, trennte die Lunge heraus und hielt sie dem Himmel entgegen. Sonne und Mond schoben sich übereinander. Finsternis trat ein. Die Priester gerieten in Unruhe. Der als Kondor Gewandete zerrte ungläubig an der Lunge und der andere fauchte ihn an.
Das Volk spottete, dass die Priester nutzlos seien. Selbst sie verstünden die Zeichen zu deuten. Das Sternbild des Jaguars, das ewig scheinende Chuquichinchay, stehe nicht mehr am Nachthimmel. Die Prophezeiung erfülle sich. Die Götter wollten ihre Welt umstürzen. Nichts anderes als die Unterwerfung bliebe ihnen. Das Pachakuti sei gekommen.
Mit einem gellenden Kreischen brachte der Kondor die hysterische Menge zum Schweigen und der Jaguarpriester zeigte auf eine junge Frau. Ohne Widerworte fügte sie sich ihm, der ihr Haar mit seinen Klauen kurz schor, ihr Cocablätter in den Mund stopfte und ihr aus einem Tonkrug so viel Chicha zu trinken gab, dass das Maisbier über ihr taubes Gesicht lief.
Die Übrigen beherzigten das Flehen des Kondors, die mit der Aschewolke herausgesprengten Felsbrocken einzusammeln. Er hob selbst einen der Steine auf und bat die Götter um Gnade. »Tayta Inti! Mama Killa! Ihr Diener Wiraquchas!«, sprach er Sonne und Mond untertänig an. »Er, der Schaum des Meeres, der alles Seiende schuf, auch euch, hat uns die weißen Götter geschickt, die das blinkende Quri und uns Menschen verschlingen wollen. Wendet euch nicht von uns ab. Ihr habt unsere Vorfahren geschaffen, Manqu Qhapaq und Mama Uqllu, die neuen Menschen, Mann und Frau, Bruder und Schwester, Liebender und Liebende zugleich, die inmitten der Fluten aus dem Titiqaqa qucha entsprungen sind. Sie, die eine Erdspalte durchquerten und aus der Gebärmutter unserer Welt hervortraten, der heiligen Höhle Paqariqtampu. Von dort stiegen sie in ein fruchtbares Tal hinab, wo ihr Stab in der Erde versank, und begründeten unser Reich. Sie folgten euren Weisungen, belehrten die rohen Menschen und unterwarfen alle Völker, aus allen Himmelsrichtungen, bis an die Grenze der vernünftigen Welt. Habt ihr vergessen, wer wir sind? Wir führen ein gutes Leben, das wir nach euch ausrichten, und bringen euch Opfer dar. Seht euch unsere Auserwählte an, die wir euch zu geben bereit sind. Tika, die Vollkommenste unter uns. Kehrt auf eure Bahnen zurück und ordnet unsere Welt wieder!«
Bevor Amaru realisieren konnte, was unter der anhaltenden Sonnenfinsternis und den Blitzen des Eruptionsgewitters vor sich ging, prasselten die ersten Felsbrocken auf Tika nieder, die ihn Hilfe erflehend anstarrte: »AMARU!« Ihr Todesschrei verstummte durch die Gewalt der Steine.
Mit der eingetretenen Stille erwachte Amaru. Die Wirkung des Yopopulvers hatte nachgelassen. Geblieben war ein bestialischer Kopfschmerz, der seinen Traum lebendig hielt. Tika hatte nach ihm gerufen und sein Mitgefühl geweckt. Seinen Mut. Sein Begehren. Seinen Willen. Keinesfalls würde sie dermaßen nach einem Fremden verlangen. Der Klang ihrer Stimme war ihm vertrauter als seine eigene und trotzdem schaffte er es nicht, sie zuzuordnen. Wer war sie? Woher kannten sie einander? Weshalb fühlte er sich zu ihr hingezogen? Das Pochen in seinem Schädel wurde immer unerträglicher, je mehr er sich sein vergessenes Leben zurückzuholen versuchte. Was vor ihm lag und Linderung versprach, war allein ihre Welt. Amaru hatte sich durch seine Unfähigkeit zu handeln schuldig gemacht. Er hätte die Steinigung mit einer einfachen Handbewegung abwenden können. Vor Zorn biss er sich in seiner Faust fest und schlug mit der anderen auf die Tischplatte ein.
Im Moment des Auftreffens donnerte eine Explosion und die Fensterscheiben barsten. Die Druckwelle schleuderte Amaru rücklings gegen die Wand und er duckte sich vor den umherfliegenden Glassplittern. Seine Lungenflügel pumpten aufgeregt. Er hustete Staub. Mit Verzögerung ertönte panisches Geschrei.
Amaru schwankte auf den Balkon und sah über die wiederbelebte Stadt. Flammen schossen aus dem gegenüberliegenden Gebäude und erhellten die Nacht. Im zerfetzten Dachgeschoss war anscheinend ein Sprengsatz gezündet worden. Der aufsteigende Qualm vermengte sich mit den Schwaden, die aus dem Regierungsviertel herüberzogen. Auch dort loderten Brände. In den Rußwolken glaubte Amaru, die Konquistadoren auf ihren Pferden reiten zu sehen. Vorneweg der Federmann, der die sich überlagernden Himmelskörper hinter sich herzog und einen Glutregen herabfallen ließ.
Aus den einstürzenden Häusern flohen die Menschen ins Freie. Sie warfen sich Schutz suchend auf den mit Schutt und Scherben übersäten Asphalt. Sirenen heulten auf und erstickten ihr Klagen. Die Löschmannschaften kämpften sich verzweifelt durch das Gewühl. Das auf den gesamten Straßenzug übergreifende Feuer ließ sich nicht mehr eindämmen. Zwei Blocks weiter detonierte der nächste Sprengsatz. Heftiger als der vorherige.
Amaru nahm die Zerstörung mit Gleichgültigkeit hin. Er empfand kein Mitleid mit den Toten und den Verletzten und kehrte seiner Welt den Rücken. Hätte er um einen einzigen ihn liebenden Menschen gewusst oder um einen, der es verdient hätte, geliebt zu werden, wäre sein Traum in Vergessenheit geraten, und er, diesen Menschen suchend, hinausgestürzt. Aber Amaru wähnte sich allein in dieser entzauberten Welt. Was hielt ihn noch in diesem Leben, da er sich an niemanden erinnern konnte und ihm alles bedeutungslos vorkam. Hier gab es nichts mehr für ihn zu tun. Nichts verband ihn mit den anderen. Fortan sollte das Unwahrscheinliche, dieses unerwartet in sein Leben getretene Ereignis, seine Zukunft bestimmen. An einem anderen Ort brauchte jemand dringend seine Hilfe. Tika. Zum Aufbruch entschlossen warf er seinen Mantel über und stopfte das Geldbündel und die Papiere, den Wollring und die Silbermünzen in seine Taschen. Das restliche Yopo nahm er unmittelbar. Geübt schnupfte er das berauschende Pulver. Er wollte endlich zu einem handelnden Menschen werden.
Sieben Tage und sieben Nächte plagte Amaru ein wiederkehrender Traum, bis er sich dazu entschied, diese taumelnde, diese aus ihrer Bahn geglittene Welt zu verlassen.
Kapitel 2
Damals, am Ende der alten Welt.Die Totgesagten gehen um.Europa steht in Flammen.
*
»Ich habe mit Amarus Verschwinden nichts zu tun und ich weiß auch nicht, wo er jetzt ist. Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen, Herr Kriminalkommissar? Weshalb hätte ich mir die Mühe machen sollen, ihn zu beseitigen? Er lebt ohnehin seit Jahren wie ein Toter. Er ist ein Teilnahmsloser, ein Unterwürfiger, der die Erlösung durch einen anderen nicht verdient, weil er für nichts auf der Welt zu sterben bereit ist. Aber gut, wenn Sie es so wollen, fange ich eben wieder von vorne an.
Natürlich sprechen die vorhandenen Indizien gegen das, was ich Ihnen berichten kann, doch meine Darlegung, das Kaleidoskop meiner Erinnerung, wird Ihnen mein Handeln und dessen Notwendigkeit nun hoffentlich begreifbar machen. Sie wissen ja um die Aktivitäten der Bewegung 3. Juli, um unseren Widerstand gegenüber der verrohten Gesellschaft. Die Blockaden. Die Entführungen. Die Bombardements. Die Morde. Allerdings verstehen Sie nach wie vor nicht, dass revolutionäre Gewalt das uns einzig verbliebene, ja das einzig rechtmäßige Mittel ist, um die Gegenwart zu bezwingen. Würden Sie dies realisieren, dürfte ich diesen Vernehmungsraum als freie Frau verlassen. Sie würden mir die Hand schütteln, mich nach draußen begleiten und sich, sofern Sie sich Ihre Angst und Apathie zu überwinden trauten, uns anschließen. Leider ist Ihr Charakter dazu nicht fähig, denn wie soll er sich in einem komatösen Körper entwickeln, der so taub geworden und aus der Welt genommen ist, als litte er an der Encephalitis lethargica? Ihnen ergeht es wie Amaru, in dieser unablässig vereinnahmenden Betriebsamkeit, in der nichts notwendiger ist als die Wiederbelebung unserer Fantasie.
Bevor mir Amaru vor einigen Monaten über den Weg lief, hatten wir uns mehr als zwanzig Jahre lang nicht gesehen. Als er mir dann gegenüberstand und ich begriff, was aus ihm geworden ist, schämte ich mich für meine Naivität. Ich hatte geglaubt, er könnte mein Verbündeter sein und mit mir rächen, was es zu rächen galt. Bedauerlicherweise hatte er sich seines früheren Lebens entledigt. Selbst als wir am Morgen nach unserer Zufallsbegegnung nebeneinander aufwachten, nackt, verschwitzt und wie zu einem Körper verwachsen, dämmerte es ihm nicht, wer ich bin. Er war zu weit von sich selbst entrückt, als dass er mich noch erkannt hätte: Tika. Ich empfand Mitleid mit ihm und dachte wehmütig an die Zeit zurück, als alles noch ungeschehen war. Damals in Bolivien, bevor wir entzweigerissen wurden, weil wir Dinge bezeugen konnten, die wir nicht hätten sehen dürfen. Darauf hoffend, dass ich durch Amaru Zugriff auf seinen Vater erhalten würde, um die Welt wieder zurechtzurücken, nahm ich mich seiner an.
Amarus Zustand war wirklich desaströs. Früher war er ein Mensch der Tat, einer, der zwar langsam, aber überlegt handelte. Ein Mensch, dem das Verlangen nach Veränderung innewohnte, der über sich hinausdachte und Mitgefühl zeigte. Zuallerletzt ist er nicht mehr als ein für sich arbeitendes Tier gewesen. Ein nach Selbstoptimierung lechzendes, amorphes und einsames Wesen. Ein Gezähmter. Ein Schuldbeladener. Ein in der Masse der Gleichen aufgehender Sklave. Bis zum Schluss fügte er sich dem Rhythmus Ihrer Welt, in der er vor Jahrzehnten Zuflucht gefunden hatte. Aber ein tot geglaubtes Geschwür wucherte in ihm. Es breitete sich unaufhaltsam aus und führte dazu, dass er seine Mitmenschen mehr und mehr verabscheute. All die, die ihm glichen, die ihm beipflichteten und mochten, waren ihm fremd geworden, und ihre Anwesenheit erzeugte in ihm einen Ekel, den er sich nicht erklären konnte, da er ihre Gesellschaft und seine Zugehörigkeit eigentlich begehrte. Den Wenigen, die ihn außer mir noch aufsuchten, deren Gegenwart er nicht allzu sehr scheute, erging es wie ihm. Sie waren außerstande, seine missliche Lage nachzuvollziehen: Ein Mensch, der aufhört zu revoltieren, hört auf, Mensch zu sein.
Amaru hatte die Fähigkeit verloren, frei zu denken, zu fühlen und zu handeln. Seine Hände erschienen ihm zunehmend nutzlos, ein Anhängsel eines gelähmten Körpers. Seine Gedanken waren der allgegenwärtigen Konformität unterworfen, dem lächerlichen Versuch, das Auseinanderdriften von ihm und der Welt zu kompensieren. Sein Fühlen war zu einer bloßen Selbstbespiegelung verkommen, die den Blick auf den anderen nicht mehr zuließ. Die Freiheit, in der sich dieser Narziss wähnte, der Irrglaube, dem er sich beugte, mündete unweigerlich in der Ablehnung der anderen und im Hass gegen sich selbst. Dabei hätte Amaru es besser wissen müssen, hatte er doch bereits als junger Mann von einer alternativen Welt erfahren. Obwohl er einmal ein sehr reflektierter Mensch war, der Gegebenheiten hinterfragte, anstatt einfach zu akzeptieren, dass etwas so ist, wie es sich zeigt, schaffte er es nicht, sich seine Erfahrungen zunutze zu machen. Die Schuld muss seine Erinnerungen getilgt haben. Ihretwegen verleugnete er sein Leben, als würde es zu einem anderen gehören. Blind geworden für das, was dort draußen vor sich ging, zog er sich in sich zurück. Das Leid der anderen scherte ihn nicht, solange es ihn in seinen Geschäften nicht einschränkte. Wie sehr er seinem Vater im Endeffekt glich.
Erst kurz vor Amarus Verschwinden regte sich etwas in ihm. Als ich ihn zuletzt sah, ein paar Tage vor meiner Festnahme, sprach er begehrlich von den verbliebenen Refugien, in denen der Mensch wirklich frei sei. Er war fest davon überzeugt, dass sich allein im Traum und im Rausch, den einzigen Orten unzensierter Lust und Schöpferkraft, eine andere Welt mit harmonischen Menschen herausbilden könne. Fatalerweise hat er in seiner Wirrnis die Tatsache vernachlässigt, dass eine Zustandsveränderung ausschließlich durch die direkte Aktion zu erreichen ist. Nur das physische Eingreifen des Menschen, basierend auf einer grundlegenden Überzeugung, einer klar gezogenen Linie, an der er nicht anders kann, als zu sagen, ich handle, besitzt genügend Potenzial, um dem Gegebenen eine neue Form zu verleihen. Man schmiedet ein Eisen nicht dadurch, dass man davon spricht, sondern indem man mit einem Hammer auf ein glühendes Metall einschlägt. Amarus Gerede war nutzlos und ohne Wirkungsmacht, wie das Geschwafel der Theoretiker. Immerhin hat er wieder erkannt, wie dringlich die radikale Neuausrichtung von allem Seienden ist.
Nehmen Sie wieder Platz und rauchen Sie. Sie wirken etwas durcheinander. Wenn Sie verstehen wollen, was geschehen ist, wird es eine ganze Weile dauern. Haben Sie mich gehört? Entweder Sie gedulden sich oder Sie bringen mich in meine Zelle zurück. Wie soll ein Mensch denken, wenn Sie wie in einem Käfig auf und ab tigern? Ich bestreite keine der Taten, für die ich verantwortlich bin, jedes Detail gebe ich lückenlos preis, nur bitte setzen Sie sich endlich. Okay. Gut so. Lassen Sie uns noch einmal zum Ursprung des Unglücks zurückkehren, auf dass die Dinge endlich klarer werden. Amaru und ich.
Das erste Mal begegneten wir uns als Kinder, in den Weiten des Altiplanos, des südbolivianischen Hochlands. An der Hand seines groß gewachsenen Vaters stand er in unserer schäbigen Lehmhütte, in deren Mitte das Feuer der Kochstelle qualmte. Meine Tante Pilpintu und ich wohnten in einem mickrigen Raum, und wenn die Tage besonders kalt waren, wie es in dieser schutzlosen Landschaft nicht selten ist, holten wir die Jungtiere der Alpakaherde herein. Als Amaru sah, wie wir lebten, verzog er das Gesicht. Die Gerüche waren ihm noch so fremd und unheimlich wie unsere Sprache. Die dünne Höhenluft zwang ihn, hektisch zu atmen. Mit seinem Handrücken wischte er sich Blut von der Nase. Er war in der Neuen Welt angekommen.
Nach dem Suizid seiner Mutter hatte sich sein Vater dazu entschieden, dass Amaru nun bei ihm leben durfte. Ihm, der sich uns als Federmann vorstellte, war meine Tante, deren Vorfahren seit Jahrhunderten die Kinder der Noblen in der Sprache der Menschen unterrichteten, empfohlen worden. Während der Federmann seinen Geschäften in Potosí nachging, chauffierte einer seiner Angestellten Amaru allmorgendlich zu uns aufs Land. Der Federmann hatte es für nützlich befunden, dass sein Sohn sowohl Spanisch als auch Runasimi, das Sie in Ihrer Welt Quechua nennen, erlernte. Wie sollte er sonst merken, wenn die Menschen schlecht über ihn, ihren zukünftigen Herrn, sprechen würden?
Nachdem sich Amaru in den ersten Wochen gesträubt hatte, da ihm unser Leben primitiv und langweilig anmutete, war er ja aus Europa anderes gewohnt, begann er allmählich damit, sich darauf einzulassen. Er imitierte unsere Worte, half bei der Feldarbeit mit, trug Wasser heran und beaufsichtigte die Alpakas. Unsere Gemächlichkeit und Geduld, die er anfangs noch beklagt hatte, weil wir ihm faul und unaufrichtig vorkamen, wusste er bald so zu schätzen, dass er in unserem Rhythmus aufging. Die Annehmlichkeiten, die er unten in der Stadt genoss, wurden für ihn bedeutungsloser. Er fand Gefallen daran, wenn es ohne Elektrizität stockdunkel war, er sich in der Nacht auflöste und mit allem, was ihn umgab, verschmolz. Mit uns und den Tieren. Dem Staub. Den von Mineralien durchzogenen Bergen. An windstillen Tagen saß er allein vor der Hütte, fantasierte sich zum Mond hinauf und horchte seinem eigenen Puls nach. Das lärmende Spektakel seiner Welt erschien ihm wie eine eiserne Barriere vor dem Wesentlichen. Unser Leben sog ihn auf, denn es war seinem so gegensätzlich und frei von all den Zwängen, denen er schon als Kind unterlag.
Ich kann nicht fassen, dass er die Jahre mit Pilpintu wirklich vergessen konnte, obwohl sie ihm alles gegeben hatte. Sie war es, die ihm beibrachte, wie er sich in der Natur zu bewegen hatte, wie der Wind klang, wenn er Regen oder eine andere Botschaft barg, die ihm die Mythen unserer Vorfahren erzählte, von denen er nicht genug hören konnte. All sein Wissen um unsere Bräuche und Rituale, unsere Vorstellungen vom Kosmos und der Dualität der Dinge verdankte er allein ihr. Dank ihr entwickelte er ein Verständnis für unser auf Gegenseitigkeit beruhendes Miteinander. Er lernte, genügsam zu sein, und schätzte die anderen in ihrer Andersartigkeit. Pilpintu formte aus ihm einen echten Menschen und taufte Amaru auf seinen heutigen Namen.
Das Geld, das ihm der Federmann für uns mitgab und das meine Tante annahm, obschon sie Amaru nach einigen Monaten nicht weniger liebte als mich, half uns über die mageren Ernten hinweg. Die Erde warf in jenen Jahren nicht genug Mais und Quinoa ab, um sie auf dem Wochenmarkt in Potosí zu verkaufen, und mein Onkel hatte Pilpintu bereits Jahre zuvor verlassen müssen. Ihn und Abertausende Mineros hatten die neuen Herren in den Bergbaustädten Potosí und Oruro aus den Minen gejagt. Den Männern war, wenn sie ihre Familien satt wissen wollten, nichts anderes übrig geblieben, als in die fruchtbare Tiefebene von Chapare zu ziehen. Unweit von Cochabamba bestellte er als Cocabauer ein Stück Land, um uns über die Runden zu helfen. Präsident Paz Estenssoro und seine Partner hatten die Männer zu Kriminellen verdammt, die die steigende Nachfrage der Drogenkartelle bedienten und sie mit der heiligen Pflanze belieferten. All die Ideale, für die unser Präsident als junger Politiker gekämpft hatte, entpuppten sich als austauschbar. Er huldigte nun den neuen Göttern, den neoliberalen Ökonomen und Investoren. Er war ein Jünger der freien Welt und des sich selbst regulierenden Marktes.
Es ist schon erstaunlich, wie viele Existenzen ein Mensch im Verlauf seines Lebens annehmen, verinnerlichen und für wahrhaftig halten kann, ohne daran zu zerbrechen. Nur etwa 30 Jahre lag es damals zurück, dass Estenssoro, getragen von der Masse der Studenten und Gewerkschaften, unsere Revolution angeführt hatte. Er war es, der uns Unterdrückten einst das Wahlrecht schenkte und uns Würde verlieh, indem er die Bodenschätze und die Betriebe verstaatlichte. Nichts davon wollte er uns nun lassen. Die fremden Götter lockten mit Gewinnen, die alle Moralvorstellungen sprengten. Zuversichtlich, bald selbst zu ihnen zu gehören, gaben er und die Seinen Bolivien Mitte der 1980er-Jahre abermals zur Plünderung frei. Sie raubten unser Land. Sie zerrütteten unsere Gemeinschaft. Sie degradierten uns wieder zu Sklaven. Wir darbten vor uns hin, wohingegen andere, wie der Federmann, vom offenen Spiel profitierten, dessen Regellosigkeit und Totalität wir erst noch kennenlernen sollten. Zu Beginn misstrauten viele von uns den Versprechen der Wohltäter weniger, als wir es hätten tun sollen. Ihrer Litanei der Entwicklung. Ihren Dogmen des Wachstums. Die uns übergestülpte Welt brachte uns zunächst ja auch etwas Gutes.
Dass mein Vater damals in Potosís finsteren Schächten weitergraben durfte und wir nicht schon viel früher getrennt wurden, war allein dem Wohlwollen des Federmanns geschuldet. Als er seine Stollen besichtigte, hoch oben am kegelförmigen Cerro Rico, dem schönen und reichen Berg, der seinen rostroten Todesschatten seit Jahrhunderten über die Stadt wirft, hatten sich die Arbeiter vor den Eingängen aufzureihen. Jeden einzelnen inspizierte der Federmann penibel auf dessen Brauchbarkeit. Er prüfte, ob die Finger und Rücken zu steif waren, um die Werkzeuge zu bedienen und die Lasten zu tragen, ob die Augen entschlossen genug glänzten und sie den Glauben an frische Adern nicht verloren hatten.
Eigentlich war mein Vater mit seinen vierzig Jahren zu alt, um sich weiterhin durch den Berg zu wühlen. Der feine Staub hatte sich schon zu lange auf seine Lungen gelegt. Sein Körper war so verkrüppelt, dass er dem harten Gestein kaum noch etwas abtrotzen konnte. Aber irgendetwas hatte der Federmann an Wayra, meinem Vater, gefunden, konnte er sich doch von Anfang an seinen Namen merken. Die anderen Indios sprach der Federmann nur mit den von ihnen geförderten Mineralien an, wobei er sich meistens täuschte. Er hatte Knechte vor sich und keine Menschen. Weshalb sollte er sie zu unterscheiden lernen? Wahrscheinlich verwechselte der Federmann die Verachtung im Blick meines Vaters mit Ergebenheit und glaubte, in ihm seine eigene Gier wiederzuerkennen. Jedenfalls bot er ihm eine Anstellung in seinen Minen an, denn er wollte ihn für seine Zwecke missbrauchen.
Kein anderer kannte die Umgebung besser als Wayra. Niemand hatte größeren Einfluss auf unseren Ayllu als er. Unsere Gemeinschaft respektierte seine Ratschläge und Schlichtungen, entstammten er und meine Tante doch einer Schamanenfamilie, die von den Sapa Inka jahrhundertelang um Beistand gebeten worden war. Mein Vater praktizierte die Heiltradition des Hochlandes und beherrschte die uns verborgenen Kräfte des Waldes, womit er uns von unseren Leiden befreite. Er war ein angesehener Weiser, der sich zu einem simplen Lohnarbeiter herabgestuft hatte, weil es mich zu versorgen galt. So trat mein Vater in Federmanns Spiel ein, verbarg seine Ablehnung hinter Unterwürfigkeit, erduldete, was ein Mensch eigentlich nicht erdulden kann.
Wie Sie wissen, war meine Mutter nach meiner Geburt fortgegangen und nie wiedergekehrt, wie es der Brauch verlangt, wenn eine Frau einem Schamanen ein Kind gebiert. Somit oblag es unserem Ayllu, uns zu versorgen, aber die von den zurückliegenden Jahren der Diktatur ausgemergelten Glieder waren dazu nicht mehr in der Lage. Was Wayra für seine Rituale und Behandlungen erhielt, Gesten der Dankbarkeit und der Bewunderung, genügte nicht, um mich als seine Nachfolgerin auszubilden und mir zugleich Zugang zu Ihrer Welt zu verschaffen. Hätte man die Mechanismen unserer Welt nicht sabotiert, wäre ich heute womöglich Heilerin und keine Revolutionärin, wobei ihr Wesenskern sowieso identisch ist.
Wie dem auch sei. Mein Vater schuftete damals als Minero, den die anderen auch deshalb schätzten, da er ihnen in den Stollen Glück brachte und mit den Apus, diesen allgewaltigen Berggottheiten, sprechen konnte. Ja, auch mit dem mächtigsten und zornigsten von ihnen, dem in der Herzkammer des Cerro Rico hausenden Tío mit seiner Raubkatzenfratze, gelang es ihm zu verhandeln. Selten ging einer aus Wayras Grabungstrupp im Dunkel verschollen oder wurde von herabfallenden Felsbrocken erschlagen. Nie kamen sie mit leeren Loren ins Abendlicht zurück. Der Federmann honorierte die Leistungen meines Vaters und schenkte ihm hin und wieder frische Cocablätter oder eine Flasche Singani, damit er nicht wie die anderen Mineros reinen Spiritus in sich hineinschüttete, vorschnell verrückt wurde oder verreckte. Mit den Almosen konnte Wayra den Tío, den es mit Opfern zu besänftigen galt und der allein darüber entschied, ob man die Mine lebend verließ, milde stimmen.
Nach ein paar Jahren, Amaru und ich waren inzwischen unzertrennlich, beförderte der Federmann meinen Vater sogar zu seinem persönlichen Übersetzer. Wir bezogen ein Haus im Stadtzentrum, trocken und an das Stromnetz angeschlossen, vor allem in Sichtweite zu meinem Freund Amaru, der mit seinem Vater und den Bediensteten im größenwahnsinnigen Kolonialbau des früheren Statthalters lebte. Indessen ich begeistert war, Amaru nun immerzu treffen zu können, trauerte mein Vater um seine verlassene Eremitenhütte, die er nur noch einmal im Monat aufsuchte, um die unerlässlichsten Riten zu vollziehen, und der er bald für immer fernblieb.
Der Federmann vereinnahmte Wayra, als wäre er sein Besitz. Zu besonderen Anlässen, etwa dann, wenn Freunde oder Geschäftspartner zu Besuch eintrafen, bestellte uns der Federmann ein und mein Vater hatte seinen Anzug zu tragen, den ihm sein Herr für derlei Anlässe hatte maßschneidern lassen. Sonst kleidete er sich mit Stolz in der Tracht unseres Ayllus, denn allein durch die Gemeinschaft war er das, was er war, und er schämte sich, an seinen Freunden und Nachbarn vorbeizugehen, um bei den Machthabern Platz zu nehmen. Die spottenden Blicke derer, zu denen er eigentlich gehörte, quälten ihn mehr als Federmanns Erniedrigungen und das Auskratzen des Berges, wozu er als lebendiger Talisman weiterhin verpflichtet war. Amaru und ich langweilten uns zu Tode, wenn der Federmann und die anderen mit vollkommener Natürlichkeit über die unerschlossenen Märkte und ihre geplanten Raubzüge sprachen, die mein Vater lange Zeit schweigend hinnahm. Ohne zu durchblicken, was wirklich in ihm vorging, vertrieben wir uns die Zeit, indem wir uns darüber amüsierten, wie er am Tisch ungeduldig hin und her rutschte, um Luft ringend den Kragen lockerte und das Samtsakko zurechtrückte.
Wie so oft wurde an diesen Abenden maßlos getrunken und haufenweise Kokain konsumiert. Der Federmann brüstete sich dann damit, dass seine Vorfahren ein nicht auszugebendes Vermögen gemacht hätten, und er wunderte sich darüber, warum es uns Bolivianern nicht gelungen sei, zu Wohlstand zu kommen, wo doch alles offen daliege und es nur zuzugreifen gelte. Wenn er sich komplett in Rage geredet hatte, prahlte er, belegen zu können, dass sein Stammvater Nikolaus Federmann gemeinsam mit Pizarro und seinen Konquistadoren dieses Land zivilisiert habe. Er sei nach Núñez de Balboa und noch vor seinem Freund und Weggefährten Pizarro der zweite Europäer gewesen, der den Pazifik vom Isthmus von Panama aus erblickt habe. Der Federmann liebte es, im Rausch die Mühen der Eroberer nachzuspielen. Wild gestikulierend schlug er sich durch den Dschungel und überstieg die höchsten Berge. Wayra diente ihm als Lastenträger, den er auf dem beschwerlichen Weg zum Südmeer töten musste, da dieser Zweifler zur Umkehr geraten hatte. Amaru und ich hetzten meinem Vater als Bluthunde nach, und der Federmann inszenierte die Inbesitznahme des fremden Ozeans. Er stemmte sein imaginiertes Kreuz und seine Standarte in die Höhe und zeigte in Richtung Süden, wo er das Goldland vermutete.
Wahr ist, dass die Federmänner über Generationen hinweg auf unserem Kontinent wüteten. Erst verlangten sie nach Gold und Silber, dann nach Kautschuk, Öl, Zink, Zinn und Gas. Und schließlich gierten sie nach dem kostbarsten unserer Rohstoffe: Lithium. Pilpintus Warnungen zum Trotz hatte mein Vater den Federmann in die von Horizont zu Horizont reichende weiße Wüste begleitet, in deren Untergrund das Leichtmetall lagerte. Im ausgetrockneten Salzsee, dem Salar de Uyuni, witterte der Federmann einen nie da gewesenen Reichtum. Ich erinnere mich daran, wie sie nach ihrer ersten Ausfahrt durch die lebensfeindliche Ebene dem Geländewagen entstiegen waren und der Federmann nicht aufhören konnte, vor Freude zu lachen. Er umarmte seine Bediensteten, hakte sich bei meinem Vater ein und beorderte ihn unmittelbar ans Telefon, damit er dem zuständigen Ministerium sein Angebot übersetzte. Hätten der Federmann und Estenssoros Nachfolger Sánchez de Lozada, später der wiedergewählte Exdiktator Banzer, um den sich anbahnenden Widerstand unserer Gemeinschaft gewusst, wären sie an ihrem schamfreien Lachen erstickt. Bis zu seinem Tod war Amarus Vater vom Salar besessen. Eine Art erotische Obsession.