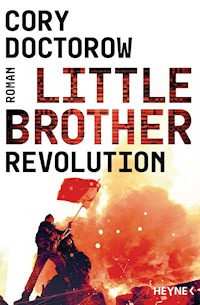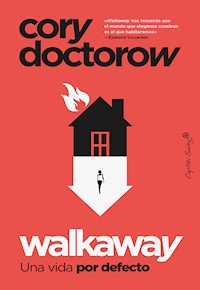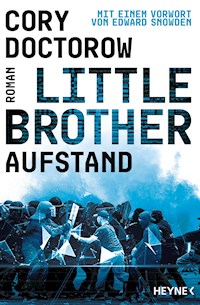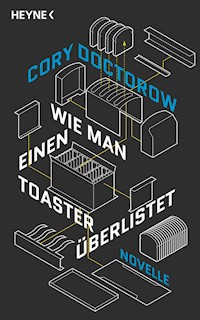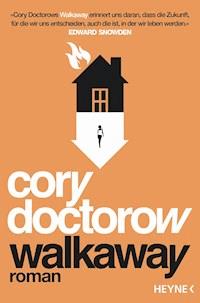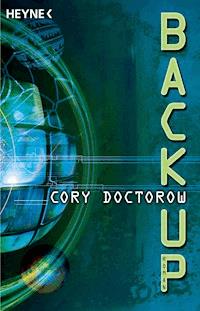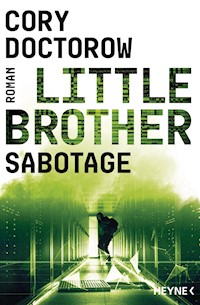
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Little Brother
- Sprache: Deutsch
Masha Maximov hat einen gut bezahlten Job bei der Cybersecurity-Firma Xoth Intelligence, wo sie sich im Auftrag von Regierungen weltweit in die Accounts von Dissidenten und Aktivisten hackt. Manchmal nutzt Masha ihre Fertigkeiten aber auch, denselben Aktivisten und Dissidenten dabei zu helfen, einem Hackerangriff zu entgehen. Dieses gefährliche Doppelspiel war aufregend, solange es um Leute in anderen Ländern ging. Doch der neueste Auftraggeber von Xoth Intelligence ist die Regierung von einem Land ähnlich wie Mashas Heimat. Masha steht vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Masha Maximov hat einen gut bezahlten Job bei der Cybersecurity-Firma Xoth Intelligence, wo sie sich im Auftrag von Regierungen weltweit in die Accounts von Dissidenten und Aktivisten hackt. Manchmal nutzt Masha ihre Fertigkeiten aber auch, denselben Aktivisten und Dissidenten dabei zu helfen, einem Hackerangriff zu entgehen. Dieses gefährliche Doppelspiel war aufregend, solange es um Leute in anderen Ländern ging. Doch der neueste Auftraggeber von Xoth Intelligence ist die Regierung von Mashas Heimatland. Sie kann nicht tatenlos dabei zusehen, wie ihre Familie und ihre engsten Freunde in Gefahr gebracht werden. Masha steht vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens …
Die Reihe
Mit seinen LITTLE BROTHER-Romanen hat Cory Doctorow die Welt im Sturm erobert und eine neue Generation für die Möglichkeiten und Tücken des Internets begeistert:
Erster Roman: Little Brother – Aufstand
Zweiter Roman: Little Brother – Revolution
Dritter Roman: Little Brother – Sabotage
Der Autor
Cory Doctorow, 1971 in Toronto geboren, ist Schriftsteller, Journalist und Internet-Ikone. Mit dem Blog boingboing.net und seinem Kampf für ein faires Copyright hat er weltweite Bekanntheit erlangt. Seine Little Brother-Romane wurden internationale Bestseller. Cory Doctorow ist verheiratet, hat eine Tochter und lebt in Los Angeles.
Besuchen Sie uns auf
Cory Doctorow
Little Brother
sabotage
Dritter Roman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:HOMELANDDeutsche Übersetzung von Jürgen LangowskiDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Neuausgabe 01/2022
Copyright © 2020 by Cory Doctorow
Copyright © 2022 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Gorodenkoff, Vandathai, getgg)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28260-8V001diezukunft.de
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Epilog
Nachwort von Ron Deibert, Citizen Lab
Nachwort von Runa Sandvik
Anmerkung des Autors
Glossar
Für die Whistleblower, die auf die Stimme ihres Gewissens gehört und die Wahrheit ausgesprochen haben: Daniel Ellsberg, Thomas Drake, Chelsea Manning, Bill Binney, Edward Snowden, Alexander Nikitin und John Doe und all die anderen von den Panama Papers. Die Gesellschaft ist euch zu großem Dank verpflichtet. Ihr habt eure Freiheit, euer Vermögen und sogar euer Leben riskiert, um uns die Wahrheit mitzuteilen.
Und für die Reporter, die ihnen geholfen haben, die Wahrheit ans Licht zu bringen, besonders Daphne Caruana Galizia, die ermordet wurde, weil sie ihre Arbeit gemacht hat. Ruhe in Frieden.
Ihr Beispiel möge uns inspirieren, damit wir den Mut finden, Korruption bloßzustellen, wo immer wir sie entdecken.
Mein einziges Motiv ist es, die Öffentlichkeit über das zu informieren, was in ihrem Namen getan wird und was gegen sie getan wird.
Edward Snoard Snowden
1
Genau deshalb liebe ich die Technologie: Wenn man sie richtig einsetzt, schenkt sie uns Macht – und nimmt den anderen Menschen die Privatsphäre. Es war die sechzehnte Stunde meines Einsatzes im Hauptrechenzentrum der staatlichen Telekommunikation in Blzt, der Hauptstadt von Slovstakien. Offensichtlich sind das Aliasnamen. Im Gegensatz zu manchen anderen Leuten, die ich benennen könnte, weiß ich meine Geheimnisse zu hüten.
Sechzehn Stunden für eine Aufgabe, die – das hatte meine Chefin dem Auftraggeber, dem slovstakischen Innenministerium, versichert – in drei Stunden erledigt sein sollte. In der Stasi stieg man nicht so weit auf wie sie, wenn man nicht wusste, wann man sich aus taktischen Gründen wie ein Arschloch verhalten musste.
Ich wünschte nur, sie hätte mich das Rechenzentrum erkunden lassen, ehe sie die Einschätzung der notwendigen Arbeitszeit abgab. Das Problem bestand darin, dass die slovstakische Kommunikationsinfrastruktur lange vor dem Fall der Berliner Mauer eingerichtet worden war. Sie beruhte auf Kupferdrähten, die man mit Zeitungspapier umwickelt und in Guttapercha getaucht hatte. Nach dem Fall der Mauer war die Verantwortung für diesen Bereich in die liebevollen Hände von Anton Tkachi übergegangen, der im ehemaligen Sowjet-Slovstakien ein Topschnüffler gewesen war. Es gibt sicher viele Dekaden, in denen man sich darüber ärgern kann, dass die Telekommunikation einem inkompetenten, gierigen Kleptokraten untersteht, aber die 1990er-Jahre waren ein besonders ungünstiges Jahrzehnt, um den gewohnten Upgrade-Zyklus in der Telekommunikation zu verschlafen. Wegen des Internets.
Nachdem Tkachi beseitigt war – 2005 eingesperrt, 2006 wegen einer »Geisteskrankheit« in eine Klinik eingewiesen, 2007 verstorben –, setzte das slovstakische Kommunikationsministerium eine Reihe von Vertragsfirmen ein – Swisscom, T-Mob, Vodafone, Orange (Gott steh uns bei) –, die dem Land der Reihe nach die schrottigsten Telekomanlagen andrehten, die man je gesehen hatte, gewissermaßen die dreimal aufgebrühten Teebeutel in der Welt der Telekommunikation. Das Zeug war vorher in Kriegsgebieten zum Einsatz gekommen, und jede Schicht der Anlage war halb konfiguriert, halb abgesichert und halb dokumentiert.
Das Internet in Slovstakien war reif für die Mülltonne.
Jedenfalls hatte meine Chefin Ilsa, She Wolf of the SS, benannt nach dem gleichnamigen Film, dem Innenministerium versprochen, dass ich nur drei Stunden brauchen würde, woraufhin das Innenministerium das Telekommunikationsministerium angerufen und den Befehl erteilt hatte, zu der Amerikanski-Dame, die eigens herüberkam, um streng geheime Arbeiten zu erledigen, besonders nett zu sein und ihr alles zu beschaffen, was sie brauchte. Ich kann bestätigen, dass sie sich wirklich Mühe gaben, denn als ich im Hauptrechenzentrum des Landes eintraf, es war ein riesiger alter brutalistischer Kasten, den ich auf der Stelle für meine Sammlung brutalistischer Sowjetbauten fotografieren musste, bei denen das Fotografieren früher mit der Todesstrafe geahndet wurde – überschaubare, kurze Sätze sind etwas für Loser, die sich freiwillig die 280-Zeichen-Zwangsjacke anziehen –, schickte mich der Mann am Empfang sofort zum Leiter der Sicherheitsabteilung.
Er hieß Litvinchuk und nahm seine Aufgabe äußerst ernst. Das erkannte man daran, dass er eine eigene Truppe von Telekom-Polizisten besaß. Die wie RoboCop bekleideten Wächter standen vor seiner Tür, ihre Gewehre waren länger als die Beine, und sie rochen nach Knoblauchwurst und dem Schweiß aus tausend Schichten Kevlar. Litvinchuk begrüßte mich freundlich und ließ mich mit einer ausufernden Ansprache wissen, wie sehr er sich darüber freute, (wieder einmal) eine ausländische Vertragsfirma in seinem Rechenzentrum zu empfangen, und ganz besonders die Vertreterin einer Firma, die so teuer war wie Xoth Intelligence.
»Moment, das nicht richtiges Wort«, sagte er mit einem extra dick aufgelegten Smirnoff-Akzent (er hatte in der London School of Economics den Master gemacht, und ich hatte bei TEDx einen Vortrag gesehen, bei dem er wie ein Nachrichtensprecher der BBC geklungen hatte). »Exklusiv? Berühmt?« Er sah mich an – ganz besonders meine Titten, an die jeder slovstakische Regierungsvertreter, mit dem ich bisher zu tun gehabt hatte, seine Bemerkungen vorzugsweise richtete. Ich verschränkte nicht die Arme vor der Brust.
»Berüchtigt«, half ich ihm.
Er grinste schief. »Das kann ich mir vorstellen, Miss Maximow.« Er sprach das »W« stimmhaft und weich aus, wie es immer geschah, sobald ich Frankreich in östlicher Richtung verließ. »Wir freuen uns sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Sie werden aber sicher verstehen, dass wir sehr vorsichtig sein und genau prüfen müssen, welchen Vertragsarbeitern wir den Zugang zu unseren streng gesicherten Anlagen gewähren.« Er schob ein mit Büroklammern zusammengeheftetes Formular auf dem Schreibtisch zu mir herüber. Ich zählte bis sieben – das ist genauso effizient und wirkungsvoll, wie bis zehn zu zählen – und nahm es in die Hand. Neun Blätter, schmierige Fotokopien, voller Fragen wie: »Benennen Sie alle NGOs und Wohltätigkeitsorganisationen, die Sie direkt oder indirekt unterstützt haben.«
»Nein«, antwortete ich.
Er setzte eine knallharte Miene auf. Bei der Dorfjugend, die auf dem Flur Judge Dredd spielte, kam das sicherlich unglaublich gut an. Aber mich hatte Ilsa die Wölfin von Blabla angestarrt, und ich war an die härtesten Augäpfel der Welt gewöhnt.
»Ich muss darauf bestehen«, beharrte er.
»Ich fülle das Formular nicht aus«, erwiderte ich. »Firmenvorschriften. Xoth hat beim Innenministerium für alle Mitarbeiter eine pauschale Erlaubnis erwirkt, Ihre Einrichtungen zu betreten.« Das entsprach der Wahrheit. Ich hasste Papierkram und ganz besonders diese Art von Papierkram – Formulare voller Fragen, die man im Leben nicht vollständig oder ehrlich beantworten konnte, sodass sie einem immer ein Kapitalverbrechen anhängen konnten, wenn man auf die falschen Zehen trat. Glücklicherweise gab es bei Xoth eine unaufhebbare Anweisung, dass die Techniker in den Anlagen der Kunden keinerlei offizielle Dokumentation abzeichnen durften. Ich würde mir bei der Arbeit selbst Notizen machen und in der Hierarchie nach oben durchreichen zu Ilsa der SS-Wölfin, Blabla. Sie würde dann alles bereinigen und dem Innenministerium Kopien für deren eigene Akten übergeben. Dabei fielen gewisse entscheidende Details unter den Tisch, sodass wir ihnen für weitere Wartungsarbeiten jeweils neue Rechnungen stellen konnten.
Ich bemühte mich sehr, gelangweilt zu wirken – das war kein Problem, weil mir sowieso schon vor Langeweile die Augen wehtaten –, und starrte den postsowjetischen Telefonkommissar an.
»Ich fülle das für Sie aus«, erklärte er.
Ich zuckte mit den Achseln.
Er arbeitete zügig, der Stift tanzte förmlich über das Papier. Es war nicht sein erster Einsatz an der Bürokratenfront. Dann schob er die Dokumente wieder herüber. »Unterschreiben Sie.« Er lächelte. Es war kein freundliches Lächeln.
Ich sah es mir an. Lauter kyrillische Schriftzeichen.
»Nö«, antwortete ich.
Er schaltete das Lächeln ab. »Madam.« Es klang ein wenig wie: »Mädchen!« Mir dämmerte, dass wir nicht gut miteinander auskommen würden. »Sie dürfen mein Rechenzentrum nicht betreten, solange wir nicht die grundlegenden Informationen über Sie erfasst haben. Das verlangen unsere Vorschriften.«
Er starrte mich an, das Gesicht wurde immer härter, und wartete offensichtlich darauf, dass ich die Nerven verlor. Schon lange bevor Ilsa mich ihrem verschärften Training in Sachen Stoizismus unterzogen hatte, war ich mit ähnlichen Situationen konfrontiert gewesen. Im DHS kam man nicht weit, wenn man nicht mit bürokratischen Hemmnissen umzugehen wusste. Ich stellte die gelangweilte Miene eine Stufe höher und vermittelte ihm den Eindruck, dass ich mehr Zeit zu verplempern hatte als er.
Er streckte die Hand aus. Ich hatte ihn als dumpfbackigen Dickfinger verbucht, doch er hatte die Hände eines Pianisten und war ausgezeichnet manikürt. Das machte mir meinen Mangel an mädchenhafter Aufmachung schmerzhaft bewusst. »Ausweis.«
Xoth gibt uns hübsche ID-Karten mit RFID, saphirglasbeschichteten Smartchips und Hologrammen, die wir in den Anlagen der Kunden tragen können, doch die sind nur Staffage, um irgendwelche Dödel zu beeindrucken. Ich nahm meinen Ausweis von der Kordel ab und reichte ihn hinüber.
Wieder tanzte der Stift, dieses Mal unten auf dem Formular. Er drehte das Blatt herum und zeigte es mir. Er hatte »unterzeichnet von Masha Maximow« in die Unterschriftszeile geschrieben. Bravo, Boris. Das hast du ganz wunderbar gemacht. Was für ein Arschloch.
»Sind wir jetzt fertig?«
Gewissenhaft fertigte er auf dem Multifunktionsgerät eine Kopie an – ich kannte fünf verschiedene Exploits für das Gerät, mit denen ich sein ganzes Netzwerk hätte übernehmen können, wenn ich es gewollt hätte – und reichte sie mir. »Für Ihre Unterlagen.«
Ich faltete das Blatt auf ein Viertel zusammen und schob es in die Gesäßtasche. »Wo entlang?«
Er sagte etwas auf Russki, worauf ein Stormtrooper unter der Last seines Körperpanzers herein schlurfte und mich zum Rechenzentrum führte. Ich warf einen Blick auf die zahllosen Racks voller Hardware, zog im eisigen Luftzug der Kühlung den Reißverschluss der Fleecejacke hoch und machte mich an die Arbeit. Es sollten sehr lange drei Stunden werden.
Als ich endlich fertig war, fluchte ich mit klappernden Zähnen. Mein Hoodie war viel zu dünn, und ich hatte den Verdacht, dass die langfingrige Dumpfbacke einem gepanzerten Boris den Befehl gegeben hatte, die Kühlung auf »Antarktis« zu stellen.
Aber es war geschafft, und die Testläufe waren gestartet. Ich stand von dem Klappstuhl auf, den ich im Rechenzentrum zwischen den Racks hin und her geschleppt hatte, um die Leitungen zu verfolgen und den Haarballen aufzudröseln, den korrupte IT-Firmen mit ihren faulen Abkürzungen und ihrer Unfähigkeit hinterlassen hatten.
Als ich mein Werk betrachtete, empfand ich … nun ja, um ehrlich zu sein, eine tiefe Sinnlosigkeit. Ich hatte sechzehn Stunden geschuftet – fünfzehn, wenn man Essens- und Toilettenpausen abzog – und den Sectec-Netzwerkmonitor von Xoth installiert, konnte aber trotz all meiner Mühen nichts vorweisen außer einem unauffälligen schwarzen Server in einfacher Bauhöhe, der im untersten Regal des hintersten Racks montiert war. Das entsprach der Firmenpolitik von Xoth. Wir bauten unseren Kram so weit weg wie möglich ein, falls barbarische Horden unsere diktatorischen Klienten stürzten und die Tore stürmten, um telegene Beweise für die Kollaboration der Machthaber mit bösen Überwachungsfirmen (das wäre dann ich) zu suchen.
Jetzt konnte ich feiern. Ich sah mich über die Schulter um und vergewisserte mich, dass ich momentan allein war – die RoboCops hatten sich angewöhnt, hinter mir zu stehen und meinen Arsch anzustarren, wenn ich meinen Stuhl hin und her schleppte –, bückte mich und berührte die Zehen. Sofort spürte ich die wundervolle Spannung in den Kniesehnen und das Knirschen im Hals und in den Schultern, als meine Haare über den Boden streiften. Dann richtete ich mich wieder auf, ließ die Knöchel knacken, verband meinen Laptop mit dem Handy und stellte einen VPN-Tunnel zu dem mobilen Router her, den ich am Morgen im Hotelzimmer eingerichtet hatte. Dessen Akku war voll geladen, und das Gerät war im WLAN des Hotels angemeldet, das allerdings (siehe oben) eine erbärmliche Bandbreite hatte. Ich startete auf dem Laptop eine virtuelle Maschine, suchte einen Container mit einer voll gepatchten Kopie der aktuellen freien Windows-Version und verband mich über den Browser mit Facebook.
Der slovstakische Widerstand hatte noch nicht begriffen, dass der einzige wirkliche Nutzen von Facebook während einer Revolution darin bestand, den Leuten zu zeigen, wie man etwas einsetzte, das mehr Sicherheit bot als Facebook. Ihre gesamte Kommunikation fand in zwei Gruppen statt, auf die sie über den verschleiernden Tor-Service zugriffen, der gute alte https://facebookcorewwi.onion, der eine ziemlich hohe Sicherheit bot (das musste wohl stimmen, wenn ich es sagte).
Ihr Problem bestand darin, dass sie technisch weit unterlegen waren, denn von jetzt an kämpften sie gegen das Beste, was Xoth zu bieten hatte (oder jedenfalls das Beste im mittleren bis gehobenen Preisbereich). Bald würde es für die beherzten Demonstranten in Slovstakien sehr, sehr eng werden.
Die virtuelle Windows-Version in meiner virtuellen Maschine verband sich über das Hotelnetzwerk mit Tor – mit dem Onion-Router, einem System, das die Netzwerkverbindungen über die ganze Welt streute und jeden Hop separat verschlüsselte, sodass man die Datenpakete der Benutzer nicht verfolgen, abfangen und verändern konnte – und dann mit dem versteckten Dienst von Facebook, einer Darknet-Website, die in einem erheblich schöneren Rechenzentrum als diesem gehostet wurde. Es befand sich in einer entlegenen Ecke von Oregon mit bemerkenswert niedriger Jahresdurchschnittstemperatur (Kühlung durch die Umgebungstemperatur ist der wichtigste Faktor bei der Kostenminimierung, wenn man ein ganzes Gebäude voller überhitzter Computer betreibt).
Mit Alt-Tab wechselte ich zur Überwachung der Sectec-Box neben mir und benutzte dabei eine nicht getunnelte Schnittstelle im Netzwerkgerät meines Handys. Die Sectec-Box konnte gleichzeitig zehn Millionen Verbindungen verwalten und alle Datenpakete durchforsten. Dabei setzte sie Modelle des maschinellen Lernens ein, die (Fun Fact!) ursprünglich entwickelt worden waren, um Krebszellen auf einer mikroskopischen Aufnahme zu erkennen. Und richtig, die Box bemerkte einen normalen Windows-Laptop im Sofitel Blzt, der über das Tor-Netzwerk kommunizierte. Mithilfe der Fingerprints der Pakete erstellte sie ein Profil der Maschine und startete eine Suche in der Kunden-API von Xoth, um einen brauchbaren Exploit für diese Konfiguration zu finden. Ich hängte das Fenster an den oberen Rand des Desktops und schaltete zurück zur virtuellen Maschine. Die Adressleiste des Browsers flackerte kurz und zeigte eine unschuldige Fehlermeldung. Ein Blick in die Diagnose der virtuellen Maschine verriet mir, dass die Schadsoftware dort angekommen war.
Sie benutzte einen Zero-Day-Exploit des Tor-Browsers, der immer auf leicht veralteten Version von Firefox beruhte und deshalb angenehmerweise durch die Exploits von gestern verwundbar war, um aus der Sandbox des Browsers auszubrechen und in das Betriebssystem einzudringen. Dort baute sie einen komplexeren Exploit ein, der Windows selbst angriff, und spielte persistenten Code auf, den die Integritätsprüfung des Bootloaders nicht wahrnehmen konnte, um sich schließlich in ein Modul einzuklinken, das erst zu einem späteren Zeitpunkt des Startvorgangs geladen wurde. Nach weniger als fünf Sekunden war es erledigt. Die virtuelle Maschine war vollständig kompromittiert und bereits dabei, meine Webcam und das Mikrofon zu kapern. Gleichzeitig suchte sie auf der Festplatte nach interessanten Dateien, klaute gesicherte Passwörter meines Browsers und aktivierte einen Keylogger. Da dies in einer virtuellen Maschine geschah – nicht in einem echten Computer, sondern nur in einer Software, die so tat, als sei sie ein Computer –, hatte all das glücklicherweise keinerlei Auswirkungen auf die Realität.
Jetzt war die Zeit für einen echten Test gekommen. Sectec hatte einen Modus, der den gesamten eingehenden und ausgehenden Netzwerkverkehr nach E-Mail-Adressen und Benutzernamen durchsuchen konnte, um bestimmte Personen aufzuspüren. Ich fütterte ihn mit Litvinchuks E-Mail-Adresse und wartete, bis sein Computer auftauchte. Es dauerte weniger als eine Minute, denn er rief alle sechzig Sekunden automatisch die E-Mails vom Server des Ministeriums ab. Zwei Minuten später kontrollierte ich seinen Rechner, archivierte seine Porno-Favoriten und lud seinen Suchverlauf herunter. Ich habe ein nützliches Skript, das im Zielcomputer alles findet, wo ich erwähnt werde. Ich bin nämlich ein neugieriges Miststück, was die doch eigentlich wissen sollten.
Litvinchuk interessierte sich für ausgesprochen widerliche Pornos – was soll denn dieses ewige Anpinkeln? – und hatte auf Google wie besessen nach mir gesucht. Außerdem hatte er von einem Geheimagenten mein Zimmer durchwühlen lassen. Sie hatten in mein Handy eine Standortüberwachung eingebaut, die auf einer aufgeblähten Netzwerk-App beruhte. Das Ding hatte ich bereits bei meiner ausführlichen Debugging-Sitzung im Rechenzentrum entdeckt. Ich hätte die Schnüffelsoftware mit falschen Daten füttern können, schaltete sie dann aber einfach ab, weil ich dachte, die können mich mal. Schließlich lud ich noch ein halbes Gigabyte Videos von Litvinchuk persönlich herunter, vor Pisse glänzend in einem schweren deutschen Ganzkörperlatexanzug. Danach stand ich auf, streckte mich noch einmal und klappte den Deckel zu.
Mein Abenteuer hatte am Vortag um 16:00 Uhr begonnen. Jetzt war es 8:00 Uhr, was bedeutete, dass die Demonstrationen auf dem Hauptplatz bis auf die Notbesetzung geschrumpft waren. Die wirklich interessanten Leute kamen erst nach dem Abendessen heraus und bemannten im Dunklen die Barrikaden. Zu der Zeit, wenn die üblen Dinge abgingen und die Provokateure und Neofaschisten erschienen – oft ein und dieselben Personen – und die echten Demonstranten sich doppelt so schwer ins Zeug legen mussten.
Auf dem Rückweg rief ich im Sofitel an und erteilte dem Zimmerservice einen Auftrag. Momentan gab es nur Frühstück, aber ich brauchte ein Abendessen. Deshalb orderte ich dreimal Frühstück und schenkte mir längere Erklärungen, warum ich trotzdem nur einen Satz Besteck haben wollte.
Ich traf im gleichen Augenblick wie der verwirrte Kellner vor der Zimmertür ein, winkte ihm zu, öffnete die Tür mit der Karte und folgte ihm und seinem Wägelchen nach drinnen. Er war einer dieser Laufburschen, die man überall im Hotel sah. Früher hatte er einen Job in der sowjetischen Schwerindustrie gehabt, aber seit alles nach China ausgelagert war, spielte er Zimmerservice und schob Karren durch die Gegend. Im Gegensatz zu ihren aufgeweckten Söhnen, die den Gamerslang beherrschten und sich auf Video- und Fotoplattformen tummelten, sprachen diese Typen kein Englisch. »Dobre«, sagte ich. »Pajalsta.« Ich zeichnete die Rechnung ab und gab ihm 10 Euro Trinkgeld – im Sofitel bezahlte man mit Euro, seit die örtliche Währung zusammengebrochen war. Bisher hatte ich mir noch nicht die Mühe gemacht, Bargeld einzutauschen. Allerdings hatte ich bei einem geschäftstüchtigen Händler, der es auf Touristen abgesehen hatte, eine 10.000.000.000-Dinar-Note gekauft. Mir gefiel der Stich des Opernhauses auf der Rückseite, doch der Boris auf der Vorderseite war wieder ein Dickfinger mit durchgezogener Augenbraue aus der zentralen Darstelleragentur. Ich vergaß immer wieder, nach ihm zu googeln, war aber ziemlich sicher, dass er aus irgendeinem ebenso schrecklichen wie passenden Grund vergöttert wurde. Vielleicht hatte er Armenier vernichtet oder mit Stalin kollaboriert.
Vier Stunden später schellte mein Wecker. Ich suchte meinen Badeanzug und den wasserdichten MP3-Player heraus, zog den Hotelbademantel an und vergewisserte mich, dass alle Geräte heruntergefahren und die USB-Ports abgedeckt waren. Dann ging ich zum Pool.
Das Schwimmen – selbst mit lauter Musik – walkt immer mein Unterbewusstsein durch. Die Eintönigkeit zwingt es, nach innen in die vernachlässigten Ecken zu spähen. Irgendwann während der fünfzigsten Bahn (es war ein kleines Becken) erinnerte ich mich an das, was für diesen Tag geplant war. Ich berechnete die Zeitzonen im Kopf und erkannte, dass ich noch Zeit hatte, etwas zu unternehmen. Was für eine gequirlte Scheiße. Ich kletterte aus dem Pool und nahm mein Handtuch.
Kurz danach hockte ich immer noch tropfend auf dem Schreibtischstuhl meines Zimmers und schaltete das Handy ein, um die Fotos der Schraubenköpfe meines Laptops abzugleichen. Ich hatte alle Schrauben mit Glitzernagellack verklebt, von den Klebstellen große Aufnahmen gemacht und die Fotos beschriftet. So konnte ich leicht feststellen, ob jemand meinen Laptop aufgeschraubt und etwas Gemeines getan hatte, wie etwa einen Hardware-Keylogger oder, na ja, etwas Semtex mit einem Haufen Heftklammern einzubauen. Mit einem Open-Source-Astronomieprogramm, das bei der Erkennung von Sternbildern hilft, überprüfte ich zwei der sieben Schrauben. Die Glitzermuster waren inzwischen alte Freunde, denn ich kontrollierte sie jedes Mal vor dem Einschalten, wenn ich meinen Computer eine Weile nicht in Reichweite gehabt hatte.
Schließlich startete ich das Gerät, zog mir das Handtuch über den Kopf, um versteckte Kameras auszusperren, und tippte das Passwort ein, während ich halblaut »Uaaah« machte. Das sollte verhindern, dass jemand mein Passwort erriet, indem er die Geräusche der Finger auf der Tastatur abhörte. Für die wirklich heiklen Dinge hatte Xoth einen Air-Gap-Raum, der von einem faradayschen Käfig umgeben war. Dort standen Computer, die die Techniker verdeckt von der Stange kauften, indem sie in irgendeinen Elektronikladen gingen. Danach wurden die Geräte für den Rest ihres Lebens bei Xoth eingesperrt. Zuerst wurden sie mit einer hauseigenen Version von TAILS, einer paranoiden Linux-Distro, leer gefegt. Die WLAN-Karten und die Bluetooth-Sender wurden mit Zangen herausgerissen. Die USB-Anschlüsse wurden mit Kappen aus dem 3-D-Drucker gesichert, die man nicht entfernen konnte, ohne sie zu zerstören. Mit einem Stick brachte man die verschlüsselten Daten in den Raum, suchte sich einen Computer aus und brach das Siegel, um den USB-Stick hineinzustecken und die Daten auszulesen. Danach übergab man den Rechner einem Techniker, der alles genau überprüfte und die Anschlüsse wieder versiegelte. Verglichen damit, war ich gar nicht besonders paranoid.
Litvinchuk war ein fleißiger Boris. Mein Computer lud seine eigenen Abhöranweisungen herunter und sortierte sie, als er mit dem Sectec einen Probelauf machte. Ich ging die Liste durch, und siehe da, eine Menge dieser Namen kannte ich schon. Es waren die Leute, mit denen ich mich in ein paar Stunden auf einen Drink treffen wollte. Ich sortierte die Folien für meinen Kryptoparty-Vortrag um.
Es wurde allmählich Zeit für ein spätes Mittagessen oder ein frühes Abendessen, oder wie auch immer man eine Mahlzeit um 15:00 Uhr nennen wollte. Gerade, als ich noch einmal den Zimmerservice rufen wollte, schlug mein Handy Alarm. Das geschah nicht sehr oft, weil ich alle Benachrichtigungen abgeschaltet hatte.
Wenn dieses Piepsen einsetzte, zog es mir immer sämtliche Schließmuskeln zusammen.
»Trauung von Marcus Yallow und Ange Carvelli«, dazu eine abgekürzte URL. Natürlich ein Livestream. Es war ja Marcus. Diese exhibitionistische Aufmerksamkeitshure. Dieser Drecksack.
Mein Gott, er machte mich verrückt. Ich startete den Livestream. Sie hatten alle Leute, die sie mochten, nach Boston zur Trauung rüberfliegen lassen, weil das Mädchen einen straffen Stundenplan an der Universität hatte. Im Saal waren Roboter aufgebaut, die sie sich beim MIT Media Lab ausgeliehen hatten, damit es ein wenig mehr nach Nerds aussah. Natürlich trug sie kein Weiß. Ihr Brautkleid war mit Leuchtschnüren durchwirkt, die im Takt der Musik pulsierten, und Marcus’ Anzug – Beatles-schwarz, schmaler Schlips und Röhrenhosen, in denen seine Beine noch dürrer aussahen als sowieso schon – war ebenfalls verdrahtet, doch seine Lämpchen pulsierten nur, wenn die beiden sich berührten. Dann wanderten vom Kontaktpunkt aus Lichtbänder über seinen Anzug.
Ja, na gut, das war schon ziemlich cool.
Eine bekannte Hackerin aus Cambridge nahm die Trauung vor. Sie gehörte zu den Leuten, die man hinzugezogen hatte, als man Chelsea Manning schnappen wollte. Damals war sie selbst noch ein Kind gewesen, aber jetzt wirkte sie älter, und ihre Frau hatte etwas abseits die Kinder der beiden auf dem Schoß. Sie trug ein Abtropfsieb auf dem Kopf, denn sie war in der Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters geweiht worden. Das ging mir dann doch zu weit.
Marcus und sein Mädchen legten die Treuegelübde ab. Marcus versprach, ihr Kaffee zu machen, ihr die Füße zu massieren (urgs), ihren Code zu überprüfen und ernsthaft um Verzeihung zu bitten; sie versprach, ihm nachzugeben, wenn sie falschlag, ihm zu verzeihen, wenn er sich entschuldigte, und ihn zu lieben, »bis die Räder vom Rollstuhl fallen« (zweimal urgs). Dann küssten sie sich, und die Gäste applaudierten. Ich wartete noch drei Minuten, bis ich sicher war, dass die Zeremonie tatsächlich vorüber war und die Feier begann. Ich bin ja kein Monster.
Was man über Cambridge wissen muss: Dort gibt es einen Drohnen-Lieferservice. Für einen kleinen Aufpreis kann man die Lieferung auf die Minute genau festlegen. Ich sah auf die Uhr in der Ecke des Bildschirms. Rechts hinter der Priesterin war ein großes Fenster, das zum Charles River hinausging. Draußen konnte man den Schnee und die Stiefelspuren der Studenten erkennen. Ich sah noch einmal auf die Uhr.
Die Drohne flog bis vor das Fenster und klopfte höflich an. Sie hatte vier große Rotoren und eine Sensorenanlage, die mir alle möglichen Telemetriedaten über die Aktivitäten in dem Raum lieferte, von Bluetooth-Geräte-IDs bis hin zu den mit Lidar erfassten Umrissen der Menschen. Der Livestream der Trauung zeigte mir, vom Standort der Braut und des Bräutigams aus gesehen, wie die Drohne ans Fenster klopfte (gut ein Dutzend Kameras speisten den Stream, und die Software war klug genug, um immer auf diejenige zu wechseln, die die interessantesten Bilder auffing), während der Stream der Drohne die entgegengesetzte Blickrichtung übertrug: Marcus, sein Mädchen und ihre netten nerdigen Freunde und Verwandten, die in das Fischaugenobjektiv starrten.
Markus brach den Bann und öffnete das Fenster, damit die Drohne geschickt in den Saal schweben und ihm die Schachtel in die Hand drücken konnte. Er zog den Verschlussstreifen von der Plastikhülle und legte den Geschenkkarton im Inneren frei. Sie fischte die Karte aus dem Umschlag und las sie vor. Ich muss zugeben, dass ich eine Gänsehaut bekam, als sie meinen Namen vorlas.
Als Marcus es hörte, machte sein Gesicht etwas Komisches. Dabei bekam ich auch eine Gänsehaut, aber von einer anderen Art. Wir haben eine komplizierte Geschichte. Ich rieb mir die Finger, die er mir gebrochen hatte, als ich erst sechzehn war. Er hatte es getan, um mein Handy zu stehlen, auf dem ich ein Video hatte, das den Vorwurf, er sei ein Terrorist, widerlegen konnte. Kompliziert. Die Finger taten immer weh, wenn ich an ihn dachte.
Er richtete den Blick direkt auf die Sensoren der Drohne. »Danke, Masha«, sagte er. »Wo auch immer du gerade bist.« Normalerweise hätte die Drohne eine Aufzeichnung angefertigt und mir später überspielt, aber wenn man eine eklige Stalkerin ist (ähem), dann kann man es sich auch gleich in Echtzeit ansehen. Ich funkte die Drohne an und ließ sie einen Knicks machen. Sie teilte mir mit, dass ich fünf Sekunden Zeit hatte, um noch einmal 50 Dollar für fünf weitere Minuten auszugeben, denn sie musste auch noch andere Päckchen ausliefern. Ich gab sie frei, und der Feed brach ab.
Auf dem Livestream verfolgte ich, wie sie mein Geschenk auspackten. Um ein Haar hätte ich ihnen eine Packung Kopi Luwak geschenkt. Das sind die Kaffeebohnen, die von Schleichkatzen gefressen werden. Man kann den Kot aufsammeln und die Bohnen zurückgewinnen und rösten. Ich hatte aber einen Artikel über die quälerische Käfighaltung der Tiere gelesen und mich deshalb für einen Raspi Altair 8080 entschieden. Das ist ein »PC« aus dem Jahre 1974, den man mit Schaltern auf der Vorderseite steuert. Die Ergebnisse kann man an kleinen Lämpchen ablesen. Im Inneren steckt allerdings ein Raspberry Pi, dessen Open-Source-Software das alte Gerät nachbildet und ihm dabei ungefähr acht Fantastilliarden Mal die ursprüngliche Rechenleistung schenkt. Das Gehäuse war weitgehend leer. In den freien Raum hatte die Handwerkerin, die es mir verkauft hatte, aus handgeschnitzten Holzmechanismen ein asymmetrisches Getriebe eingebaut, das eifrig surrte, solange der Computer arbeitete. Wenn man das optionale durchsichtige Gehäuse wählte, konnte man es sogar beobachten.
Marcus wusste genau, was es war (weil ich das Ding mithilfe seines Twitter-Feeds gefunden hatte) und wie viel es gekostet hatte (weil er gestöhnt hatte, er werde es sich in einer Million Jahren nicht leisten können), und nun wirkte seine Miene hinreißend schockiert. Er wechselte in den hyperaktiven, Spucke spritzenden Modus, wie er es immer tat, wenn er stark erregt war, und erklärte es seinem Mädchen. Die Art und Weise, wie sich ihre Miene veränderte, war sogar noch befriedigender: eine Mischung aus Eifersucht und Anerkennung, die ich sehr genoss, weil ich so ein kleinlicher, schrecklicher Mensch bin.
Ich fühlte mich wie die böse Fee, die Dornröschen aus Rachsucht verfluchte, weil man sie nicht zur Taufe eingeladen hatte – nur eben, dass dies eine Hochzeit und keine Taufe war. Oh, und sie hatten mich natürlich auch eingeladen.
Aber ich hatte zu tun. He, ich hatte ihnen immerhin ein klug ausgedachtes Geschenk geschickt, auch wenn ich damit ihre dumme Nerd-Hochzeit auf eine ganz neue Ebene gehoben hatte. Sie hätten eben noch nerdiger sein müssen, wenn sie nicht von höheren Ebenen überrascht werden wollten.
Ich hatte immer noch Hunger, und allmählich wurde es Zeit, nach draußen auf den Platz zu gehen. Der Zimmerservice im Sofitel war sowieso erbärmlich. Ich wollte mir einen Döner holen. Ach, am besten gleich einen ganzen Sack voll Döner, die ich mitnehmen konnte.
Das vegane Café, wo sich meine Lieblingsrevoluzzerzelle traf, hieß Danube Bar Resto. Dort waren sie immer zu finden, bevor die abendlichen Aktionen begannen, denn, zum Teufel mit der Sicherheit, warum sollte man es der Geheimpolizei nicht leicht machen, irgendwo fern von der Menge die ganze Truppe auszuheben? Es war zum Verzweifeln.
Kriztina war schon da und verdrückte etwas, das nie die Gelegenheit bekommen hatte, zu atmen, zu leben, zu laufen und zu spielen. Ich öffnete den zusammengeknüllten Beutel, damit der Fleischduft der Dönertaschen aufsteigen konnte. »Lass noch Platz«, riet ich ihr.
Sie lachte erstickt und reckte mit vollem Mund den Daumen hoch, als ich mich neben sie setzte. Zu Kriztinas kleiner Zelle gehörten acht Personen, darunter zwei Grafikdesigner, zwei Webdesigner und ein Dichter (ehrlich). Die anderen taten nicht einmal so, als gingen sie einer geregelten Tätigkeit nach. Für unter Dreißigjährige war das in Slovstakien allerdings der Normalfall.
»Willst du was trinken?« Oksana hatte immer Geld in der Tasche. Ich hatte sie bei unserer ersten Begegnung als Spitzel eingestuft, inzwischen aber erfahren, dass sie bei einer Anwaltskanzlei, die für westliche Firmen arbeitete und keine Probleme damit hatte, ein Transmädchen als Gehilfin bei sich arbeiten zu lassen, gutes Geld verdiente. Sobald ich mich vergewissert hatte, dass sie nicht auf Litvinchuks Geheimagentenliste stand, mochte ich sie sogar. Sie erinnerte mich an einige Frauen, die ich im Nahen Osten kennengelernt hatte. Toughe Kämpferinnen, die es geschafft hatten, großartig auszusehen, während rings um ihre hübschen Schultern ihre Städte in Schutt und Asche gebombt wurden, furchtlos unter den Hidschabs und prachtvoll, auch wenn sie mit Staub und Blut bedeckt waren.
»Klar.« Ich rechnete mit etwas aus Weizengras, lebendigen Mikroben und vermutlich ein paar Zweigen, aber vor allem Orangensaft und Mangomark. Der Typ, der den Laden schmiss, erzählte immer, wie das Chlorophyll unser Blut mit Sauerstoff anreicherte. Allerdings produziert Chlorophyll nur unter dem Einfluss von Sonnenlicht Sauerstoff, und wenn das Sonnenlicht in den Darm scheint, dann hat man noch ein ganz anderes Problem. Und selbst wenn man das Grünzeug im Hinterteil sammelt, kann das Arschloch den Sauerstoff nicht absorbieren. Ich beziehe meinen Sauerstoff lieber auf die gute alte Art und Weise, indem ich atme.
»Heute Abend …«, setzte Kriztina an. Ich hob eine Hand.
»Batterien oder Beutel«, sagte ich. Die anderen machten betretene Gesichter. Wer ein Handy mit wechselbarer Batterie hatte, nahm sie heraus. Die anderen steckten die Geräte in die Faradaybeutel, die ich beim ersten Treffen mit diesen Amateuren verteilt hatte.
»Ehe wir über den heutigen Abend reden, will ich euch über einige neue Sicherheitsmaßnahmen informieren.« Sie stöhnten. Ich war eine echte Spaßbremse. »Zuerst einmal: Paranoid Android zu benutzen, ist nicht mehr optional. Ihr müsst euch jeden Abend die aktuelle Version holen und die Signaturen überprüfen. Jedes einzelne Mal.« Das Stöhnen wurde lauter. »Leute, ich meine es ernst. Das Innenministerium hat jetzt einen Netzwerkschnüffler, der dreimal am Tag neue Exploits nachlädt. Wenn ihr eure Software nicht aktuell haltet, dann seid ihr erledigt.
Zweitens müsst ihr dafür sorgen, dass eure Abwehr gegen die IMSI-Catcher auf dem neuesten Stand ist. Sie haben für ihre gefälschten Basisstationen gerade ein Update gekauft und fischen die ID jedes Handys heraus, das sich dort einbucht. Die App, mit der ihr letzte Woche noch einen Schnüffelsender von einem echten unterscheiden konntet, ist jetzt nutzlos. Spielt Updates ein, immer wieder, jeden Tag. Und überprüft alle Signaturen.
Drittens müsst ihr dafür sorgen, dass die intelligenten Verbrauchszähler bei euch zu Hause nicht heimlich wieder online gehen. Das Innenministerium will es halten wie in Minsk und wartet nur auf eine Gelegenheit, um mitten im Februar jedem die Heizung abzustellen, den es mit den Demonstrationen in Verbindung bringen kann.
Und außerdem müssen alle Dazzle auflegen. Ohne Ausnahme.« Wieder stöhnten sie, doch ich holte schon die Tuben aus meiner Tasche und reichte sie herum. Die Creme reflektierte sichtbares Licht und Infrarotstrahlung so stark, dass jeder, der ein Foto machen wollte, nur Gegenlicht und Flackern in der Kamera sah, weil die Sensoren überlastet waren. Die Creme war für von Paparazzi geplagte Stars entwickelt worden, doch der Geruch des Materials und das schmierige Gefühl, das es auf der Haut hinterließ – ganz zu schweigen von den beharrlichen Gerüchten, dass es ein starkes Karzinogen sei –, hatten dazu geführt, dass es als Kuriosität galt, die nur noch Jugendliche bei Klassenfotos und paranoide Verrückte benutzten.
Ich schlürfte den grünen Saft, den Oksana mir gegeben hatte, und war angenehm überrascht, weil er unverkennbar nach Tequila schmeckte. Sie blinzelte mir zu. Oksana, du bist meine Heldin.
»Macht schon«, sagte ich. »Führt ein Update durch, ehe wir hier weggehen. Vergesst nicht, dass die Operationssicherheit ein Mannschaftssport ist. Euer Fehler lässt alle eure Freunde auffliegen.«
Sie legten los. Kriztina, Oksana und ich überprüften die Maßnahmen aller anderen, und dann überprüften wir uns gegenseitig. Freunde lassen nicht die Daten von Freunden durchsickern. Außerdem schmierten wir uns mit Dazzle ein, und sie machten auf Boris Witze über den Geruch, die ich beinahe verstehen konnte, obwohl mein Boris viel schlechter war als das Englisch aller anderen.
»Heute Abend sind die Nazis unterwegs«, erklärte Kriztina nach einem Blick auf ihr Handy. Sie kannte Leute, die wieder andere Leute kannten. Slovstakien war so klein, dass praktisch jeder mit jedem verwandt war. Das bedeutete, dass sich der idiotische Skinhead-Cousin von irgendjemandem gerade mit seinen Freunden betrank und »Heil Hitler« rief. Die Typen hatten wohl schon die passenden Klamotten und Stiefel angezogen, und natürlich besaßen sie auch Teleskop-Schlagstöcke (das unverzichtbare Accessoire der aktuellen Nazi-Mode) und Schlagringe. Die Neonazis waren die nützlichen Idioten anderer Leute, sie tauchten gern bei den Demonstrationen auf und brüllten, sie wollten die Regierung stürzen, und dann hoben sie die rechten Arme und griffen die Polizeiketten an.
Man konnte ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht klar sagten, was sie wollten – sie hassten Immigranten, besonders Flüchtlinge und besonders braunhäutige Flüchtlinge; außerdem auch Russen, Juden, Moslems, Schwule, Veganer, das Europaparlament und jedes einzelne Mitglied der Nationalversammlung. Möglicherweise waren sie sogar ganz von selbst auf diese Ideen gekommen, die so gut zu ihren intoleranten, klotzköpfigen Ressentiments passten. Aber diese Typen hatten auch Geld, ein Vereinsheim und eine Bezugsquelle für die hübschen Teleskopschlagstöcke, und irgendjemand hatte ihnen anscheinend einen Vortrag darüber gehalten, wie man höchst effiziente Molotowcocktails herstellte, denn sonst hätten sie sich schon längst selbst aus dem menschlichen Genpool gesprengt.
Ich trieb mich seit einem Monat in Litvinchuks Netzwerk herum, genauer gesagt, seit ich hier gelandet war, um das Verkaufsteam zu unterstützen, das ihn bearbeitete. Ich hatte ihnen URLs der Pastebins geliefert, wo die Hacker die sensiblen Daten hochluden, die sie aus seinen Rechenzentren gestohlen hatten. Wir ließen diese Daten außerdem an seine politischen Gegner durchsickern, sodass er mit der Zeit immer schlechter dastand und sich schließlich überzeugen ließ, uns eine Menge Dollar aus der Währungsreserve zu übergeben.
Daher wusste ich, wie seine Theorie über die Skinheads aussah: Für ihn steckte der Kreml dahinter. Er warf dem Kreml buchstäblich alles vor. Das war gar keine so schlechte Idee, denn Moskau mischte sich grundsätzlich gern in die inneren Angelegenheiten der früheren Satellitenstaaten ein. Ich hatte allerdings herausgefunden, welche privaten Konten seine leitenden Mitarbeiter benutzten, und mich dort ein wenig umgesehen. Meiner Ansicht nach waren die Skinheads, ohne es selbst zu wissen, Kanonenfutter bei den internen Machtkämpfen, in die sich alle Borisse so gern verbissen. Natürlich bedeutete das andererseits nicht automatisch, dass der Kreml saubere Hände hatte. Vielleicht unterstützten sie sogar einen von Litvinchuks Stellvertretern und hofften, sie könnten das Land destabilisieren und ihren gewieften Gegenspieler durch ein dümmeres und gefügigeres Exemplar ersetzen.
»Was sollen wir dagegen tun?«
Kriztina und ihre Zellenmitglieder wechselten Blicke und murmelten etwas auf Boris, das ich nicht verstand. Daraus entwickelte sich ein Streit, der mit zunehmender Intensität leiser – und nicht lauter – wurde, bis nur noch ein Zischeln und Tuscheln zu hören war, das mindestens genauso auffällig war wie wütendes Geschrei. Sie hatten Glück, dass die anderen Gäste im Danube Bar Resto keine Spitzel waren (in dieser Hinsicht war ich jedenfalls ziemlich sicher).
»Pawel sagt, wir sollten uns ganz zurückziehen, sobald sie auftauchen. Oksana meint, wir sollen zur anderen Seite des Platzes laufen und uns erst verdrücken, wenn sie uns dorthin folgen.«
»Was denkst du?«
Kriztina schnitt eine Grimasse. »Ich fürchte, sie wollen heute Abend hart zuschlagen. Vielleicht ist das ihr großer Tag. Das ist übel. Wenn wir im Hintergrund sichtbar sind, während sie über die Barrikaden klettern …«
Ich nickte. »Ihr wollt nicht, dass euch die ganze Welt mit ein paar Schlägertypen in Verbindung bringt, die sich mit den Cops prügeln.«
»Genau. Außerdem wollen wir uns nicht einfach so von den Cops die Schädel einschlagen lassen, nur weil sie allen zeigen wollen, dass wir nicht auf ihrer Seite stehen.«
»Das leuchtet mir ein.«
Oksana schüttelte den Kopf. »Wir müssen uns schützen. Wir brauchen Helme und Masken.«
»Masken halten keine Kugeln ab«, wandte Pawel ein.
»Das ist richtig, das können sie nicht. Wenn die Cops auf uns schießen, müssen wir in Deckung gehen oder weglaufen. Daran können wir nichts ändern.«
Er schien verstimmt.
Die Spannung war fast körperlich spürbar. Kriztinas hübsches Gesicht war traurig. Ihre kleine Zelle war eine Gruppe von guten Freunden gewesen, ehe sie zu »gefährlichen Radikalen« geworden war. Dieses Problem hatte ich nicht, weil ich keine Freunde hatte.
»Es ist wahr, dass du Kugeln nicht überlebst, und es ist wahr, dass die Holzköpfe versuchen werden, irgendetwas Schreckliches zu provozieren, wenn sie können. Genauso wahr ist, dass die Cops auf der anderen Seite sich vor Angst in die Hosen machen und seit einem Monat kein Geld mehr bekommen haben. Es gibt Faktoren, die man kontrollieren kann, und andere, bei denen das nicht möglich ist. Der Wunsch, es möge anders sein, verändert nicht die Realität. Es ist in Ordnung, wenn man sagt, heute lieber nicht, um es später noch einmal zu versuchen. Vielleicht schalten sich die Cops und die Nazis gegenseitig aus.«
Alle schüttelten die Köpfe und begannen gleichzeitig zu reden. Die Veganer in der Nähe konnten den Aufruhr nicht mehr übersehen. Kriztina errötete und wedelte mit den Händen wie eine Dirigentin, bis ihre Freunde sich beruhigten. Die glotzenden Veganer taten so, als glotzten sie nicht mehr.
»Vielleicht können wir sie auf unsere Seite ziehen«, überlegte Kriztina leise. Die anderen stöhnten. Dies war Kriztinas liebste Fantasie. Keiner von uns hatte 1991 schon gelebt, als in Moskau die Panzer angerollt kamen und Jelzins zerlumpte Radikalentruppe niedermachen wollten, aber natürlich kannten sie alle die Geschichte von den jungen, idealistischen Unterstützern, die mit den Soldaten über ihr gerechtfertigtes Anliegen gesprochen hatten, worauf sich die Panzerfahrer geweigert hatten, die Revolutionäre platt zu walzen. Dann hatte es Borschtsch und Wodka für alle Borisse gegeben, und der große Boris, Boris Jelzin, hatte die UdSSR zu einem friedlichen Wandel geführt.
Pawel löste die Spannung auf. »Dann fang mal an.« Wir lachten alle.
Ich wusste schon, was ich als Nächstes sagen wollte. »Es war mir eine Ehre, euch zu dienen. Morgen trinken wir zusammen, hier oder in Walhalla.« Die falsche Sagenwelt, aber es gibt keinen lebenden Boris, der einem anständigen Wikingersegen widerstehen könnte.
Wir bezahlten, ich kippte den Weizengras-Margarita, und als wir das DanubeBar Resto verließen, hakte sich Oksana bei mir ein. Kriztina nahm mir geschickt den Beutel mit den Dönertaschen ab und verteilte sie. Wir aßen im Gehen. An einer roten Ampel zückte ich das Handy, sah kurz meine Social-Media-Feeds durch und warf einen Blick auf Marcus und sein Mädchen, die mit strahlendem Lächeln auf ein Tandem-Liegerad stiegen, um in die Flitterwochen zu fahren. Sie sahen so reizend und verliebt aus, dass ich beinahe meinen Döner weggeworfen hätte.
Kriztina bemerkte etwas in meiner Miene und berührte meine Hand. Sie schenkte mir ein hübsches, jugendliches, schwesterliches Lächeln, das ich erwiderte. Ich hatte mal Freundinnen gehabt, die zur Stelle waren, wenn ein dummer Junge etwas Dummes getan hatte. Sie waren nicht mehr da, aber Kriztina gab mir manchmal das Gefühl, es wäre beinahe so wie früher.
Als wir uns dem Hauptplatz näherten, begegneten wir anderen Gruppen, die in die gleiche Richtung unterwegs waren. Vor einem Monat waren die abendlichen Demonstrationen ausschließlich die Domäne hartgesottener Straßenkämpfer gewesen, die Unisex-Masken getragen hatten wie der schwarze Block oder Pussy Riot. Doch nach allzu vielen derben Schlägen auf allzu zahlreiche Köpfe, was vorübergehend sogar Menschen außerhalb dieser Ecke der Welt aufgefallen war, hatte sich die Polizei zurückgezogen, und man sah inzwischen viele Babuschkas und Familien mit Kindern. Es gab sogar Themenabende wie die offene Party, zu der jeder einen Teller mitbrachte und das Essen mit den anderen Demonstranten und einigen Cops und Soldaten teilte.
Dann aber prügelten die Neonazis auf die Polizisten ein, die daraufhin kein Essen mehr von Leuten wie uns annahmen. Jetzt waren die nächtlichen Scharmützel an der Tagesordnung, und die Familien blieben überwiegend daheim. Doch dies war eine relativ milde Nacht – warm genug, um wenigstens ein paar Hundert Meter weit ohne Handschuhe umherzulaufen –, und es waren mehr Kinder unterwegs als in der ganzen letzten Woche. Die etwas Größeren hüpften neben ihren Eltern einher, die Kleinen wurden auf Armen getragen, dösten oder sahen Videos auf ihren Handys. Natürlich wurden die IDs aller Geräte von den falschen Basisstationen ausgelesen, die mühelos die unzulängliche Abwehr der Telefone durchbrachen.
Auf dem Platz summte es vor guter Energie. Eine Reihe Großmütter hatte Töpfe und Holzlöffel mitgebracht, hämmerte auf das Metall ein und sang etwas auf Boris, das alle verstehen konnten. Kriztina versuchte zu übersetzen, doch es war mit irgendeiner Baba-Jaga-Geschichte vermengt, die jeder Slovstake schon mit dem Borschtsch-Rezept der Mutter aufgenommen hatte.
Wir blieben an einer Feuertonne stehen und verteilten die letzten Döner an die Leute, die dort herumstanden. Ein Mädchen, das ich schon einmal gesehen hatte, löste sich aus der Menge und entführte Kriztina, um sich leise mit ihr zu unterhalten. Ich konnte das Gespräch verfolgen, weil ich aus dem Augenwinkel die Körpersprache beobachtete. Es schien mir, als hätten einige Gruppen Spione in die Neonazi-Szene eingeschleust, und nach Kriztinas Reaktionen zu urteilen, gab es sehr schlechte Neuigkeiten.
»Was ist los?«, fragte ich. Sie schüttelte den Kopf. »Sag schon, was ist denn?«
»Zweiundzwanzig Uhr«, erklärte sie. »Dann wollen sie angreifen. Angeblich laufen ein paar Cops zu ihnen über. Anscheinend ist sogar Geld geflossen.«
Das war eines der Probleme, die man sich einhandelte, wenn man die Gehälter der Polizisten halbierte: Möglicherweise fand sich jemand, der die andere Hälfte bezahlte. Die slovstakische Polizei hatte einen sicheren Instinkt dafür entwickelt, bei Säuberungen und Regimewechseln immer einen Schritt voraus zu sein. Wer diesen Instinkt nicht besaß, landete in den eigenen Zellen oder starb durch die Hände der Kollegen.
»Wie viele?«
Borisse sind erstklassige Achselzucker, was sogar für bezaubernde Kobolde wie Kriztina galt. Im Englischen mag es zweihundert Wörter für »passiv-aggressiv« geben, und die Inuit kennen zweihundert Begriffe für »Schnee«, doch die Borisse können zweihundert Abstufungen von Emotionen mit den Schultern zeigen. Ich las die Geste als: »Ein paar, genug, zu viele – wir sind im Arsch.«
»Keine Märtyrer, Kriztina. Wenn es so schlimm ist, kommen wir an einem anderen Abend wieder her.«
»Wenn es so schlimm ist, gibt es vielleicht keinen anderen Abend mehr.«
Das nennt man Fatalismus.
»Schön«, entschied ich. »Dann müssen wir eben etwas unternehmen.«
»Was denn?«
»Zeig mir eine Stelle, wo ich mich hinsetzen kann, und halte alle anderen eine Stunde lang von mir fern.«
Die Barrikaden rings um den Platz waren schon vor langer Zeit von den Demonstranten mit Planen zu Schutzzelten umgewidmet worden, in die sie sich zurückziehen konnten, wenn sie eine Pause brauchten. Kriztina kehrte nach ein paar Minuten zurück und führte mich in eine leere Ecke des Verhaus. Es roch nach Körpern und Kohlfürzen, aber ich war im Windschatten und einigermaßen abgeschirmt. Ich schob mir die Schöße meines langen Mantels zur Isolierung unter den Hintern, ließ mich im Schneidersitz nieder und verband meinen Laptop. Ein paar Minuten später sah ich mir Litvinchuks E-Mail-Konto an. Ich hatte auf seinem Computer eine Remote-Desktop-App installiert und hätte seine eigene Webmail-Schnittstelle benutzen können, aber es ging schneller, wenn ich mich direkt in den Mailserver einklinkte. Glücklicherweise hatte eines seiner ersten Dekrete nach der Übernahme des Ministeriums verfügt, dass sie alle G-Mail verlassen mussten – dieser Dienst wurde rund um die Uhr von Ninja-Hackern bewacht, die mich zum Frühstück verspeist hätten – und einen Mailserver in genau dem Rechenzentrum benutzen sollten, in dem ich sechzehn Stunden verbracht hatte. Der Laden war mit Wunschdenken, Kaugummi und Spucke abgesichert. Das bedeutete, dass die US-Regierung, falls sie die slovstakische Regierung kompromittieren wollte, einen trivialen Hack gegen diesen Rechner ausführen musste, statt sich mit Googles notorisch bösartigen Anwälten herumzuschlagen.
Die wichtigste Devise der Boris-Politik lautete: »Traue niemandem.« Was bedeutete, dass sie alles selbst tun mussten.
Litvinchuks falsche Basisstationen schickten die Daten in ein großes Analysesystem, das soziale Netzwerke grafisch aufbereitet in Dossiers ablegte. Er hatte verlangt, dass die Befehlshaber der Polizei und des Heeres die IDs aller Untergebenen einreichten, damit diese im System auf eine Whitelist gesetzt werden konnten – es war ja nicht sinnvoll, bei jedem Tumult alle Cops unter Generalverdacht zu stellen, nur weil sie von Berufs wegen dort anwesend waren. Die Datei befand sich in seinen gespeicherten E-Mails.
Ich wechselte zu einer anderen Schnittstelle und baute eine gesicherte Verbindung zu der Xoth-App auf. Sie verarbeitete die Datei und spuckte alle SMS aus, die zwischen den Cops hin und her gegangen waren, seit sie sich aktiviert hatte. Dann rief ich Kriztina zu mir. Sie hockte sich neben mich und reichte mir eine Thermoskanne mit Kaffee, die sie irgendwo organisiert hatte. Der Kaffee schmeckte scheußlich und erinnerte mich an Marcus. Marcus und sein kostbarer Kaffee – bei einem echten Aufstand von Radikalen hätte er sich keine zehn Stunden gehalten, weil er beim Straßenkampf keine Gelegenheit gefunden hätte, einen Handröster für die Bohnen zu finden.
»Kriztina, hilf mir mal, die Nachrichten herauszusuchen, die sich darum drehen, die Nazis durch die Linien zu lassen.«
Sie betrachtete meinen Bildschirm, auf dem die SMS der Polizisten abspulten.
»Was ist das denn?«
»Es ist das, wonach es aussieht. Alle Nachrichten, die die Cops in den letzten etwa zehn Stunden empfangen oder gesendet haben. Ich kann sie aber nicht lesen, dazu brauche ich deine Hilfe.«
Sie staunte, ganz Wangenknochen, Rehaugen und sinnliche Lippen. Dann fuhr sie mit der Maus auf und ab und las die Textnachrichten. »Oh, verdammt«, sagte sie auf Slovstakisch. Das war einer der wenigen Ausdrücke, die ich kannte. Dann, das muss ich ihr zugutehalten, überwand sie den Schreck und nahm sich die Nachrichten vor. »Wie kann ich suchen?«
Kriztina war keine Hackerin, aber ich hatte sie bei einem früheren Projekt ein wenig in die Kunst der regulären Ausdrücke eingeweiht. Sie sind die Geheimwaffe der Hacker: kompakte Suchbegriffe, die riesige Dateien nach unglaublich spezifischen Mustern durchwühlen können. Sofern man keinen Mist baut, was die meisten Leute aber tun.
Sie versuchte es mit einigen Suchläufen. »Was wollen wir überhaupt finden? Namen? Passwörter?«
»Etwas Krasses, damit das Innenministerium auf der Stelle ausflippt. Wir werden ihnen ein paar davon schicken.«
Sie hielt inne und starrte mich wimpernvoll an. »Ist das ein Witz?«
»Es wird nicht so aussehen, als wäre es von uns gekommen. Es wird aussehen, als sei die Quelle innerhalb des Ministeriums.«
Sie starrte weiter, hinter den Augen sah ich die Hamsterräder rotieren. »Masha, wie machst du das?«
»Wir haben einen Deal. Ich helfe dir, und du stellst mir keine Fragen.« Nach unserer ersten gemeinsamen Nacht auf den Barrikaden hatte ich diese Abmachung mit ihr getroffen und ihr gezeigt, wie sie Paranoid Android auf ihr Handy ziehen konnte. Wir hatten beobachtet, wie die Stingrays vergeblich einzudringen versuchten, während sie auf dem Platz hin und her lief. Sie ahnte, dass ich für eine amerikanische Sicherheitsfirma arbeitete, und hatte meine Verbindung zu »M1k3y«, den sie (natürlich) anbetete, auf Google abgefragt. Ich hatte die Nachrichten gelesen, die sie an den Chatkanal ihrer Zelle geschickt hatte, um mich als vertrauenswürdige Kollegin ihres Amerikanski-Helden zu empfehlen. Zwei andere hatten klugerweise (und beinahe zutreffend) angenommen, ich sei ein Polizeispitzel. Womöglich bereute sie inzwischen, nicht auf ihre Freunde gehört zu haben.
Ich wartete. Zuerst zu reden, bedeutete, die Initiative aus der Hand zu geben und schwach zu wirken.
»Wenn wir dir nicht mehr vertrauen können, sind wir schon so gut wie tot«, sagte sie schließlich.
»Das ist wahr. Glücklicherweise könnt ihr mir vertrauen. Such weiter.«
Wir gingen einige Abfragen durch, und ich zeigte ihr, wie sie die Wildcards einsetzen konnte, um die Suche zu erweitern, ohne wahllos die ganze riesige Zahl von Kurznachrichten zu erfassen. Es wäre schneller gegangen, wenn ich die slovstakische Sprache hätte lesen können, aber in dieser Hinsicht musste ich mich auf Kriztina verlassen.
Als wir eine gute repräsentative Auswahl hatten – ungefähr hundert Textnachrichten, also genug, um überzeugend zu sein, aber nicht so viele, dass Litvinchuk sie nicht mehr verdauen konnte –, schickte ich ihm eine E-Mail in englischer Sprache. Das war nicht so eigenartig, wie es scheinen mochte: Er hatte in ganz Europa führende Mitarbeiter und außerdem zwei südafrikanische Söldner rekrutiert, die zur Verständigung untereinander eine Art Pidgin-Englisch benutzten, in das sie großzügig Ergebnisse von Google Translate einfügten. Wegen der überragend wichtigen Operationssicherheit, alles klar?
Gebrochenes Englisch zu imitieren, war viel einfacher, als einen Muttersprachler zu spielen. Trotzdem, ich wollte nichts dem Zufall überlassen, schnappte mir zweitausend E-Mails von einem mittleren Bürokraten, den ich verkörpern wollte, und schob sie in eine Cloud, wo ich einen Fork von Anonymouth vorhielt. Eigentlich war es ein Plagiatscanner, der die Stilometrie benutzte, um die Grammatik, die Syntax und das Vokabular anhand von Trainingsdateien so aufzubereiten, dass man neue Texte daraufhin prüfen konnte, ob sie von demselben Autor stammten. Ich hatte meine Anonymouth-Software mit mehreren Tausend Profilen von Journalisten und Bloggern und sogar mit allen meinen Vorgesetzten gefüttert. Das war manchmal praktisch, wenn ich herausfinden wollte, ob jemand einen Ghostwriter einsetzte oder etwas an einen Untergebenen delegiert hatte. Vor allem benutzte ich das System, wenn ich selbst jemand anders verkörpern wollte.
Ich bin sicher, dass auch andere Leute schon darüber nachgedacht haben, die Stilometrie für fein abgestimmte Fälschungen zu benutzen, aber ich finde niemanden, der etwas dazu gesagt hat. Ich brauchte nicht lange, um Anonymouth so weit zu modifizieren, dass ich eine nach Wichtigkeit sortierte Liste mit Vorschlägen bekam, um meine eigene Fälschung für Anonymouth weniger gut erkennbar zu gestalten – hier einen Satz kürzen, dort ein Synonym benutzen, zwei Kommata einfügen. Nach ein paar Durchläufen konnten meine Fälschungen mühelos Menschen und Roboter hereinlegen.
Ich dachte an einen ganz bestimmten Whistleblower – einen der Südafrikaner, er hieß Nicholas van Dijk. Ich hatte ihn in mehreren Flamewars mit slovstakischen Kollegen in Aktion erlebt. Aufgrund dieser Spannungen kam er als glaubwürdiger Verräter infrage. Ich verstärkte das noch, indem ich ihm eine kaum verschleierte Verärgerung darüber unterschob, dass seine Feinde für ihren Verrat angeblich viel zu viel Geld einstrichen und dass er doch wenigstens einen kleinen Finderlohn beanspruchen könne, weil er so ein aufrichtiger Kerl sei. Plausibilität. Litvinchuk würde an die Decke gehen, wenn ihm bewusst wurde, dass sein Korps mit Verrätern durchsetzt war, aber selbst er würde es für verdächtig halten, wenn ein Betonkopf wie van Dijk seine Teammitglieder anschmierte, ohne zu versuchen, für sich selbst etwas herauszuschlagen.
Noch zwei Läufe durch Anonymouth, und ich hatte einen Mustertext und eine URL für ein Pastebin, wo ich alle SMS hochladen würde. Im Innenministerium benutzte kein Mensch PGP für E-Mails, weil das sowieso kein normaler Mensch tat, und daher war es sehr leicht, in Litvinchuks Eingangsordner eine Mail zu legen, die nicht von einer echten zu unterscheiden war. Ich fälschte sogar die Header aus dem gleichen Grund, aus dem ein Puppenhausbauer winzige Titel auf die Buchrücken im Wohnzimmer malt – obwohl sie niemals jemand sehen wird, verlangt es der berufliche Stolz, auch im Detail ordentlich zu arbeiten.
Außerdem hatte ich ein Skript, das dies alles für mich erledigte.
»Und jetzt?« Kriztina schien betörend besorgt, als könnte ich gleich die Reißzähne ausklappen und ihr an die Kehle gehen.
»Jetzt lassen wir Litvinchuk eine Viertelstunde Zeit, um nach seiner E-Mail zu sehen. Wenn er sie bis dahin noch nicht gelesen hat, schicken wir ihm von van Dijks Handy eine SMS. Ah, da fällt mir etwas ein.« Alt-Tab, Alt-Tab und die Nummer einfügen. Drei Klicks und ich hatte van Dijks Handy vom Netzwerk getrennt und dafür gesorgt, dass Litvinchuk ihn nicht erreichen konnte.
Inzwischen war es ziemlich dunkel und sehr kalt. Ohne Handschuhe brannten mir die Finger. Da ich vorerst mit Tippen fertig war, zog ich die Handschuhe an und schaltete die eingebauten Wärmer ein. Ich hatte sie den ganzen Tag lang geladen, und sie sollten eine Nacht auf den Barrikaden halten. Kriztinas Handschuhe hatten von den Zigaretten Brandmale an den Fingern, durch die sicherlich die Kälte eindrang. Eine miese Angewohnheit. Es geschah ihr ganz recht.
Auf dem Platz war inzwischen einiges los. Feuertonnen brannten, im flackernden Licht und im letzten Lila des Sonnenuntergangs sah ich viele dünne, selbst gebaute Rüstungen.
»Ihr kriegt jetzt wirklich Schwierigkeiten.«
»Warum?«
Ich zeigte auf einen jungen Mann, der Anstreichermasken verteilte. »Die Masken nützen nichts gegen Tränengas oder Pfefferspray.«
»Ich weiß.« Fatalismus konnte sie wirklich gut.
»Und?«
Sie zuckte auf Boris mit den Achseln. »Es gibt ihnen das Gefühl, sie könnten etwas tun.«
»Das Gefühl reicht nicht«, entgegnete ich. »Vielleicht hat es früher mal gereicht, in der Zeit von Václav Havel oder so. Damals gab es diese angebrüteten Borisse, die ihre Geheimpolizei mit Wodka und Säuberungen am Laufen hielten und sich auf ihr eigenes Ingenieurstalent verließen, um Abhörgeräte zu bauen, die so groß waren wie Kühlschränke und stündlich repariert werden mussten oder einen Ölwechsel brauchten. Heute können Geheimdienstler wie Litvinchuk alle zwei Jahre nach DC zur Schnüfflermesse fliegen, wo die finanzkräftigsten Überwachungsfirmen der Welt ihre Waren zum Verkauf feilbieten. Natürlich, sie haben alle Backdoors der Russen, der Chinesen oder der Amerikaner, aber sie sind immer noch eine Million mal besser als alles, was Slovstakien selbst herstellen kann, und sie pellen dir und deinen Freunden die Schutzmaßnahmen ab wie eine Apfelsinenschale.
Damit meine ich nicht nur die Überwachung. Du solltest dir mal die Broschüren der Firmen ansehen, die nicht tödliche Waffen herstellen. Schmerzstrahlen, die dir das Gesicht schmelzen lassen, aerostatisches Pfefferspray und Nervengas, Schallsender, damit du dir in die Hosen scheißt …«
»Ich weiß, ich weiß. Das erzählst du mir jedes Mal. Was soll ich denn machen? Ich versuche, klug vorzugehen und meinen Freunden zu helfen, damit sie möglichst vorsichtig sind, aber was können wir schon tun, wenn all diese Leute …«
Mir wurde heiß, als ich das hörte. »Die Tatsache, dass du noch keine Lösung hast, bedeutet nicht, dass du nicht weiter danach suchen sollst, und es heißt auch nicht, dass man keinesfalls eine finden kann. Du und deine sieben Freunde, ihr werdet allein nicht viel verändern. Ihr braucht die anderen, aber ihr wisst etwas, das sie nicht wissen. Solange sie es nicht ebenfalls wissen, werden sie weiter eingeseift.« Meine Hände zitterten so sehr, dass ich sie in die Manteltaschen schob. Ich schüttelte den Kopf, um die Schreie zu vertreiben, die in meinen Ohren gellten. Schreie von einem anderen Ort und aus einer anderen Zeit. »Du musst es besser machen, weil es ernst ist. Wenn du es nicht besser machst, wirst du sterben. Verstehst du das? Du kannst vor den Witzfiguren weglaufen und dich mit Paranoid Android und Faraday-Beuteln verstecken, aber du wirst Fehler machen, und die Computer, die deine Feinde betreiben, werden die Fehler entdecken, und wenn das geschieht …«
Mir kam der Döner wieder hoch, ich konnte nichts mehr sagen, ohne zu würgen, oder vielleicht war es auch ein Schluchzen. Ich wusste nicht einmal, was schlimmer gewesen wäre. Ich bin nicht dumm: Ich redete eher mit mir selbst als mit ihr. Man macht sich selbst kaputt, wenn man hauptberuflich repressiven Regimes dabei hilft, die Dissidenten auszuspionieren, und als Hobby den Dissidenten hilft, der Entdeckung zu entgehen.
So viel weiß ich.
Aber wer kann schon von sich behaupten, er sei frei von Widersprüchen? Sagen Sie mir nicht, dass Sie nicht manchmal dissoziativ sind und Dinge tun, von denen Sie wissen, dass Sie es später bereuen werden. Etwas, von dem Sie wissen, dass es falsch ist, aber Sie tun es trotzdem und sehen sich selbst dabei zu.
Ich lebe nur eine dramatischere Version davon, das ist alles.
Anscheinend spürte Kriztina, was mich bewegte, und das gefiel mir überhaupt nicht. Was sich in meinem Herzen oder meinem Kopf abspielte, ging sie nichts an.
Doch sie nahm mich einfach fest in die Arme. Auch das ist eine Spezialität der Borisse. Ich zog schniefend den Rotz hoch, drückte die Tränen weg und erwiderte die Umarmung. Unter all den Kleidungsschichten war ihr Körper winzig.
»Schon gut«, sagte sie. »Wir wissen ja, dass du nur um unsere Sicherheit besorgt bist. Wir geben unser Bestes.«
Euer Bestes wird nicht reichen. Ich sprach es nicht aus, sondern fasste sie an der Hand. »Lass uns ein Stück gehen.«
Die Menge der Demonstranten war angeschwollen, es war sogar ein richtiges Gedränge worden, und einige sangen abwechselnd Folksongs, erst die tiefen und dann die hohen süßen Stimmen.
Kriztina sang halblaut mit. Das Lied wehte über den Platz und veränderte die Rhythmen der Nacht, die Leute trampelten im Takt, hoben die Köpfe und blickten zu den Reihen der Polizisten. Einige Cops nickten ebenfalls im Takt. Ich fragte mich, ob das die gleichen Leute waren, die eingewilligt hatten, die Neonazis durch ihre Reihen zu lassen und das Parlament zu zerstören.
»Was singt ihr da?«
Kriztina wandte sich mit warmen Augen an mich. »Der größte Teil ist Unsinn, du weißt schon, ›Slovstakien, unsere Mutter, dein Busen nährt uns‹, aber die schönen Teile sind wirklich gut: ›Wir alle zusammen, so verschieden wir sind, wir wollen immer füreinander eintreten und Verständnis zeigen, wir sind unbesiegbar, solange wir nicht vergessen, wer wir sind, und unsere Brüder angreifen …‹«
»Das kann doch nicht sein.«
»Doch. Der Text stammt von einem Dichter des siebzehnten Jahrhunderts, der ihn nach einem schrecklichen Bürgerkrieg schrieb. Ich habe ihn in der Übersetzung für dich ein wenig modernisiert, aber …« Sie zuckte mit den Achseln. »Diese Art von internen Kämpfen sind unser altes Problem. Es gibt immer jemanden, der sich ein kleines Reich aufbauen will, der zehn Autos und fünf Villen besitzen will, während sich die anderen unten auf dem Platz streiten und Blut vergießen. Aber nach allem, was du sagst, werden wir dieses Mal sowieso verlieren, ganz egal, wie viel Blut vergossen wird.«
Ich betrachtete die Polizeiketten und die umherwuselnde Menschenmenge. Es war jetzt völlig dunkel, große Rauchwolken wehten über den Platz. Sie quollen aus den Feuertonnen und wurden von den riesigen LED-Batterien angestrahlt, die hinter den Cops aufgestellt waren. So blieben die Polizisten bloße Schatten, während die Demonstranten im vollen, fototauglichen Licht standen. An den Masten der Leuchten schimmerten die Linsen der Überwachungskameras. Die Polizeiwagen, die rings um den Platz abgestellt waren, trugen ganze Wälder eigenartiger Antennen, fingen die unsichtbare Kommunikation in der Nähe ab und durchsuchten gedankenschnell Handys nach virtuellen Identitätsdokumenten.
»Ihr seid ziemlich im Arsch«, erklärte ich.
Kriztina grinste. »Du sprichst wie eine Slovstakin.«