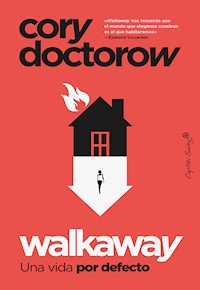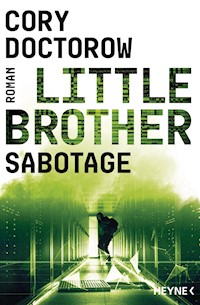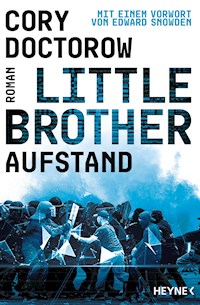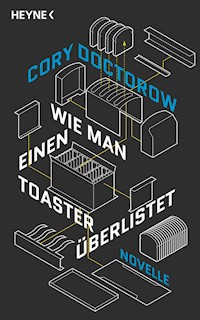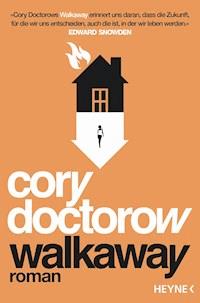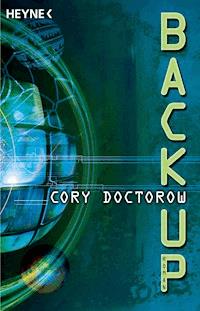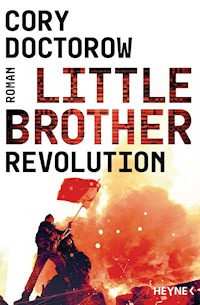
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Little Brother
- Sprache: Deutsch
Vor einigen Jahren hat sich Marcus Yallow mit Homeland Security angelegt – und gewonnen. Nun ist er Webmaster für einen aufstrebenden Politiker, der dem von Wirtschaftskrisen gebeutelten Kalifornien Reformen verspricht und gegen die staatliche Überwachung vorgehen will. Doch dann bekommt Marcus von Masha, seiner früheren Gegenspielerin, einen USB-Stick mit brandheißen und streng vertraulichen Daten zugesteckt, die er veröffentlichen soll. Er zögert, denn wenn er sich dazu bekennt, kostet ihn das seinen Job. Wenn er aber nicht mitspielt, machen die Behörden munter weiter. Was soll er tun? Und dann sind da auch noch die verdächtigen Gestalten, die Marcus immer enger beschatten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
CORY DOCTOROW
LITTLE BROTHER
HOMELAND
Roman
Mit Nachworten von
Jacob Appelbaum und Aaron Swartz
Aus dem Amerikanischen von
Oliver Plaschka
Die Originalausgabe ist unter dem Titel
Homeland
bei Tor Teen/Tom Doherty Associates, LLC, New York, erschienen.
Copyright © 2013 by Cory Doctorow
Copyright © 2013 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Usch Kiausch
Umschlagillustration: Yuko Shimizu
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Satz und eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-11244-8
www.heyne-fliegt.de
Für Alice und Poesy,
die mich erst vollständig machen
1
Beim Burning Man war ich gleichzeitig einer der meistfotografierten und am wenigsten überwachten Menschen der Welt.
Ich zog meinen Burnus höher, sodass er Mund und Nase bedeckte, und steckte ihn unter den Rand meiner großen, verkratzten Schutzbrille. Die Sonne stand hoch am Himmel, es waren fast vierzig Grad, und durch das bestickte Baumwolltuch war die Hitze noch drückender. Doch der Wind hatte gerade aufgefrischt und wirbelte eine Menge Staub in der Playa auf – einer Salztonebene voll feinem Gipssand, trügerisch pulverig und weich, aber alkalisch genug, dass einem die Augen brannten und die Haut völlig austrocknete. Nach zwei Tagen in der Wüste hatte ich gelernt, dass Schwitzen immer noch besser war, als zu ersticken.
So ziemlich jeder auf dem Festival hatte irgendeine Kamera dabei – natürlich vor allem Smartphones, aber auch große Spiegelreflexapparate, altmodische Rollfilmkameras und sogar eine uralte Plattenkamera, deren Besitzer sich vor dem Staub unter ein riesiges schwarzes Tuch geflüchtet hatte. Allein beim Gedanken daran wurde mir heiß. Alles hier war staubgeschützt; am besten, man steckte seine Sachen einfach in einen Schnellverschlussbeutel, so wie ich das auch mit meinem Handy getan hatte. Langsam drehte ich mich um die eigene Achse, versuchte, ein Panoramabild aufzunehmen, und merkte, dass der Mann, der gerade hinter mir vorbeilief, eine Schnur hielt, die zu einem großen Heliumballon gut hundert Meter über ihm führte. Am Ballon hatte er eine Videokamera montiert. Außerdem war der Mann völlig nackt.
Na ja, nicht ganz – er trug schon noch Schuhe. Das war verständlich, denn der alkalische Staub hier konnte wirklich fies sein. Die Füße werden so trocken, dass die Haut ganz rissig wird und sogar abblättert. Alle hier waren sich einig, dass so was richtig scheiße war.
Burning Man ist ein Festival, das jedes Jahr im September, am Wochenende vor dem Labor Day mitten in der Black Rock Desert in Nevada stattfindet. Dann versammeln sich fünfzigtausend Menschen in dieser unglaublich heißen, staubigen Landschaft und bauen gemeinsam eine Stadt: Black Rock City. Jeder in der Stadt ist automatisch auch Teilnehmer. »Zuschauer« ist gleichbedeutend mit »Gaffer« und ein übles Schimpfwort in Black Rock City. Von jedem hier wird erwartet, dass er irgendwas macht und den anderen die verdiente Aufmerksamkeit schenkt (daher auch die vielen Kameras). Beim Burning Man ist jeder Teil der Show.
Ich war zwar nicht nackt, hatte mir heute früh aber mit farbigem Zinkstift ein paar aufwendige Mandalas auf die unbedeckten Stellen meiner Haut malen lassen. Die Künstlerin – eine ältere Frau in einem Batik-Brautkleid, die meine Mutter hätte sein können – hatte wirklich gute Arbeit geleistet. Das ist noch so was Typisches beim Burning Man: Alles läuft auf der Basis von Geschenken, sodass man ständig wildfremden Leuten kleine Gefallen anbietet und sich im Gegenzug wirklich wohl in der Stadt fühlt.
Ich erkannte mich selbst kaum wieder, nachdem die Malerin mit mir fertig war, und auf meinem Weg nach Neun Uhr waren haufenweise Handys auf mich gerichtet.
Black Rock City ist wie eine richtige Stadt: Es gibt sanitäre Einrichtungen (Toilettenhäuschen mit dreckigen Gedichten, die einen ermahnen, ja nichts außer Klopapier reinzuwerfen), Strom und Internet (auf Sechs Uhr, im Zentrum der ringförmigen Stadt), so was Ähnliches wie eine Regierung (die Veranstalter), mehrere kleine Zeitungen (von denen jede bessere Arbeit leistet als die großen Blätter da draußen!), ein Dutzend Radiosender, eine freiwillige Polizei (die Black Rock Rangers, die auf dem Gelände in Tutus, Glitzerfarbe und Hühnerkostümen patrouillieren) und zahllose Annehmlichkeiten der modernen Welt.
Es gibt aber keine allgemeine Überwachung: keine Sicherheitskameras, keine Straßensperren – abgesehen vom Einlass am Haupttor, wo die Eintrittskarten eingesammelt werden –, keine Ausweiskontrollen, keine Durchsuchungen, keine Kontrolle auf Schritt und Tritt durch RFID-Chips oder den eigenen Netzbetreiber. Allerdings gibt es dafür auch kein Handynetz. Die einzigen motorisierten Fahrzeuge sind die vorab registrierten Mutantenautos, die verrückten Art Cars, sodass auch die Überwachung via Nummernschild oder elektronischem Mautsystem wegfällt. Das WLAN ist unverschlüsselt, und der Datenverkehr wird nicht protokolliert. Die Fotos, die man macht, dürfen nur für private Zwecke verwendet werden, und es gilt einfach als höflich, die Leute vorher zu fragen, ehe man eine Nahaufnahme von ihnen macht.
So lief ich also im Schutz meines silberblauen Burnus, unter dem ein Schlauch zu der Wasserflasche an meinem Gürtel führte, durch die Staubwolken und war gleichermaßen Fotograf wie Motiv, beobachtet, doch nicht überwacht, und es fühlte sich herrlich an.
»Juhu!«, rief ich dem Staub zu, den Art Cars, den Nackten und der riesigen Holzfigur, die mitten in der Wüste mit ausgebreiteten Armen auf einer Pyramide stand. Das war er – der Mann, den wir am Samstagabend verbrennen würden, deshalb hieß das Festival ja auch Burning Man. Ich konnte es kaum noch erwarten.
»Bist ja gut drauf«, stellte da ein Jawa neben mir fest. Trotz des Verzerrers in der Atemmaske hätte ich die Stimme des kapuzentragenden Wüstenbewohners jederzeit erkannt.
»Ange?« Wir hatten uns den ganzen Tag über verpasst. Ich war eine Stunde vor ihr aufgewacht und hatte mich aus dem Zelt gestohlen, um den Sonnenaufgang anzusehen (ist eine unglaubliche Erfahrung). Seitdem hatten wir uns immerNachrichten hinterlassen, wo wir als Nächstes hingingen.
Den ganzen Sommer über hatte Ange an diesem Umhang gearbeitet: Tücher nahmen den Schweiß auf und leiteten ihn über die Haut, sodass er beim Verdunsten für zusätzliche Kühlung sorgte. Darüber lag der charakteristische, fleckig-braune Stoff, der ein wenig an eine Mönchskutte erinnerte, selbst geschneidert und gefärbt. Zwei einander überkreuzende Patronengurte betonten ihre Brüste, wodurch das ganze Outfit ganz schön kriegerisch und einfach umwerfend wirkte. Es war das erste Mal, dass sie es in der Öffentlichkeit trug, aber hier, im blendend hellen Staub, war sie ungelogen der überzeugendste Wüstenbewohner, der mir je untergekommen war. Wir umarmten uns, und sie drückte so fest, dass ich kaum noch Luft bekam – einer ihrer gefürchteten Knuddel-Griffe.
»Ich hab deine Farbe verschmiert«, stellte sie durch den Verzerrer fest.
»Und ich deinen Umhang.«
Sie zuckte die Achseln. »Ist doch egal! Wir sehen beide toll aus. Also, was hast du erlebt, was hast du gemacht, und wo bist du gewesen, junger Mann?«
»Wo soll ich da anfangen?« Ich war durch die strahlenförmig angelegten Straßen gewandert und hatte mir die ganzen skurrilen Sachen angesehen. In einem Camp stellten die Leute mit einer gefährlich wirkenden Mühle aus riesigen Eisblöcken Speiseeis her. In einem anderen gab es eine linoleumbeschichtete Rutsche, die man auf einem fliegenden Plastikteppich runterrodeln konnte. Ein paar Liter Abwasser reichten schon, um auf dem Linoleum ordentlich Tempo zu kriegen, und nebenbei wurde man so auch gleich sein graues Wasser los (so nannte man das Wasser, das man zum Duschen, Geschirrspülen oder Händewaschen benutzt hatte – schwarzes Wasser hieß es, wenn es Fäkalien enthielt). Eine der Regeln beim Burning Man lautet, keine Spuren zu hinterlassen – wenn wir wieder gingen, würden wir jedes noch so kleine Stück von Black Rock City mit uns nehmen, auch das graue Wasser. Jeder Tropfen Wasser, der auf der Rutsche verdunstete, war also ein Tropfen, den wir nicht den ganzen Weg bis Reno würden mitnehmen müssen.
Es gab etwas speziellere Camps, in denen Pärchen lernen konnten, wie man einander fesselt; ein »Junkfood-Glory-Hole«, durch das man geheimnisvolles und meist sehr ungesundes Essen in den Mund geschoben bekam (bei mir waren es völlig überzuckerte Cornflakes, dazu Marshmallows mit Kokosgeschmack, in der Form von Sternzeichen); woanders konnte man sich Wüstenräder leihen, die zwar völlig staubverkrustet waren, aber auch liebevoll mit Glitzerteilchen, Kunstfell, Glöckchen und komischen Fetischen verziert; in einem Teehaus hatte ich eine japanische Sorte probiert, von der ich noch nie was gehört hatte (der Tee war etwas säuerlich, aber wirklich köstlich); es gab Camps voll mit verrücktem Krimskrams, andere widmeten sich der Physik oder optischen Täuschungen; es gab Camps für Männer und Frauen und auch ein relativ unbeaufsichtigtes Kindercamp, wo mit viel Gerenne und Geschrei gerade irgendein großes Spiel ablief – so viele Dinge, die ich mir nie hätte träumen lassen.
Und dabei hatte ich erst einen kleinen Teil von Black Rock City kennengelernt.
Ich erzählte Ange, an was ich mich noch erinnern konnte, und sie nickte, sagte »ooh« und »aah« und wollte wissen, wo ich das alles gesehen hatte. Dann erzählte sie mir von ihrem Tag: von Frauen oben ohne, die einander die Brüste bemalten; von einer kompletten Blaskapelle; von einem mittelalterlichen Katapult, das uralte kaputte Klaviere verschoss, während die Zuschauer in Erwartung des finalen Klangs, mit dem jedes Klavier auf dem harten Wüstenboden zerschellte, den Atem anhielten.
»Es ist einfach unglaublich!« Sie sprang mehrmals aufgeregt hoch, sodass ihre Patronengurte klimperten.
»Ich weiß. Und wenn ich daran denke, dass wir’s fast nicht hierher geschafft hätten …«
Ich hatte immer schon auf dieses Festival gewollt – immerhin komme ich wie die meisten Teilnehmer aus San Francisco. Es hatte aber auch eine Menge Arbeit gekostet. Erst einmal reden wir hier von einem Camping-Trip mitten in die Wüste, für den man absolut alles einpacken muss, auch das Wasser. Dann muss man auch alles wieder mitnehmen – alles, was nicht auf dem Dixiklo bleibt, und es gab sehr strenge Regeln, was da reindurfte und was nicht. Dann war da die Geschenkökonomie: Ich musste mir also überlegen, was die Leute in der Wüste brauchen könnten. Dazu die Frage der Kostümierung, und was ich an coolen Kunstwerken oder Erfindungen beizusteuern hätte … Jedes Mal, wenn ich anfing, darüber nachzudenken, bekam ich fast einen Nervenzusammenbruch.
Doch ausgerechnet dieses Jahr hatte ich es geschafft, im selben Jahr, in dem meine Eltern ihre Jobs verloren. Es war das Jahr, in dem ich das Studium lieber abbrach, als mich dafür noch schlimmer zu verschulden. Das Jahr, in dem ich Klinken putzen ging, um Arbeit zu finden – ganz egalwas, Hauptsache bezahlt –, doch vergebens.
»Man sollte nie die Entschlossenheit junger Leute unterschätzen, die knapp bei Kasse und reich an Zeit sind«, sinnierte Ange. Dann nahm sie sich mit einer Hand die Maske ab und zog mich mit der anderen näher heran, um mich zu küssen.
»Du solltest T-Shirts drucken, mit Sprüchen wie dem.«
»Jetzt, wo du’s sagst, fällt mir was ein. Schau her!«
Sie öffnete ihren Umhang und enthüllte stolz ein rotes Shirt mit der Aufschrift MACHWASSCHÖNESUNDZÜNDEESAN. Das Layout war ähnlich wie bei den alten »KEEPCALMANDCARRYON«-Postern aus England, bloß mit dem Burning Man statt der Krone.
»Kommt gerade noch rechtzeitig«, sagte ich und hielt mir die Nase zu. Ich sagte es nur halb im Scherz – kurz vor knapp hatten wir die Hälfte unserer Klamotten wieder ausgepackt, um mehr Platz für Geheimprojekt X-1 in unseren Rucksäcken zu schaffen. Und da wir bei unserer täglichen Katzenwäsche der Schweißkruste, Farbe und Sonnencreme mit nicht viel mehr als feuchten Tüchern zu Leibe rückten, rochen wir beide nicht mehr besonders.
Sie zuckte nur die Achseln. »Die Wüste sorgt für uns alle.« Dieses Motto des Festivals hatten wir gleich am ersten Tag aufgeschnappt. Beide hatten wir uns darauf verlassen, dass der jeweils andere an die Sonnencreme gedacht hatte. Kurz bevor wir uns so richtig stritten, verschlug es uns ins Sonnencreme-Camp, dessen nette Bewohner uns von Kopf bis Fuß mit Lichtschutzfaktor 50 einschmierten und uns noch etwas Creme mit auf den Weg gaben. »Die Wüste sorgt für uns alle!«, sagten sie zum Abschied und wünschten uns alles Gute.
Als ich Ange den Arm um die Schultern legte, schnüffelte sie übertrieben an meiner Achsel und setzte daraufhin demonstrativ die Maske auf.
»Los«, sagte sie, »gehen wir zum Tempel.«
Der Tempel war ein zweistöckiges, ausladendes Gebäude, das mit hohen Türmen und Strebebögen gespickt war. Sein Inneres war voller tibetanischer Gongs, die maschinengesteuert den ganzen Tag lang ihre seltsamen, scheppernden Töne von sich gaben. Ich hatte den Tempel früh am Morgen von Weitem gesehen, als ich durch die Ebene spazierte und die Sonne den Staub in rostig-orangefarbenes Licht tauchte. Aber ich war bislang noch nicht drin gewesen.
Die äußeren Flügel waren nicht überdacht und bestanden aus demselben Bauholz wie der Rest des schnörkeligen Baus. An den Wänden gab es Bänke und zahlreiche Nischen und Winkel. Und alle Oberflächen waren komplett mit Postern, Bildern, Symbolen und Schrift überzogen.
Fast alles davon handelte von Toten.
»Oh Mann«, sagte Ange, als wir die Wände abliefen und all die hingemalten und festgetackerten Gedenksprüche lasen. Ich fand einen handgeschriebenen, dreißig Seiten langen Brief einer Frau an ihre toten Eltern, in dem sie schrieb, wie ihre Eltern sie verletzt und ihr Leben zerstört hatten und dank ihres verkorksenden Einflusses ihre Ehen eine nach der anderen zu Bruch gegangen waren. Der Brief schlug den Bogen von einer hitzigen Anklage über Verbitterung bis hin zu Trauer, eine einzige emotionale Achterbahnfahrt. Erst war es mir etwas unangenehm, fast peinlich, das zu lesen, weil das alles so persönliche Dinge waren – aber alles im Tempel war dazu da, gesehen zu werden.
Jede einzelne Fläche war dem Gedenken an jemanden oder etwas gewidmet. Es gab Babyschuhe und Fotos von Großeltern, ein Paar Krücken und einen zerknautschen Cowboyhut, dessen Band aus getrockneten Blumen bestand. Die Besucherschar, kostümiert und halb nackt wie ein Zirkus vom Ende der Welt, lief feierlich von einer Botschaft zur nächsten. Oft standen den Menschen beim Lesen Tränen in den Augen, und es dauerte nicht lange, da weinte auch ich. Es berührte mich auf eine Art und Weise, wie ich das noch nie erlebt hatte – vor allem eingedenk der Tatsache, dass wir das alles Sonntagnacht verbrennen würden, ehe wir Black Rock City demontierten und nach Hause zurückkehrten.
Ange hatte sich in den Staub gehockt und blätterte in einem Heft voller düsterer Zeichnungen. Ich ging weiter ins zentrale Atrium, einen hohen, offenen Raum, an dessen Wänden sich die Gongs reihten. Der Boden war voller Leute. Sie saßen herum oder lagen mit geschlossenen Augen da und nahmen die Feierlichkeit des Moments in sich auf, einige sehr ernst, manche mit stillem Lächeln, andere mit Tränen im Gesicht.
In der Schauspielgruppe an der Highschool hatten wir einmal zu meditieren versucht. Es hatte nicht sonderlich gut funktioniert. Ein paar der Kids hatten ständig gekichert, und irgendein Geschrei vor der Tür und das Ticken der Uhr hatten mich daran erinnert, dass es jeden Moment läuten und eine tobende Meute Schüler durch die engen Gänge zur nächsten Unterrichtsstunde stapfen würde. Dabei hatte ich häufig gelesen, wie gut Meditation einem angeblich tat. In der Theorie ist es auch leicht: Man muss sich bloß hinsetzen und an gar nichts denken.
Zeit, es auszuprobieren. Sobald ein Platz auf dem Boden frei wurde, zog ich meinen Mehrzweckgürtel zurecht, damit er mir nicht in den Hintern schnitt, und setzte mich hin. Über mir fielen Sonnenstrahlen durch die hohen Fenster, grau-goldene Lanzen, in denen glitzernder Staub tanzte. Ich vertiefte mich in den Anblick dieser schwebenden Körnchen, dann schloss ich die Augen. Ich stellte mir ein Gitter aus vier weißen Quadraten vor, jedes von dicken schwarzen Rändern umgeben. Dann löschte ich in meinen Gedanken eines der Quadrate aus. Dann noch eines. Und ein weiteres. Jetzt war nur noch ein einziges Quadrat übrig. Ich löschte auch dieses.
Nun war da gar nichts mehr. Ich dachte an nichts, im wortwörtlichen Sinn. Dann aber begann ich darüber nachzudenken, dass ich jetzt ja an gar nichts dachte, und gratulierte mir innerlich schon zu meiner Leistung, bis mir auffiel, dass das so nicht funktionierte. Also stellte ich mir wieder meine vier Quadrate vor und fing von vorn an.
Ich weiß nicht, wie lange ich da saß, ein paar Mal aber schien es mir, als würde sich die Welt von mir entfernen und mir zugleich näher sein als je zuvor. Ich lebte in genau diesem Augenblick, ohne an irgendetwas danach oder zuvor zu denken. Ich war einfach nur da. Dieser Zustand dauerte jedes Mal nur den Bruchteil einer Sekunde, aber trotzdem … Das hatte schon was.
Ich schlug wieder die Augen auf und atmete im langsamen, gleichmäßigen Takt der Gongschläge. Irgendetwas grub sich in meinen Hintern, vielleicht ein Teil meines Gürtels. Das Mädchen vor mir hatte sich eine komplizierte Formel zwischen die Schulterblätter brennen lassen, ein tiefes Relief mathematischer Symbole und Zahlen aus verbrannter Haut. Irgendwer rauchte Gras. Jemand anderes schluchzte leise. Vor dem Tempel rief jemand etwas. Jemand lachte. Die Zeit kroch so träge wie Sirup dahin, kam mir fast klebrig vor. Nichts schien mehr von Bedeutung, und alles war einfach nur wundervoll. Das war’s wohl, was ich mein Leben lang gesucht hatte, ohne es zu wissen. Ich lächelte still vor mich hin.
»Hallo, M1k3y«, zischte eine Stimme neben mir, ganz leise und so nahe an meinem Ohr, dass die Lippen mein Ohrläppchen kitzelten. Auch die Stimme selbst war wie ein Kitzeln und rührte etwas in meiner Erinnerung auf. Ich kannte diese Stimme – auch wenn ich sie sehr lange nicht mehr gehört hatte.
Ich drehte den Kopf, ganz langsam, als wäre ich eine Giraffe mit einem baumlangen Hals.
»Hallo Masha«, sagte ich ruhig. »Ausgerechnet hier treffen wir uns also wieder.«
Sie griff nach meiner Hand, und mir fiel ein, wie sie mir bei unserer letzten Begegnung das Gelenk mit einem Kampfsportgriff verdreht hatte. Ich glaubte aber nicht, dass sie es schaffen würde, mir einfach den Arm auf den Rücken zu drehen und mich still und heimlich hier rauszuschaffen. Wenn ich um Hilfe schrie, würden all diese Menschen … Na ja, sie würden Masha wohl nicht gerade in Stücke reißen, aber irgendwas würden sie schon machen. Entführungen verstießen eindeutig gegen die Regeln beim Burning Man. Ich war mir sogar ziemlich sicher, dass es eine der wichtigsten war.
Doch Masha zog mich einfach nur an der Hand. »Na los«, sagte sie. »Komm schon.«
Ich stand auf und folgte ihr aus freien Stücken, und obwohl ich vor lauter Angst zitterte, war es irgendwie auch aufregend. Wahrscheinlich, weil es hier, beim Burning Man, geschah.
Vor ein paar Jahren noch hatte ich mehr Aufregung gehabt, als mir lieb gewesen war. Ich hatte einen virtuellen Guerillakrieg gegen das Department of Homeland Security angeführt, ein Mädchen kennengelernt und mich verliebt, war verhaftet und gefoltert worden, hatte eine gewisse Berühmtheit erlangt und die Regierung verklagt. Seitdem war es irgendwie bergab gegangen. Das Waterboarding war schrecklich, unvorstellbar schlimm gewesen – ich hatte immer noch Albträume vom Ertrinken –, aber das war nun mal passiert und vorbei. Dann kamen der langsame Bankrott meiner Eltern, der harte Alltag einer Stadt, in der es keine Jobs gab, schon gar nicht für einen halbqualifizierten Studienabbrecher wie mich, und der Kredit, den ich monatlich zurückzahlen musste, ob ich wollte oder nicht. Das war das Elend, mit dem ich jeden Tag zu kämpfen hatte. Und es sah nicht so aus, als ob sich daran irgendwas ändern würde. Nicht gerade die Art von dramatischem Konflikt, aus dem Heldengeschichten entstehen. Es war einfach nur, na ja, die Realität. Und die Realität war einfach nur scheiße.
Also ging ich mit, denn Masha hatte fast zwei Jahre mit Zeb im Untergrund zugebracht, und bei allem Schlechten, was man über sie sagen mochte, hatte sie auf jeden Fall eine Menge Staub aufgewirbelt. Vielleicht war die Geschichte ihres Lebens ja genauso scheiße wie meine, aber sie war in großen, bunten Neonlettern geschrieben, nicht in der unleserlichen Schrift eines Teenagers, der verzweifelt in sein Tagebuch kritzelt.
Sie führte mich aus dem Tempel. Der Wind blies stärker als zuvor, und der Staub nahm einem die Sicht wie ein Schneesturm. Ich zog mir wieder Burnus und Schutzbrille vors Gesicht, doch selbst so konnte ich kaum was erkennen, und jeder Atemzug hinterließ den Geschmack von Gips und zähem Speichel auf der Zunge. Mashas Haar war nicht mehr grellrosa, sondern ein undefinierbares Aschblond, das wegen des Staubs fast mausgrau wirkte, und ziemlich fransig – die Sorte Haarschnitt, die man auch mit einer Gartenschere hinbekommt. Während der Pubertät hatte ich auch oft so eine Frisur gehabt. Mashas Schädelknochen wirkten sehr fein und zerbrechlich, die Haut spannte sich wie Pergament über die Wangenknochen. Ihre Nacken- und Kiefermuskeln waren angespannt. Sie hatte abgenommen, seit ich sie das letzte Mal gesehen hatte, und ihr Teint war deutlich dunkler, dunkel wie eine Lederhaut. Das war keine normale Sommerbräune.
Wir waren kaum zehn Schritte gegangen, doch es hätte ebenso gut eine Meile sein können. Der Tempel war im Staub nicht mehr zu erkennen. Ringsum waren Stimmen zu hören, doch ich konnte die Worte über das unheimliche Geheul des Windes hinweg, der durch die Fenster des Tempels fegte, nicht verstehen. Winzige Staubkörnchen legten sich zwischen die Brillengläser und meine verschwitzte Haut und reizten mir Augen und Nase.
»Das ist weit genug«, sagte sie schließlich und ließ mich los. Mein Blick fiel auf die verunstalteten, gekrümmten Fingerspitzen ihrer linken Hand. Ich erinnerte mich noch lebhaft daran, wie ich, um Masha zu entkommen, ihre Finger in der Rolltür eines Umzugswagens eingequetscht hatte. Damals war ich mit Beweisen dafür, dass mein bester Freund Darryl von der Heimatschutzbehörde gefangen gehalten wurde, auf der Flucht gewesen. Masha hatte mich seinerzeit mehr oder weniger zu entführen versucht. Ich hatte nicht vergessen, wie verblüfft sie aufgeschrien hatte, als die Tür ihre Hand zermalmte.
Als ihr klar wurde, was mir durch den Kopf ging, verbarg sie die Hand im Ärmel ihres weiten Baumwollhemds.
»Wie läuft’s denn so, M1k3y?«, fragte sie.
»Mittlerweile bin ich nur noch Marcus«, sagte ich. »Und es lief schon besser. Wie steht’s mit dir? Hätte nicht erwartet, dich je wiederzusehen. Schon gar nicht hier, beim Burning Man.«
Rings um ihre Augen bildeten sich kleine Fältchen, der Schleier vor ihrem Gesicht hob sich, und ich merkte, dass sie lächelte. »Na ja, M1k3y –Marcus– das war der einfachste Weg, dich zu treffen.«
Ich hatte nicht gerade ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich dieses Jahr zum Burning Man wollte. Auf Craigslist und in diversen Hackerforen hatte ich monatelang »Biete Arbeit für Mitfahrgelegenheit« und »Kann mir jemand seine alten Campingsachen leihen?« gepostet und zu beweisen versucht, dass Menschen mit zu viel Zeit durch eisernen Willen ihren Mangel an Geld kompensieren können. Jeder, der sich dafür interessierte, wo ich dieses Wochenende steckte, hätte das in drei Sekunden locker googeln können.
»Weißt du, Masha, irgendwie machst du mich schon ziemlich nervös. Willst du mich umbringen, oder was treibt dich her? Und wo hast du Zeb gelassen?«
Sie kniff die Augen wegen einer neuen Staubwolke zusammen. »Zeb ist hier irgendwo unterwegs. Ich hab ihn vorhin in einem Café helfen sehen. Später wollte er noch zu einer Yogastunde – als Barista hat er aber deutlich mehr drauf. Und nein, ich will dich nicht umbringen. Ich will dir nur was geben. Was du damit anstellst, liegt ganz bei dir.«
»Du willst mir was geben?«
»Ja. Hier läuft doch alles durch den Austausch von Geschenken, hast du das nicht mitgekriegt?«
»Was genau willst du mir denn geben, Masha?«
Sie schüttelte den Kopf. »Besser, du weißt es nicht, bis es so weit ist. Praktisch wäre es sogar besser – zumindest für dich – wenn du’s nie erfahren würdest. Aber die Dinge sind nun mal, wie sie sind.« Fast kam mir Mashas Gerede wie ein Selbstgespräch vor. Die Zeit im Untergrund hatte sie verändert – sie wirkte irgendwie suspekt. Als stimmte etwas nicht mit ihr. Oder als hätte sie was ausgeheckt und könnte jeden Augenblick die Flucht ergreifen. Dabei war sie mal so selbstsicher und entschlossen gewesen. Und undurchschaubar. Jetzt schien sie einfach nur durch den Wind zu sein. Teilweise neben der Spur, teilweise geradezu verängstigt, falls ich richtig lag.
»Heute Abend«, sagte sie. »Um acht wird die Bibliothek von Alexandria verbrannt. Komm hinterher raus zum Abfallzaun, gegenüber von Sechs Uhr. Wenn ich noch nicht da bin, warte auf mich. Ich muss erst noch ein paar Dinge erledigen.«
»Meinetwegen, machen wir’s so. Kommt Zeb denn auch? Ich würd ihn gern mal wiedersehen.«
Sie verdrehte die Augen. »Wahrscheinlich wird er tatsächlich da sein, aber du wirst ihn wohl kaum sehen. Du musst allein kommen. Und ohne Licht, verstanden?«
»Vergiss es«, sagte ich. »So läuft das nicht. Du weißt doch sicher, dass ich mit Ange zusammen bin, und wenn sie mitwill, kommt sie mit. Und ohne Licht? Du hältst mich wohl für blöd.«
Für eine Stadt von fünfzigtausend Einwohnern mit einer Schwäche für gewisse Genussmittel, Pyrotechnik und überdimensionierte Monstermaschinen lag die Sterberate von Black Rock City an sich erstaunlich niedrig. Doch gerade in einer Stadt, in der man der Gefahr ins Gesicht lachte, grenzte es an Lebensmüdigkeit, nachts ohne Licht loszuziehen. Bei Dunkelheit ohne Fackeln oder Taschenlampen (in der Regel nahm man jede Menge davon mit) in die Wüste zu gehen, war tatsächlich so ziemlich das Gefährlichste und Dümmste, was man beim Burning Man machen konnte. So jemand nannte man einen »Blindgänger«, und Blindgänger liefen auf Schritt und Tritt Gefahr, von einem Bike oder Mutantenauto auf nächtlicher Spritztour über den Haufen gefahren zu werden. Das inoffizielle Motto des Festivals mochte zwar lauten »Über die Sicherheit reden wir später«, aber Blindgänger mochte niemand.
Masha schloss die Augen und blieb so reglos wie eine Statue vor mir stehen. Der Wind ebbte etwas ab, doch ich fühlte mich noch immer, als hätte ich gerade ein Pfund Talkumpulver verschluckt, und meine Augen brannten wie von Pfefferspray.
»Dann bring dein Mädchen halt mit, wenn’s unbedingt sein muss. Aber kein Licht, sobald du an den letzten Art Cars vorbei bist. Und wenn ihr beide später Probleme kriegt, bloß weil du nicht allein kommen wolltest, dann weißt du genau, wer schuld daran ist.«
Sie machte auf dem Absatz kehrt, stolzierte davon und war im Handumdrehen außer Sicht. So schnell es ging, lief ich zurück zum Tempel, um Ange zu suchen.
2
Beim Burning Man wird eine Menge Kram verbrannt. Erst mal natürlich die Figur, nach der das Festival benannt ist. Das findet am Samstagabend statt, und ich hatte es auf Video schon aus hundert Perspektiven gesehen, mit vielen verschiedenen Figuren (der Mann sieht jedes Jahr etwas anders aus). Es ist ein sehr ursprüngliches, wildes Spektakel. Die Leute sind total außer sich, und die Sprengsätze im Sockel der Figur gehen wie riesige Pilzwolken hoch. Verglichen damit ist die Verbrennung des Tempels Sonntagnacht eine ruhige und feierliche Angelegenheit. Doch vor diesen großen Events gibt es schon zahlreiche kleinere.
Letzte Nacht wurde zum Beispiel die regionale Kunst verbrannt. Feuerliebhaber aus der ganzen USA, aus Kanada und dem Rest der Welt hatten atemberaubende hölzerne Objekte gebaut, unter denen sich alles von der Größe einer Parkbank bis zu dreistöckigen, verspielten Türmen fand. Diese Kunstwerke säumten die weite, offene Fläche inmitten des Halbkreises von Black Rock City, und da sie als Erstes verbrannt werden würden, hatten wir sie uns gleich am Tag unserer Ankunft angesehen. Als es dann gestern soweit war, konnte man gar nicht alles auf einmal verfolgen: Die Objekte wurden gleichzeitig verbrannt, und jedes brannte auf seine ganz eigene Art. Die Menschen scharten sich um die Flammen, wobei die Black Rock Rangers ein Auge darauf hielten, dass niemand zu nahe kam, ehe die zusammengestürzten Holzhaufen nicht einen halbwegs stabilen Eindruck machten. Alles wurde auf eigens dafür vorgesehenen, feuerfesten Plattformen verbrannt, denn das Motto »Keine Spuren hinterlassen« betraf sogar Brandspuren.
Das war schon alles ziemlich spektakulär gewesen. Heute Abend aber war die Bibliothek von Alexandria dran. Natürlich nicht die echte – die hatte Julius Cäsar (oder ein anderer Römer) schon 48 vor Christus angezündet. Diesem Brand fiel die größte Sammlung von Schriften zum Opfer, die je existiert hatte. Es war sicher nicht die erste Bibliothek, die verbrannt war, und es blieb auch nicht die letzte, aber dieses Ereignis stand wie kein anderes der Geschichte für die mutwillige Zerstörung von Wissen. Die Bibliothek des Festivals ruhte auf vierundzwanzig großen Rädern und zwölf Achsen und wurde von Hundertschaften Freiwilliger an Seilen durch die Wüste gezogen. Im Inneren wechselten sich kleine Säulen und Nischen voller Schriftrollen ab. Jede dieser Rollen war die handgeschriebene Kopie eines gemeinfreien Buchs von Project Gutenberg. Ein ganzes Jahr hatten die Freiwilligen dafür gebraucht. Fünfzigtausend Bücher hatten sie heruntergeladen und von Hand auf Papier übertragen und alle diese Bücher würden verbrannt werden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!