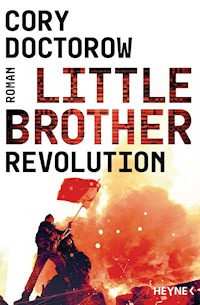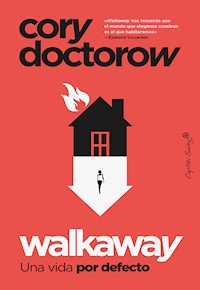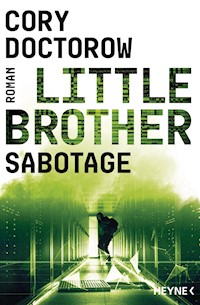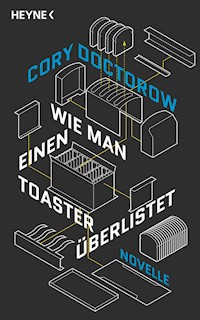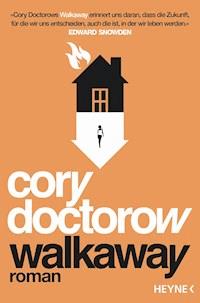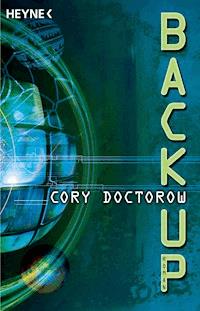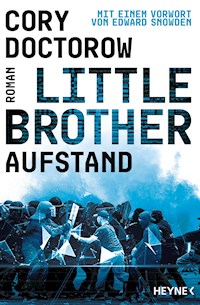
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Little Brother
- Sprache: Deutsch
Marcus Yallow ist smart, schnell und im Netz zu Hause. Als Terroristen einen Anschlag auf San Francisco verüben, sind er und seine Freunde jedoch in einem illegalen Onlinegame unterwegs. Agenten der Homeland Security nehmen ihn fest und verhören ihn tagelang. Als Marcus endlich wieder freigelassen wird, hat sich seine Heimatstadt in einen Überwachungsstaat verwandelt. Marcus und seine Freunde schwören, dass sie Homeland Security aus ihrer Stadt vertreiben werden – es beginnt ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Marcus Yallow ist smart, schnell und im Netz zu Hause. Als Terroristen einen Anschlag auf San Francisco verüben, sind er und seine Freunde jedoch in einem illegalen Onlinegame unterwegs. Agenten der Homeland Security nehmen ihn fest und verhören ihn tagelang. Als Marcus endlich wieder freigelassen wird, hat sich seine Heimatstadt in einen Überwachungsstaat verwandelt. Marcus und seine Freunde schwören, dass sie Homeland Security aus ihrer Stadt vertreiben werden – es beginnt ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel …
Mit seinen LITTLE BROTHER-Romanen hat Cory Doctorow die Welt im Sturm erobert und eine neue Generation für die Möglichkeiten und Tücken des Internets begeistert:
Erster Roman: Little Brother – Aufstand
Zweiter Roman: Little Brother – Revolution
Dritter Roman: Little Brother – Sabotage
Der Autor
Cory Doctorow, 1971 in Toronto geboren, ist Schriftsteller, Journalist und Internet-Ikone. Mit dem Blog boingboing.net und seinem Kampf für ein faires Copyright hat er weltweite Bekanntheit erlangt. Seine Little Brother-Romane wurden internationale Bestseller. Cory Doctorow ist verheiratet, hat eine Tochter und lebt in Los Angeles.
Besuchen Sie uns auf
CoryDoctorow
LittleBrother
Aufstand
Erster Roman
Mit einem Vorwort von Edward Snowden
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
LITTLE BROTHER
Deutsche Übersetzung von Uwe-Michael Gutzschhahn
Übersetzung des Vorworts von Sebastian Pirling.
Das Zitat aus dem Gedicht »Geheul« von Allen Ginsberg folgt der Übersetzung von Carl Weissner (München: Carl Hanser Verlag, 1999). Das Zitat aus »Unterwegs« von Jack Kerouac ist angelehnt an die Übersetzung von Thomas Lindquist (Reinbek: Rowohlt Verlag, 1998).Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Überarbeitete Neuausgabe 11/2021
Copyright © 2008 by Cory Doctorow
Copyright © 2008 der Nachworte by Bruce Schneier und Andrew Huang
Copyright © 2020 des Vorworts by Edward Snowden
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (boyphare, Vandathai, getgg)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-28021-5V002
diezukunft.de
Vorwort
vonEdwardSnowden
Wenn mir damals, als ich noch bei der CIA arbeitete, jemand gesagt hätte, dass Jugendliche irgendwann eine Rebellion anzetteln und, ausgerüstet mit Laserpointern als Waffen und Verkehrshütchen als Schilde, einen der mächtigsten Staaten der Welt lahmlegen würden – dann hätte ich höchstens eine Augenbraue hochgezogen. Und doch passiert jetzt, da ich fast zehn Jahre später diese Worte schreibe, genau das in Hongkong. In dieser Stadt hatte ich mich mit Journalisten getroffen, um ihnen die geheimen Informationen zu übergeben, die mich von einem ehemaligen Geheimagenten zu einem der meistgesuchten Männer der Welt machen würden. Tatsächlich lag dieses Buch, das Sie gerade in den Händen halten, damals auf dem Tisch in meinem Hotelzimmer, dem letzten Zimmer, das ich noch mit einer Kreditkarte bezahlen konnte.
Was ich den Journalisten damals gezeigt habe, waren Dokumente und Beweise dafür, dass die selbst ernannten »Fünf Augen« – die Sicherheitsbehörden von USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada – verdeckt zusammengearbeitet hatten, um die Gesetze ihrer Länder zu schwächen. Sie hatten die großen Telekommunikationsfirmen und Internetgiganten gezwungen, ihnen heimlich Zugriff auf ihre Netzwerke zu verschaffen (obwohl die Daumenschrauben bei einigen nicht allzu fest angezogen werden mussten). Dabei hatten sie nur ein Ziel: die Transformation des freien und vielfältigen Internets in das erste globale, zentralisierte Instrument der Massenüberwachung.
Das Problem dabei ist, dass die weltweite Reaktion auf diese Enthüllung zwar sehr empört war, hatte man hier doch den größten Geheimdienstskandal unserer Zeit aufgedeckt. Die Massenüberwachung selbst aber läuft bis heute praktisch uneingeschränkt weiter. So gut wie alles, was Sie tun, und so gut wie jeder Mensch in Ihrem Umfeld wird überwacht. Die Daten werden von einem System aufgezeichnet, dessen Reichweite nahezu grenzenlos ist, ganz im Gegensatz zu seinen Kontrollmechanismen.
Dieses System wurde seitdem kaum verändert – die meisten Regierungen haben weniger Interesse an echten Reformen als daran, die Rechte ihrer Bürger einzuschränken. Was sich hingegen verändert hat, ist unser öffentliches Bewusstsein. Dass Regierungen einfach so die Kommunikation unbescholtener Bürger abhören können, galt früher als Hirngespinst von Verschwörungstheoretikern (oder als Stoff für lehrreiche Romane wie den, den Sie gerade in den Händen halten). Auf einmal stellte sich aber heraus, dass diese Vorstellung bittere Realität ist, und zwar so allumfassend, dass diese Tatsache heute von unehrlichen Politikern gern als nicht weiter erwähnenswert abgetan wird.
Mittlerweile ist den globalen Konzernen langsam klar geworden, dass ihr schlimmster Sündenfall – die willentliche Komplizenschaft bei Verbrechen gegen die Öffentlichkeit – folgenlos blieb. Im Gegenteil, Kollaborateure wurden sogar belohnt, indem man ihnen ausdrücklich und rückwirkend Straffreiheit zusicherte oder indem man ihnen formlos dauerhafte Immunität garantierte. Damit wurden diese Firmen zu unserem neuen Big Brother, immer eifrig darum bemüht, umfassende Aufzeichnungen unseres Privatlebens in Profit und Macht umzuwandeln. Das einst so freie Internet ist korrumpiert worden, und heute haben wir nur noch einen Überwachungskapitalismus. Inzwischen haben wir begriffen, dass es bei diesen Technologien nie um Beziehungen zueinander, sondern um Macht über andere ging. Die Weiterentwicklung der Massenüberwachung ging einher mit dem Abbau öffentlicher Souveränität.
Das sind die düsteren Aussichten nach meinen sieben Jahren im Exil. Dennoch finde ich mehr Gründe für Hoffnung als für Verzweiflung, und das hat nicht wenig mit den Laserpointern und Verkehrshütchen in Hongkong zu tun. Meine Zuversicht rührt nicht daher, wie diese Dinge zweckentfremdet werden – damit Überwachungskameras gestört oder, mithilfe von etwas Wasser, die Tränengaskanister entschärft werden können –, sondern was sie symbolisieren: den unstillbaren Hunger der Menschen nach Freiheit.
Die Probleme, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen – die Enteignung durch Oligarchen und ihre Monopole sowie die Entrechtung durch autoritäre Herrscher und die von ihnen in bequeme Geiselhaft genommenen Politiker –, sind alles andere als neu. Neu dagegen sind die technischen Mittel, mit deren Hilfe diese Zustände einzementiert wurden. Mit anderen Worten: Die bösen Jungs haben das bessere Werkzeug.
Jeder von uns kennt dieses Sprichwort: Wenn du nur einen Hammer hast, wird jedes Problem zum Nagel. Darin liegt der Irrtum jedes Ordnungssystems, das sich mehr auf die Omnipotenz seiner Methoden verlässt als auf die Rechtmäßigkeit seines Mandats. Es gab Zeiten, da wurden Imperien durch Bronze, Schiffe und Schwarzpulver zu Fall gebracht. Keines dieser Reiche gibt es heute noch. Was jedoch all diese längst vergessenen Flaggen überdauert hat, ist unsere größte Errungenschaft: die Sprache. Sie ist das Imperium des Geistes.
Ja, wir alle sind wie Marcus Yallow und seine Freunde in einen ungleichen Kampf hineingezogen worden. Doch kein Ausmaß der Überwachung, sei sie auch noch so vollkommen, kein Ausmaß der Unterdrückung und der Gewinnmaximierung kann und wird ändern, wer wir sind. Ob mutige Studenten in Hongkong oder brillante Cypherpunks in San Francisco – es vergeht kein Tag, an dem nicht zahlreiche Einzelne versuchen, die Systeme, die unser Leben bestimmen, zu erneuern und zu verbessern. Wir haben gesehen, wie geniale Ideen und Erfindergeist zur Entstehung von Systemen geführt haben, die unsere Geheimnisse – vielleicht sogar unsere Seele – sicher verwahren können. Diese Systeme wurden in einer Welt geschaffen, in der schon die Absicht und die Mittel, eine Privatsphäre aufrechtzuerhalten, sich wie ein Verbrechen anfühlen. Wir haben gesehen, wie einzelne Menschen neue Werkzeuge dafür erschaffen haben, bessere Werkzeuge, als selbst die größten Staaten sie herstellen konnten. Doch niemand schafft es, sich ganz allein gegen diese verärgerten Giganten zu wehren, die ihre Ausschlusspolitik und ihre Gewaltmaßnahmen durchsetzen wollen. Denn das ist der wirklich wichtige Teil der Geschichte: Was beim Einzelnen beginnt, muss in der Gemeinschaft fortgeführt werden.
Um ein Zeitalter zu verändern, kommt es auf mehr an als auf Laserpointer und Verkehrshütchen – es kommt auf die Hände an, die sie halten.
Es kommt auf Sie an.
LITTLEBROTHER
DERAUFSTAND
Für Alice, die mich gesund macht
1
Ich gehe in die Oberstufe der Cesar Chavez High im sonnigen Mission-Viertel von San Francisco, und das macht mich zu einem der meistüberwachten Menschen der Welt. Ich heiße Marcus Yallow, aber zu der Zeit, als diese Geschichte losging, lief ich unter w1n5t0n. Gesprochen »Winston«.
Und nicht »Wee-eins-enn-fünf-tee-null-enn« – außer du bist so ein orientierungsloser Erziehungsbeamter, der die Kurve nicht gekriegt hat und das Internet immer noch als »Datenautobahn« bezeichnet.
Ich kenne jemanden, der tatsächlich so orientierungslos ist. Er heißt Fred Benson und ist einer der drei stellvertretenden Schulleiter der Chavez High. Der Kerl hat echt den Schuss. Aber wenn schon Gefängniswärter, dann lieber einen hilflosen Trottel als jemanden, der es voll draufhat.
»MARCUS YALLOW«, tönte es am Freitagmorgen über die Lautsprechanlage. Wenn ein Tag gleich mit der Anlage losgeht, ist das echt scheiße, und jetzt stell dir das Ganze noch mit Bensons üblichem Genuschel vor, das sich eher nach Verdauungsproblemen durch verdorbenen Burrito anhört als nach Schuldurchsage. Aber wir Menschen haben echt ein Talent, aus jedem noch so plärrenden Audio-Wirrwarr zumindest den eigenen Namen herauszuhören – muss ein Überlebenstrick sein.
Ich schnappte meine Tasche, klappte den Laptop drei viertel zu – wollte ja schließlich nicht meine Downloads schreddern – und stellte mich auf das Unvermeidbare ein.
»KOMMEN SIE SOFORT IN DAS BÜRO DER SCHULLEITUNG.«
Ms. Galvez, meine Sozialkundelehrerin, sah mich an und verdrehte die Augen. Und ich tat ihr gegenüber das Gleiche. Der Mann hatte es auf mich abgesehen, nur weil ich die Schul-Firewalls so leicht überwinde wie einen Bordstein, die Software zur Gangerkennung austrickse und die Überwachungschips lahmlege, mit denen sie uns aufspüren. Die Galvez ist aber in Ordnung, sie hält mir das nie vor (vor allem, weil ich ihr bei ihrer Webmail helfe, damit sie mit ihrem Bruder quatschen kann, der im Irak stationiert ist).
Darryl, mein Kumpel, klatschte mir auf den Hintern, als ich vorbeiging. Ich kenne Darryl schon seit der Zeit, als wir noch Pampers trugen und uns heimlich aus dem Kindergarten schlichen. Hab ihn ständig in irgendwelche Scheiße geritten und wieder rausgerettet. Ich hob die Arme über den Kopf wie ein Preisboxer, verschwand aus dem Sozialkundetrakt und machte mich auf den Büßerweg Richtung Schulleitung.
Ich war schon halb da, als plötzlich mein Handy klingelte. Das war noch so ein No-go – Handys sind muy prohibido in der Chavez High –, aber was ging das mich an? Ich verschwand in die Toilette und schloss mich in der mittleren Kabine ein (die hintere ist immer am schlimmsten, weil die so viele anpeilen in der Hoffnung, dass es da nicht so stinkt und versifft ist – Erleichterung und anständige Hygiene findest du aber nur in der Mitte). Ich checkte das Handy – mein Rechner zu Hause hatte eine Mail weitergeleitet, dass es irgendwas Neues bei Harajuku Fun Madness gab, was einfach das beste Spiel ist, das je erfunden wurde.
Ich grinste. Freitags in der Schule ist sowieso scheiße, und ich war froh, eine Entschuldigung zu haben, um mich vom Acker zu machen.
Ich schlenderte weiter Richtung Bensons Büro und hob lässig die Hand, als ich reinkam.
»Wenn das nicht Wee-eins-enn-fünf-tee-null-enn ist«, sagte er. Fredrik Benson – Sozialversicherungsnummer 545-03-2343, Geburtsdatum: 15. August 1962, Mädchenname der Mutter: Di Bona, Geburtsort: Petaluma – ist wesentlich größer als ich. Ich bin schlappe 1,73, er bringt es auf gute zwei Meter, aber seine College-Zeit als Basketballspieler liegt schon so weit zurück, dass die Brustmuskeln nur noch einen schlaffen Männerbusen bilden, der unter dem Billig-dot-com-Poloshirt unangenehm aufträgt. Er wirkt immer so, als ob er dir gleich einen reinwürgen will, und liebt es wegen der dramatischen Steigerung, ordentlich laut zu werden. Beides verliert aber bei häufiger Anwendung seine Wirkung.
»Nee, tut mir leid«, antwortete ich, »hab noch nie was von Ihrer R2D2-Figur gehört.«
»W1n5t0n«, sagte er, die Zeichen wieder einzeln aussprechend. Er musterte mich mit einem strengen Blick und wartete, dass ich klein beigab. Natürlich war das mein Deckname, und zwar schon seit Jahren. Unter dieser Identität agierte ich in den Foren, wo ich meine Beiträge zum Thema angewandte Sicherheitsforschung postete. So Sachen, wie man sich aus der Schule schleicht und die Signalkennung im Handy deaktiviert. Aber Benson wusste nicht, dass das mein Deckname war. Nur ganz wenige kannten ihn, und denen vertraute ich total.
»Ähm, da klingelt gar nichts bei mir«, sagte ich. Ich hatte unter diesem Benutzernamen ein paar echt coole Dinge in Sachen Schule gebracht – war total stolz auf meine Entwicklung eines Überwachungskillers –, und wenn er die beiden Identitäten zusammenbringen könnte, säße ich schön in der Scheiße. Niemand nannte mich auf der Schule w1n5t0n oder auch nur Winston. Nicht mal meine Freunde. Ich hieß Marcus und sonst gar nichts.
Benson setzte sich hinter seinen Schreibtisch und klopfte mit seinem Jahrgangsring nervös auf der Schreibunterlage rum. Das tat er immer, wenn es nicht gut für ihn lief. Pokerspieler nennen das Tell – etwas, woran man erkennen kann, was im Kopf des andern abgeht. Ich kannte Bensons Tells in- und auswendig.
»Marcus, ich hoffe, du begreifst, wie ernst die Sache ist.«
»Sofort, wenn Sie mir sagen, worum es geht, Sir.« Ich nenne Autoritätstypen wie ihn immer »Sir«, wenn ich sie verarsche. Das ist mein Tell.
Er schüttelte den Kopf und sah nach unten, noch so ein Tell. Als Nächstes würde er mich gleich anbrüllen. »Hör zu, Junge! Es wird Zeit, dir darüber klar zu werden: Wir wissen, was du getan hast, und werden das nicht einfach so hinnehmen. Du kannst von Glück reden, wenn du nicht suspendiert bist, nachdem unser Gespräch hier vorbei ist. Hast du vor, deinen Abschluss hier zu machen?«
»Mr. Benson, Sie haben mir immer noch nicht gesagt, was das Problem …«
Er knallte die Hand auf den Schreibtisch, dann zeigte er mit dem Finger auf mich. »Das Problem, Yallow, ist, dass du dich an einer kriminellen Verschwörung beteiligt hast, um das Sicherheitssystem der Schule zu untergraben, und du deine Mitschüler mit entsprechenden Mitteln versorgt hast. Du weißt genau, dass wir letzte Woche Graciella Uriarte suspendiert haben, weil sie so ein Teil von dir benutzte.« Uriarte hatte es übel erwischt. Sie trug einen Störsender bei sich, den sie in einem Drogenladen in der Nähe der BART-Station 16. Straße – BART ist die unterirdisch verlaufende S-Bahn von San Francisco – erstanden hatte, und das Ding löste auf dem Gang Alarm aus. Hatte ich nichts mit zu tun, aber sie tat mir trotzdem leid.
»Und Sie glauben, ich häng da mit drin?«
»Wir haben zuverlässige Quellen, die darauf hindeuten, dass du w1n5t0n bist« – wieder sprach er Zeichen für Zeichen einzeln aus, und ich fragte mich langsam, ob er gar nicht begriffen hatte, dass die 1 ein I war und die 5 ein S. »Wir wissen, dass dieser w1n5t0n verantwortlich ist für den Diebstahl der landesweit vereinheitlichten Prüfungsaufgaben vom letzten Jahr.« Das war nun wirklich nicht ich gewesen, aber echt ein super Hack, und total schmeichelhaft, dass sie es mir anhängten. »Dafür gibt es gut und gern ein paar Jahre Gefängnis, wenn du nicht kooperierst.«
»Sie haben zuverlässige Quellen? Die würde ich dann doch gern mal sehen.«
Er warf mir einen finsteren Blick zu. »Deine Haltung ist nicht gerade förderlich für dich.«
»Wenn es Beweise gibt, Sir, finde ich, Sie sollten die Polizei rufen und ihr die Sache übergeben. Klingt ja nach einer ernsten Angelegenheit, und ich möchte den rechtmäßig zuständigen Behörden bei ihrer Untersuchung wirklich nicht im Weg stehen.«
»Du willst, dass ich die Polizei rufe?«
»Und meine Eltern. Das wär wohl das Beste.«
Wir starrten uns über den Schreibtisch an. Er hatte offensichtlich erwartet, dass ich sofort einknicken würde, wenn er die Bombe platzen ließ. Aber ich knicke nicht ein. Ich hab einen Trick, Leute wie Benson niederzustarren. Ich schaue leicht nach links an ihrem Kopf vorbei und denke an die Verse alter irischer Volkslieder, solche mit mindestens dreihundert Strophen. Das lässt mich dann völlig ruhig und unbesorgt aussehen.
Und der Flügel saß an dem Vogel und der Vogel saß auf dem Ei und das Ei saß im Nest und das Nest saß auf dem Blatt und das Blatt saß an dem Zweig und der Zweig saß an dem Ast und der Ast saß am Stamm und der Stamm saß im Baum und der Baum saß im Moor und das Moor unten im Tal – oh! Hei ho! Das rumpelnde Moor unten im Tal – oh! …
»Du kannst wieder in deine Klasse gehen«, sagte er. »Ich rufe dich, wenn die Polizei bereit ist, mit dir zu reden.«
»Werden Sie sie jetzt gleich rufen?«
»Es ist ein kompliziertes Verfahren, die Polizei zu rufen. Ich hatte gehofft, dass wir die Sache schnell und fair lösen könnten, aber da du darauf bestehst …«
»Ich kann auch warten, solange Sie mit der Polizei telefonieren«, sagte ich. »Mir egal.«
Er klopfte wieder mit seinem Ring, und ich wartete darauf, dass er platzte.
»Geh!», brüllte er. »Verschwinde endlich aus meinem Büro, du übler kleiner …«
Ich ging und ließ mir nichts anmerken. Er würde die Polizei nicht anrufen. Wenn er genügend Beweise gehabt hätte, um zur Polizei zu gehen, hätte er es gleich gemacht. Er hasste mich, und zwar abgrundtief. Ich nahm an, dass er ein paar Gerüchte gehört und gehofft hatte, er könnte mir Angst machen, damit ich alles ausspuckte.
Ich lief frisch und frei den Flur entlang und bemühte mich für die Gangerkennungskameras um einen möglichst gleichmäßigen Schritt. Die waren erst vor einem Jahr installiert worden, und ich liebte sie, weil sie so schön dämlich waren. Davor hatten wir Kameras zur Gesichtserkennung gehabt, die fast jeden öffentlichen Bereich der Schule erfassten, aber ein Gericht hatte entschieden, dass sie gegen das Gesetz verstießen. Also hatten Benson und jede Menge andere paranoide Schulobere unseren Lehrbuchetat geplündert und diese idiotischen Kameras angeschafft, die angeblich in der Lage waren, die Gangart jedes Einzelnen zu unterscheiden. Ja, klar.
Ich kam in die Klasse zurück und setzte mich. Ms. Galvez lächelte mir freundlich zu. Dann packte ich das Hauptarbeitsgerät unserer Schule aus und ging in den Modus für unseren Klassenraum. Die sogenannten SchoolBooks waren die fieseste Spitzeltechnologie überhaupt. Sie zeichneten jede Eingabe auf, überwachten den gesamten Netzverkehr nach verdächtigen Stichwörtern, zählten alle Klicks und verfolgten jeden noch so flüchtigen Gedanken, den man übers Netz verbreitete. Wir hatten die Geräte in meinem ersten Jahr an der Schule bekommen, und es dauerte nur ein paar Monate, bevor der Lack ab war. Als die Leute erst mal geschnallt hatten, dass diese »kostenlosen« Laptops in Wirklichkeit für den Direx arbeiteten – und zudem mit Unmengen abtörnender Werbung verseucht waren –, kriegten sie plötzlich Gewicht und lasteten schwer.
Mein SchoolBook zu cracken war einfach gewesen. Einen Monat nachdem das Teil auftauchte, war der Crack online, und es gab gar kein Problem – einfach das DVD-Image runterladen, brennen und ab ins Laufwerk des SchoolBooks, dann hochfahren, während man gleichzeitig eine ganze Reihe von Tasten gedrückt hielt. Den Rest machte die DVD. Sie installierte einen Haufen versteckte Programme auf dem Laptop, solche, die auch dann unentdeckt blieben, wenn die Schulleitung ihre täglichen Kontrollchecks zentral über alle Geräte laufen ließ. Ab und zu musste ich zwar ein Update für die Software besorgen, um die neuesten Testprogramme der Schulleitung zu umgehen, aber das war ein kleiner Preis dafür, ein bisschen Kontrolle über die Kiste zu kriegen.
Ich startete IMParanoid, den geheimen Instant Messenger, den ich immer gebrauchte, wenn ich mitten im Unterricht was bereden wollte, das nicht für jeden bestimmt war. Darryl hatte sich bereits eingeloggt.
> Das Spiel ist eröffnet! Bei Harajuku Fun Madness läuft irgendein großes Ding, Kumpel. Bist du dabei?
> Nein. Vergiss. Es. Wenn ich zum dritten Mal beim Unterrichtschwänzen erwischt werde, bin ich weg vom Fenster. Mann, das weißt du doch. Wir machen’s nach der Schule.
> Du hast doch Mittagspause und danach Selbstbeschäftigung. Macht zwei Stunden. Genug Zeit, um dem Hinweis nachzugehen und rechtzeitig wieder zurück zu sein, bevor irgendjemand was merkt. Ich trommel das ganze Team zusammen.
Harajuku Fun Madness ist das beste Spiel aller Zeiten. Ich weiß, dass ich das schon mal gesagt hab, aber ist nicht verkehrt, es noch mal zu wiederholen. Es ist ein ARG, ein Alternate Reality Game, und es dreht sich dabei um Folgendes: Im Tempel von Harajuku, wo in den letzten zehn Jahren eigentlich jede bedeutendere Subkultur von coolen japanischen Teenagern erfunden wurde, hat eine Gruppe von Fashion-Kids einen geheimnisvollen heilenden Edelstein entdeckt. Sie werden von bösen Mönchen, von der Yakuza (also der japanischen Mafia), von Aliens, Steuerfahndern, Eltern und einer skrupellosen künstlichen Intelligenz gejagt. Und sie schicken den Spielern codierte Botschaften, die wir entschlüsseln und dann anwenden müssen, um neue Hinweise zu finden, die zu neuen codierten Botschaften und neuen Hinweisen führen.
Stell dir den schönsten Tag vor, den du je erlebt hast, während du durch deine Stadt geschlendert bist. Du guckst dir all die Leute an, die komischen Flugblätter, ein paar Spinner und geile Läden. Und jetzt füg noch eine Art Schnitzeljagd hinzu, eine, bei der du aber nach alten Filmen, Songs und Jugendkulturen aus allen Zeiten und sämtlichen Gegenden der Welt suchen musst. Und das Ganze ist ein Wettkampf, bei dem das Viererteam, das den Hauptpreis gewinnt, für zehn Tage nach Tokio reisen, auf der Harajuku-Brücke abhängen, auf der Elektronikmeile Akihabara herumstöbern und so viel Astro-Boy-Merchandise mitnehmen darf, wie du nur tragen kannst. Bloß dass Astro Boy in Japan Atom Boy heißt. Das ist Harajuku Fun Madness, und wenn du erst mal ein, zwei Rätsel gelöst hast, führt echt kein Weg mehr zurück.
> Nein, Mann, ganz einfach nein. NEIN. Frag erst gar nicht.
> Ich brauch dich, D. Du bist der Beste, den ich habe. Ich schwöre, ich bring uns da rein und raus, ohne dass jemand was merkt. Du weißt doch, dass ich das schaffe, oder?
> Ich weiß, dass du das schaffst.
> Dann bist du also dabei?
> Verdammt, nein.
> Ach komm schon, Darryl. Du wirst dir schon nicht auf dem Sterbebett wünschen, dass du mehr Zeit in der Schule gehockt hättest, um zu lernen.
> Ich werde mir aber auf dem Sterbebett auch nicht wünschen, dass ich mehr Zeit mit ARGs-Spielen verbracht hätte.
> Okay, aber meinst du nicht, du wirst dir auf dem Sterbebett wünschen, du hättest mehr Zeit mit Vanessa Pak verbracht?
Van war Teil meines Teams. Sie ging auf eine Privatschule für Mädchen in der East Bay, und ich wusste, sie würde sofort den Unterricht schwänzen und herkommen, um die Aufgabe mit mir durchzuziehen. Darryl stand echt seit Jahren auf sie – sogar schon zu der Zeit, als die Pubertät sie noch nicht mit jeder Menge üppiger Reize ausgestattet hatte. Darryl hatte sich in ihren Verstand verliebt. Echt traurig so was.
> Arschloch.
> Du kommst also?
Er sah mich an und schüttelte den Kopf. Dann nickte er. Ich zwinkerte ihm zu, und danach machte ich mich an die Arbeit, den Rest meines Teams anzuklicken.
Ich war nicht seit eh und je ARG-Fan. Ich habe ein dunkles Geheimnis: Ursprünglich war ich nämlich eher LARPer. LARPing bedeutet Live Action Role Playing, also live Actionrollen spielen, und was man darunter versteht, ist genau das, wonach es klingt: in Kostümen rumlaufen, mit verstellten Stimmen sprechen, so tun, als ob man ein Topspion, ein Vampir oder ein mittelalterlicher Ritter ist. Ist so ähnlich wie Capture the Flag in Monsterkluft, mit ein bisschen Theaterwerkstatt dabei. Und die besten Spiele waren die, die wir in Pfadfinderlagern außerhalb der Stadt in Sonoma oder unten auf der Halbinsel spielten. Diese dreitägigen Endlosgeschichten konnten echt haarig sein: Märsche von morgens bis abends, unendliche Kämpfe mit Schwertern aus Schaumstoff und Bambus, oder Leute verhexen, indem man Schaumstoffbällchen warf und »Feuerball!« rief. Echt lustig, wenn auch vielleicht ein bisschen kindisch. Aber nicht halb so nerdig wie darüber reden, was dein Elf vorhat, und dabei an einem Tisch voller Cola-light-Dosen und bemalter Figuren hocken. Und viel mehr körperliche Action, als wenn du daheim bei einem Massive Multiplayer Game in ein Mauskoma fällst.
Zum Verhängnis wurden mir die Minispiele in den Hotels. Wann immer es in der Stadt eine Science-Fiction-Convention gab, überredete irgendein LARPer die Organisatoren, dass sie uns auf der Tagung ein paar Sechs-Stunden-Minispiele machen ließen, damit wir uns in die angemieteten Räumlichkeiten einklinken konnten. Dass so ein Haufen begeisterter Kids in Kostümen durch die Gegend lief, gab dem Event ein bisschen Zusatzfarbe, und wir kriegten dadurch Kontakt zu Leuten, die noch ein bisschen mehr von der Norm abwichen als wir.
Das Problem bei den Hotels ist, dass sie auch jede Menge Nichtspieler beherbergen – und zwar nicht bloß SF-Leute. Sondern ganz normale. Aus Bundesstaaten, die vorn und hinten Vokale haben wie Iowa. Leute auf Urlaub.
Und manchmal missverstanden diese Leute das Wesen eines solchen Spiels. Lassen wir’s dabei, okay?
Die Stunde endete in zehn Minuten, das ließ mir kaum Zeit, alles vorzubereiten. Der erste Tagungsordnungspunkt waren die nervigen Kameras zur Gangerkennung. Wie ich schon sagte, zuerst hatten sie Gesichtserkennungskameras gehabt, die aber rechtswidrig waren. Soweit ich weiß, hat bisher noch kein Gericht entschieden, ob die Gangerkennungskameras legaler sind, weshalb wir sie bis dahin einfach an der Arschbacke haben.
Wir Menschen sind echt gut darin, unterschiedliche Gangarten zu unterscheiden – wenn du das nächste Mal auf Campingtour bist, guck dir mal an, wie das Licht der Taschenlampe hin und her springt, mit der dein Kumpel von fern auf dich zuläuft. Durchaus möglich, dass du ihn allein an der Bewegung des Lichts erkennst; es ist nämlich die charakteristische Art, wie es auf und ab hüpft, die unserem Affenhirn sagt: Das ist ein Mensch, der da kommt.
Die Gangerkennungssoftware erfasst Bilder deiner Bewegung, versucht dich in den Fotos als Silhouette zu isolieren und bemüht sich dann, diese Silhouette mit der Datenbank abzugleichen, um zu sehen, ob sie dich erkennen kann. Es ist also ein biometrisches Identifizierungssystem, so wie der Abgleich von Fingerabdrücken oder von Netzhautscans, aber es gibt viel mehr »Kollisionen« als bei den beiden andern. Eine biometrische »Kollision« bedeutet, dass die Vermessung mit mehr als einer Person übereinstimmt. Dein Fingerabdruck weist nur dich aus, aber deine Art zu gehen teilst du mit vielen andern Leuten.
Natürlich nicht genau. Dein ganz persönlicher, Zentimeter für Zentimeter vermessener Gang ist spezifisch für dich und nur für dich, klar. Das Problem ist aber, dass der zentimetergenaue Gang variiert, abhängig davon, wie müde du bist, wie der Boden beschaffen ist, ob du dir beim Basketball den Knöchel verstaucht hast oder ob du kürzlich die Schuhe gewechselt hast. Das heißt, das System erfasst dein Profil nur verschwommen und sucht nach Personen, die mehr oder weniger so laufen wie du.
Es laufen aber viele Menschen mehr oder weniger wie du. Und was noch entscheidender ist: Es ist kein Kunststück, nicht mehr oder weniger zu laufen wie du – zum Beispiel, wenn du einfach einen Schuh ausziehst. Natürlich läufst du in dem Fall immer wie du mit nur einem Schuh, also werden die Kameras unter Umständen rausfinden, dass du es trotzdem bist. Weshalb ich es vorziehe, den Angriffen auf die Gangerkennung stets ein bisschen Zufälligkeit beizumischen: Ich tue eine Handvoll Steinchen in beide Schuhe. Das ist billig und effektiv, keine zwei Schritte fallen mehr gleich aus. Außerdem bekommst du dabei eine umfassende Fußreflexzonenmassage. (War nur Spaß, Reflexzonenmassage ist wissenschaftlich ungefähr genauso sinnvoll wie Gangerkennung.)
Die Kameras schlugen jedes Mal Alarm, wenn jemand den Schulhof betrat, den sie nicht erkannten.
Das durfte natürlich nicht sein.
Der Alarm ging alle zehn Minuten los. Wenn der Postbote kam. Wenn irgendein Elternteil reinschaute. Wenn die Bauarbeiter kamen, um den Basketballplatz in Ordnung zu bringen. Wenn ein Schüler mit neuen Schuhen aufkreuzte.
Deshalb versucht das System inzwischen nur noch nachzuverfolgen, wer wann wo ist. Wenn jemand während der Unterrichtszeit das Schultor verlässt, wird das Gangmuster gecheckt, um zu sehen, ob es irgendwie halbwegs zu einem der Schüler passt, und wenn ja, wuuup, wuuup, wuuup, geht der Alarm los!
Die Chavez High ist ringsum von Kieswegen umgeben. Ich hab vorsichtshalber immer ein paar Hände voll Steinchen in meiner Schultertasche, nur für den Fall. Stillschweigend reichte ich Darryl zehn oder fünfzehn spitze kleine Fieslinge rüber, und wir beluden beide unsere Schuhe.
Die Stunde war fast zu Ende – und mir fiel ein, dass ich noch immer nicht die Website von Harajuku Fun Madness gecheckt hatte, um nachzuschauen, wo der nächste Hinweis war! Ich hatte mich ein bisschen zu sehr auf unsere Flucht konzentriert und mich überhaupt nicht darum gekümmert, wohin wir eigentlich flohen.
Ich ging in mein SchoolBook und tippte auf der Tastatur rum. Der Browser, den wir verwendeten, war mit dem Rechner mitgeliefert worden. Es war eine gesperrte Spyware-Version des Internet Explorers, Microsofts Crashware-Dreck, den niemand unter vierzig freiwillig nutzen würde.
Ich hatte eine Firefox-Kopie auf dem USB-Stick, der in meine Armbanduhr eingebaut war, aber das reichte nicht – SchoolBook lief mit Windows Vista4Schools, einem Uraltsystem, das dafür geschaffen war, Schulleitern die Illusion zu geben, sie würden die Programme kontrollieren, die ihre Schüler verwenden durften.
Aber Vista4Schools ist selbst sein schlimmster Feind. Es gibt jede Menge Programme, von denen es nicht will, dass du sie ausschalten kannst – Keylogger, Zensurprogramme –, und diese Programme laufen in einer speziellen Betriebsart, die sie für das System unsichtbar macht. Du kannst sie nicht ausschalten, weil du sie im System gar nicht siehst.
Jedes Programm, dessen Bezeichnung mit $SYS$ beginnt, ist für das Betriebssystem unsichtbar. Es taucht weder in einem Festplatten-Verzeichnis noch im Process Monitor auf. Deshalb hatte ich meine Firefox-Kopie $SYS$Firefox genannt – und als ich sie startete, wurde sie für Windows unsichtbar – und damit auch unsichtbar für alle Schnüffelprogramme des Systems.
Jetzt, wo der Indie-Browser lief, brauchte ich nur noch eine Indie-Netzwerkverbindung. Das Schulnetz zeichnete jeden Klick ins System oder aus ihm heraus auf, was scheiße war, wenn du auf die Seite von Harajuku Fun Madness gehen wolltest, um dir außerhalb der Schulmauern ein bisschen Spaß zu gönnen.
Die Antwort liegt in einem genialen Teil namens TOR – was die Abkürzung für The Onion Router ist. Ein Onion- oder Zwiebel-Router ist ein Server, der Anfragen nach irgendwelchen Webseiten entgegennimmt und sie so lange an andere Zwiebel-Router weiterleitet, bis einer entscheidet, die Site anzusprechen und ihren Inhalt durch die Zwiebelschichten zurückzureichen, bis sie wieder bei dir landet. Der Verkehr zu und zwischen den Zwiebel-Routern läuft verschlüsselt, was bedeutet, dass die Schule nicht sehen kann, wonach du suchst, und die Zwiebelschichten wissen nicht, für wen sie arbeiten. Es gibt Millionen Netzwerkknoten – das Programm wurde von der Forschungsabteilung der US-Marine entwickelt, um es ihren Leuten zu ermöglichen, in Ländern wie Syrien oder China die Zensurprogramme zu umgehen, was es für den Rahmen einer durchschnittlichen amerikanischen Highschool perfekt macht.
TOR funktioniert, weil die Schule nur eine begrenzte Liste von anstößigen Adressen hat, auf die wir nicht gehen dürfen. Und die Adressen der Netzwerkknoten wechseln ständig – keine Chance für die Schule, da nachzukommen. Firefox und TOR zusammen machten mich zu dem unsichtbaren Mann, der immun gegen die Schnüffelattacken der Schulbehörde war und deshalb nach Belieben die Seite von Harajuku FM anklicken konnte, um zu sehen, was dort los war.
Und da war er, der neue Hinweis. Wie alle Hinweise von Harajuku Fun Madness hatte er eine physische, eine Online- und eine geistige Komponente. Die Onlinekomponente war ein Rätsel, das du lösen musstest, eines, bei dem es einen Haufen verworrene Fragen zu beantworten gab. Darunter waren auch jede Menge Fragen zu bestimmten Geschichten in Dōjinshis – das sind Comicbücher, die von Manga-Fans gezeichnet werden. Sie können so umfangreich sein wie die ursprünglichen Comics, die die Leute inspiriert haben, aber sie sind viel verschrobener, mit verworrenen Handlungsfäden und manchmal echt bescheuerten Songs und total abwegiger Action. Jede Menge Lovestorys natürlich auch. Gibt totale Begeisterung bei den Fans, wenn sich der Comicheld verliebt.
Die Rätsel würde ich später lösen müssen, wenn ich zu Hause war. Klar wären sie am einfachsten mit dem ganzen Team zu knacken gewesen, indem wir Unmengen von Dōjinshi-Filmen runterluden und auf Antworten checkten.
Ich war gerade fertig, sämtliche Hinweise zusammenzutragen, als es zum Ende der Stunde läutete, und wir machten uns auf die Flucht. Ich schüttete mir heimlich die Steinchen in den Schaft meiner kurzen Stiefel – knöchelhohe australische Blundstones, die sich gut zum Rennen und Klettern eignen. Außerdem ist die schnürsenkellose Form zum bloßen Rein- und Rausschlüpfen perfekt bei den ganzen Metalldetektoren, die es inzwischen überall gibt.
Natürlich mussten wir auch die physische Überwachung umgehen, aber das wird immer einfacher, je mehr aktuelle Schnüffeltechnik sie übereinanderlegen – die ganzen Pfeifen und Glocken lullen unsere geliebte Lehrerschaft doch bloß in einen völlig absurden Sicherheitsglauben. Wir ließen uns mit den anderen Schülern durch die Flure treiben und gingen in Richtung meines Lieblingsseitenausgangs. Als wir es schon halb geschafft hatten, zischte Darryl plötzlich: »Scheiße! Ich hab total vergessen, dass ich ja noch das Buch aus der Bibliothek in der Tasche habe.«
»Du willst mich verarschen«, sagte ich und zerrte ihn in die nächste Toilette, an der wir vorbeikamen. Bücher aus der Bibliothek sind ganz schlecht. In jedem Buch ist hinten in die Bindung ein RFID-Chip – ein Peilsender zur Identifizierung per Funk – eingeklebt, der es den Bibliothekarinnen erlaubt, den Titel auszutragen, indem sie ihn über ein Lesegerät halten. Außerdem kann auf diese Weise jedes Regal sofort melden, wenn irgendein Buch am falschen Platz steht.
Aber der Chip gibt der Schule auch die Möglichkeit, ständig zu überwachen, wo du dich gerade rumtreibst. Das war noch so ein legales Schlupfloch: Kein Gericht würde der Schule erlauben, dass sie uns mit RFID-Chips überwacht, aber natürlich durfte die Schule Bibliotheksbände überwachen und die Aufzeichnungen auswerten, um festzustellen, wer wahrscheinlich gerade welches Buch dabeihatte.
Ich hatte einen kleinen Faraday-Beutel bei mir – das sind mit einem Gewebe aus Kupferdraht gefütterte Umschläge, die Funkwellen wirksam abblocken und RFID-Chips zum Schweigen bringen. Die Beutel waren eigentlich dafür gedacht, Ausweise und Mautstellen-Transponder zu neutralisieren. Und nicht für Bücher wie …
»Einführung in die Physik?«, stöhnte ich. Das Buch war so dick wie ein Lexikon.
3
Auf der Straße Richtung BART-Station Powell Street liefen wir an großen Menschenmengen vorbei. Sie hetzten und rannten, mit bleichen Gesichtern, schweigend oder schreiend, in schierer Panik. Obdachlose kauerten in Eingängen und beobachteten das Ganze, während eine große schwarze Transen-Hure zwei bärtige junge Männer wegen irgendwas anbrüllte.
Je mehr wir uns der BART näherten, desto schlimmer wurde das Gedränge und Geschiebe. Als wir die Treppe zur Haltestelle erreichten, führten sich die Leute auf wie der übelste Mob, ein einziges Hauen und Stechen von Menschen, die alle versuchten, sich einen Weg die schmale Treppe hinunter zu bahnen. Ich wurde mit dem Gesicht gegen einen Rücken gestoßen, und ein anderer Mensch wurde gegen meinen gedrückt.
Darryl war immer noch neben mir – er war kräftig genug, dass man ihn so leicht nicht wegschubsen konnte. Jolu war gleich hinter ihm und klammerte sich mehr oder weniger an seine Taille. Vanessa entdeckte ich ein paar Meter entfernt, eingepfercht zwischen anderen Leuten.
»Verpiss dich!«, hörte ich Van hinter mir schreien. »Du perverses Schwein! Pfoten weg!«
Ich drehte mich um, stemmte mich gegen die Menge und sah, wie Van voller Verachtung einen grinsenden alten Sack in schickem Anzug anblickte. Sie fummelte in ihrer Tasche, und ich wusste, wonach sie suchte.
»Kein Tränengas!«, rief ich über den Lärm hinweg. »Sonst erwischst du auch alle andern.«
Bei dem Wort Tränengas schaute der Kerl plötzlich entsetzt und versuchte irgendwie nach hinten zu entwischen, aber die Menge schob ihn weiter. Ein Stück vor mir sah ich, wie jemand – eine Frau mittleren Alters in einem Hippiekleid – stolperte und hinfiel. Sie schrie, als sie stürzte, und ich sah, wie sie um sich schlug, um wieder hochzukommen, aber es gelang ihr nicht, der Druck der Menge war zu groß. Als ich herankam, beugte ich mich nach unten, um ihr zu helfen, und wurde fast über sie geworfen. Am Ende trat ich ihr auch noch in den Magen, als mich die Masse an ihr vorbeistieß, aber ich glaube, das spürte sie schon gar nicht mehr.
Ich war so in Panik wie noch nie in meinem Leben. Von überallher kamen jetzt Schreie, Menschen lagen am Boden, und der Druck von hinten war gnadenlos, als ob ein Bulldozer schöbe. Ich war nur noch damit beschäftigt, auf den Füßen zu bleiben.
Wir befanden uns jetzt in der offenen Halle der BART-Station, wo die Drehkreuze sind. Hier war es kaum besser – der ringsum von Wänden umschlossene Raum ließ die Stimmen in sämtliche Richtungen widerhallen. Von dem Dröhnen brummte mir der Kopf, und der Gestank und die Nähe all dieser Körper machten mich ganz klaustrophobisch, obwohl ich noch nie gehört hatte, dass ich für so was anfällig war.
Immer noch drängten Leute die Treppe hinunter, andere quetschten sich durch die Drehkreuze und dann die Rolltreppen nach unten zu den Bahnsteigen, aber mir war klar, dass das kein gutes Ende nehmen würde.
»Sollen wir lieber unser Glück oben versuchen?«, fragte ich Darryl.
»Ja, verdammt, ja«, antwortete er. »Das hier ist Mord.«
Ich schaute zu Vanessa rüber – unmöglich, dass sie mich hören würde. Es gelang mir, mein Handy rauszuholen, und ich schickte ihr eine SMS.
> Wir hauen ab hier
Ich sah, wie sie das Vibrieren spürte, dann draufguckte, schließlich zu mir rübersah und heftig nickte. Darryl hatte inzwischen Jolu informiert.
»Hast du einen Plan?«, brüllte mir Darryl ins Ohr.
»Wir müssen da wieder rauf!«, schrie ich zurück und deutete auf das erbarmungslose Gedränge der Menschen.
»Das ist unmöglich!«, sagte er.
»Es wird noch unmöglicher, wenn wir länger warten!«
Er zuckte die Schultern. Van arbeitete sich zu mir herüber und fasste nach meinem Handgelenk. Ich nahm Darryls, und der fasste mit der anderen Hand nach Jolu, und so drängten wir uns hinaus.
Es war echt schwierig. Zuerst schafften wir keine zehn Zentimeter in der Minute, und als wir die Treppe erreicht hatten, ging es noch langsamer. Die Leute, an denen wir uns vorbeischoben, waren nicht gerade erfreut, dass wir sie aus dem Weg drängten. Einige beschimpften uns, und einer sah so aus, als wenn er mir am liebsten in die Fresse schlagen würde, sofern er nur seinen Arm rausgekriegt hätte. Wir kamen an drei weiteren Menschen vorbei, die auf dem Boden lagen, doch es gab keine Möglichkeit, ihnen zu helfen. Aber zu diesem Zeitpunkt dachte ich auch längst nicht mehr an Helfen. Das Einzige, was noch zählte, war, die Lücken vor uns zu erspähen, um weiterzukommen, dazu Darryls kraftvoller Griff um mein Handgelenk und mein Todesgriff um das Gelenk von Van hinter mir.
Eine Ewigkeit verging, dann plötzlich schossen wir wie Sektkorken ins Freie und blinzelten in das graue, rauchgeschwängerte Licht. Die Fliegeralarmsirenen jaulten genauso wie vorher, und das Sirenengeheul der Krankenwagen, die die Market Street runterjagten, dröhnte noch lauter. Es war jetzt fast niemand mehr auf den Straßen – bis auf die Leute, die immer noch hoffnungslos versuchten, nach unten zu kommen. Viele weinten. Ich entdeckte ein paar leere Bänke – gewöhnlich waren die immer von stinkigen, saufsüchtigen Pennern besetzt – und zeigte in ihre Richtung.
Wir bewegten uns auf sie zu, geduckt und mit eingezogenen Schultern wegen der Sirenen und des Rauchs. Kaum hatten wir die Bänke erreicht, da stürzte Darryl nach vorn.
Wir schrien alle, und Vanessa packte ihn und drehte ihn auf den Rücken. Sein Hemd hatte seitlich einen roten Fleck. Der Fleck breitete sich aus. Sie riss das Hemd hoch und legte einen langen, tiefen Schnitt in seiner gut gepolsterten Seite frei.
»Irgendein Idiot in der Menge hat ihn abgestochen«, sagte Jolu und krampfte die Hände zu Fäusten. »Verdammt, ist das fies.«
Darryl stöhnte, sah uns an und danach an seiner Seite hinab. Dann stöhnte er wieder, und sein Kopf kippte zurück.