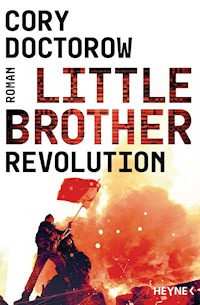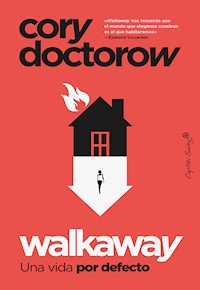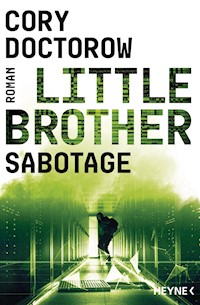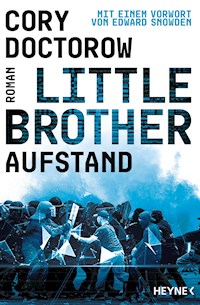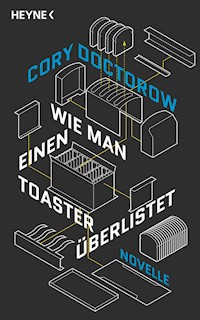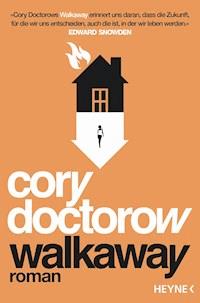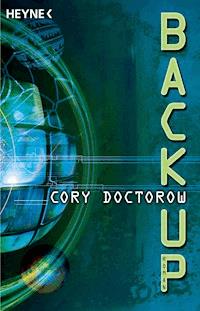
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Leben als Sicherungskopie
Die virtuelle Revolution hat ein Utopia erzeugt, in dem es keinen Tod und keine Krankheit mehr gibt – jeder kann seinen Geist abspeichern und ihn in einen neuen Körper laden. Doch es kommt vor, dass diese „Backups“ nicht immer dem neuesten Stand entsprechen und Menschen mit veralteten Daten im Kopf herumlaufen. Ein Umstand, den sich so manche kriminelle Organisation zunutze macht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
Julius ist hundert Jahre alt und immer noch ein junger Mann. Das liegt daran, dass er in einer Welt lebt, in der es keinen Tod, keine Krankheit, kein Geld, keine Energieknappheit mehr gibt. Eine Welt, in der technisch alles möglich ist: in der man seinen Geist in einer Datenbank speichern und – in Form eines Backups – immer wieder in einen neuen Körper herunterladen kann. Doch was wie ein Paradies, wie ein Wirklichkeit gewordenes Utopia klingt, hat seine Schattenseiten. Denn leider gibt es auch in dieser schönen neuen Welt Konkurrenzdenken, Verrat und Verbrechen – wie Julius buchstäblich am eigenen Leib erfahren muss …
Rasant, cool und wunderbar ironisch erzählt – »Backup« ist der Kult-Roman für die Internet-Generation!
Der Autor
Cory Doctorow ist Schriftsteller, Journalist, Internet-Aktivist. Er wurde 1971 in Toronto geboren und lebt heute im weltweiten Netz. Sie finden ihn unter: www.craphound.com
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Ich lebte lange genug¬ um in den Genuss der Unsterblichkeit zu gelangen; um den Aufstieg der Bitchun Society zu verfolgen; um zehn Sprachen zu lernen; um drei Symphonien zu komponieren; um meinen Kindheitstraum zu verwirklichen und mich in Disney World niederzulassen; um die Arbeit und die Arbeitsplätze sterben zu sehen1.
Allerdings hätte ich nie gedacht, den Tag zu erleben, an dem Immer-auf-Achse-Dan beschließen sollte, sich bis zum Wärmetod des Universums auf Eis zu legen.
Als ich Dan kennenlernte, irgendwann Ende des 21. Jahrhunderts, befand er sich in der zweiten oder dritten Blüte seiner Jugend. Er war ein feingliedriger Desperado mit tief eingegerbten Falten in den Augenwinkeln und sonnenverbranntem Hals, trug ausgelatschte, aber überaus bequeme Stiefel und wirkte wie etwa fünfundzwanzig. Zu dieser Zeit arbeitete ich an meinem vierten Doktorat, einer Dissertation in Chemie. Er dagegen hatte in seinem Eifer, die Welt zu retten, eine Pause eingelegt, spannte auf dem Campus in Toronto aus und analysierte Speicherauszüge für irgendeinen armen Anthropologie-Studenten. An einem turbulenten, frühlingshaften Freitagabend trieben wir uns beide in der Studentenkaschemme rum, die Eingeweihte nur SK oder Stukka nannten. Ich kämpfte mich mühsam an einen Platz an der zerkratzten Theke heran, indem ich mich jedes Mal ein Stückchen näher schob, wenn der Druck der Leiber etwas nachließ; Dan jedoch thronte bereits auf einem der wenigen Barhocker, umgeben von Zigarettenkippen und vorübergehend verwaisten Plätzen, die offensichtlich belegt waren.
Ich war schon ein ganzes Stück vorgerückt, als er mir den Kopf zuwandte und eine sonnengebleichte Augenbraue hob. »Noch einen Schritt näher, mein Junge, und ich muss das als Annäherungsversuch werten.«
Ich sah ungefähr wie vierzig aus, und es passte mir überhaupt nicht, wenn mich jemand mein Junge nannte. Aber als ich ihm in die Augen blickte, kam ich zu dem Schluss, er müsse in Echtzeit wohl schon so viele Jahre auf dem Buckel haben, dass er mich jederzeit so nennen durfte. Ich wich ein Stück zurück und entschuldigte mich.
Er zündete sich eine Zigarette an und blies dem Barkeeper eine dichte, stinkende Wolke über den Kopf. »Mach dir keine Gedanken. Ich bin wahrscheinlich etwas verwöhnt, was Bewegungsspielraum angeht.«
Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich auf Bodenhöhe zuletzt jemanden über Bewegungsspielraum hatte reden hören. Aufgrund einer Sterblichkeitsrate, die bei null und einer Geburtenrate, die darüberlag, rückten sich die Menschen zwangsläufig immer näher auf die Pelle, woran auch die Abgänge durch Auswanderung und Kälteschlaf nichts ändern konnten.
»Hast du Weltraumtrips unternommen?«, fragte ich. Seine Augen blickten so wach, dass er dem Kälteschlaf bestimmt nicht eine einzige Sekunde persönlicher Erfahrung geopfert hatte – so jedenfalls schätzte ich ihn ein.
Er kicherte. »Nein, Sir. Ich doch nicht. Ich muss mich mit einem miesen Machojob rumschlagen, den’s nur auf Bodenhöhe gibt. Weltraumtrips sind doch Kinderkram. Ich brauche Arbeit.« Das Glas in seiner Hand klirrte so, als wollte es seine Aussage bekräftigen.
Es dauerte einen Moment, bis auf meinem Headmount-Display sein Woppel-Stand angezeigt wurde. Ich musste die Größe des Fensters anpassen, denn die Zahl hatte mehr Nullen, als auf mein Standarddisplay passten. Ich versuchte cool zu bleiben, aber er bemerkte wohl, dass meine Augen kurz nach oben zuckten und die Pupillen sich unwillkürlich weiteten. Erst spielte er ein bisschen den Bescheidenen, ließ es dann aber und zeigte ein stolzes Lächeln.
»Ich versuche, nicht allzu viel darauf zu geben. Manche Leute übertreiben es mit ihrer Dankbarkeit. « Offenbar bemerkte er auch das nächste Aufwärtszucken meiner Augen, als ich mir seine Woppel-History ansah. »Hör mal, lass das! Wenn du’s unbedingt wissen willst, werd ich’s dir erzählen. Weißt du, man kann auch gut ohne Hyperlinks leben. Man meint zwar, man würde sie schrecklich vermissen, aber das stimmt gar nicht.«
In diesem Moment machte es klick bei mir. Er war ein Missionar – einer dieser Exzentriker, die als Abgesandte der Bitchun Society in die finstersten Winkel der Welt geschickt werden, wo die Menschen, aus welchen Gründen auch immer, sterben, verhungern und an petrochemischen Abfällen ersticken wollen. Es ist erstaunlich, dass solche Gemeinschaften mehr als eine Generation überstehen; wer sich an die Regeln der Bitchun Society hält, lebt gewöhnlich länger als deren Kritiker. Die Missionare sind nicht sonderlich erfolgreich – man muss wirklich sehr überzeugend sein, um zu einer Kultur durchzudringen, die nahezu einem Jahrhundert an Propaganda widerstanden hat –, aber wenn man ein ganzes Dorf bekehrt, sackt man alles Woppel ein, das dort zu holen ist. Häufiger kommt es allerdings vor, dass Missionare aus einem Backup reanimiert werden, wenn man ein Jahrzehnt lang nichts mehr von ihnen gehört hat. Ich hatte noch keinen aus Fleisch und Blut getroffen.
»Wie viele erfolgreiche Missionen hast du denn schon hinter dir?«, fragte ich.
»Bist mir draufgekommen, wie? Hab gerade meine fünfte in zwanzig Jahren abgeschlossen. Ging um Konterrevolutionäre, die sich im alten Stützpunkt des Weltraum-Verteidigungskommandos auf Cheyenne Mountain verschanzt hatten und eine Generation später immer noch dort ausharrten.« Er fuhr sich mit den Fingerspitzen durch den Backenbart. »Deren Eltern hatten abtauchen müssen, nachdem ihre Ersparnisse aufgebraucht waren, und sie selbst benutzten keine Technik, die über ein einfaches Gewehr hinausging. Davon hatten sie allerdings reichlich. «
Daraufhin erzählte er die faszinierende Geschichte, wie er nach und nach erst die Anerkennung und dann das Vertrauen der Bergbewohner errungen und es schließlich auf ebenso hinterhältige wie wohltätige Weise missbraucht hatte: indem er ihre Gewächshäuser an Freie Energie ankoppelte, die eine oder andere genmanipulierte Getreidesorte einführte, ein paar Tote zum Leben erweckte und den Bergbewohnern die Ideale der Bitchun Society langsam näher brachte, bis sie selbst nicht mehr wussten, warum sie nicht genau das von Anfang an gewollt hatten. Inzwischen hatten die meisten von ihnen den Planeten verlassen, stießen mit Entdeckerfreude, unbegrenzten Energiereserven und unerschöpflichen Ressourcen zu neuen Grenzen vor und überbrückten die langweiligen Phasen der Reise durch Kälteschlaf.
»Wären sie auf dem Planeten geblieben, hätten sie den Schock, glaube ich, nicht überstanden. Weißt du, sie betrachten uns als den Feind und hatten schon alle möglichen Vorkehrungen für den Fall getroffen, dass wir sie angreifen und von dort wegbringen würden: Giftkapseln in hohlen Zähnen, Sprengfallen, geheime Rückzugsorte, Treffpunkte für die Überlebenden. Sie können ihren Hass auf uns einfach nicht überwinden, obwohl wir nicht einmal wissen, dass es sie gibt. Auf anderen Welten können sie sich immer noch einreden, sie führten ein hartes, bodenständiges Leben.« Erneut rieb er sich das Kinn; die harten Handschwielen kratzten über den Backenbart. »Aber was mich angeht, findet das wirkliche raue Leben immer noch hier, auf dieser Erde, statt. Jede der kleinen Enklaven stellt so etwas wie eine Alternativgeschichte der Menschheit dar. Was wäre zum Beispiel, wenn wir die Freie Energie in Anspruch genommen, aber auf die Möglichkeiten des Kälteschlafs verzichtet hätten? Was wäre, wenn wir den Kälteschlaf zwar angewendet hätten, aber nur bei Schwerkranken, nicht bei Leuten, die lediglich der Langeweile auf endlosen Busfahrten entkommen wollen? Oder Hyperlinks nutzen würden, aber auf keine Ad-hoc-kratie und kein Woppel zurückgreifen könnten? Jede dieser Alternativen ist wundervoll und hat ihren eigenen Reiz.«
Da ich die dumme Angewohnheit habe, mich nur um des Streitens willen zu streiten, sagte ich aus dem Bauch heraus: »Wundervoll? Na klar, nichts ist herrlicher als, sagen wir, zu sterben, zu verhungern, zu erfrieren, im eigenen Saft zu schmoren, zu töten, Grausamkeiten, Ignoranz, Schmerz und Elend zu erdulden. Das sind die Dinge, die ich wirklich vermisse.«
Immer-auf-Achse-Dan schnaubte verächtlich. »Meinst du etwa, ein Junkie vermisst es, nüchtern zu sein?«
Ich klopfte auf die Theke. »Hallo! Es gibt keine Junkies mehr!«
Er zündete eine weitere Zigarette an. »Aber du weißt doch wohl, was ein Junkie ist, nicht? Junkies vermissen die Nüchternheit deshalb nicht, weil sie sich gar nicht daran erinnern, wie intensiv sie in diesem Zustand alles ringsum erlebt haben und wie sehr der Schmerz die Freude versüßt hat. Wir können uns nicht mehr daran erinnern, wie es gewesen ist, den eigenen Lebensunterhalt mit Arbeit verdienen zu müssen; sich zu sorgen, mit dem Geld vielleicht nicht auszukommen, zu erkranken oder von einem Bus überfahren zu werden. Wir wissen nicht mehr, wie’s ist, wenn man Risiken eingeht, und wir wissen erst recht nicht, wie’s ist, wenn Risiken sich auszahlen.«
Er hatte nicht ganz unrecht. Hier stand ich, erst zum zweiten oder dritten Mal erwachsen und schon bereit, alles dranzugeben und irgendetwas anderes, ganz egal was, zu tun. Er hatte nicht ganz unrecht – aber ich wollte es nicht zugeben. »Das behauptest du. Ich behaupte, dass ich schon ein Risiko eingehe, wenn ich in einer Bar ein Gespräch anfange oder mich verliebe … Und was ist mit Leuten im Kälteschlaf? Ich kenne zwei Leute, die sich gerade für zehntausend Jahre in Kälteschlaf begeben haben! Erzähl mir bloß nicht, dass sie kein Risiko eingehen!« Um die Wahrheit zu sagen, lagen praktisch alle, die ich in meinen rund achtzig Jahren kennengelernt hatte, im Kälteschlaf, waren irgendwo unterwegs oder einfach abgetaucht. Es waren einsame Tage damals.
»Bruder, das läuft auf einen halbherzigen Selbstmord hinaus. So wie’s bei uns zugeht, können diese Leute von Glück sagen, wenn sie nicht einfach abgeschaltet werden, sobald’s Zeit für die Wiederbelebung wird. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist: Es wird hier allmählich ziemlich eng.«
Ich grummelte etwas Unverständliches vor mich hin und wischte mir die Stirn mit einer Serviette ab – an Sommerabenden war es im Stukka elend heiß. »Ja, ja, vor hundert Jahren, bevor Freie Energie zur Verfügung stand, ist es auf der Erde auch schon mal ein bisschen eng geworden. Damals gab’s zu viele Treibhausgase, zu viele Atombomben, mal war’s zu heiß und mal war’s zu kalt. Wir haben’s damals gerichtet, und wir werden’s wieder richten, wenn’s so weit ist. Ich werd noch in zehntausend Jahren hier sein, jede Wette, Mann, aber bis dahin hab ich vor, eine große Ehrenrunde zu drehen.«
Er legte den Kopf schräg und dachte kurz darüber nach. Wäre er einer meiner Kommilitonen gewesen, hätte ich angenommen, er lasse in seinem Kopf eine Suchroutine laufen, um seinen nächsten Geistesblitz mit ein paar Halbwahrheiten zu untermauern. Aber bei ihm war ich mir sicher, dass er wirklich über meine Worte nachdachte, auf die altmodische Art.
»Wäre ich in zehntausend Jahren immer noch hier, müsste ich schon total durchgeknallt sein. Junge, zehntausend Jahre! Vor zehntausend Jahren waren Ziegen der neuste Stand der Technik. Meinst du wirklich, dass du in hundert Jahrhunderten noch etwas sein wirst, das man als Mensch erkennen kann? Also, ich jedenfalls bin nicht daran interessiert, ein Posthumaner zu werden. Ich werde eines Tages aufwachen und mir sagen: ›Na gut, ich glaube, ich hab genug gesehen‹, und das wird mein letzter Tag sein.«
Ich hatte geahnt, worauf er hinauswollte, und nicht mehr zugehört, während ich mir meine Antwort zurechtlegte. Ich hätte wohl besser aufpassen sollen. »Aber warum? Warum nicht einfach ein paar Jahrhunderte im Kälteschlaf überbrücken und schauen, ob einen nicht irgendetwas begeistert, und wenn nicht, dann eben noch ein paar Jahrhunderte verschlafen? Warum etwas so Endgültiges?«
Er beschämte mich, indem er mit ernster Miene darüber nachdachte, so dass ich mir wie ein angesoffener Dummschwätzer vorkam. »Ich nehme an«, sagte er schließlich, »weil es sonst nichts Endgültiges mehr gibt. Mir war immer schon klar, dass ich eines Tages nicht mehr herumziehen, nicht mehr suchen, nicht mehr kämpfen und mit allem fertig sein würde. Es wird der Tag kommen, an dem für mich alles erledigt ist und ich nur noch aufhören kann.«
Wegen seiner Desperado-Ausstrahlung und seiner Lebensart nannten sie ihn auf dem Campus den Immer-auf-Achse-Dan. Irgendwie kam es dazu, dass er jedes Gespräch dominierte, das ich während der folgenden sechs Monate führte. Ein paar Mal pingte ich Dans Woppel an und konnte feststellen, dass es unaufhaltsam nach oben kletterte: Zunehmend erwarb er sich die Wertschätzung der Menschen, denen er begegnete.
In derselben Zeit wirtschaftete ich mein Woppel ziemlich in den Keller und brauchte alle Rücklagen von den Symphonien und den ersten drei Doktorarbeiten auf, indem ich im Stukka meinen Verstand versoff, an Bibliotheksterminals herummurkste und Professoren belästigte, bis ich jeden Respekt, den man mir früher entgegenbrachte, verspielt hatte. Nur Dan achtete mich aus irgendeinem Grund noch und lud mich regelmäßig zu einem Bier, einem Essen oder einem Kinobesuch ein.
Ich entwickelte das Gefühl, ich müsse etwas Besonderes sein – schließlich hatte nicht jeder einen derart extravaganten Kumpel wie Immer-auf-Achse-Dan, den legendären Missionar, der die einzigen Orte besucht hatte, auf die die Bitchun Society noch keinen Einfluss ausübte. Ich weiß nicht genau, warum er sich mit mir abgab. Er erwähnte ein paar Mal, dass ihm meine Symphonien gefallen hätten. Außerdem hatte er meine Dissertation in Ergonomie gelesen – darin hatte ich mich darüber ausgelassen, wie man Techniken zur Publikumslenkung und -überwachung in Themenparks auf städtische Umgebungen übertragen kann – und mochte meine Ausführungen. Aber ich glaube, letztlich lief es darauf hinaus, dass wir einfach Spaß daran hatten, uns aneinander zu reiben.
Gelegentlich unterhielt ich mich mit ihm über den gewaltigen Teppich der Zukunft, der sich gegenwärtig vor uns ausrollte, über die Gewissheit, dass wir früher oder später auf fremde Intelligenzen stoßen würden, über die unvorstellbaren Möglichkeiten, die sich vor jedem von uns auftaten. Er behauptete oft, eine Person, die sich in Kälteschlaf begebe, lasse damit klar erkennen, dass sich ihr Reservoir an Introspektion und Kreativität erschöpft habe; ohne inneren Kampf könne es keinen echten Sieg geben.
Wir führten anregende Wortgefechte und hätten sie bis in alle Ewigkeit fortsetzen können, ohne dass einer von uns als Sieger daraus hervorgegangen wäre. Ich konnte ihm das Zugeständnis abringen, dass das Woppel-System, die Anhäufung von virtuellem Kapital, das allein auf Reputation beruht, den eigentlichen Sinn des Geldes verwirklicht hatte. In früheren Zeiten hatte man, selbst wenn man pleite war, nicht verhungern müssen, falls man bei seinen Mitmenschen Ansehen genoss; war man dagegen reich, aber verhasst, konnte man sich mit keinem Geld der Welt Sicherheit und Frieden erkaufen. Indem das beziffert wurde, wofür Geld eigentlich stand – nämlich das persönliche Ansehen, das man bei Freunden und Nachbarn genoss –, konnte man seinen Erfolg viel genauer einschätzen.
Und dann führte er mich auf einen raffinierten, sorgfältig mit Ködern ausgelegten Abweg, der mir das Eingeständnis entlockte, dass wir zwar irgendwann auf fremde Intelligenzen mit ganz ungewöhnlichen, fantastischen Eigenschaften stoßen könnten, die Welt gegenwärtig jedoch unter einer etwas deprimierenden Gleichförmigkeit litt.
An einem schönen Frühlingstag präsentierte ich meine Abschlussarbeit zwei organischen Menschen und einem Professor, dessen Körper gerade einer Generalüberholung unterzogen wurde und dessen Bewusstsein über eine Freisprech-Verbindung mit dem Computer teilnahm, auf dem er derzeit gespeichert war. Alle drei mochten meine Arbeit. Anschließend zog ich meine Lammfelljacke über und suchte auf den süßlich nach Blumen stinkenden Straßen nach Dan.
Er war nicht aufzutreiben. Der Anthropologie-Student, den er mit seinen Kriegsgeschichten malträtiert hatte, sagte, Dan habe am Morgen seine Sachen gepackt und sei in die ummauerte Stadt Tijuana abgereist. Offenbar wolle er sich mit den dort ansässigen Nachkommen eines Zugs von US-Marines beschäftigen, die mit der Bitchun Society nichts zu tun haben wollten.
Und deshalb ging ich nach Disney World.
Als Hommage an Dan absolvierte ich den Flug in Echtzeit, in einer der winzigen Kabinen, die für jene von uns reserviert sind, die sich für einen zweistündigen Flug auf keinen Fall einfrieren und wie Holzbalken aufeinanderstapeln lassen wollen. Ich flog als Einziger in Echtzeit, aber eine Flugbegleiterin servierte mir pflichtschuldig ein Glas Orangensaft mit dem Volumen einer Urinprobe und ein gummiartiges, übel riechendes Käseomelett. Während der Autopilot eine Turbulenz umflog, starrte ich aus dem Fenster auf die schier unendliche Wolkendecke und fragte mich, wann ich Dan wiedersehen würde.
Eins
Meine Freundin hatte gerade fünfzehn Prozent meines Alters erreicht, und ich war altmodisch genug, dass es an mir nagte. Sie hieß Lil und lebte in zweiter Generation in Disney World. Ihre Eltern hatten der ursprünglichen Ad-hoc-kratie angehört, die die Verwaltung von Liberty Square, dem historischen Viertel, und Tom Sawyers Insel übernommen hatte. Lil war im wahrsten Sinne des Wortes in Walt Disney World aufgewachsen, und das merkte man.
Man merkte es wirklich. Sie war peinlich sauber und ordentlich, von ihrem glänzend roten Haar bis zu ihrer sorgfältigen Buchführung über jedes Getriebe und jedes Zahnrad in der Animatronik, für die sie verantwortlich zeichnete. Ihre Angehörigen hatten sich für ein paar Jahrhunderte auf Eis gelegt und steckten in Kanopen, die in Kissimee lagerten.
An einem schwülen Mittwoch ließen wir die Füße über den Rand des Bootspiers baumeln, an dem der Raddampfer Liberty Belle vertäut war, und sahen im Mondlicht zur Fahne der Konföderierten hinüber, die schlaff über Fort Langhorn auf Tom Sawyers Insel hing. Das Magische Königreich war geschlossen. Die letzten Gäste hatten wir gerade durch das Bahnhofstor an der Hauptstraße gescheucht. Jetzt konnten wir endlich erleichtert aufatmen, einen Teil unserer Kostümierung ablegen und uns entspannen, während die Grillen zirpten.
Ich war zwar mehr als ein Jahrhundert alt, aber es hatte immer noch etwas Magisches, bei Mondlicht den Arm um die zarten, warmen Schultern eines Mädchens zu legen, fern vom Gewusel der Putzkolonnen an den Drehkreuzen, und die warme, feuchte Luft zu atmen. Lil ließ den Kopf an meine Schulter sinken und drückte mir einen hauchzarten Kuss unters Kinn.
»Her name was McGill«, sang ich leise.
»But she called herself Lil«, sang sie, und ich spürte ihren Atem an meinen Schlüsselbeinen.
»And everyone knew her as Nancy«, sang ich.
Ich war erstaunt, dass sie die Beatles kannte. Schließlich waren sie schon in meiner Jugend ein alter Hut gewesen. Aber ihre Eltern hatte ihr eine gründliche – wenn auch eklektische – Ausbildung zukommen lassen.
»Willst du mich auf meiner Runde begleiten?«, fragte sie. Diese Runde zählte zu den Pflichten, die ihr am liebsten waren. Sobald die Touristenmeute verschwunden war, leuchtete sie mit der Taschenlampe jeden Zoll der Fahrgeschäfte ab, für die sie verantwortlich war. Wir sahen uns beide gern an, welcher Mechanismus hinter dem vordergründigen Zauber steckte. Vielleicht war das auch der tiefere Grund dafür, dass ich an unserer Beziehung, trotz aller Magie, gern herumkrittelte.
»Ich bin ziemlich kaputt. Falls du nichts dagegen hast, würde ich hier gern noch etwas sitzen bleiben.«
Sie gab einen theatralischen Seufzer von sich. »Na, meinetwegen, du alter Mann.« Als sie eine Hand ausstreckte und mir leicht in die Brustwarze kniff, zuckte ich wohlig zusammen. Ich glaube, der Altersunterschied machte auch ihr zu schaffen, obwohl sie mich neckte, wenn ich darauf zu sprechen kam.
»Ich glaube, eine kleine Besichtigung des Spukhauses schaffe ich noch, wenn sich meine müden Knochen vorher ein bisschen ausruhen dürfen. « Ich spürte ihr Lächeln an meiner Brust. Sie mochte das Spukhaus sehr, so sehr, dass sie im Ballsaal gern ihre Runden mit den Gespenstern drehte und auf dem staubigen Parkett Walzer mit ihnen tanzte; und sie legte sich auch gern mit den Marmorbüsten in der Bibliothek an, deren Blicke einem beim Vorbeigehen folgten, und versuchte sie niederzustarren.
Mir gefiel es dort auch, aber am liebsten saß ich mit ihr einfach so da und betrachtete das Wasser und die Bäume. Ich wollte mich gerade aufraffen, als ich in meiner Hörschnecke ein leises Ping vernahm. »Mist«, sagte ich. »Ich bekomme gerade einen Anruf herein.«
»Sag einfach, du bist beschäftigt.«
»Mach ich.« Ich nahm den Anruf im subvokalen Modus entgegen. »Julius hier.«
»Hallo, Julius. Hier ist Dan. Hast du einen Moment Zeit?«
Ich kannte zwar tausend Dans, doch diese Stimme konnte ich sofort zuordnen, obwohl unser letztes gemeinsames Besäufnis im Stukka zehn Jahre her war. Ich stellte mein Subvokal-Modul auf Warteschleife. »Lil, es ist ein wichtiger Anruf. Macht’s dir was aus, wenn ich …?«
»Aber nein, natürlich nicht«, erwiderte sie mit sarkastischem Unterton, setzte sich aufrecht hin und entzündete ihre Crack-Pfeife.
»Dan?« Ich ging wieder auf Subvokal-Modus. »Lange nichts von dir gehört.«
»Ja, Junge, das kannst du laut sagen.« Seine Stimme brach plötzlich und er begann zu schluchzen.
Ich wandte mich Lil zu und bedachte sie mit einem so eindringlichen Blick, dass sie die Pfeife sinken ließ. »Kann ich irgendwie helfen?«, fragte sie leise, aber ohne zu zögern. Ich winkte ab und schaltete das Telefon in den Freisprechmodus. In der von Grillen durchzirpten Stille klang meine Stimme unnatürlich laut.
»Wo steckst du, Dan?«
»Hier in Orlando. Ich hänge gerade auf der Insel der Freuden fest.«
»Gut, dann würde ich sagen, wir treffen uns im Abenteurerclub, oben auf dem Sofa an der Tür. Ich bin in …« Ich warf Lil einen Blick zu. Sie kannte die Wege, die nur das Personal benutzte, besser als ich und streckte zehn Finger hoch. »Bin in zehn Minuten da.«
»Gut«, sagte er. »Entschuldige.« Er hatte seine Stimme wieder unter Kontrolle. Ich schaltete aus.
»Was ist los?«, fragte Lil.
»Ich weiß nicht genau. Ein alter Freund ist in der Stadt. Hört sich an, als hätte er Probleme.«
Lil deutete mit dem Zeigefinger auf mich und tat so, als drückte sie auf einen Abzug. »Hier«, sagte sie. »Ich hab gerade die günstigste Route zur Insel der Freuden in dein öffentliches Verzeichnis kopiert. Halt mich auf dem Laufenden, ja?«
Ich begab mich zum Tunneleingang unweit der Halle der Präsidenten. Während ich die Treppe hinunterstapfte, wurde das Summen aus dem unterirdischen Tunnelsystem immer lauter. Ich nahm das Laufband zum Personalparkplatz und schwirrte in meinem kleinen Wagen ab, auf die Insel der Freuden.
Als ich Dan entdeckte, saß er auf einem L-förmigen Sofa unter einer Reihe getürkter Fotos von Jagdausflügen mit humorigen Bildunterschriften. Am Fuß der Treppe bedienten die Ensemblemitglieder die Animatronik-Masken und -Figuren und plauderten mit den Gästen.
Dan, der apathisch und in sich zusammengesunken dahockte, sah knapp über fünfzig aus und wirkte leicht untersetzt. Sein Gesicht war von Bartstoppeln überzogen und die Tränensäcke ähnelten den Augenringen eines Waschbären. Während ich auf ihn zuging, pingte ich sein Woppel an und musste zu meiner Bestürzung feststellen, dass sein Ansehen nahezu auf null gesunken war.
»Meine Güte«, sagte ich, als ich mich neben ihm niederließ. »Siehst du scheiße aus, Dan.«
Er nickte. »Die äußere Erscheinung kann zwar täuschen, aber in diesem Fall hast du den Nagel auf den Kopf getroffen.«
»Möchtest du drüber reden?«
»Aber nicht hier, ja? Ich hab gehört, dass sie hier jeden Tag um Mitternacht das Neue Jahr einläuten. Ich fürchte, das wäre mir im Moment ein bisschen zu viel.«
Ich führte ihn zu meinem Wagen und kurvte zu dem Häuschen, das ich mit Lil draußen in Kissimmee bewohnte. Während der zwanzigminütigen Fahrt rauchte er acht Zigaretten, rammte sich eine nach der anderen in den Mund und füllte meinen Sportwagen mit stinkenden Rauchwolken. Ich beobachtete ihn im Rückspiegel. Er hatte die Augen geschlossen und sah in dieser Ruhestellung fast wie ein Toter aus. Ich konnte kaum glauben, dass dies mein lebensprühender Action-Held aus alten Zeiten sein sollte.
Unterwegs wählte ich heimlich Lils Nummer. »Ich bring ihn mit nach Hause«, teilte ich ihr in subvokalem Modus mit. »Er ist in einem miesen Zustand. Ich weiß nicht genau, was mit ihm los ist.«
»Ich mach das Sofa zurecht«, sagte sie, »und koche einen Kaffee. Hab dich lieb.«
»Ich dich auch.«
Als wir uns dem kitschigen kleinen, windschiefen Ranchhaus näherten, schlug er die Augen auf. »Du bist ein echter Kumpel, Jules.« Ich winkte ab. »Doch, wirklich. Ich hab überlegt, wen ich anrufen könnte, und du bist der Einzige, der mir eingefallen ist. Ich hab dich vermisst, Junge.«
»Lil sagt, sie kocht einen Kaffee. Du siehst so aus, als könntest du einen gebrauchen.«
Lil saß auf dem Sofa und wartete schon auf uns. Auf dem Beistelltisch lagen eine zusammengefaltete Decke und ein Kissen. Daneben standen Becher aus Disneyland Beijing und eine Kanne Kaffee. Sie erhob sich und streckte die Hand aus. »Ich bin Lil.«
»Und ich Dan. Ist mir ein Vergnügen.«
Ich wusste, dass sie gerade sein Woppel anpingte, und bemerkte den Ausdruck plötzlicher Missbilligung auf ihrem Gesicht. Alte Knaben wie wir, die schon vor der Einführung des Woppel gelebt haben, wissen zwar, dass die Reputation wichtigist; aber für die Kids ist sie die ganze Welt. Jemand ohne Woppel-Punkte ist von vornherein verdächtig. Lil überwand ihr Misstrauen aber schnell wieder, lächelte und wischte sich die Hand verstohlen an der Jeans ab. »Kaffee?«, fragte sie.
»Oh ja, gern.« Dan ließ sich aufs Sofa plumpsen.
Sie goss ihm eine Tasse ein und stellte sie auf einen Untersetzer auf dem Kaffeetisch. »Ich lass euch dann mal in Ruhe plaudern«, bemerkte sie und ging zur Schlafzimmertür.
»Nein«, sagte Dan. »Warte bitte. Wenn du nichts dagegen hast … Ich würde gern auch mit jemand Jüngerem reden.«
Sie setzte den Blick emsiger Hilfsbereitschaft auf, den alle Ensemblemitglieder der zweiten Generation aus dem Stegreif beherrschten, nahm in einem Lehnstuhl Platz, holte ihre Pfeife hervor und entzündete ein Klümpchen Crack. Ich hatte meine Crack-Phase schon hinter mich gebracht, als sie noch nicht geboren war, kurz nachdem eine Soft-Variante des Zeugs den Markt überschwemmt hatte, und kam mir immer uralt vor, wenn ich Lil oder ihre Freunde mit einem Pfeifchen sah. Dan überraschte mich, indem er eine Hand ausstreckte und die Pfeife entgegennahm. Er tat einen kräftigen Zug, dann gab er sie zurück.
Danach schloss er wieder die Augen, grub sich die Fäuste in die Augenhöhlen, nippte an seinem Kaffee. Offensichtlich überlegte er, wo er anfangen sollte.
»Um es zusammenzufassen: Ich hab mich für mutiger gehalten, als ich wirklich bin«, begann er.
»Das geht doch jedem so«, erwiderte ich.
»Ich hab wirklich gedacht, ich könnte es schaffen. Ich wusste, dass mir eines Tages die Herausforderungen ausgehen würden, dass mich nichts mehr interessieren würde. Ich wusste, dass ich eines Tages am Ende sein würde. Du erinnerst dich sicher, wir haben immer darüber gestritten. Ich war mir sicher, dass ich irgendwann am Ende sein und mir dann nichts mehr übrig bleiben würde als abzutreten. Und an diesem Punkt bin ich jetzt angekommen. Auf der Erde gibt’s keinen einzigen Ort mehr, der nicht unter dem Einfluss der Bitchun Society steht. Es ist nichts mehr übrig, woran ich mitwirken will.«
»Dann leg dich einfach für ein paar Jahrhunderte auf Eis«, sagte ich. »Schieb die Entscheidung auf.«
»Nein!«, rief er so laut, dass wir beide zusammenzuckten. »Ich bin erledigt. Es ist vorbei!«
»Dann mach’s doch«, sagte Lil.
»Ich kann’s nicht«, schluchzte er und vergrub das Gesicht in den Händen. Er weinte wie ein Baby; die rauen, lauten Schluchzer erschütterten den ganzen Körper. Lil verzog sich in die Küche, holte ein Papiertuch und drückte es mir in die Hand. Ich setzte mich neben ihn und tätschelte ihm unbeholfen den Rücken.
»Mein Gott«, murmelte er in seine Hände hinein. »Mein Gott.«
»Dan?«, fragte ich leise.
Er richtete sich auf, nahm das Tuch und wischte sich Gesicht und Hände ab. »Danke. – Ich hab ja versucht, was draus zu machen, wirklich. Hab die letzten acht Jahre in Istanbul verbracht und Artikel über meine Missionen und die Gemeinschaften geschrieben, die ich kennengelernt hatte. Hab auch Folgestudien angestellt, Interviews durchgeführt. Niemand war daran interessiert, nicht einmal ich selbst. Hab eine Menge Hasch geraucht, aber es hat nicht geholfen. Und so bin ich eines Morgens aufgewacht, zum Basar gegangen und hab mich von den Leuten verabschiedet, mit denen ich mich dort angefreundet hatte. Dann bin ich zur Apotheke gegangen und hab mir eine tödliche Injektion vorbereiten lassen. Der Apotheker hat mir noch viel Glück gewünscht. Danach bin ich in mein Zimmer zurückgekehrt, hab den ganzen Nachmittag mit der Injektionspistole dagesessen und irgendwann beschlossen, eine Nacht darüber zu schlafen. Als ich am nächsten Morgen aufstand, ging alles wieder von vorn los. Nach eingehender Prüfung meines Innenlebens musste ich mir eingestehen, dass mir schlicht der Mumm dazu fehlt. Ich hatte einfach nicht den Mumm. Ich hab schon hundert Knarren in die Mündung gestarrt, tausend Messer an der Kehle gespürt, aber einfach nicht den Mumm, diesen Schritt zu tun.«
»Du warst einfach zu spät dran«, warf Lil ein.
Wir drehten uns beide zu ihr um.
»Du kommst ein Jahrzehnt zu spät. Schau dich doch an. Du bist ein Jammerlappen. Wenn du dich jetzt umbringen würdest, wärst du nur ein abgewrackter Verlierer, der nichts auf die Reihe bringt. Wenn du’s vor zehn Jahren getan hättest, wärst du ein Held gewesen – ein Champion, der auf Dauer abtritt.« Sie stellte ihren Becher unnötig heftig ab.
Manchmal sind Lil und ich haargenau auf derselben Wellenlänge. Doch zuweilen kommt sie mir so vor, als lebte sie auf einem anderen Stern. Ich konnte nur schockiert dasitzen und mir anhören, wie sie fröhlich über den besten Zeitpunkt für den Selbstmord meines alten Freundes debattierte.
»A day late and a dollar short«, seufzte er.
»Dann sitz hier nicht einfach rum«, sagte sie. »Du weißt, was du zu tun hast.«
»Was denn?«, fragte ich, unwillkürlich verärgert über ihren Ton.
Sie sah mich so an, als ob ich mich absichtlich dumm stellte. »Er muss wieder nach oben kommen. Er muss sich zusammenreißen, auf Vordermann bringen, produktive Arbeit leisten. Sein Woppel wieder hochbringen. Dann kann er sich mit Würde von der Welt verabschieden.«
Ich hatte noch nie etwas derart Idiotisches gehört. Dan allerdings hob eine Augenbraue und sah sie nachdenklich an. »Wie alt bist du eigentlich?«
»Dreiundzwanzig.«
»Ich wünschte, ich wäre mit dreiundzwanzig schon so klug gewesen.« Er seufzte und setzte sich auf. »Kann ich bei euch wohnen, solange ich damit beschäftigt bin?«
Ich sah Lil von der Seite an. Sie überlegte einen Moment, dann nickte sie.
»Klar, Kumpel, sicher«, sagte ich und klopfte ihm auf die Schulter. »Du siehst ziemlich fertig aus.«
»Fertig ist maßlos untertrieben«, erwiderte er.
»Na dann, gute Nacht.«
Zwei
Die Ad-hoc-kratie¬ die auf spontanen Zweck- oder Projektgemeinschaften basiert, funktioniert gut, meistens jedenfalls. Lils Angehörige hatten mit mehreren gleich gesinnten Seelen die Organisation von Liberty Square übernommen. Sie leisteten gute Arbeit, ihr Woppel schoss in die Höhe, und wären andere dahergekommen und hätten sie zu verdrängen versucht, hätten die Gäste sie derart zur Schnecke gemacht, dass sie in keinem Pissoir mehr willkommen gewesen wären. Oder sie hätten es auf eine ganz neuartige, radikale Weise anpacken müssen, um Lils Eltern und ihren Freunden Konkurrenz zu machen und sie zu übertreffen.
Es konnte trotzdem den Bach runtergehen. Es gab Anwärter auf den Thron – eine Gruppe, die mit der ursprünglichen Ad-hoc-kratie zusammengearbeitet und sich dann auf andere Betätigungen verlegt hatte. Einige hatten studiert, andere Filme gedreht, Bücher geschrieben oder waren nach Disneyland Beijing gegangen, um dort beim Aufbau zu helfen. Ein paar von ihnen hatten sich einige Jahrzehnte auf Eis gelegt.
Sie kehrten mit einer klaren Botschaft nach Liberty Square zurück: Die Attraktionen müssen auf den neusten Stand gebracht werden. Doch die Ad-hoc-kraten von Liberty Square waren die strammsten Konservativen im Magischen Königreich und hielten ungeachtet des übrigen Parks, in dem es praktisch täglich etwas Neues gab, an ihrer altmodischen Technik fest. Die heimgekehrte Veteranengruppe dagegen stand mit den übrigen Parkbetreibern auf einer Seite, genoss deren Unterstützung, und es sah alles danach aus, als könnte sie einen erfolgreichen Vorstoß unternehmen.
Und deshalb musste Lil darauf achten, dass die dürftigen Attraktionen von Liberty Square von Pannen verschont blieben: die Halle der Präsidenten, der Flussdampfer Liberty Belle und das legendäre Spukhaus, wahrscheinlich die coolste Attraktion, die den fiebrigen Köpfen der alten Disney-Imagineure entsprungen war.
Ich fand Lil in den Garderoberäumen in der Halle der Präsidenten, wo sie gerade an Lincoln dem Zweiten – der Reserve-Animatronik – herumbastelte. Lil versuchte von jeder Figur zwei Exemplare in Gang zu halten, für den Fall, dass eine ausfiel. Innerhalb von fünf Minuten konnte sie einen defekten Roboter austauschen – mehr ließ die Publikumsüberwachung auch nicht zu.
Seit Dans Ankunft waren zwei Wochen vergangen. Obwohl ich ihn in dieser Zeit kaum gesehen hatte, beeinflusste seine Gegenwart spürbar unser Leben. Ein neuer und nicht unangenehmer Geruch erfüllte unser kleines Ranchhaus, eine Aura von wiedergewonnener Jugend, Hoffnung und Verlust, kaum wahrnehmbar durch den Duft der tropischen Blumen, die auf unserer Veranda die Köpfe hängen ließen. Drei- bis viermal am Tag klingelte mein Telefon: Dan meldete sich von seinen Streifzügen durch den Park, die er nur deswegen unternahm, um irgendwie persönliches Kapital anzuhäufen. Seine Begeisterung und sein Engagement waren ansteckend und versetzten mich in eine Scheiß-auf-alles-und-dreh-auf-Stimmung.
»Du hast Dan knapp verpasst«, sagte Lil. Sie hatte den Kopf in Lincolns Brustkorb gesteckt und hantierte mit einer Lötlampe und einem Vergrößerungsglas herum. Wenn sie sich so hinunterbeugte, das rote Haar straff zurückgebunden, Schweißtropfen auf den dünnen, sommersprossigen Armen, und nach Mädchenschweiß und Schmiermitteln roch, wünschte ich mir oft, irgendwo hinter der Bühne hätte eine Matratze gelegen. Ich beschränkte mich darauf, ihr liebevoll das Hinterteil zu tätscheln, und sie reckte sich wohlig. »Dan sieht jetzt besser aus.«
Seit seiner Verjüngung sah er wieder wie fünfundzwanzig aus, so wie ich ihn von früher her in Erinnerung hatte. Er wirkte hager und zäh wie eh und je, doch die niedergeschlagene Körperhaltung, die mich bei unserem Wiedersehen im Abenteurerclub so bestürzt hatte, war immer noch da. »Was wollte er denn?«
»Er war mit Debra unterwegs. Wollte mich darüber aufklären, was sie vorhat.«
Debra gehörte zur alten Garde und war eine frühere Gefährtin von Lils Eltern. Sie hatte ein Jahrzehnt in Disneyland Beijing verbracht und Fahrsimulationen programmiert. Wäre es nach ihr gegangen, hätten wir jede herrliche Rube Goldberg -Maschine im Park abmontiert und durch jungfräuliche weiße Simulatorkabinen auf riesigen Hydraulikgestellen ersetzt.
Das Problem bestand darin, dass ihre Simulationen wirklich hervorragend waren. Ihre Retrospektive von Filmklassikern bei MGM war atemberaubend – die Star Wars-Sequenz hatte bereits hunderte Fan-Websites inspiriert, die Millionen Hits verzeichneten.
Ihr Erfolg hatte ihr zu einem Geschäft mit den Ad-hoc-kraten des Abenteuerlands verholfen, für die sie die Piraten der Karibik wiederbelebte. Die Kulissen steckten voller Anspielungen auf die Klassiker, Schatztruhen, Entermesser und Bugspriets inbegriffen. Es war ein beeindruckendes Szenario; die Piraten waren das letzte Fahrgeschäft, dessen Montage der alte Walt noch persönlich überwacht hatte, und wir hatten es bisher als Heiligtum betrachtet. Doch Debra hatte eine Piraten-Simulation in Beijing installiert, die die Legende von Chend I Sao aufgriff, der chinesischen Piratenkönigin aus dem Neunzehnten Jahrhundert, und es hieß, damit habe sie den ganzen Park vor dem Ruin und dem Sturz in die Bedeutungslosigkeit gerettet. Die Neuauflage dieser Installation in Florida würde die besten Attraktionen des chinesischen Gegenstücks kopieren. Vorgesehen waren KI-betriebene Simulationen, die miteinander und mit den Gästen kommunizierten, sie jedes Mal namentlich begrüßten, wenn sie vorbeifuhren, und ihnen altersgerechte Geschichten über die Piraten der Weltmeere erzählten; eine spektakuläre Tauchfahrt durch eine Totenstadt aus verrottendem Müll auf dem Meeresboden; schauriges Gepfeife und Geheul, wenn die Simulation einen wilden, atemberaubenden Sturm nachempfand. Allerdings sollten sich Themen und Darstellung an der westlichen Tradition orientieren. Also würden Duftschwaden jamaikanischer Pfeffersauce durch die Lüfte wabern, afro-karibische Akzente zu hören sein und die Choreografien der Schwertkämpfe sich an den Vorlagen jener Piraten ausrichten, die einst durch die blauen Meere der Neuen Welt gekreuzt waren. Reihen gleichförmiger Simulatorkabinen sollten künftig den Platz einnehmen, der derzeit noch von den sperrigen Fahrgeschäften und Dioramen beansprucht wurde. Ziel war dabei auch, das Fassungsvermögen an Zuschauern zu verfünffachen und deren Durchlaufzeit zu halbieren.
»Und was hat Debra vor?«
Lil löste sich von den mechanischen Innereien des Gouverneurs Richard Oglesby, Abraham Lincolns Mann fürs Grobe, und zog scherzhaft eine Grimasse, als wäre sie ernsthaft beunruhigt. »Sie ist gerade damit beschäftigt, die Piraten auf Vordermann zu bringen – und sie leistet fantastische Arbeit. Sie und ihre Leute sind dem Zeitplan weit voraus und machen im Netz bereits Furore. Die einflussreichen Gruppen überschlagen sich geradezu. « Inzwischen war alles Scherzhafte aus ihrem Gesicht verschwunden und echter Sorge gewichen.
Sie wandte sich ab, schloss den Deckel des alten Abe und tat so, als feuerte sie mit einem Gewehr auf ihn. Er setzte sich geschmeidig in Bewegung und nahm nacheinander verschiedene