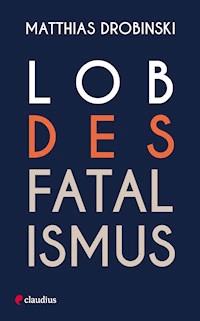
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Claudius Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit jeher hat der Fatalismus einen schlechten Ruf. Philosophen, Theologen und Politiker haben ihn im Namen der Willensfreiheit bekämpft. Und doch ist es an der Zeit, ihn neu zu entdecken – als Tugend, als Haltung und als Möglichkeit, das Leben zu meistern. Der moderne Mensch hat sich ganz der Souveränität verschrieben, will dem Leben seinen Willen aufzwingen, um doch regelmäßig zu scheitern. Jeder Plan hat seine Grenzen dort, wo er plötzlich mit dem Ungeplanten konfrontiert wird. Bert Brecht wusste davon ein Lied zu singen. Fatalismus dagegen bedeutet Gelassenheit. So viele Dinge kann man nicht ändern im Lauf der Welt – und man muss es auch nicht können. Viel mehr Sinn macht es, die eigene Wirkmacht nicht zu überschätzen und dem Unverfügbaren Tribut zu zollen. Anders gesagt: Fatalismus macht cool.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 82
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
Machen sie sich denn gar keine Sorgen? Eine Hommage an Rudolf Iwanowitsch Abel, den kleinen Sowjetspion
Warum der Fatalismus einen schlechten Ruf hat – nicht ganz zu Unrecht
Et kütt, wie et kütt: Warum es trotzdem an der Zeit ist, einen aufgeklärten und partiellen Fatalismus zu loben
Fatalismus befreit von der Pest der Glückssuche und der Lebensoptimierung
Der Fatalismus nimmt dem Lebensende den Schrecken – und vorher den diversen Lebenswenden auch
Der Fatalismus erhebt Einspruch, wenn Sicherheit zum höchsten Gut ernannt wird
Der Gott der Verunsicherung und der Glaube auf schwankendem Boden
Nachwort
VORWORT
Um es gleich vorweg zu sagen: Dieses Buch ist kein Ratgeber. Der Ratgeber weiß, wo es lang geht. Er nimmt den Leser bei der Hand, führt ihn hinaus aus der Krise und hinein ins bessere Leben. Der Ratgeber hat einen Katalog guter Ratschläge parat, passt der eine nicht, dann sicher der andere. Er ist hilfreich, edel, gut und manchmal penetrant in seiner Selbstgewissheit und Hilfsbereitschaft. Wenn der Leser ausgelesen hat, stellt er den Ratgeber aufseufzend zurück ins Regal und sagt: So ist’s! Er ändert dann sein Leben ein wenig, und nach ein paar Monaten kehrt der alte Schlendrian wieder ein, bis das Leiden wieder da ist und der Leidende sagt: Ich bräuchte mal einen Ratgeber. Einen, der Antwort gibt und Sicherheit. Einen, der weiß, wo es lang geht. Kein schlechtes Geschäftsmodell.
Der Autor dieses Buches ist kein Freund von Ratgebern, vor allem dann nicht, wenn sie ganz genau wissen wollen, wo es lang geht zum optimalen Selbst. Er selber weiß nämlich nicht immer so recht, wo es lang geht. Er tastet sich eher auf rutschigem Boden durchs Gestrüpp, manchmal gebückt, gar auf allen Vieren; manchmal beneidet er jene, die da schon alle Wege wissen. Er will es aber, wenn er es recht bedenkt, auch gar nicht anders haben. Er glaubt, einen Kompass zu haben, der ihm die Richtung zeigt – nur hilft der nicht immer jeden Tag im unübersichtlichen Gelände. Die Lebensratschläge, die er bislang erteilt hat, waren von begrenzter Qualität und Wirkung: Mal halfen sie, mal auch nicht. Vorsicht also: Die Umsetzung der hier aufgeschriebenen Gedanken ins konkrete Leben erfolgt auf eigene Gefahr. Der Autor hätte nichts dagegen, wenn die Eine oder der Andere nach dieser Lektüre ihr oder sein Leben änderte. Fertige Konzepte dafür hat er allerdings nicht, und bedrängen möchte er erst recht niemanden.
Diesem Buch liegt auch keine geschlossene Philosophie zugrunde, dann wäre jetzt, nach zehn Jahren Vorarbeit, ein Standardwerk mit tausend Seiten fällig. Der Autor ist aber kein Wissenschaftler, sondern ein Journalist, ausgestattet mit dem gediegenen Halbwissen seines Berufsstandes, und der Erfahrung aus zwei Jahrzehnten politischer, religiöser und kirchlicher Berichterstattung, nicht mehr, nicht weniger. Und das „Lob des Fatalismus“, das er auf den Titel gehoben hat, singt er dann auch noch mit einigen Einschränkungen, manchem Wenn und Aber und Ach und Weh. Er kann den Menschen, die das lesen, nicht die Unsicherheit nehmen, vielleicht verstärkt er sie am Ende sogar – er ist nun mal ein schlechter Ratgeber.
Trotzdem ist er der Auffassung, dass es an der Zeit ist, das Lob des Fatalismus anzustimmen, eines aufgeklärten, und ja: partiellen Fatalismus. Er bürstet den Begriff gegen den Strich: Dieser Fatalismus hat nichts zu tun mit bequemer, zynischer oder depressiver Resignation vor den Zuständen der Welt und dem Lauf des Lebens. Sein Lied zu singen heißt aber, auf alle zu pfeifen, die einem einreden möchten, man müsse sein Leben immer ganz in der Hand und fest im Griff haben und seines Glückes eigener Schmied sein. Es heißt, auf die zu pfeifen, die den Leuten einreden, sie müssten in der schlimmsten Krise eine Chance sehen und die Schläge des Schicksals positiv, und dass man nur immer an sich arbeiten müsse, um ein optimaler, gar idealer Mensch zu werden. Und es heißt, jenen zu widersprechen, die Sicherheit und Kontrolle im Land für das höchste Gut halten; allen, die Angst predigen, um die Rechte der Bürger einzuschränken und alles Fremde auszugrenzen, das verunsichern könnte. Der aufgeklärte Fatalismus setzt aber auch dem Weltverbesserungspathos Grenzen, der Phantasie, eine schöne neue Welt sei planbar und in einem Willensakt herstellbar. Sie muss unvollständig bleiben, diese Welt, will sie menschengemäß sein. Das Unplanbare und Unvorhersehbare gehört zu ihrem Wesen. Gerade das aber verunsichert die Menschen, seit sie über sich und die Welt nachdenken. Eine gute Portion Fatalismus im Leben löst das Problem nicht. Man kann aber besser mit ihm leben. Zum Schluss wird dieses Buch vom Vertrauen und auch vom Wert der Gnade reden und vom Gottvertrauen auf dem schwankenden Boden des Lebens, und der Autor sagt gleich: Es muss und soll da nicht jeder mitgehen. Das Nein zu diesem Gedanken des Autors ist so berechtigt wie das Ja.
Denn dieses Büchlein ist im Wortsinn ein Essay, die Präsentation eines Abwägens, Suchens und Versuchens. Die Essays, die der französische Autor Michel de Montaigne im 16. Jahrhundert schrieb, waren Gegenentwürfe zu den hochfahrenden scholastischen Gedankenburgen mit ihrem Absolutheitsanspruch, mit ihren hohen Mauern und geschlossenen Toren. Montaigne wagte, skeptisch zu fragen. Das brachte seine Werke auf den Index der verbotenen Bücher der katholischen Kirche; die Mauern des Wahrheitsanspruchs zu schleifen und die Türen zu öffnen kann gefährlich werden. Der Autor hat es da heute einfacher. Er kann frei schreiben. Und das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist Widerspruch. Der allerdings ist erwünscht. Und wenn darüber hinaus die Lektüre anregt und Spaß macht, ist er sogar ein bisschen glücklich.
Machen sie sich denn gar keine Sorgen? Eine Hommage an Rudolf Iwanowitsch Abel, den kleinen Sowjetspion
Rudolf Iwanowitsch Abel kam 1903 in Großbritannien auf die Welt und starb 1971 in Moskau, dazwischen war er Spion für die Sowjetunion in England und wäre fast ermordet worden in Stalins Säuberungsaktionen. Er ging, wieder als Agent, 1948 in die USA und spionierte dort das amerikanische Atomwaffen-Programm aus. 1957 wurde er enttarnt und kam ins Gefängnis; 1962 tauschte ihn die Sowjetunion gegen zwei abgestürzte Piloten des Spionageflugzeugs U2 aus – auf der Glienicker Brücke zwischen Berlin-West und dem damals ostdeutschen Potsdam. Der Regisseur Steven Spielberg hat den Stoff in seinem Film „Bridge of Spies“ verarbeitet, der vom Irrsinn des Kalten Krieges erzählt und vom tapferen Anwalt James B. Donovan, der ans Rechtssystem und die Werte der Vereinigten Staaten glaubt. Er bewahrt den gefangenen Spion vor der Hinrichtung und macht dann den Austausch mit den gefangenen US-Agenten möglich; nebenbei rettet er noch einen unbedarften amerikanischen Studenten, der in die Fänge der DDR-Staatssicherheit geraten ist.
Für einen Versuch über den Fatalismus aber ist nicht der tatkräftige Anwalt von Bedeutung, Steven Spielbergs Held also, sondern Rudolf Abel, der Spion; im Film spielt ihn der britisch-amerikanische Schauspieler Mark Rylance großartig lakonisch. Dieser Rudolf Abel fällt von einer aussichtslosen Lage in die nächste. Die Amerikaner enttarnen und verhaften ihn; Staatsanwaltschaft, Gericht und Politik wünschen einen kurzen, spektakulären Schauprozess, an dessen Ende der Tod Abels auf dem elektrischen Stuhl stehen soll. Gegen alle Wahrscheinlichkeit kann der Anwalt dieses Ende verhindern. Ein paar Jahre später soll dann der Russe gegen die in Moskau gefangen gehaltenen US-Piloten ausgetauscht werden. Ob das sein Glück ist oder sein Verderben, weiß Abel allerdings nicht. Der sowjetische Geheimdienst KGB könnte ihn, wie so viele gefangene Soldaten und Spione zuvor, für einen Verräter halten und ins Lager in Sibirien schicken, in den langsamen Tod auf dem Archipel Gulag.
Rudolf Abel weiß das alles genau. Doch er, das hin und her geworfene Menschlein im zynischen Spiel der verfeindeten Atommächte, erträgt dies alles in wortkargem Gleichmut. Er genießt die Zigaretten, die ihm sein Anwalt ins Gefängnis schmuggelt. Er freut sich über die Schostakowitsch-Symphonie, die er über ein kleines Transistorradio hören kann, auch wenn sie ziemlich blechern aus dem Lautsprecher klingt. „Machen Sie sich denn gar keine Sorgen?“ fragt sein Verteidiger Donovan, der mehr und mehr sein Verbündeter, am Ende gar Freund wird. Er fragt das immer, wenn die Lage wieder einmal völlig hoffnungslos zu sein scheint. Und jedes Mal verzieht Abel spöttisch den Mund und fragt zurück: „Würde es denn helfen?“
Würde es denn helfen? Der fatalistische Spion Rudolf Abel, dessen Leben keinen Pfifferling mehr wert zu sein scheint, bringt die Kraft des Schicksalsergebenen auf den Punkt. Was hilft es, Tag um Tag und Nacht um Nacht darüber zu grübeln, dass der eigene Lebensfaden im Grunde schon durchschnitten ist, wenn das Grübeln daran nichts ändert? Welchen Sinn hat es, Szenarien zu wälzen, die eintreten oder nicht, egal was man sich ausdenken mag? Komm her, Schicksal, sagt der kleine sowjetische Spion Rudolf Abel. Lass uns zusammen Schostakowitschs Geigen hören, sind sie nicht großartig? Lass uns eine rauchen, solange es noch Zigaretten gibt, was immer die Gesundheitsapostel davon halten mögen. Und dann sehen wir weiter, in einer Stunde, morgen, kommenden Monat, nächstes Jahr.
Der Fatalismus ist Rudolf Abels Überlebensstrategie. Er macht ihn unangreifbar im Angesicht der Übermacht der Verhältnisse: Ihr habt mein kleines Leben. Doch meine Angst und meine Unterwerfung bekommt ihr nicht. Denn auch ihr seid Ausgelieferte des Schicksals, das morgen genauso gut wie meinen Tod auch meine Rettung und euren Tod bringen kann. Es macht krank und verrückt, sich jeden Tag auszudenken, was passieren könnte – und es macht stark selbst im Aussichtlosen, dagegen ein beherztes: na und? zu setzen. Es garantiert nicht die Rettung gegen alle Wahrscheinlichkeit. Aber die Frage: Was würde es helfen? hat ihre eigene Macht, selbst dann, wenn das Wunder ausbleibt. Denn dieser Fatalismus ist subversiv. Er beugt sich dem Unausweichlichen und bewahrt doch das Eigene. Er richtet sich wieder auf, selbst wenn er weiß, dass er sich dem nächsten Unausweichlichen beugen





























