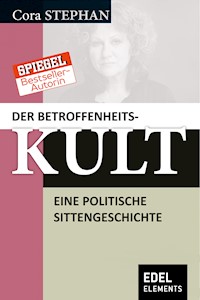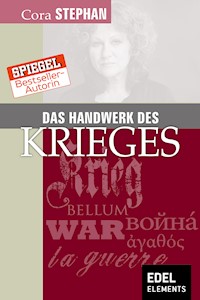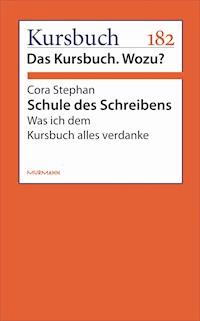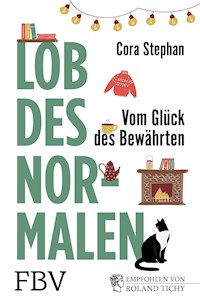
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die »Normalen« stellen die Mehrheit im Lande. Oft ein bisschen spießig, verheiratet, ein bis zwei Kinder, Eigenheim, geregeltes Einkommen, verlässliche Steuerzahler; gutmütige Menschen, die das Abweichende schätzen, das sie sich selbst längst nicht mehr erlauben. Weltoffen und bunt, tolerant bis zur Selbstaufgabe, und sie haben es sich lange geduldig gefallen lassen, zum Auslaufmodell erklärt zu werden. Doch das ist vorbei. Sie wehren sich – durch stille Verweigerung oder über den Wahlzettel. Lob des Normalen ist kein »zurück zu vergangenen Verhältnissen«, sondern die Wiedergewinnung des Sinns für die Wirklichkeit – für das Bewährte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cora Stephan
LOB DES NORMALEN
Vom Glück des Bewährten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
EDITION TICHYS EINBLICK
3. Auflage 2021
© 2021 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Caroline Kazianka
Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt
Umschlagabbildung: Starostov/shutterstock.com
Satz: ZeroSoft, Timisoara
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN Print 978-3-95972-400-5
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-741-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-742-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Prolog
I. Was ist normal?
1. Stinknormal
2. Fremdheit
3. Populisten an der Macht
II. Krieg der Geschlechter
1. Oversexed
2. Liebesverhängnis
3. Die Ehe und ihre Feinde
4. Ehe für alle
5. Zurück zu?
6. Ach ja, die Solidarität
7. Parité?
8. Der toxische Mann
III. Heimat
1. Heimat, deine Sterne
2. Stadtluft macht frei
3. Exkurs ins Unbehauste
4. Flucht aufs Land
5. Entheimatung
6. Stammeskulturen
7. Globale Solidarität?
IV. Das Eigene und das Fremde
1. Selbsthass
2. Multikulti
3. Willkommensjubel
4. Alles Fremdenfeinde
5. All lives matter
6. Das verfallene Haus des Islam
7. Neorassismus
V. Diktatur der Moral
1. Betroffenheitskult
2. Wie Angst funktioniert
3. Wahrheit und Wissenschaft
4. Die große Transformation
VI. Ausblick
Dank
Anmerkungen
Literatur
Prolog
In einer handfesten Krise verflüchtigen sich plötzlich all die Themen, die kurz zuvor noch heiß debattiert wurden, und erscheinen als das, was sie womöglich immer schon waren: als Modeerscheinungen, gar als Zeichen beginnender oder bereits eingetretener Dekadenz. Plötzlich steht er wieder nackt und bloß da, der Mensch, ganz existentiell, ohne modischen Überwurf. Erfreulich ist das nicht immer, was man da zu sehen bekommt, das Elementare ganz ohne Verkleidung ist selten ansehnlich. Auch der Glauben an das Gute entpuppt sich als reine Gutgläubigkeit: Löwen sind keine Schmusekätzchen, Natur ist nicht »chemiefrei« und »bio« nicht giftlos. Gutmenschlichkeit ist nicht krisenfest.
Es macht demütig zu erfahren, dass all das Große, was man sich vorgenommen und angemaßt hat, nichts bedeutet vor dem Angriff eines Feindes, der es aufs Leben abgesehen zu haben scheint, ohne dass der Mensch eine Waffe zur Gegenwehr besitzt.
Wir retten das Klima, wir schützen die Natur? Welche Hybris! In Gestalt eines Virus erscheint die Natur als das, was sie immer schon war: als feindliche Umwelt, derer sich der nackte Mensch zu erwehren versucht. An die Güte der Natur kann nur glauben, wem es, wie der westlichen Zivilisation, gelungen ist, sich seit Jahrhunderten erfolgreich gegen sie zu verbarrikadieren; wer Feuersbrünste und Überschwemmungen zu verhindern und zu bekämpfen gelernt hat und wer fernab aktiver Vulkane lebt. Doch die Natur hat keine Moral, sie denkt nicht daran, gut oder böse zu sein, und würde, könnte sie es, all jene belächeln, die so größenwahnsinnig sind zu glauben, dass sie die Macht hätten, sie zu schützen oder gar zu retten.
All die großen Projekte verglühen im Angesicht einer existentiellen Bedrohung. Zurückgeworfen aufs Wesentliche, in Angst um die bloße Existenz, ist es plötzlich ohne Belang, ob Worte als beleidigend empfunden oder Bezeichnungen nicht politisch korrekt sind. Auf die menschliche Natur reduziert zu sein – Mensch wird geboren, lebt sein Leben und stirbt – lässt einen gar nicht erst auf den Gedanken kommen, man könne selbst bestimmen, wer oder was man ist, Mann, Frau, divers. Im Zweifelsfall ist man ein leidendes oder auch nur angsterfülltes Menschenkind. Der Körper hat sich längst selbst entschieden: jene Natur, die mehr Macht über alle und alles hat, als sich der fluide Metropolenmensch so wünscht.
In solchen Zeiten tritt es wieder ins Bewusstsein, das, was man »normal« genannt hat, als das noch nicht die abwertende Vokabel für jene vermeintlich Zurückgebliebenen war, die dem jeweils dominierenden Zeitgeist nicht huldigen wollten.
In den siebziger Jahren, Hochzeit des linksalternativen Lebenstraums, nannte man sie spöttisch »Normalos« oder sogar »Stinos«, also Stinknormale, all jene, die nicht so progressiv waren, wie mancher sich selbst vorkam. Deren Untergang war eigentlich beschlossene Sache. Doch sie haben sich als widerständig erwiesen, es gibt sie noch heute, ja, sie stellen weiterhin die Mehrheit im Lande. Die hundsnormalen Spießer, christlich geprägt, verheiratet, ein bis zwei Kinder, Eigenheim, geregeltes Einkommen, verlässliche Steuerzahler. Gutmütige Menschen, die das Abweichende schätzen, das sie sich selbst längst nicht mehr erlauben. Heterosexuell, doch oft zu müde dafür, aus Langeweile oder Arbeitsüberlastung, weshalb sie den Anspruch, sexuelle Avantgarde zu sein, neidlos anderen überlassen.
Die Spießer von heute sind selbstverständlich weltoffen und bunt, tolerant bis zur Selbstaufgabe und haben es sich lange geduldig gefallen lassen, zum Auslaufmodell erklärt zu werden, zu einem Überbleibsel längst vergangener Zeiten. Sie werden gern übersehen, das Normale ist nicht schlagzeilenträchtig, nur in Krisenzeiten sieht man, dass es ohne sie nicht geht: ohne Handwerker und Bauern, Polizisten und Feuerwehrleute, Postboten und LKW-Fahrer, Verkäufer, Apotheker, Reinigungskräfte, Pfleger – die Liste ist unvollständig, sie wäre zu lang. Verzichtbar ist eher der Meinunghabende, der Intellektuelle, sind die Plaudertaschen in den Medien oder gar die Influencer im Netz. Oder all jene, die eine mehr und mehr ausufernde Bürokratie bedienen, die vielen in den weit nützlicheren oder gar lebenswichtigen Berufen das Leben schwermachen, etwa den Hausärzten und Apothekern.
Normal ist, was Gewohnheit begründet, etwas, das man nicht erklären muss. Auf das man sich verlassen kann. Das mag eher glanzlos sein, aber es ist: völlig normal. Und es hat in Zeiten, in denen sich das Vertraute aufzulösen scheint, etwas ungemein Beruhigendes. Man verachte das Glück des Spießers nicht, das rächt sich.
Anders gesagt: Es hat sich längst gerächt. Der Überdruss am täglichen Angriff aufs Normale hat jene begünstigt, die abwertend »Populisten« genannt werden, als ob allein schon verdächtig wäre, auf das unterschwellige Grummeln des Volks überhaupt zu hören. Und als ob die ärgsten Populisten nicht jene wären, die noch jeden Konflikt oder Widerspruch mit beidhändig geworfenen Kamellen (vulgo: Geld der Steuerzahler) erledigen wollen. Ereignisse wie die Wahl Donald Trumps in den USA, der kometenhafte Aufstieg der AfD aus dem Nichts in Deutschland oder der Brexit von Großbritannien hätten Warnung genug sein müssen: Die Plebs macht nicht mehr alles mit. Nicht die Eurorettung 2010, nicht die milliardenschwere, aber nutzlose »Energiewende«, nicht die Schuldengemeinschaft der EU, die beflissene Genderei oder das Theater um ein »drittes Geschlecht«. Die Provinz schlägt zurück – durch stille Verweigerung oder den Wahlzettel. Doch lieber arbeiten sich die Meinunghabenden an Donald Trump ab oder an den »Rechtspopulisten« der AfD, statt auf die Botschaft zu hören, die deren Wahlerfolge verkünden: Wir, die ständig Übersehenen und Beleidigten, haben den ganzen Zirkus gründlich satt.
Warum bleiben unsere Grenzen (und der Sozialstaat) offen für Menschen, mit denen wir weder Sprache noch Kultur gemein haben und von denen wir nicht wissen, ob sie tatsächlich hilfsbedürftig sind oder Glücksritter und Kriminelle? Warum gibt es in Deutschland um die 200 Lehrstühle für Genderforschung, aber noch nicht mal die Hälfte für Wissenschaftler, die sich mit einem neuartigen Virus auskennen?1 Warum meint der Staat, alles besser zu können als der eigentliche Souverän, das Volk, von der Kindererziehung bis zum Unternehmertum, scheitert aber im Krisenfall an seiner ureigensten Aufgabe, nämlich der, für den Schutz der Bürger zu sorgen? Warum fühlt sich eine ihrem Volk und niemandem sonst verpflichtete Kanzlerin eher für Europa zuständig oder gar zur Rettung der Welt berufen, obzwar ihr niemand den Auftrag dafür verliehen hat? Und seit wann darf man der Regierung nicht mehr widersprechen? Wäre das nicht eigentlich – normal?
Vor einem »neuen Normal«, von dem seit Corona immer wieder die Rede ist, steht das alte Normal, und das ist extrem zäh und überlebensfähig. In Krisenmomenten meldet sich der Mensch in seiner archetypischen Verfasstheit. Wichtiger als die jeweiligen Identitätsmoden sind nun die Nächsten, sprich: die bürgerliche Familie und die spießige Nachbarschaft. »Familie und Nation sind krisenfeste Solidargemeinschaften«, meint der Soziologe Heinz Bude, der eine Renaissance des Konservatismus prophezeit.2 Die ist, was das betrifft, womöglich schon länger unterwegs. Auch wenn historisch gesehen die Ehe an Nachwuchs und Erbfolge geknüpft war, so zeigt die Beliebtheit der Ehe für alle doch eins: Selbst unter der einstigen sexuellen Avantgarde, bei Schwulen und Lesben, verbinden offenbar viele mit dem offiziellen Akt der Ehe die Bekräftigung, in guten wie in schlechten Tagen füreinander zu sorgen. Glauben sie etwa, das private Bündnis sei womöglich auf Dauer verlässlicher als die Segnungen des Sozialstaates? Dann allerdings ist Ehe heutzutage nicht mehr spießig, sondern geradezu subversiv. Das Private erhält seine Würde zurück.
Wo wir schon beim Menschen als naturhaftem Wesen sind: In Gefahr neigen Menschen zum Abschließen, Abschotten, Verbarrikadieren, sie schließen die Stadttore und ziehen die Zugbrücke hoch. Xenophobie, darauf weist schon Claude Lévi-Strauss hin, gehört zum alten Erbe der Gattung Homo sapiens. Und so gab es in Corona-Zeiten im grenzenlosen Europa plötzlich wieder geschlossene Landesgrenzen, die man doch zuvor gegen illegale Einwanderung angeblich nicht schließen konnte. Grenzen wurden sogar innerhalb Deutschlands wieder gezogen, und die richteten sich nicht gegen eine Gefahr, die von außen kam, es sei denn, man erklärte die Hauptstadt Berlin für staatenlos. Sie richteten sich gegen Deutsche wie etwa gegen die Berliner Schriftstellerin Monika Maron, die es wie jedes Jahr in ihren Zweitwohnsitz im ziemlich menschenleeren Vorpommern nahe der polnischen Grenze zog. Dort ereilte sie eine »Ausreiseverfügung«. Weil sie verdächtig war, den Feind in Gestalt des Virus einzuführen? Womöglich reagierte hier eine Behörde nach uraltem Muster, demzufolge es »da draußen« Feinde gibt, die ins Gemeinwesen eindringen wollen, woran man sie hindern muss.
Doch halt: War die Furcht vor dem Bösen, das da eindringen könnte, den Deutschen im Willkommensüberschwang 2015 nicht abhandengekommen? »Jahrelang hatte es geheißen, dass die Versöhnung mit dem Fremden das höchste Ziel moralisch richtigen Handelns sei. Nun tritt uns die Figur des Anderen auf einmal ganz neu entgegen: im Modus des allgegenwärtigen Verdachts. Um grundmenschliche Urängste auszulösen, muss er oder sie dabei nicht einmal fremd sein oder auch nur so aussehen. Ein leichtes Husten genügt völlig, um vorsorglich die Straßenseite zu wechseln«, konstatiert der Philosoph Wolfram Eilenberger.3 So schnell kann das gehen.
Pragmatisch gesagt: Menschen haben es gern überschaubar, nicht grenzenlos. Sie sind nicht unbedingt fremdenfeindlich, solange die Fremden nicht überhandnehmen.4 Es gibt Gefühle von Zugehörigkeit, die mit Fremdenhass erst einmal gar nichts zu tun haben. Solidarität zum Beispiel, eine schöne Tugend (und viel zu oft eine Forderung im Sinne einer aufgehaltenen Hand), fällt leichter unter Menschen, die sich in wesentlichen Aspekten ihrer Identität ähneln – oder mit denen man verwandt oder verheiratet ist.
Das könnte man nachgerade als Nebeneffekt der Ehe für alle sehen: In der neuerlichen Konjunktur der Ehe scheint genau das wieder eine Rolle zu spielen, dass eine Ehe mit oder ohne Nachkommen die Urzelle von Fürsorge sein, dass sie Autarkie bedeuten kann, Privatsphäre gegen die Übermacht des Politischen. Denn der Sozialstaat hat die Familie von Bindungen und Verbindlichkeiten über die Generationen hinweg zwar entlastet, doch damit zugleich entmachtet.
Nicht nur Konservative, auch Liberale bezweifeln, dass Vater Staat der bessere Erziehungsbeauftragte ist. Die Diskussion über frühkindliche Betreuung außerhalb der Familie offenbart, dass nicht wenige Eltern dem womöglich ideologisch geprägten Kanon in staatlich kontrollierten Betreuungseinrichtungen misstrauen. Sie fürchten den Angriff der moralisierenden Politik auf die letzte private Einheit und die Entkleidung des Individuums von allem Schützenden, so dass als einzige Schutzmacht nur einer übrigbleibt: der Staat. Und der sorgt durch seinen Schutz (und mit Steuergeld) für das Fortbestehen des Übels, das er zu bekämpfen vorgibt. Bekanntes Beispiel für dieses Phänomen: Die Prämien für den Fang von Kobras in Indien führten zu einer blühenden Kobraschlangenzucht.5
Sich im Notfall nach außen zusammen- und abzuschließen ist ein uralter Instinkt, der sich, ist es erst einmal so weit, kaum niederkämpfen lässt. In Krisenzeiten sind jene im Vorteil, die sich abschließen können: die Verwurzelten, die einen Ort haben, also die Somewheres, wie David Goodhart sie nennt.6 Eher nicht die Anywheres, die jeden Flughafen der Welt kennen, was wenig nützt, wenn keine Flugzeuge mehr abheben. Und es sind diejenigen im Vorteil, die Vorrat angeschafft haben. Das gilt nicht nur für Privathaushalte. Das gilt auch für Unternehmen, die sich seit Jahren daran gewöhnt hatten, benötigte Komponenten nicht mehr selbst vorzuhalten, sondern just in time irgendwo auf der Welt produzieren zu lassen. Globalisierung bekommt ihren längst verdienten Dämpfer.
Nicht, dass der Welthandel verschwinden wird, das wäre für alle Beteiligten schrecklich. Welthandel gibt es seit ewigen Zeiten und es gab ihn auch, als man fürchten musste, dass Handelsschiffe die Pest an Bord haben. In einer Krise aber wirkt allzu große Abhängigkeit verschärfend. Oder hat man in Deutschland die Lehre aus dem Ersten Weltkrieg vergessen, als Handelsblockaden eine gewaltige Hungersnot auslösten? Autarkie gibt es nicht, aber ein gewisses Maß an Selbstversorgung hilft zu überleben. Im Konfliktfall ist es nicht gut, allzu sehr auf das Wohlwollen anderer angewiesen zu sein.
Schon deshalb braucht es die heimische Landwirtschaft – was ja unter den Schlagworten »regional« und »nachhaltig« dem grünen Zeitgeist entspräche. Doch paradoxerweise wird die eigene Landwirtschaft mit viel Bürokratie und allerhand Einschränkungen kujoniert, die Einfuhr von billigen Lebensmitteln indes begünstigt, bei denen nicht gefragt wird, wie tier- und menschenfreundlich sie produziert worden sind. Die grünen Besserwisser aber, die den einheimischen Bauern das Leben schwermachen, zeigen mit dem nackten Finger auf die Konsumenten, weil sie »Billigprodukte« bevorzugen.
Was also kann man in Zeiten der Krise lernen? Dass Menschen seit Jahrtausenden nach ähnlichen Mustern leben und reagieren und dass vieles, was seit etlichen Jahren in der medienvermittelten Öffentlichkeit verbreitet wird, nicht viel mehr als die Ausdünstungen der Dekadenz ist.
Mag sein, dass es konservativ ist, sich auf das zu besinnen, was »normal« ist. Spannender als ein solches Etikett scheint mir jedoch, nach den Strukturen zu suchen, die unterhalb der bunt-divers-weltoffenen Oberfläche verborgen liegen, und sie wieder kenntlich zu machen: das Fundament der Gesellschaft, sozusagen das alte Normal.
Doch was ist überhaupt normal? Ist es eine bloße Übereinkunft, also eine (willkürlich) festgesetzte Norm? Der Begriff Heteronormativität (anstelle von Heterosexualität) suggeriert genau das. Diversität sei die neue Normalität, tönt es von der Barrikade der Genderista, die sorgsam darüber wacht, dass jedes Geschlecht zur Sprache kommt, auch das eingebildete. Die meisten Menschen aber empfinden ihre Sexualität nicht als etwas Gesetztes, ebenso wenig, wie Homosexuelle glauben, sie hätten sich ihre sexuelle Präferenz einfach so ausgesucht, könnten sie also auch jederzeit wieder ablegen.
Ob es einem gefällt oder nicht: Die meisten Menschen sind heterosexuell, möchten eine Familie mit Kindern und haben keine Zeit, sich lustig zu machen über das Reihenhaus, das sie teuer genug kommt. Die meisten Frauen wollen nicht sofort nach der Entbindung wieder an den Arbeitsplatz eilen, egal, ob das jemand von den Sozialdemokraten reaktionär findet. So sieht sie halt aus, die Normalität, ob das den kulturellen Eliten passt oder nicht. Was kann an dieser Tatsache kränkend sein? Wolfram Eilenberger: »Die sogenannte Wirklichkeit schert sich einen feuchten Kehricht darum, was wir von ihr denken, erhoffen oder selbst kollektiv von ihr für richtig und wahr vermeinen. Vielmehr ist sie das, wogegen niemand je immun ist.«
Gewiss gehören zum Normalen auch gesetzte Normen. Doch die Behauptung, dass dies oder jenes rein normativ sei, erinnert an die Vorstellung, das Neugeborene sei eine Art leere Tafel, die von seiner Umwelt beschrieben werden müsse, damit ein Mensch daraus wird. Der Psychologe Steven Pinker7 hat die Vorstellung des »unbeschriebenen Blattes« umfassend zurückgewiesen: Es gibt sie, die menschliche Natur, »eine angeborene menschliche Konstitution«8, es gibt Vererbung, also einen genetischen Zusammenhang zwischen Eltern, Kindern, Geschwistern, auch, was die Intelligenz betrifft.
Das ist, selbstredend, eine Kränkung, und zwar für alle Beteiligten. Für das Individuum, weil es erkennen muss, dass es so einzigartig nicht ist. Studien an unabhängig voneinander aufgewachsenen eineiigen Zwillingen zeigen, dass sie sogar kleine Ticks teilen, ohne sich jemals begegnet zu sein.9 Und wer in der Pubertät noch glaubte, nichts, aber auch gar nichts mit den Eltern gemein zu haben, findet im Laufe des Lebens mehr Ähnlichkeiten, als dem Selbstbild gefällt. Trost gibt da nur die Erkenntnis, dass man Vater oder Mutter zwar ähnlich sein mag, aber nicht mit ihnen identisch ist.
Auch den Eltern bereitet die Natur manche Kränkung – wenn selbst die liebevollste Umgebung und die aufmerksamste Zuwendung der Eltern aus einem Kind kein Genie machen und noch nicht mal einen guten Menschen. Das heißt natürlich nicht, dass Erziehung und Umwelt, dass »Kultur« keine Rolle spielt. Das Kind mag dadurch glücklicher aufwachsen – oder überfordert sein, das ist ein schmaler Grat. Ganz sicher aber mündet die These vom unbeschriebenen Blatt in einer unendlichen Überforderung der Eltern, die sich Vorwürfe machen müssen, wenn das Kind trotz aller Bemühungen nicht so wird, wie sie es sich vorgestellt haben. Vielleicht, weil es die Voraussetzungen dafür nicht mitbringt? Die Erkenntnis, dass ihr Einfluss relativ ist, nimmt den Eltern ihr schlechtes Gewissen – und entbindet sie vom zumeist fruchtlosen Bemühen, kleine Jungs und kleine Mädchen von ihren Lieblingsspielen abzubringen, weil das Herumfuchteln mit Spielzeugwaffen und das Hätscheln von Puppen das Verankern geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung begünstigen und also der Gleichberechtigung im Wege stehen soll. Doch warum sollten Jungs und Mädchen nicht gleichberechtigt sein, nur weil sie nicht gleich sind?
Und nein: Das Böse wird nicht von der Gesellschaft den an und für sich Unschuldigen injiziert, ebenso wenig, wie man die Menschen durch Social Engineering so umkrempeln kann, dass sie zur jeweils bevorzugten Utopie passen. Die Vorstellung von der völligen Formbarkeit hat nichts Emanzipatorisches, im Gegenteil, sie ist das perfekte Lockmittel für autoritäre Versuchungen. Auch dann, wenn sie in der scheinbar menschenfreundlichen Form des Nudging auftritt, des sanften Anstupsens: Man müsse, heißt es, die Menschen nur in die richtige Richtung schieben, dann würden sie schon vernünftig. Doch wer bestimmt darüber, was die richtige Richtung ist oder was die Vernunft gebietet?
Für Nudging spricht höchstens, dass es sein Ziel auf weniger blutige Weise erreichen will als die linken Versuchsanordnungen unter Mao, Stalin oder Pol Pot, bei denen alle, die sich dem Ideal des sozialistischen Menschen nicht unterwerfen wollten, aus dem Spiel genommen, nämlich ins Umerziehungslager gesteckt oder gleich liquidiert wurden.
Ja, unter Druck wird er sichtbar, der Mensch, in seiner normalen Form, ob sie gefällt oder nicht. Es kommt zum Vorschein, was seit Jahrtausenden in ihm angelegt ist, mehr oder weniger gebändigt durch das, was wir Zivilisation nennen.
Schlichtes Beispiel aus jüngster Zeit: Das, was herablassend Hamstern genannt wurde, als plötzlich manche Regale im Lebensmittelhandel leer waren, ist ein völlig normales, ja in jeder Hinsicht vernünftiges Verhalten in einer Bedrohungssituation. Wir leben hierzulande zwar seit gut 70 Jahren in einer Zeit ohne allzu große materielle Not, kaum einer muss hungern und frieren, wie es die Kriegsgeneration jahrelang erlebt hat. Der Tiergarten in Berlin, im Zweiten Weltkrieg zerstört, abgeholzt und dann zum großen Schrebergarten für die Stadtbevölkerung gemacht, ist längst wieder ein Park. Niemand muss vorrätig haben, was er täglich braucht, der Supermarkt hat selbst auf dem Land oft bis 22 Uhr geöffnet, überdies gibt es genug Restaurants, Pizzaläden und Dönerbuden. Doch was, wenn all das wegfällt und in den Regalen der Lebensmittelläden Lücken zu sehen sind? Wohl dem, der Tiefkühltruhe, Einweckgläser und einen Garten hat. Und der überhaupt noch etwas von Vorratswirtschaft versteht – für den Fall, dass der Strom ausfällt.
Was also ist normal? All das, was 68 ff. als Spießertum etikettiert wurde? Traditionen, Glauben, Konventionen, Heimat oder, ganz schlimm, Vaterland – das alles sollte damals auf den Schutthaufen der Geschichte geschickt werden. Regeln und Institutionen: stören bloß die freie Entfaltung. Sexualmoral, Ehe und Familie: alles des Teufels. Wer noch zu Hause oder gar dörflich lebte, statt das Metropolenleben zu genießen, musste sich als zurückgeblieben verdächtigen lassen. Und nur der nackte, ursprüngliche Mensch galt plötzlich als ehrlich und authentisch. »Sich nackt machen« heißt es noch heute, wenn es um Ehrlichkeit geht. Doch wie der Philosoph Helmuth Plessner schon 1924 spöttisch festhielt: »Der Schrei nach korsettloser Tracht verdient nur bei sehr guten Figuren ein Echo zu finden.«10
Regeln und Institutionen sind nicht nur Gefängnisse der freien Individuen, sondern sie dienen ihrer Entlastung: Nicht alles muss »ausdiskutiert« werden, auf einiges kann man sich schlicht und einfach verlassen, auch Gewohnheiten können befreiend wirken. Solche Vorzüge entdeckt vielleicht derjenige früher als andere, der einst das endlose Ausdiskutieren normalster Angelegenheiten und Verrichtungen in Wohngemeinschaften und Beziehungen erlebt hat.
Der Abschied von allen Konventionen macht es nicht leichter, hat Menschen nicht freier gemacht. Konventionen sind Regeln, die Menschen sich geben, um einander ohne Verletzung begegnen zu können. Vieles davon hat sich im Laufe von Jahrhunderten eingebürgert. Vor langer Zeit bedeuteten heute so selbstverständliche Gesten wie die hingehaltene Hand oder die Umarmung, dass man seine friedlichen Absichten bekundete: keine Waffe in der Hand, kein Dolch im Gewand – »die Entwicklung der Grußformen (...) ist ein sehr spannendes Kapitel der Menschheitsgeschichte«, schreibt der Philosoph Peter Sloterdijk.11
Während der Corona-Panik war das Gegenteil geboten. Man bemühte sich, einander möglichst nicht zu nahezukommen, damit eine Verletzung (durch Ansteckung) ausbleibt. Konventionen mögen sich also ändern – aber in jeder Gesellschaft gibt es einen Konsens über sie, und wer dazugehören will, muss sie kennen. Das gilt erst recht dann, wenn man es gern bunt und vielfältig und weltoffen hätte. Konventionen sind die Lingua franca zwischen Fremden. Sie sind als Hilfsmittel unverzichtbar.
Normal ist, die begrenzten Möglichkeiten der Menschen anzuerkennen. Und manchmal brauchen sie eben Krücken.
I.Was ist normal?
1. Stinknormal
Normal ist, was Gewohnheit begründet, etwas, das man nicht erklären muss. Auf das man sich verlassen kann. Normal ist das, was funktioniert, weil es sich im Laufe der Zeit bewährt hat. Das Wiederkehrende, das Alltägliche. Ordnung und Sicherheit. Beruhigende Gewohnheit. Routine, die nicht zum ständigen Nachdenken nötigt.
Normal ist alles, was Orientierung schafft. Was uns dazu befähigt, es miteinander auszuhalten, weil wir einen gewissen Konsens erwarten können.
Dem widerspricht nicht, dass der Mensch nach Abwechslung giert, neue Reize braucht, das Besondere und Außerordentliche sucht, überrascht werden will. Aber nicht jeden Tag. Alltäglich hält man ein Programm voller Nervenkitzel höchstens aus, wenn man zwischen 13 und 30 Jahre alt ist. (Und es ist, nebenbei, womöglich nicht das Wichtigste, bis ins hohe Alter regelmäßig Sex zu haben, so oft wie Sport und Duschen, wie es die Ratgeber empfehlen.)
Auch deshalb ein Plädoyer für das Normale: Es ist das, was ein ganzes Leben hält.
Auch wegen dieser Vorzüge wird das Normale verkannt: Normal ist langweilig. Normal ist die große Masse, die gesichtslose, die Herde, die ihrem Herdentrieb folgt, die Schar der Lemminge mit Lust am Untergang. Normal ist, im alltäglichen Trott normale Dinge zu tun, ohne das normale Maß zu übersteigen, Rädchen zu sein im Getriebe. Normal ist, ohne Ansprüche an sich und die Welt, schicksalsergeben dem Lauf der Dinge zu folgen. Und wenn normal die Mehrheit ist, denkt sich da das widerspenstige Individuum, dann will ich nicht dabei sein, ich lasse mich von keiner Mehrheit unterdrücken. Etiam si omnes, ego non – und mögen auch alle mitmachen, ich nicht. Das ist ein stolzer Spruch. Und wer ihn zum Lebensmotto erhebt, lässt sich auch von einer Minderheit nicht unterdrücken. Womit wir beim Thema wären.
Normal steht heute von zwei Seiten unter Druck: von denen, die ihre Verachtung für die Masse mit Identitätspolitik kaschieren wollen, und von denen, die als Minderheit das Normalsein für sich reklamieren. Frage an die Verfechter von Identitätspolitik wie die Democrats in den USA und die linken Parteien in Deutschland, die SPD eingeschlossen: Glaubt man dort wirklich, ohne die Normalos Wahlen gewinnen zu können? Frage an die anderen: Wieso ist das Abweichen vom Normalen das neue Normal? Wollen heute ausgerechnet die Paradiesvögel Spießer sein?
Das wollen wahrscheinlich keineswegs alle, die meinen, dass Normalität im Sinne von womöglich auch noch einträchtiger Mehrheit sie ausschließe. Doch warum wollen sie eingemeindet werden? Wir leben hierzulande seit Jahrzehnten in einer Gesellschaft mit maximaler Toleranz, der Vorwurf, man diskriminiere eine Person – ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Neigung, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer kulturellen Bräuche wegen –, lässt jeden Menschen, der sich redlich glaubt, zusammenzucken (und kostet manch einen wegen herabsetzender oder auch nur dummer Sprüche Ansehen oder Job). Nur ein übelgelaunter Normalo würde es wahrscheinlich heute noch wagen, entnervt darum zu bitten, diese oder jene Minderheit möge endlich damit aufhören, andauernd beleidigt zu sein: »Was wollt ihr denn noch? Nun respektieren wir euch in eurer Anders- und Einzigartigkeit, und es reicht immer noch nicht? Und, ganz ehrlich: Ist es vielen unter euch nicht auch langsam peinlich, dass sich Medien und Politiker regelmäßig mit Olivia Jones schmücken, um zu zeigen, wie bunt-divers und tolerant sie sind?«
Reicht es wirklich nicht, möchte man da ergänzen, kein Rassist zu sein, muss man auch noch Antirassist sein, wie der deutsche Bundespräsident jüngst postulierte?1
Das Provozierende am Normalsein beruht offenbar auf einem groben Missverständnis. Normal ist nicht, wie es bei den Kämpfern von LSBTIQ oft heißt, eine bloße Norm, die irgendwann einmal willkürlich festgelegt wurde, durch Macht, Gewalt, Unterdrückung, also wahrscheinlich vom Patriarchat, weshalb man sie ebenso willkürlich ändern kann. Schon gar nicht, wenn es um Biologie geht. Genau darum aber tobt der Streit.
Biologisch gesehen ist Zweigeschlechtlichkeit normal. Heterosexualität ist die normale Grundstruktur (nicht nur) von Menschen, sie kann nicht einfach an- oder umerzogen werden (ebenso wenig wie Homosexualität), auch wenn sich ihre Ausdrucksformen ändern mögen. Zur Fortpflanzung braucht es Mann und Frau bzw. den männlichen Samen und ein weibliches Ei. Das ist das schmutzige kleine Geheimnis der Zweigeschlechtlichkeit.
Heterosexualität ist also keine bloße Norm, kein lediglich tradiertes Stereotyp, nichts, was man dekonstruieren kann, sondern einfach nur normal. »Biologie ist keine Kränkung, (sondern) beschreibt schlicht Fakten unseres evolutionsbiologischen Erbes und ist mächtiger und nachhaltiger als jegliche Ideologie«, schreibt der Evolutionsbiologe Axel Meyer.2 In Zahlen: Die sogenannten LSBTIQ-Menschen bilden weltweit eine Minderheit von wahrscheinlich 5 bis 8 Prozent (und sind sich im Übrigen durchaus nicht so einig in ihren Zielen, wie das eingemeindende Kürzel suggeriert).3
Das sagt nichts Wertendes über sexuelle Orientierung. Doch sexuelle Neigung ändert nichts am biologischen Geschlecht. Menschen, die tatsächlich weder das eine noch das andere sind, also »Menschen mit intermediären und gemischtgeschlechtlichen primären oder sekundären körperlichen Merkmalen«, stellen womöglich weit weniger als 1 Prozent der Menschheit. Schwule sind Männer, und Lesben sind Frauen. Ein Mann, der eine Frau werden will, bleibt biologisch ein Mann, und Frauen, die Männer werden wollen, sind biologisch gesehen Frauen.4 Das bedeutet, jedenfalls in den freien westlichen Gesellschaften, keine Diskriminierung all jener, die sich in ihrem biologischen Geschlecht nicht wohl fühlen.
Ohne jeden Zweifel und schlimm genug: Das war einmal anders. Wer nicht »normal« wirkte, also anders als die anderen zu sein schien, wer krank oder mit ungewöhnlichen Merkmalen ausgestattet war, wurde zu früheren Zeiten, in denen es auf das Überleben des Stammes oder der Familie ankam, gewaltsam ausgesondert, wenn man das irritierende Geschöpf nicht schon bei oder nach der Geburt getötet hatte. Dahinter steht eine natürliche Logik, wie es sie auch bei Tieren gibt: Was nicht lebensfähig war, sollte auch nicht am Leben erhalten werden, und fortpflanzen sollten sich nur die, die man für normal hielt, »Unnormales« durfte nicht weitergegeben werden. »Erbgesundheit« haben nicht die Rassisten aller Couleur erst erfunden; danach zu streben gehört wahrscheinlich zu unserem genetischen Erbe. In einigen afrikanischen Ländern etwa werden Menschen mit Albinismus, also weißer Hautfarbe, noch immer verfolgt oder gar ermordet.5
Sind wir heute weiter als unsere »primitiven« Vorfahren? Ja. Nein. Vielleicht. Sicher kann man sich nicht sein. Trotz aller Berichte über die besonders liebenswürdigen Eigenschaften von Menschen mit Down-Syndrom werden offenbar die meisten Embryos, bei denen man Trisomie 21 feststellt, abgetrieben.6 Noch gibt es hierzulande etwa 50 000 Menschen mit Down-Syndrom, aller Erwartung nach wird sich diese Zahl in den nächsten Jahren weiter reduzieren. Denn die Auslese nach »normalen« Kriterien wird sich mit jedem Erfolg der Wissenschaft fortsetzen.
Finster? Erschreckend? Eigentlich unmenschlich? In der Tat. Besser ist höchstens, dass solche Selektion nicht mehr am entwickelten lebenden Objekt vollzogen wird. Doch man sieht daran vielleicht, dass das Gefühl für und die Bevorzugung von Normalität ein sehr durchsetzungsstarkes, ein mächtiges Erbe ist. Fürs Überleben eines Menschen war es vor unseren Zivilisationen entscheidend, vom Gewohnten und Vertrauten abweichende Muster zu erkennen und den entsprechenden Erscheinungen aus dem Weg zu gehen. Das ist auch heute nicht immer und unbedingt falsch. Doch wir leben in einer Welt, in der man sich bemüht hat, solch Erbe zu zivilisieren. Wer zu den »Normalen« gehört, wertet heute nicht mehr gleichsam automatisch Minderheiten, Andersartige, Fremde ab. Muss man ihm Toleranz und Feinfühligkeit da wirklich noch immer geradezu einbleuen? Das macht keine gute Stimmung. Es nervt.
Von vielen LSBTIQ-Aktivisten werden mit neuerdings wachsender Inbrunst die alten Kämpfe um Anerkennung wiederaufgenommen. Dabei ist der Kampf längst gewonnen. Lasst sie doch die Ausnahme bleiben, meinetwegen auch die Avantgarde, die bunte Vielfalt, warum nicht! Aus einer Minderheit wird jedoch auch bei größten Verrenkungen keine Mehrheit.
Und ehrlich: Manche Kämpfe an der Queer-Front sind nur noch bizarr. Die Forderung, dem anderen sein Geschlecht nicht zu unterstellen (don’t assume my gender), überfordert auch die Gutwilligsten. Woher sollen sie wissen, wie ein empfindsamer Diverser gerade genannt werden will? Black is beautiful, hieß es früher, und heute sollen sie das hässliche Wörtchen PoC für eine Person of Color benutzen? »Neger« sagen sie schließlich längst nicht mehr. Und wie sollen sie erahnen, wie sich ein Gegenüber ohne auffällige Identitätsmerkmale definiert, ob als queer, trans oder inter? Ist das nicht, Verzeihung, eigentlich Privatsache, interessiert also höchstens, wenn man auf der Suche nach einer sexuellen Begegnung ist?
Herr oder Frau Normalo weiß, ob er männlich oder sie weiblich ist; niemand hat sie als Mädchen gezwungen, mit Puppen zu spielen, oder ihn als Jungen laufend dazu angehalten, zu raufen und laut zu sein. Geschlecht ist nicht anerzogen, und man wird keine Mehrheit der Menschen davon überzeugen können, dass es lediglich ein soziales Konstrukt sei, dem man nach Belieben entfliehen könne, was die meisten wahrscheinlich gar nicht wollen.
Identitätspolitiken aller Art sind im Grunde paradox. Sie bestehen auf dem Unterschied und reklamieren zugleich Normalität, indem sie neue Normen setzen. Irgendwie geht die Rechnung nicht auf – vielleicht, weil vieles davon so verdammt weltfremd ist.
Nicht nur hierzulande wurde Ausgrenzung schon längst mit umfassender Inklusion beantwortet, was allerdings oftmals die vorhandenen Unterschiede besonders deutlich erkennen lässt. Die Debatte, ob es richtig ist, alle Kinder gemeinsam zu unterrichten, egal, ob sie körperliche oder geistige Merkmale haben, die man früher Behinderung genannt hätte, hält noch nach Jahren an. Denn in vielen inklusiven Klassen richtet sich alles nach den weniger erfolgreichen Schülern, was denen nicht hilft und die Normalbegabten unterfordert. Das Gutgemeinte tut nicht immer gut.
Menschen sind nicht gleich, sie unterscheiden sich, nicht nur nach ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung, auch nach ihrer körperlichen Ausstattung, nach ihrer Intelligenz, nach ihren Genen. Sie sind kein unbeschriebenes Blatt, dem die Gesellschaft alles einschreiben kann, was ihr beliebt Derlei Experimente sind bislang stets übel ausgegangen, man denke an die Sowjetunion, an Maos China, an Hitlers Deutschland. Im schlimmsten Fall wurden alle Ungleichen einen Kopf kürzer gemacht.
Hierzulande spricht nichts dagegen, Ungleiches auch so zu nennen. In den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hätte sich die Avantgarde der homosexuellen Minderheit vehement dagegen verwahrt, als normal zu gelten. Man wollte nicht mehr Versteck spielen und so tun als ob, wollte nicht mehr Opfer sein, sondern voller Selbstbewusstsein schwul oder lesbisch. Ist das heute vorbei? »Konnten sich vor 50 Jahren bekennende Homosexuelle, die zweifellos gesellschaftlich krass benachteiligt, bedrängt und geächtet wurden, als Fanal des Ungehorsams gegenüber dem Mainstream, der heterosexuellen Anpassung, Gleichrichtung und verlogener Kultur darstellen, so wirken sie heute mit ihren Integrationsbestrebungen, etwa der Ehe und Kinderadoption, als Musterschüler eines bürgerlichen Spätkapitalismus.«7