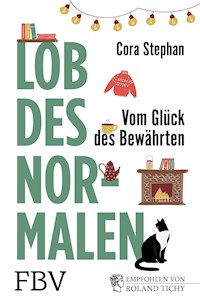19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
An der Universität in Cambridge waren sie ein seltenes und seltsames Freundespaar: der adelige Schotte Liam Broedie und Alard von Sedlitz, Gutsbesitzersohn aus Oberschlesien. Schon ihre Väter hatten zusammen in Heidelberg studiert und waren Freunde fürs Leben geblieben, obwohl sie durch den 1. Weltkrieg zu Kriegsgegnern geworden waren. Cora Stephan schildert das Leben zweier europäischer Familien von Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des 2. Weltkriegs, als eine ganze Welt in Schutt und Asche versunken war. Der Blick der Erzählerin geht dabei weit zurück in das Landleben Oberschlesiens Anfang des Jahrhunderts, wo Alard eine unbeschwerte Kindheit und Jugend erlebt – trotz der Katastrophe des 1. Weltkriegs und seiner Folgen. Zugleich taucht man ein in das Leben eines uralten schottischen Clans, der seine besten Zeiten hinter sich hat und immer noch die alte Feindschaft gegen die englische Krone hochhält. Inspiriert von ihrer großen Zuneigung zueinander versuchen die beiden Freunde auf konspirative Weise das Unmögliche: den Lauf der heraufziehenden Menschheitskatastrophe aufzuhalten und die Feindschaft ihrer Länder im 2. Weltkrieg zu überwinden. Alard als Mitarbeiter des Auswärtigen Amts in Berlin, Liam im Auftrag des britischen Auslandsgeheimdienstes SIS. Doch so sehr sie einzelne Menschen wie die deutsch-jüdische Fotografin Helene im Spanischen Bürgerkrieg retten können, so wenig gelingt es ihnen, das Grauen, das sie auf die Welt zukommen sehen, abzuwenden. Und doch bleibt am Ende dieses großen historischen Romans die tiefe Freundschaft zweier Menschen in niederschmetternden Zeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Ähnliche
Cora Stephan
Über alle Gräben hinweg
Roman einer Freundschaft
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Cora Stephan
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Cora Stephan
Cora Stephan ist seit vielen Jahren freie Autorin und schreibt Essays, Kritiken, Kolumnen – und Bücher. Ihr Roman »Ab heute heiße ich Margo« erschien 2016 bei Kiepenheuer & Witsch. Neben zahlreichen Sachbüchern hat sie unter dem Pseudonym Anne Chaplet preisgekrönte Kriminalromane veröffentlicht, u.a. »In tiefen Schluchten« (2017) und »Brennende Cevennen« (2018).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
An der Universität in Cambridge waren sie ein seltenes und seltsames Freundespaar: der adelige Schotte Liam Broedie und Alard von Sedlitz, Gutsbesitzersohn aus Oberschlesien. Schon ihre Väter hatten zusammen in Heidelberg studiert und waren Freunde fürs Leben geblieben, obwohl sie durch den 1. Weltkrieg zu Kriegsgegnern geworden waren.
Cora Stephan schildert das Leben zweier europäischer Familien von Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des 2. Weltkriegs, als eine ganze Welt in Schutt und Asche versunken war. Der Blick der Erzählerin geht dabei weit zurück in das Landleben Oberschlesiens Anfang des Jahrhunderts, wo Alard eine unbeschwerte Kindheit und Jugend erlebt – trotz der Katastrophe des 1. Weltkriegs und seiner Folgen. Zugleich taucht man ein in das Leben eines uralten schottischen Clans, der seine besten Zeiten hinter sich hat und immer noch die alte Feindschaft gegen die englische Krone hochhält. Inspiriert von ihrer großen Zuneigung zueinander versuchen die beiden Freunde auf konspirative Weise das Unmögliche: den Lauf der heraufziehenden Menschheitskatastrophe aufzuhalten und die Feindschaft ihrer Länder im 2. Weltkrieg zu überwinden. Alard als Mitarbeiter des Auswärtigen Amts in Berlin, Liam im Auftrag des britischen Auslandsgeheimdienstes SIS. Doch so sehr sie einzelne Menschen wie die deutsch-jüdische Fotografin Helene im Spanischen Bürgerkrieg retten können, so wenig gelingt es ihnen, das Grauen, das sie auf die Welt zukommen sehen, abzuwenden.
Und doch bleibt am Ende dieses großen historischen Romans die tiefe Freundschaft zweier Menschen in niederschmetternden Zeiten.
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
XVI. Kapitel
XVII. Kapitel
XVIII. Kapitel
XIX. Kapitel
XX. Kapitel
XXI. Kapitel
XXII. Kapitel
Zweites Buch
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
Drittes Buch
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
XVI. Kapitel
XVII. Kapitel
XVIII. Kapitel
Viertes Buch
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
Fünftes Buch
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
Sechstes Buch
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
Anhang
Personen
Dank
Erstes Buch
Benita
I
Königsdorff-Jastrzemb
Buchhaltung war alles andere als langweilig, fand Benita von Lanzdorf, die in der Arztpraxis ihrer Eltern über den Büchern saß. Sie mochte es, wenn die Bilanzen stimmten, Ordnung war beruhigend. Beunruhigend war höchstens, dass die Stimme ihrer Mutter aus dem Nebenraum in den letzten Minuten immer lauter geworden war, was ihre Konzentration beeinträchtigte.
»Was soll ich denn unter all den Herrschaften? Wir gehören nicht dazu!« Ihre Eltern stritten sich, das kam selten vor. Sie hörte ihren Vater irgendetwas murmeln, doch ihre Mutter übertönte ihn. »Da trifft sich die große Welt. Das ist nicht die unsere.«
Unsinn, dachte Benita. Alle Herrschaften aus der großen Welt kamen irgendwann in ihre Praxis, sei es, dass Mylady vom Pferd gefallen oder Hochwohlgeboren betrunken gestürzt war. Sie hatte keine Angst vor großen Namen, schon als kleines Mädchen war sie der Liebling aller Patienten von Rang und Stand gewesen, die im Vorzimmer auf den Herrn Doktor warteten und sich von der lieben Kleinen gern ablenken ließen. Prinzen und Minister hatten ihr die Weltlage erklärt, als sie älter geworden war. Sie waren auch nur Menschen.
»Was, wenn der Kaiser da ist? Oder der britische König? Oder die Königin von Rumänien?« Die Stimme ihrer Mutter hatte jetzt einen leicht schrillen Klang.
Darum ging es also. Heute morgen war ein Brief gekommen, von Prinzessin Daisy. Offenbar die Einladung zu einem ihrer Feste auf Schloss Pless. Benitas Herz schlug ein wenig schneller.
Ihr Vater sprach, langsam, aber immer noch so leise, dass Benita nur Bruchstücke verstand. Eine Ehre. Reverenz erweisen. Sich durchringen.
»Wir werden da nur wie die Ölgötzen herumstehen, niemand wird uns ansprechen, wir machen uns lächerlich!« Ihre Mutter gab nicht nach. »Wer möchte schon seinem Arzt auf einem großen Empfang begegnen? Der ihn in Unterhosen gesehen hat und alles Ungehörige von ihm weiß?«
Benita hörte ihren Vater lachen.
»Ist doch wahr!« Ihre Mutter klang schon nicht mehr ganz so aufgebracht.
»Ich glaube, dass die Prinzessin uns wegen Benita eingeladen hat. Sie ist jetzt in einem Alter, in dem andere Frauen bereits ihren eigenen Hausstand führen.«
Ach, Vater! Benita verzog das Gesicht. Als ob sie mit gerade mal zwanzig Jahren bereits eine alte Jungfrau wäre. Sie hatte noch nicht die geringste Lust auf einen eigenen Hausstand. Zum Fest auf Schloss Pless aber würde sie nur zu gern gehen. Buchhaltung und die Unterhaltung kranker Patienten, wie illuster auch immer, in der Arztpraxis eines beschaulichen Kurorts wie Königsdorff-Jastrzemb waren nicht alles im Leben.
Ihre Mutter schwieg. »Aber wir haben nichts Passendes anzuziehen«, kam es endlich. Beinahe kleinlaut. Benita lächelte in sich hinein. So wie sie ihre Mutter kannte, war das die Kapitulation.
Minuten später stand Caroline von Lanzdorf in der Tür zu Benitas Zimmer, die Wangen leicht gerötet, wie immer, wenn sie sich aufgeregt hatte. »Wir gehen morgen zur Schneiderin«, sagte sie in einem Ton, der es nicht geraten sein ließ, »Warum?« zu fragen.
Ihre Mutter stand auf einem Hocker, damit die Schneiderin den Saum des bodenlangen Kleides leichter abstecken konnte. Benita hielt sich abseits, dort, wo die Stoffballen lagen. Außer schlichtem blauem Kattun und weichem Wollstoff gab es eine Rolle mit nilgrüner Foulardseide, einen dicken Ballen roter Samt, ein wenig Tüll und Batist. Jeder Stoff fühlte sich anders an. Zu jedem konnte sie sich ein passendes Kleid oder Kostüm vorstellen.
Sie hörte nur mit halbem Ohr, was das ältliche Fräulein namens Malwine erzählte, das wie ein Wasserfall redete, trotz einer Batterie von Stecknadeln zwischen den Zähnen. Es ging um Prinzessin Daisys Mann, Hans Heinrich Fürst von Pless, der reichste Mann Schlesiens.
»Schloss Fürstenstein ist schon jetzt gigantisch, und jetzt soll es die größte Anlage weit und breit werden? Der Mann leidet unter Größenwahn. Und woher kommt sein Geld? Von der Ausbeutung der Arbeiter«, knurrte Malwine.
»Winchen!« Benitas Mutter versuchte, tadelnd zu klingen, aber Benita bemerkte das Zucken um ihre Mundwinkel.
»Ist doch wahr. Tausende schuften sich in den Kohlegruben des Fürsten zu Tode, nur damit seine Engländerin üppige Feste mit ihren ausländischen Freunden feiern kann.«
Schloss Pless war doch viel kleiner und intimer als Fürstenstein. Und Prinzessin Daisy … Benita wollte sich einmischen, aber ihre Mutter winkte ab.
»Und wieso überhaupt Daisy?« Die Schneiderin ließ sich nicht beirren. »Sie heißt Maria Theresa.«
Maria Theresa Cornwallis-West aus Wales. Benita kannte ihre Geschichte. Prinzessin Daisy stammte aus britischem Landadel, bei ihrer Einführung in die Gesellschaft war sie im Buckingham-Palast der Queen Victoria vorgestellt worden. Eine Schönheit, die mit achtzehn Jahren den zwölf Jahre älteren Fürsten geheiratet hatte. Es hieß, sie sei ohne einen Penny in die Ehe gegangen, was dem reichsten Mann Schlesiens egal gewesen sein dürfte.
Es gab ein Foto von der Traumhochzeit in London, die Braut hatte ein Brautkleid aus elfenbeinfarbener Seide getragen, tief ausgeschnitten, mit Seidenblumen am Dekolleté und einen von der Fürstenkrone gehaltenen Brautschleier. Mit Prinzessin Daisy war die große Welt nach Schlesien gekommen.
»Sie spricht noch immer nicht Deutsch. Obwohl sie seit ewigen Zeiten hier lebt. Ist wohl zu vornehm dafür.« Winchen hatte die letzte Stecknadel in den Saum von Mutters Kleid gesteckt. »Sie mag Deutschland nicht. Was will sie dann hier?«
Benitas Mutter war zierlicher als ihre Tochter, mit einer beneidenswert schmalen Taille, und das Grün der weich fließenden Robe betonte ihre Augen. Im Vergleich zu ihr kam Benita sich manchmal wie ein derbes Bauernmädel vor. »Ganz ihr Vater«, pflegten Freunde der Eltern zu sagen, was Benita nicht gerade als Kompliment empfand. Aber es stimmte schon: Sie war zwar nicht ganz so groß wie er, doch sie hatte seine dunkelblonden Haare.
»Keine Spitze im Ausschnitt, bitte, Winchen«, sagte ihre Mutter. »Wir wollen nicht protzen. Wir sind bescheiden.«
Ja, das sind wir, dachte Benita. Sie kannte die Bilanzen. Vater war mit Leidenschaft Arzt, davon wurde man nicht reich. Ihm hatte man keine Schlösser und Ländereien in die Wiege gelegt.
»Und dauernd reist sie nach England. Natürlich musste das zweite Kind in London geboren werden. Als ob wir hier keine guten Ärzte hätten.«
Benitas Mutter war vom Hocker gestiegen. »Malwine, du bist ungerecht«, sagte sie. »Sie fühlt sich allein. Wie soll sie denn Deutsch lernen, wenn sie Stunde um Stunde von irgendwelchen Aufpassern umgeben ist? Das ist doch kein normales Leben für eine erwachsene Frau.«
Benita erinnerte sich an den Besuch der Prinzessin in der Arztpraxis ihres Vaters. Sie hatte im Büro Rechnungen geschrieben und die Besucherin in Empfang genommen, doch zuerst nicht erkannt. Daisy war allein gekommen, irgendwie musste sie es geschafft haben, ihrem üblichen Tross zu entfliehen. Blass war sie gewesen, verschüchtert, vielleicht ein wenig verstört. Eine kleine, zierliche Person – noch schmaler als Benitas Mutter. Benita hatte für ihren angedeuteten Knicks ein dankbares Lächeln bekommen, dann war die Prinzessin im Arztzimmer verschwunden. Als ein Jahr später Daisys zweiter Sohn Alexander geboren wurde, hatten die Eltern darauf angestoßen. »Manchmal hilft einfach nur ein guter Rat«, hatte ihr Vater gesagt und seine Frau angelächelt. Auch in Schlesien gibt es gute Ärzte, dachte Benita.
Caroline von Lanzdorf schälte sich aus dem neuen Kleid. »Seit dem Tod ihres Schwiegervaters ist Daisy regierende Fürstin von Pless. Das ist jetzt drei Jahre her. Sie ist längst im wirklichen Leben angekommen.«
»Wenn Sie meinen, gnädige Frau«, sagte Malwine in einem Ton, der erkennen ließ, dass sie das gänzlich anders sah.
»Woher beziehst du überhaupt deinen ganzen Klatsch und Tratsch, Winchen?«
Die Schneiderin hatte das Kleid der Mutter wieder auf den Bügel gehängt und hielt jetzt ein zartes hellblaues Etwas in der Hand.
»Ich kenne jemanden, der sie kennt, ganz einfach.«
»Ach so – Dienstbotengeschwätz! Darauf geben wir nichts«, antwortete ihre Mutter, stieg vom Schemel und gab Benita einen sanften Schubs. Jetzt war sie dran. Sie fürchtete sich ein wenig vor Malwines spitzen Bemerkungen und ihren kalten Händen, aber die Schneiderin musste nur hier ein wenig zupfen und dort etwas ziehen – das Kleid aus hellblauer bestickter Seide mit einem engen Gürtel passte wie angegossen.
»Ich denke, wir müssen uns vor den anderen nicht schämen«, sagte ihre Mutter.
II
Schloss Pless
Die Farben. Das Licht. Benita war fast ein wenig überwältigt vom Funkeln der Kronleuchter, vom Grün und Rot der Tapeten und dem warmen Braun der Holztäfelung, vom sienafarbenen Marmor über dem Kamin und der Rosentapete dahinter, vom Sahneweiß der Freitreppe und dem matten Grau und Blau des Gobelins über dem Treppenabsatz. Vom Klangteppich, der sie umhüllte, aus Frauenlachen, Männerbass und dem hellen Klirren der Gläser auf den Tabletts, die [13]livrierte Bedienstete vorbeitrugen. Von der warmen Wolke aus Schweiß und Parfüm und dem Duft üppiger Blumenbuketts. Die Gesichter vor ihr und neben ihr verschwammen, manchmal tauchten daraus rot geschminkte Münder auf oder fein gezwirbelte schwarze Schnurrbärte. Das eine oder andere Gesicht kam ihr vertraut vor, doch niemand musterte sie, ob er sie womöglich kannte. Wer erwartete schon die Tochter des Kurarztes ausgerechnet hier? Im Grunde war sie froh darüber.
Ihre Mutter hatte sie untergehakt und schob sie durch die Gästemenge, sehr zielstrebig. Dabei hatte Caroline von Lanzdorf sich doch so geziert, bevor sie die Einladung angenommen hatten!
»Ist der Kaiser da?«, flüsterte Benita. Er war oft hier, das war bekannt, in Pless oder in Promnitz, einem Jagdschlösschen gleich um die Ecke. Wenn Prinzessin Daisy einlud, trafen sich hier Europas gekrönte Häupter und die Mächtigen der Welt. Geld für so viel Gastfreundschaft gab es mehr als genug. Schloss Pless mochte nicht so groß sein wie Schloss Fürstenstein, aber Benita fühlte sich plötzlich eingeschüchtert, ganz gegen ihren Willen. Nein, sie gehörten nicht hierhin, Mutter hatte recht. Benita merkte, wie ihr die Brust eng wurde.
In diesem Moment schwebte Prinzessin Daisy auf sie zu, die Arme weit geöffnet, als ob sie Mutter und Tochter umschlingen wollte.
»Wie wunderbar, dass Sie gekommen sind«, sagte Daisy mit ihrem putzigen Akzent. Benita lächelte, sagte »Hoheit« und wollte einen Hofknicks machen, aber die Prinzessin nahm sie an beiden Händen, zog sie an sich, musterte sie und nickte schließlich, bevor sie sich Caroline von Lanzdorf zuwandte.
Benitas Französisch war besser als ihr Englisch, doch in einem Kurort, der Besucher aus aller Welt anzog, lernte man früh, sich zu verständigen. Ihre Mutter wechselte übergangslos ins Englische, was Daisy mit einem Lächeln quittierte. »Ich erinnere mich so gern an Sie!«
Caroline neigte den Kopf. »Das ehrt mich.«
Mittlerweile war auch Maximilian von Lanzdorf bei ihnen angelangt. Daisy streckte ihm die Hand hin und hauchte: »Ohne Sie wäre ich tot.«
Benita beobachtete erstaunt, dass ihr Vater, der sich doch sonst durch kaum etwas beeindrucken ließ, zu erröten schien. Wie gut er aussah in seinem Frack! Weit besser als viele der Männer, deren mit bunten Orden behängte Uniformjacken über dem Bauch spannten. Ihr wurde ganz warm vor Zuneigung.
Eine zarte Hand legte sich auf Benitas Arm. Daisy hatte sich ihr mit Verschwörermiene zugeneigt, Benita roch Puder und Parfüm, und die blauen Augen der Prinzessin waren plötzlich ganz nah. Strahlend kornblumenblaue Augen.
»Sie müssen einen guten Bekannten von mir kennenlernen, er ist mit jemandem befreundet, mit dem ich über mehrere Ecken verwandt bin, kaum zu glauben, aber wahr.«
Die Menschenmenge wich vor Daisy zur Seite, als ob sie Moses wäre, vor dem sich das Rote Meer teilt. Benita nickte hierhin und dorthin, vorsichtshalber, obwohl sie niemanden erkannte, und sie vergaß jedes Gesicht und jeden Namen, kaum dass sie ein paar Schritte weitergegangen waren. Der Tross um die Prinzessin schob sie voran. Daisy von Pless grüßte nach rechts und links, blieb hier stehen, sagte dort ein paar Worte, das Bad in der Menge schien ihr zu gefallen. Benita versuchte, an ihrer Seite zu bleiben, doch irgendwann war ihr Daisys Arm entglitten, und sie verlor die Eltern und die Prinzessin aus den Augen.
Sie blieb stehen, wusste nicht, wohin, ließ die anderen Gäste an sich vorbeiströmen, hörte hier und da ein Wort, verstand nichts. Endlich kam die Prinzessin zurück, gefolgt von Benitas Eltern, und nahm sie lächelnd bei der Hand. »Liebes Kind, wir sind Ihnen davongelaufen! Und haben dabei den Mann verpasst, den Sie unbedingt kennenlernen müssen!«
Der Mann, den sie meinte, hielt ein leeres Glas in der Hand und stand ein wenig abseits, unter einem mächtigen Hirschgeweih.
»Hoheit«, murmelte er, als er wahrgenommen hatte, wer da vor ihm stand.
»Ludwig!«, rief Daisy. »Ich will Ihnen liebe Menschen vorstellen, die mir sehr geholfen haben, als ich einmal Hilfe brauchte. Maximilian und Caroline von Lanzdorf und ihre entzückende Tochter Benita!« Daisy intonierte »entzückend« mit einem Überschwang, der Benita ein wenig peinlich war. »Benita, das ist Baron Ludwig von Sedlitz! Er wohnt auf Rittergut Mondsee bei Wohlau, leider viel zu weit weg von uns!«
»Meine Verehrung, gnädiges Fräulein«, murmelte der Baron und beugte sich über Benitas Hand. »Erschrecken Sie nicht, die Fürstin neigt zu Überfällen, ich bin ganz harmlos!«
Benita musterte ihn. Harmlos war nicht das passende Wort, dafür sah er zu gut aus: groß, schlank, mit vollem dunklem Haar und einem etwas melancholischen Lächeln. Und den sollte sie unbedingt kennenlernen? Warum nicht?
»Ein Überfall, sagen Sie? Ist das nicht eher die Spezialität von Leuten, die auf einem Rittergut hausen?«
Er lachte. »Das stimmt. Wir rauben edle Fräulein und erpressen dafür Lösegeld. Ein gewinnbringendes Geschäft.«
»Das freut mich für Sie. Ich hoffe, Sie rauben nur edle Damen, bei denen es sich lohnt.«
Er neigte den Kopf. »Nun, Schönheit ist natürlich auch etwas wert.«
»Und ebenso lukrativ?«
»Nun …« Er räusperte sich. »Ist nicht die Schönheit allem Gold der Welt vorzuziehen?«
»Vielleicht. Solange die Bilanzen stimmen. Ich sorge für die Buchführung in der Praxis meines Vaters.«
Er zog die Augenbrauen hoch. »Das kann ich nicht von der Hand weisen. Rechnen müssen wir auch auf Mondsee, manchmal sogar mit dem Schlimmsten.«
Der Mann gefiel Benita. Wenn Daisy sie hatte verkuppeln wollen, hatte sie jedenfalls keinen schlechten Geschmack bewiesen. Dass sich erst die Prinzessin zurückzog und irgendwann auch ihre Eltern weitergingen, nahm sie nicht mehr wahr.
»Vielleicht sollte auch ich einmal zur Kur kommen, verehrtes Fräulein von Lanzdorf«, sagte er irgendwann, nachdem sie ihm von den Aufgaben eines Kurarztes erzählt hatte.
»Aber gewiss doch, Herr von Sedlitz«, antwortete sie. »Unsere Sole ist reich an Jod, Brom und Kohlensäure. Wir heilen Sie von Skrofulose, Gicht und Rachitis. Welche Krankheit ist Ihnen die liebste?«
»Hilft Ihr magisches Wasser auch gegen Melancholie?«
Sie musterte ihn. »Wir haben eine Kirche. Und sonntags gibt es Konzerte.«
Er winkte einem Livrierten mit Tablett und ließ sich zwei Gläser Champagner reichen. Benita nahm das Glas entgegen, ein wenig verlegen. Etwas bedrückte den Mann.
»Jetzt sind Sie dran«, sagte sie schnell. »Erzählen Sie mir von Mondsee. Das ist ein schöner Name.«
Er lächelte. »Ja. Und manchmal spiegelt er sich tatsächlich im Teich, der Mond.« Sie standen noch immer in der Ecke, unter dem Hirschgeweih, und ließen die Gäste vorbeipromenieren. »Mit Schloss Pless kann mein Gut allerdings nicht mithalten.«
»Da haben Sie aber Glück«, entgegnete Benita. »Bedenken Sie die Unterhaltungskosten.«
»Wie recht Sie haben! Mondsee war einst nicht viel mehr als eine Burg auf einem Hügel, umgeben von einem Wallgraben. Von der Burg ist nicht mehr viel übrig, doch ein gemauerter Streitturm ist noch erhalten, der spielt in unserer Geschichte eine besondere Rolle.«
Benita hatte, ohne darauf zu achten, ihr Glas geleert und spürte, wie der Leichtsinn in ihr hochstieg. »Hat einst Rapunzel auf den Burgzinnen gestanden und ihr Haar herabgelassen?«, fragte sie.
»Leider nein.« Jetzt grinste er wie ein Schuljunge. »Die wirkliche Geschichte ist nur beinahe so schön. Der Wehrturm hat uns gegen die Tataren geschützt.« Er sah ihr in die Augen. »Wir waren nie reich, aber wir haben es verstanden, auch mit dem, was wir nicht hatten, zu protzen.«
Benita schaute ihn an. Seine Augen waren braun, ein helles, warmes Braun. Über die linke Augenbraue zog sich eine feine weiße Narbe.
»Als 1431 die Hussiten anrückten, schlachteten die Burgbewohner ihre letzten Hühner und warfen sie gebraten über die Brüstung, damit die ausgehungerten Männer da draußen glaubten, in der Burg gäbe es so große Vorräte, dass die Belagerung noch ewig dauern konnte. Das hat sie wohl überzeugt, sie zogen ab.«
»Mehr scheinen als sein«, kommentierte Benita. »Eine altehrwürdige Strategie.«
»Ja.« Er lächelte sie an. »Aber umgekehrt ist es mir lieber.« Sie sahen einander an. Er wandte als Erster den Blick ab.
»Mondsee hat eine eigene Elektrizitätsversorgung«, sagte er nach einer Weile. »Und wir haben Karpfen im Hofteich.«
Das war eine bemerkenswerte Brautwerbung, dachte sie später oft. Und daran, was sie sich gewünscht hatte, als sie im Mai den Kometen Halley über den Himmel hatte ziehen sehen. Manche glaubten, dass der Komet Unheil brachte. Sie nicht. Er war ein Glücksbringer.
Bereits einen Monat später traf Benita den Baron wieder, bei einem Empfang auf Schloss Pless aus Anlass eines Besuchs des Kaisers. Daisy war schwanger, das war nicht zu übersehen, doch sie wirkte leicht und beschwingt wie eine Flaumfeder.
Zu ihrer großen Verlegenheit bestand die Prinzessin darauf, sie dem Kaiser vorzustellen. Wilhelm II. nahm Benitas Hand, blickte ihr tief in die Augen und sagte: »Ich wünsche dir alles Glück der Welt, mein liebes Kind.« Sie nahm auch das als gutes Zeichen.
An diesem Abend sprachen Ludwig und Benita wenig. Sie tanzten unter einem Himmel mit Engeln und Putten, dem Gemälde auf der Decke über ihnen.
Ludwig besuchte sie bald darauf in Königsdorff, zur Kur, wie er sagte, und damit meinte er ihre Gesellschaft, wie er Benita am nächsten Tag gestand. Plötzlich war die Leichtigkeit zwischen ihnen verschwunden.
Auf dem Heimweg nach einem Konzert im Kurpark nahm er ihre Hand. Nach einer Weile räusperte er sich. »Landwirtschaft ist natürlich etwas ganz anderes als so ein Kurbetrieb«, sagte er.
»Wirklich? Das hätte ich nicht gedacht«, spottete Benita und versuchte, die Stimmung ein wenig aufzulockern, aber Ludwig blieb ernst.
»Wir bewirtschaften beinahe tausend Hektar, Äcker, Wiesen, Wald und Seen. Seit einigen Jahren haben wir ein eigenes Kraftwerk. Ich halte dreihundert Tiere in der Schweinezucht. Wir füttern Kartoffelflocken, ich habe die Anlage dafür erst in diesem Jahr installiert.«
Fürwahr ein großer Romantiker, dachte Benita.
»Angeblich spukt es bei uns, aber ich habe die weiße Frau noch nie gesehen.«
»Wie beruhigend«, antwortete Benita und drückte seine Hand.
»Die nächstgrößere Stadt ist fünf Kilometer entfernt. Sonderlich mondän ist Wohlau nicht, aber …«
Benita blieb stehen, hielt seine Hand fest, sah ihm in die Augen.
»Der Karpfenteich würde mich interessieren. Und das Elektrizitätswerk.«
Er wusste nicht, ob er sie küssen durfte. Sie entschied für ihn.
III
Königsdorff–Mondsee
Das Frühjahr 1910 kam ihr wie das schönste Frühjahr vor, das sie je erlebt hatte, egal, ob es regnete oder stürmte oder die Sonne schien. Es störte sie nicht, dass sie zu keinem Konzert im Kurpark gehen durfte, weil einer der Kurgäste mit Tuberkulose ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Auch ging der Aufruhr wegen des Reitunfalls des Khediven von Ägypten, Abbas Hilmi II., völlig an ihr vorbei, obwohl der in Königsdorff auf Kur weilende Vizekönig versuchte, einen politischen Skandal daraus zu machen. Sie war in Gedanken ganz woanders, bei Ludwig und den Briefen, die sie pünktlich einmal in der Woche von ihm erhielt. Jeder Satz brachte ihn ihr näher – und wenn es nur um eine Panne im gutseigenen Elektrizitätswerk ging oder um die Geburt eines Fohlens.
Im Mai durfte sie zum Pferderennen nach Groß Strehlitz fahren, ihre Eltern waren mit Graf Mortimer von Tschirschky-Renard befreundet gewesen, dem kürzlich verstorbenen Schlossherrn von Groß Strehlitz, und sie waren dort noch immer willkommen.
»Ich nehme an, dass Ludwig mit dem neuen Schlossherrn bekannt ist?«, hatte ihre Mutter gefragt. Benita musste nichts sagen, die Antwort sah man ihr an.
Inmitten der vielen Gäste, zwischen Reitern und Pferden, die Luft geschwängert von Pferdegeruch, Zigarrenrauch und dem Parfüm der Damen, waren Ludwig und sie ganz für sich.
Einen Monat später hielt Ludwig bei ihrem Vater um Benitas Hand an. Im Spätsommer, nach der Ernte, sollte geheiratet werden. Plötzlich ging ihr das alles viel zu schnell. Hatte sie nicht vor gar nicht langer Zeit geglaubt, dass sie noch kein Interesse am eigenen Hausstand hätte?
Der Abschied von Königsdorff-Jastrzemb fiel Benita schwerer, als sie es sich vorgestellt hatte. Woanders ging es womöglich mondäner zu, aber man war hier immerhin umgeben von gut gekleideten Menschen aus aller Welt, die zwischen den Kurhäusern, dem Trinkhaus und den Badeanstalten flanierten. Viele wohlhabende Besucher aus Bürgertum und Adel, die regelmäßig kamen, hatten sich ansehnliche Villen gebaut. Der Kurpark war bekannt für seine exotischen Pflanzen – und für die grazile Muschel über der Bühne, auf der jeden Sonntag Konzerte gegeben wurden. Es wurden Lesungen veranstaltet, in der Bibliothek, einem ihrer Lieblingsorte. Man konnte ins Theater gehen. Es gab sogar ein Casino. Dort verspielten auch Leute, die es sich nicht leisten konnten, ihr Geld.
Mit einem Mal wunderte sie sich über ihren Mut. Bei aller Liebe zu Ludwig: Wie würde ihr Leben aussehen in der niederschlesischen Provinz? Sicher, sie konnte sich nützlich machen, sie verstand etwas von Buchhaltung, die Bilanzen mussten auch auf einem Landgut stimmen, sie konnte Wunden versorgen und vermochte zur Not sogar einen Knopf anzunähen, aber von Landwirtschaft verstand sie gar nichts, erst recht nichts von Tieren wie Schweinen und Zugpferden. Im Kurort ritt man gepflegt aus, auf manierlichen Pferden, und kein Tier war wilder als die ondulierten Modehunde, die die Kurgäste an der Leine mit sich führten. Was sie im Ehebett erwartete, wusste sie so halbwegs, in einem Arzthaushalt blieb einem kaum etwas verborgen. Und immer, wenn Ludwig sie geküsst hatte, fühlte sie sich so glückselig wie willenlos zugleich – alles war möglich mit ihm, alles würde gut und richtig sein.
»Liebe«, sagte Caroline am Abend vor ihrer Abreise, als sie merkte, dass Benita verträumt ins Kaminfeuer blickte, »Liebe verzaubert alles, das wirst du merken. Ich glaube, dein Ludwig weiß, was er tut.«
Das gab ihr zu denken.
Ihre Mutter musste gemerkt haben, was sie dachte, und lachte leise. »Er ist ein gut aussehender Mann, das ist gewiss auch anderen Frauen nicht entgangen. Und er ist eine gute Partie. Auch wenn ich mir gewünscht hätte …«
Jetzt war es Caroline, die ins Feuer starrte.
»Was, Mama«, flüsterte Benita, plötzlich beunruhigt, »was hättest du dir gewünscht?«
Caroline sah auf und lächelte. »Dass dich die Liebe nicht so furchtbar weit von uns fortführen würde.«
Ihre Eltern begleiteten Benita nach Mondsee. Die Truhe mit der Aussteuer und die Koffer mit der Garderobe waren bereits vorausgeschickt worden. Benita hatte sich Schuhe anpassen lassen, nicht nur die Brautschuhe, auch stabiles Schuhwerk für das Leben auf dem Land. Mutter und Tochter hatten Tage und Stunden damit verbracht, Stoffe auszusuchen, die Malwine in Röcke, Hosen, Kostüme und Kleider verwandelte. Das Brautkleid war der Höhepunkt gewesen: Es sollte nicht zu üppig ausfallen, aber auch nicht zu brav, nicht städtisch wirken, aber auch nicht provinziell.
»Meine wunderschöne Tochter«, hatte Caroline bei der letzten Anprobe geflüstert und war in Tränen ausgebrochen. Benita hatte sie in den Arm genommen und mitgeweint, trotz Malwines Protesten, die den Saum abstecken wollte.
Jetzt saßen sie in ihrem Zugabteil, und Benita hatte bereits [23]Heimweh. Doch es gab einen Trost, der am Gang saß und nicht wagte, aus dem Fenster zu schauen, und der hieß Marielle.
Marielle stammte aus Tychy bei Kattowitz, sie war das zweitälteste Mädchen von sieben Kindern und hatte mit dreizehn Jahren ihren Dienst bei Benitas Eltern angetreten. Sie kam aus ärmlichen Verhältnissen, ihr Vater arbeitete in der Papierfabrik, die Mutter im Brauereiausschank. Für ihre Familie war die Anstellung bei einer Arztfamilie ein Glücksfall gewesen. Und für das Mädchen erst recht.
Benita hatte sich ihrer angenommen, als ob es ihre kleine Schwester wäre. Wie oft hatte sie das Mädchen trösten müssen, das sich nach seiner Familie sehnte und sich verloren fühlte in einem Kurort, der sich mondän gab. »Aber ich bin doch so glücklich hier«, hatte die Kleine dann oft unter Tränen geflüstert. Glück und Trauer waren eins.
Und jetzt hatte sie inständig darum gebeten, mit Benita nach Mondsee gehen zu dürfen, Benita war doch ihre große Schwester. Benitas Eltern hatten sofort zugestimmt und die Erlaubnis der Eltern von Marielle eingeholt. Die kam postwendend – mit Glückwünschen für Benita. Das alles machte den Abschied leichter.
Ludwig holte sie mit einem mit Girlanden und blühenden Zweigen geschmückten Vierspänner vom Bahnhof ab. Es war nicht weit bis zum Rittergut. Die Pferde trabten über eine Brücke, einen Kiesweg hoch und durch einen baumbestandenen Park bis zu einem Rondell vor dem Haus.
Ludwig hatte recht gehabt: Das Rittergut war kein Schloss, sondern ein zweistöckiges Gutshaus mit einem auffallenden, reich verzierten Eingangsportal. Vor der Treppe warteten Ludwigs Bedienstete auf die künftige Baronin. Nachdem sich alle mit Knicks und Verbeugung vorgestellt hatten, stieg Benita das erste Mal die Treppen hoch zum Eingang. Zwischen zwei Säulen mit filigranen Kapitellen spannte sich ein weiter Steinbogen, geschmückt mit in den Stein gemeißelten Ranken, Früchten, Putten und Tieren. Sie blieb einen Moment stehen und betrachtete die Vögel, Hasen und Eber, die zwischen den Weinranken versteckt waren. Das bringt Glück, dachte sie und trat durch die weit geöffnete Tür.
Von diesem Moment an kam sie nicht mehr zur Ruhe.
Ludwig hatte das ganze Obergeschoss für seine Braut und ihre Eltern geräumt und wollte bis zur Hochzeit im Kutscherhaus wohnen. Benita war nicht eine Minute allein mit ihm, es blieb bei zufälligen Berührungen und Blicken, die sie sich in unbeobachteten Momenten zuwarfen. Gleich der erste Tag begann mit einer Führung durch Hof und Stallungen, daran schloss sich eine Besichtigung der zum Gut gehörenden Ländereien an und eine Rundfahrt durchs Dorf, bei der sie an jedem Haus anhielten, um sich vorzustellen, ein Schwätzchen zu halten und hier und da einen Schnaps zu trinken. Benita vermochte sich all die Gesichter und Namen nicht zu merken, nur den Postboten prägte sie sich ein, Miekosch hieß der Mann, ein schmaler Kerl mit einem umso üppigeren Schnauzbart, der würde ihr Nachrichten von den Eltern bringen.
Während sie mit Ludwig und den Eltern unterwegs war, blieb Marielle zurück bei der Köchin Berbla, keine dicke Küchenmamsell, sondern eine große schlanke Frau, die blonden Haare zu einem Zopf geflochten, den sie wie einen Kranz ums Haupt trug.
Benita beobachtete beim Abendessen mit leisem Spott, wie ihr Vater sich bei der Köchin einzuschmeicheln versuchte. »Ob es auch Mohnklöße bei Ihnen gibt«, fragte er mit seinem charmantesten Lächeln, als sie das Geschirr abtrug. »So etwas bekomme ich zu Hause nicht.« Benita bemerkte den spöttischen Blick ihrer Mutter, den sie auf seine Leibesmitte richtete.
»Aber natürlich, gnädiger Herr«, sagte Berbla und lächelte ihn an, bevor sie wieder in die Küche ging.
Am Tag darauf stellten sich Benita und Ludwig beim Pfarrer vor, in der kleinen evangelischen Kirche dem Rittergut gegenüber. Das war eher entspannt als förmlich, der würdige Herr neigte zu Scherzen. Danach kutschierte Ludwig die ganze Familie nach Wohlau, der nächstliegenden Stadt, »damit ihr nicht denkt, dass es in unserer Gegend keine Lebensart gibt«.
Sie fuhren im Schatten der Alleebäume durch eine Landschaft aus heckenumkränzten Wiesen, es roch nach Falläpfeln und frisch gepflügtem Ackerboden. Benita schloss die Augen und hielt ihr Gesicht in den warmen Wind.
Gewiss, Wohlau verfügte über ein prächtiges Rathaus am Ring, dem mittelalterlichen Marktplatz, es gab eine barocke und eine gotische Kirche und ein imposantes Schulgebäude, auf das Ludwig mit besonderem Nachdruck hinwies. Doch er hatte gottlob ein gutes Gespür für das Ausmaß des Interesses der Damen an Kultur und Historie und führte sie rechtzeitig ins Café.
Abends versammelten sie sich im Kaminzimmer, die Männer tranken Cognac und rauchten Zigarren, den Damen hatte Ludwig Likör eingeschenkt. Benita fielen nach dem anstrengenden Tag fast die Augen zu. »Heiraten ist kein Spaß«, sagte ihre Mutter leise zu ihr. »Du solltest dich morgen schonen. Denn nach dem Polterabend kommt der Hochzeitstag und dann der Tag danach – es werden vor allem eure Gäste sein, die ihren Spaß haben.«
Sie hatte recht, wie immer. Der Polterabend war für die Nachbarn gedacht, die ausgelassen aßen und tranken. Benita kam sich ein wenig fremd vor, aber Ludwigs bester Freund aus seiner Studienzeit in Heidelberg schien das zu spüren und wich nicht von ihrer Seite: Alexander Duff Broedie vom Clan Broedie auf Moray Castle, der den langen Weg nach Schlesien angetreten hatte, »weil ich das Wunder kennenlernen wollte, von dem Ludwig in seinen Briefen so geschwärmt hat«.
»An dem Wunder ist nur Daisy von Pless schuld«, antwortete sie, während sie mit ihm durch den Park ging.
»Dann müssen wir ihr dankbar sein.«
»Sie sind verwandt, habe ich gehört?«
»Höchstens weitläufig, sehr weitläufig. Eigentlich haben wir nicht viel gemeinsam. Außer der Tatsache, dass sie aus Wales kommt und ich aus Schottland. Wir sind also beide keine Engländer. Erfreulicherweise.«
Benita lächelte. Auch Schlesier verstanden sich nicht als Preußen.
Sie ließ sich von ihrer Mutter früh ins Bett schicken.
Dann kam der Tag der Hochzeit. Benitas Vater führte sie zum Traualtar. Er war gerührt, was wiederum Benita rührte, sodass beide Tränen in den Augen hatten. Als er es endlich durfte, küsste Ludwig seine Braut so stürmisch, dass sie trotz der Tränen lachte.
Marielle, Berbla und das Gesinde standen Spalier, als die Kutsche mit den Frischvermählten eintraf. Im Park waren die Tische unter den Bäumen mit weißen Tischtüchern eingedeckt. Unter den Hochzeitsgästen gab es ein paar Honoratioren aus Wohlau, der Bürgermeister, der Apotheker und der Schuldirektor, jeweils mit ihren Frauen. Benita versuchte gar nicht erst, sich all die Namen zu merken, sie würde noch genug Zeit dafür haben. Prinzessin Daisy hatte dreißig Strauchrosen und zehn Hochstammrosen geschickt, die aufgereiht auf dem Rasen standen. Ludwig reichte ihr den begleitenden Brief. Daisy von Pless sandte die allerherzlichsten Glückwünsche, doch nach der Geburt ihres Sohnes Bolko sei sie krank geworden und könne deshalb nicht persönlich gratulieren. Das war auch besser so, dachte Benita. Es hätte sie alle gezwungen, noch förmlicher zu sein als dem Anlass angemessen war. Sie hatte nach alldem vielen Nicken und Händeschütteln längst Kopfschmerzen.
Beim Kaffee saßen Ludwig und sie an der Spitze der Tafel, gottlob unterhielten sich die Gäste nach den üblichen mal heiteren, mal eher peinlichen Ansprachen miteinander, sodass das Brautpaar nicht viel sagen musste. Unter dem Tisch hielt Ludwig ihre Hand. Und nach einer Weile legte er ihr einen weiteren Brief neben den Teller, einen Brief aus Russland. »Von Luise«, flüsterte er.
Von Ludwigs Schwester also, die nach Russland geheiratet hatte, einen Grafen Alexei Schuwalow. Weil sie hochschwanger war, hatte sie zur Hochzeit nicht kommen können. Benita hatte Ludwig angemerkt, wie sehr er unter ihrer Abwesenheit litt. Ihrer beider Eltern waren vor einigen Jahren bei einem Unfall auf dem Weg zum Kloster Leubus ums Leben gekommen. Sein Vater hatte die Kontrolle über das Pferdegespann verloren, der Landauer war gegen einen Baum geschleudert worden. So war Ludwig von einem Tag auf den anderen Gutsherr geworden – und hätte sich ohne seine Schwester noch einsamer gefühlt. Benita faltete den Brief auseinander.
»Bailanda, im September 1910
Mein liebster Bruder, meine künftige Schwägerin!
Ach, könnte ich doch an Eurem großen Tag bei Euch sein! Wie gerne hätte ich in das glückliche Antlitz meines Bruders geschaut und seine schöne Braut in die Arme geschlossen! Ich wünsche Euch aus tiefstem Herzen alles Glück der Welt, Gesundheit, Zufriedenheit, eine große Familie! Möge der Herrgott über Euch wachen und Euch beschützen, was immer geschieht.
Was mich betrifft: Ich kann es kaum noch erwarten, dass es sich endlich in die Welt hinauswagt, das Wesen, das ich in mir trage. Wir werden ihn Dimitri Georgij nennen – oder, wenn es ein Mädchen ist, Sofia Cecilia, nach Alexeis und unserer Mutter. Ich kann mich nicht entscheiden, was mir lieber wäre! Doch Alexei weiß ganz genau, was er will. Er möchte ein Mädchen, und es soll seiner Mutter ähnlich sein! Nun, man darf sich alles wünschen, aber die Entscheidung liegt nicht bei uns.
Erwartungsfroh und glücklich und zugleich betrübt, dass ich nicht bei Euch sein kann.
Deine Dich innig liebende Schwester Luise«
Sie würden sich hoffentlich bald kennenlernen. Benita spürte, wie sich ihre innere Anspannung löste. Sie war angekommen.
IV
In den ersten Wochen und Monaten langweilte sich Benita nicht eine Sekunde lang. Ludwigs Zuneigung schien jeden Tag zu wachsen, aber vielleicht kam ihr das nur so vor, weil sie ihn jeden Tag mehr liebte. Und Mondsee war weit geheimnisvoller, als eine alte Ritterburg vermuten ließ. Das Renaissanceportal faszinierte sie immer wieder, stets entdeckte sie ein neues Tier, das sich hinter den aus dem Stein gemeißelten Ranken versteckte. Wenn man eintrat, stand man in einer riesigen Halle mit Kreuzgewölben, die das ganze Haus durchmaß. Die Räume mit den bodentiefen Fenstern rechts und links der Halle hatten Stuckdecken mit bizarren Mustern, selbst Ludwig rätselte, ob sie irgendetwas zu bedeuten hatten. Die privaten Gemächer lagen im ersten Stock, vom Schlafzimmer aus überschaute man den Park und den Schlossgraben.
Den Ställen und den Tieren näherte sie sich mit aller Vorsicht, Gartenarbeit war ihr weit lieber. Hanesek, der Hausknecht, half ihr, Prinzessin Daisys Rosen einzupflanzen, rechtzeitig, bevor der Winter kam. Im Frühjahr würde es ein Gewächshaus geben, hatten sie und Marielle beschlossen. Gut, dass das Mädchen da war – das half gegen Anfälle von Sehnsucht nach ihrem alten Leben und ihren Eltern.
Gesellschaftliches Leben in Mondsee? Davon konnte tatsächlich keine Rede sein. Der Ort bestand hauptsächlich aus Rittergut und Kirche, dazu Gesindehäuser, die Schmiede, das Pfarrhaus, der Dorfladen und ein paar Bauernhäuser. Wenigstens besaß Ludwig eine umfangreiche Büchersammlung, das war eine sichere Burg, sollte sie einmal Langeweile haben, wonach es bislang nicht aussah.
Ab und an fuhren Ludwig und sie mit der Kutsche nach Wohlau, um Stoffe und ein paar andere Kleinigkeiten zu kaufen oder in die Apotheke zu gehen. Wenn das erledigt war, ging es zum Mittagessen in den Kaisergarten, wo man auf den Notar oder die Apothekersfrau traf, das waren die einzigen gesellschaftlichen Herausforderungen.
Die Sonntage begannen mit dem Gang in die evangelische Pfarrkirche. Dort saßen sie, als Kirchenpatrone, in einer eigenen Loge. Kelch und Hostienteller hatte Ludwigs Urgroßmutter gestiftet mitsamt einer großzügigen Spende für eine der drei Kirchenglocken. Benita war froh, dass man in der Loge unbeobachtet saß, denn Pfarrer Künzel predigte ausladend und wenig aufrüttelnd, sie war bereits einmal eingenickt.
Immerhin gab es auch mal einen Gesangsabend oder eine Lesung, ausnahmsweise nicht aus der Bibel. Anfangs kam Ludwig zu solchen Abenden mit, obwohl sie ihm anmerkte, dass er sich langweilte und lieber im Stall oder auf dem Acker wäre.
»Im Winter habe ich mehr Zeit für alle möglichen Abwechslungen, Liebes«, sagte er, als sie ihm einen Vortragsabend in Wohlau vorschlug. Das war auszuhalten, hatte Benita gedacht, der Herbst war schon fast vorbei. Im Winter würde auch seine Schwester Luise zu Besuch kommen. Doch daraus wurde nichts.
»Bailanda, Oktober 1910
Lieber Ludwig, liebe Schwägerin Benita,
unser innigster Wunsch hat sich mit der Geburt von Sofia Cecilia am 16. September erfüllt. Sie ist wunderschön, die Freude ihres Vaters und mein ganzes Glück. Das sieht man, oder? Die stolzen Eltern mit ihrem kleinen Engel – doch, das Foto, das ich Euch beigelegt habe, entspricht ganz der Wirklichkeit! Leider auch, was mich betrifft. Ludwig kennt mich so gar nicht, so blass und dünn.
Ich bin mit mir nicht zufrieden. Die Geburt war nicht einfach, ich war lange bettlägerig, Alexei musste sich Sorgen um mich machen. Dabei braucht das Gut eine zupackende Hausfrau, zumal, wenn Alexei wie so oft in Petersburg ist. Wir gehören ja nicht zu den Hochwohlgeborenen, bei denen in jeder Ecke ein Dienstbote bereitsteht, falls einer der Damen das Taschentuch herunterfallen sollte. Ich jedenfalls bin froh, dass ich mich nur um 12 Zimmer und nicht um 60 kümmern muss und dass unsere Leute Zeit für Vieh und Frucht haben, statt mir Luft zufächeln zu müssen.
Das ist ein seltsames Land, dieses Russland. Unfassbarer Reichtum auf der einen Seite – dagegen ist unser schlesischer Krösus Hans Heinrich von Pless ein Bettler. Und auf der anderen Seite eine unerhörte Armut. Den Bauern hat die Befreiung von der Leibeigenschaft nichts gebracht, sie sind zu arm, um Land zu kaufen. Und dann müssen sie zusehen, wie die Aristokraten leben – wie die Maden im Speck. Wie genau ich mich erinnere an die schrecklichen Monate im Sommer 1905, kurz nach unserer Heirat. Überall wurde geplündert und niedergebrannt, das Land lag unter Rauchwolken wie unter einem Leichentuch. Wir waren nicht reich genug, deshalb haben sie uns verschont. Aber dass man die Aufstände mit unbarmherziger Härte niedergeschlagen hat, dürfte sich rächen. Es liegt etwas in der Luft, etwas ganz und gar Ungutes.
Doch ich schweife ab, verzeiht, das ist die erzwungene Untätigkeit, die macht geschwätzig.
Ich habe Sehnsucht nach Dir und unserem lieben Mondsee, liebster Ludwig, und möchte endlich endlich Benita kennenlernen!
Ungeduldig mit sich und der Welt: Deine Schwester Luise«
Diesen Brief beantwortete Benita. Luise schrieb postwendend zurück. Ein Brief von ihr wurde zum beinahe wöchentlichen Lichtblick. Ludwig schien diese Brieffreundschaft zu freuen. »Meine behütete kleine Schwester«, sagte er an einem Dezemberabend, als Benita ihm vorlas, was Luise über die Zustände in Russland geschrieben hatte. »Sie hat das nicht verdient.« Er drehte die Zigarre zwischen den Fingern. »Mein Vater hat es gar nicht gern gesehen, dass sie unbedingt einen Mann aus der Leibgarde des Zaren heiraten wollte. Und recht hatte er.«
»Wo die Liebe hinfällt! Du weißt doch, dass man dagegen nichts machen kann!«
Er blickte auf. »Glaubst du etwa, es hätten nicht auch sachliche Gründe für dich gesprochen?«
Sie lachte. »Ja, ich weiß, du schätzt es, dass ich neben der Buchführung auch Knöpfe annähen kann. Wo hat Luise ihren Leibgardisten denn kennengelernt?«
»Bei der Kur in Homburg. Sie war von einer Freundin eingeladen worden, die nicht allein fahren wollte. Alexei wiederum begleitete seine Großmutter. Und wie das so geht – wenn man auf der Kurpromenade flaniert … daran müsstest du dich doch erinnern!«
Er lachte, gutmütig, aber es ärgerte sie trotzdem. »Ich hatte in der Praxis und mit der Buchhaltung genug zu tun und keine Zeit zum Flanieren!«
»Ich weiß doch, Liebes. Jedenfalls muss es bei Luise und Alexei so gewesen sein, wir waren ja ganz beruhigt, dass sie sich nicht im Casino beim Glücksspiel begegnet sind. Ich habe meine kleine Schwester jedenfalls immer verteidigt, auch gegen meine Eltern. Obwohl sie es in diesem Fall womöglich besser wussten.« Er seufzte. »Die Hochzeit haben die beiden noch miterlebt. Sie war eine wunderschöne Braut. Und er in seiner Uniform – unwiderstehlich!«
Sie musste lachen. »Ist das alles? Oder steckt auch was drin in der Uniform?«
Ludwig lehnte sich zurück. »Alexei ist ein sehr gebildeter und belesener Mann. Er spricht außer Russisch auch Französisch und Deutsch, und das ziemlich anständig. Sie wird sich mit ihm nicht langweilen, zumal, seit das Kind da ist. Aber die Lage in Russland – ich weiß nicht. Zar Nikolaus ist ein uneinsichtiger Dummkopf. Wer einen friedlichen Protest gegen die schlechte Versorgungslage blutig niederschlagen lässt, muss sich nicht wundern, wenn es Aufstände im ganzen Land gibt. Und dann noch die Niederlage gegen die Japaner! Inzwischen gibt es zwar ein Parlament, aber das hat nichts zu sagen. So gewinnt man das Vertrauen seines Volkes gewiss nicht zurück.«
»Machst du dir Sorgen um Luise?«, fragte Benita leise.
Er legte seine Zigarre in den Aschenbecher, stand auf, kniete sich neben ihren Sessel und nahm ihre Hände in seine. »Ja und nein, Liebes. Sie ist kein verwöhntes Dämchen, sie weiß sich zu helfen. So wie du auch. Ich bin so froh, dass ihr wenigstens brieflich befreundet seid.«
Die Freundschaft vertiefte sich, als Benita merkte, dass sie schwanger war.
V
Auch im achten Monat ihrer Schwangerschaft ging Benita noch in die Kirche, das war sie den Nachbarn schuldig. Am Ende der Predigt an einem heißen Sommertag kündigte der Pfarrer einen Vortrag an, »der Ihre Herzen berühren wird«: Ein junger Diakon würde über die Missionsarbeit in Deutsch-Südwestafrika berichten. Das ging ihr nicht aus dem Kopf. Afrika war so fern, so unendlich weit weg, die Menschen dort so fremdartig. Was zog einen jungen Menschen dorthin?
Ludwig saß im Haus, am Schreibtisch, über den Rechnungen, und reagierte gereizt auf Benitas Vorschlag, den Vortrag gemeinsam anzuhören.
»Weißt du, was Bismarck über deutsche Kolonien gesagt hat? Das ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Schlimm genug, dass wir bei diesem Unsinn dennoch mitgemacht haben.«
»Ich weiß nicht, warum wir Afrika unbedingt den Engländern und Franzosen überlassen sollen, die das Land nur ausbeuten möchten?« Benita reagierte ebenso gereizt. »Die deutsche Kultur …«
»Und ich weiß nicht, warum jeder erfolglose Abenteurer glaubt, in fremden Ländern eine Kulturmission zu haben«, unterbrach Ludwig sie. »Bei uns gibt es genug zu tun, für Leute, die anpacken können.« Er senkte den Kopf, als ob sie den Raum bereits verlassen hätte.
Sie blieb stehen, beunruhigt. So sprach er sonst nicht mit ihr. Endlich blickte er auf. »Verzeih, Liebes. Ich habe so viele andere Dinge im Kopf, Afrika ist das Letzte, was mich bewegt.«
Sie verstand. Das Wetter. Es war seit Wochen unerträglich heiß. Auch sie litt unter den hohen Temperaturen, die Schwangerschaft machte sich bemerkbar. Doch die Tiere waren schlimmer dran. Das Heu drohte zu verdorren. Die Kartoffeln, fast noch wichtiger, brauchten Regen. Ja, Ludwig hatte andere Sorgen als die deutschen Kolonien.
»Ich gehe allein.« Sie legte ihm die Hand auf die Schulter. »In der Kirche ist es wenigstens schön kühl.«
»Ich Dummkopf«, murmelte er und legte die Hand auf ihren geschwollenen Bauch. »Das habe ich ganz vergessen. Geh nur. Du sollst nicht auch noch leiden müssen.«
Die Kirche war ungewöhnlich voll, mit Leuten, die sie sonst selten dort sah, darunter erstaunlich viele junge Männer. Offenbar lockte sie das Abenteuer Afrika, es wurde ja eifrig dafür geworben, die Kolonien brauchten Menschen, hieß es, die dort etwas aufbauen wollten. Pfarrer Künzel sprach ein paar einführende Worte, dann erschien ein schmaler Mann namens Karl Meister, mit rotblondem Haar, das er gescheitelt trug, und einem noch nicht ganz ausgewachsenen Schnurrbart. Der Diakon trug Kniebundhosen und festes Schuhwerk, so, als ob er gleich nach dem Vortrag mit dem Tornister auf dem Rücken gen Afrika marschieren wollte. Er wirkte ungemein jung, beinahe unschuldig. Benita kam er viel zu unerfahren vor für ein solches Abenteuer.
»›Wir wollen es besser machen als die Spanier‹«, hub er mit leuchtenden Augen und erstaunlich tiefer Stimme an, »›denen die Neue Welt ein pfäffisches Schlächterhaus, anders als die Engländer, denen sie ein Krämerkasten wurde. Wir wollen es deutsch und herrlich machen!‹« Er machte eine Kunstpause. »So sah schon Richard Wagner, der große Komponist, im Jahre 1848 die deutsche Mission in der Welt. Wir haben seinen Ruf vernommen. Weil es ein deutsches Christentum gibt, gibt es auch eine deutsche Mission. Gerade unser Volk, von Gott so groß beschenkt, ist dazu ausersehen, diese Mitgift mit anderen zu teilen.«
Seinen Verkündigungsdrang fand Benita weit weniger interessant als die Geschichten, die der junge Mann erzählte. Die Missionsstation Ghaub in Südwestafrika befand sich auf dem Gebiet einer Farm, beinahe zehntausend Hektar groß. (Ludwig würde neidisch sein – oder sich vor der Aufgabe fürchten.) Die Farm wurde seit der Jahrhundertwende von einem Deutschen bewirtschaftet, der als Erstes den Sumpf trockengelegt und ein Bewässerungssystem eingeführt hatte. Nach der Niederschlagung eines Aufstandes der Schwarzen plante man dort ein Versöhnungsprojekt, ein Lehrer-und-Evangelistenseminar. Hier sollten die Eingeborenen unterrichtet werden. Das war eine Mission, die sie nachvollziehbar fand.
Benita hatte in der Zeitung von Aufständen gelesen, davon, dass die deutsche Kolonialmacht »die aufsässigen Neger« hätte niederringen müssen, weil sie deutsche Siedler getötet und deren Höfe niedergebrannt hatten. Dabei war Blut geflossen, das war nicht schön, aber es musste sein, hieß es allenthalben. Eine andere Meinung vertraten nur die Sozialdemokraten. Ein Patient ihres Vaters hatte ihm ab und an den »Vorwärts« mitgebracht, er wollte ihn wohl zum Parteigänger machen. Ihre Mutter hatte das Blatt mit spitzen Fingern angefasst und weggelegt, doch ihr Vater hatte das eine oder andere daraus vorgelesen. Dort prangerte man die deutsche Kolonialpolitik an, sprach von Verbrechen und Mordtaten. Das war sicher übertrieben, doch Benita hatte sich dennoch unwohl gefühlt, wenn jemand von deutschen Kolonien schwärmte. Vielleicht waren die Deutschen auch nicht besser als die anderen? Und die Eingeborenen waren nicht ganz so begeistert von der Sache wie all die Abenteurer auf »Kulturmission«?
Nach dem Vortrag ging ein Klingelbeutel herum, »jeder Groschen für unsere Mission kommt einem jungen schwarzen Menschen zugute«, hatte Meister erklärt. Benita zückte widerstrebend ihr Portemonnaie. Obwohl sie sich nicht als geizig empfand, war ihr die Mission nur ein paar Groschen wert.
Es fiel ihr nicht so leicht wie früher, aufzustehen, ihr Kleid zu ordnen und die Treppe von der Patronatsloge hinunterzusteigen. Draußen vor der Kirchentür hatten sich einige der Frauen versammelt und schwätzten.
»Dass der Pfarrosch ausgerechnet diesen Gruchlik eingeladen hat«, grummelte die Paschke vom Dorfladen, die, wie Marielle, aus Oberschlesien zugezogen war. Mit Pfarrosch war der Pfarrer gemeint, das war zu verstehen, doch was ein Gruchlik war, wusste Benita nicht. Die Bezeichnung klang jedenfalls nicht wie ein Kompliment.
»Wieso? Das ist doch schön, wenn ein junger Mensch noch Ideale hat!« Eine alte Dame, Benita kannte sie nicht, aber sie lächelte ihr zu, die Dame hatte ein freundliches Gesicht mit geröteten Wangen unter weißen Löckchen, eine echte Großmutter, nicht so eine Klapatschke wie die Ladnerin – so hatte Marielle sie genannt: eine Klatschtante.
»Die Negerjungen werden sich freuen, wenn so einer wie der ihnen beim Buchstabieren das Händchen hält«, sagte die Paschke schnippisch. »Oder was anderes.«
Die Großmutter riss die hellen blauen Augen auf. »Sie meinen …?«
»Man hört da so einiges.«
»Was hört man?« Benita hätte die Frage am liebsten zurückgenommen, als sie sah, wie die Paschke die Augen aufriss und bedeutungsvoll nickte und die kleine Dicke vom Aussiedlerhof in aufgeregtes Gekicher ausbrach.
»Ich sag nichts«, schickte die Paschke hinterher.
Was für ein Waschweib, dachte Benita. »Einen schönen Tag noch«, sagte sie, nickte den Frauen zu und wandte sich ab.
»Wann ist es denn so weit?«, rief die Paschke ihr hinterher.
Sie antwortete nicht.
Die nächsten Gottesdienste ließen sie beide ausfallen. Am 13. August 1911, in allergrößter Hitze, kam Benita von Sedlitz mit einem gesunden Kind nieder. Sie gaben ihrem Sohn den Namen Alard.
Es ist Frühjahr. Alard ist neun Monate alt und liegt im Kinderwagen unter einer Birke, ein warmer Duft nach Milch und halb verdautem Gras weht vom Kuhstall her, und das Sonnenlicht, das durch die sanft sich wiegenden Äste des Baumes mit den ersten zarten Blättern auf sein Bettchen fällt, lässt den silbernen Mond im Elfenbeinring, der über seinem Kopf hängt, aufblitzen. Nebenan, im Gemüsegarten, hört er Marielle singen, und als er glucksend nach dem silbernen Mond greift, beugt sich ein goldbrauner Hundekopf über ihn, und sein Händchen fasst in eine seidenweiche Hundeschnauze. Argos bewacht ihn von Anfang an, ein riesiger Hütehund, furchteinflößend nur für Fremde. Ein Schwarm Stare kreist über der Birke, einer nach dem anderen hockt sich in ihren Wipfel, schwätzt und pfeift, und aus dem Kuhstall hört man das Klappern von Milchkannen.
VI
Zu schnell, dachte sie oft, wenn sie ihrem Söhnchen zusah. Jetzt war er schon anderthalb Jahre alt und kein Baby mehr, das sich bereitwillig küssen und auf den Arm nehmen ließ. Er lief den lieben langen Tag auf dem Gut herum, störte Hanesek beim Holzhacken, kroch zu ihm auf den Kutschbock, wenn der Hausdiener Besorgungen zu erledigen hatte, oder er saß bei Marielle in der Küche. Es war ein großes Glück, einem Kind beim Heranwachsen zuzuschauen. Und es tat weh, dass die Zeit so schnell verging.
Das Wetter war das Einzige, was die Stimmung ein wenig trübte. Der April 1913 war ungewöhnlich kalt gewesen, vor allem die Blüten der Apfelbäume waren dem Frost zum Opfer gefallen. Anfang Mai gab es erneut einen Kälteeinbruch. Benita machte sich Sorgen um Ludwig, er hatte wieder diesen Ausdruck im Gesicht, dieses Schwere, Nachdenkliche, das sie seit dem heißen und viel zu trockenen Sommer 1911 nur zu gut kannte. Sie hatte gelernt, dass in der Landwirtschaft nichts vorhersehbar war. Doch eine ausgefallene Apfelernte konnten sie verkraften. Woher kamen sie also, diese Schatten? Es war doch alles gut. Sie litten keine Not, und harte Arbeit schadete niemandem.
»Du solltest keine Nachrichten lesen, das verdirbt die Laune«, sagte sie, als er eines Abends im Lehnstuhl saß und von ihm kaum noch etwas zu sehen war außer der aufgeschlagenen Zeitung.
»Komm, das hier wird auch dich interessieren: Das britische Unterhaus hat es abgelehnt, in Großbritannien das Frauenwahlrecht einzuführen. Was sagst du dazu?«
Benita war sich in dieser Frage gar nicht sicher. Sie hatte in der Zeitung gelesen, dass die englischen Suffragetten sich Straßenschlachten mit der Polizei lieferten. Eine von ihnen hatte sogar einen Anschlag auf das Landhaus des Schatzkanzlers verübt, das war würdelos. Und war es das wert? Sicher, warum sollten die Frauen nicht ebenso wählen dürfen wie die Männer. Andererseits: Was brachte das schon? Politiker redeten viel und entschieden, wie sie Lust hatten, da nützte es nichts, wenn sich die Frauen in ein Geschäft einmischten, von dem die meisten ohnehin nichts verstanden.
»Ich finde die Entscheidung falsch«, sagte Ludwig und legte die Zeitung beiseite.
Sie schüttelte den Kopf. »Vielleicht. Doch welchen Unterschied macht es schon, wenn die paar Frauen, die sich für Politik interessieren, zum Wählen gehen? Das ändert nichts.«
»Vielleicht nicht. Aber es wäre gerecht.«
»Dir geht es also ums Prinzip.« Ludwig ging die Probleme viel zu oft von der abstrakten Seite her an. Sie bevorzugte das Lebenspraktische. »Ich halte mich an die Realität. Und die sagt: Wir haben Besseres zu tun, als uns in die politischen Zänkereien der Männer einzumischen.«
Die Tür ging auf, Marielle kam herein, gefolgt von Alard, dem sein Nachthemd noch viel zu groß war.
»Das hier«, sagte Benita und küsste den Kleinen auf die Stirn. »Das ist so viel wichtiger. Und so viel schöner.«
Im Herbst kam Alexander Duff Broedie von Castle Moray zu Besuch.
Benita blickte den beiden Männern hinterher, wie sie in Jagdkleidung, Gewehre geschultert, zum Pferdestall gingen. Wie unterschiedlich sie waren. Ludwig war schlank und dunkel, Alex breitschultrig und hatte rote Haare – wie ein Fanal. Und wo ihr Mann zurückhaltend war, trumpfte sein bester Freund auf. Dennoch mochte sie ihn, den Schotten, seit er ihr bei der Hochzeit zur Seite gestanden hatte. Sie hatte eigens im Atlas nachgeschaut: Das Schloss lag nördlich von Edinburgh und oberhalb von Aberdeen am Moray Firth, einem tiefen Einschnitt in das zerklüftete Land. Welten entfernt. Ein wilder Mann aus einem wilden Land.
Er war jedoch alles andere als ein Wilder. Die beiden hatten sich vor Jahren angefreundet, während ihres Studiums in Heidelberg. Alex hatte Philosophie und Theologie belegt, Ludwig war an der juristischen Fakultät eingeschrieben. Ihre Freundschaft hatte die Zeit und die Entfernung überdauert. Beinahe beneidete Benita die beiden Männer. Sie blickte in den Himmel, dem Zug Kraniche hinterher, der gen Süden flog. Die Luft war frisch und feucht, zwar glühten noch die Blätter an den Bäumen und Sträuchern in allen Farben, aber die Tage wurden kürzer, und der Herbst ging langsam in den Winter über. »Wer jetzt kein Haus hat«, dachte sie und ging wieder hinein.
Oben im Kinderzimmer spielten Marielle und Alard irgendein Spiel, sie hörte beide lachen. Das war Glück. Das war Frieden.
Endlich kamen die beiden Männer von einer erfolgreichen Jagd heim, erschöpft, aber bester Laune. Nach dem Essen saßen sie zu dritt vor dem Kamin, den Hanesek schon vor Stunden angefeuert hatte, die Scheite knackten, und im roten Schein der Flammen sahen die Gesichter der Männer wie durchglüht aus. Die beiden rauchten schweigend ihre Zigarren und tranken schottischen Whisky, den Alex mitgebracht hatte, und Benita strickte ein Mützchen für Alard.
»Die Engländer haben am Firth of Forth einen großen Flottenstützpunkt errichtet. Man nimmt die militärische Bedrohung durch die Deutschen ernst«, sagte Alex nach einer Weile.
Benita ließ seufzend ihr Strickzeug sinken. Schon war wieder Schluss mit Ruhe und Frieden, so wie jeden Abend, seit Alex da war. Das war der Grund, warum sie manchmal beinahe das Ende des Besuchs ersehnte. Sie war nicht zimperlich, gewiss nicht, sie hatte nicht nur oft mit ihrem Vater, sondern auch mit einigen seiner Patienten die Weltlage erörtert, und natürlich versuchte sie auch jetzt noch, auf dem Laufenden zu bleiben. Doch seit Alex da war, übertrafen sich die beiden in den allerschwärzesten Einschätzungen der politischen Lage. Alex regte sich über England auf, Ludwig über die Franzosen, den Kaiser und die Sozialdemokraten. Doch was hieß das alles für die Zukunft ihres Kindes? Das interessierte sie, mehr als alles andere.
Ludwig, der versonnen ins Feuer geblickt hatte, richtete sich auf. »Unsinn. Der Kaiser hat völlig zu Recht den enorm angewachsenen deutschen Welthandel angesprochen, und zu dessen Schutz brauchen wir eine starke Flotte. Das hat mit einer militärischen Bedrohung nichts zu tun.«
»Aber die Engländer glauben daran. Wusstest du schon, dass sich achtzigtausend deutsche Soldaten irgendwo in London versteckt halten und nur auf einen Befehl des Kaisers warten, um die Macht zu übernehmen?«
Benita hätte beinahe gelacht. Aber Ludwig starrte den Freund an, als ob er ihn ernst nähme.
»Und dass es Tausende von deutschen Kellnern und Metzgern in England gibt, die sich ebenfalls für den Tag X bereithalten?« Alex machte ein ernstes Gesicht, aber Benita sah, wie es in seinen Augen funkelte.
»Was für ein Unsinn!« Ihr sonst so ruhiger Mann wirkte fassungslos.
Alex schwenkte sein Glas mit dem goldbraunen Whisky und nahm einen Schluck. »Natürlich ist das Unsinn. Aber sie glauben daran. Die verrückten Engländer fürchten eine deutsche Invasion. Die Stimmung ist mittlerweile gänzlich gegen euch.«
Ludwig lehnte sich wieder zurück in seinen Sessel. »Propaganda. Darauf fällt nur der Pöbel rein«, knurrte er.
»Engländer spinnen aus Gewohnheit. Und deren Weiber randalieren auf den Straßen, weil sie wählen wollen.«
Jetzt lachte Ludwig, doch Alex wiegte den Kopf. »Es ist etwas in der Luft. Ich mache mir Sorgen.«
Benita hatte genug gehört. »Ich will mir keine Sorgen machen«, sagte sie scharf. »Ich will mit Politik nichts zu tun haben. Ich will auch kein Wahlrecht, das überlasse ich gern den Männern. Ich will einfach nur in Frieden leben.«
Die Männer schwiegen. Nach einer Weile stand Ludwig auf, nahm ihr das Strickzeug aus der Hand und legte den Arm um sie. »Ich weiß«, sagte er leise. »Doch die Welt fragt nicht nach dem, was wir wollen.«
In ihrer Gegenwart wurde von Politik nun nicht mehr gesprochen, das erledigten die Männer jetzt wahrscheinlich auf ihren Jagdausflügen. Abends am Kamin sangen sie, Alex im tiefen Bass, Ludwig Tenor, schottische Lieder und Lieder der Heidelberger Burschenschaft, beide Männer waren Mitglieder gewesen. Das war der Frieden, den sie brauchte.
Es rührte Benita zutiefst, dass Alexander sie ein paar Tage später darum bat, eine Patenschaft für Alard übernehmen zu dürfen. Er war Presbyterianer, insofern stand dem Ritual in einer protestantischen Kirche nichts im Wege. Wie in einer kleinen Prozession schritten sie durch den Park und über die Brücke, die über den Schlossgraben führte, zur Kirche gegenüber. Alard saß entspannt auf dem Arm seines Paten und strahlte ihn während der Zeremonie unentwegt an, nicht einmal wurde gezappelt oder gar geweint. Als Alex eine Woche später abreiste, bedauerte Benita das aus ganzem Herzen.
»Wir besuchen dich bald, wenn wir dürfen«, sagte sie und umarmte ihn. »Sobald der Junge etwas älter ist.«
Dazu kam es nicht. Am 28. Juni des folgenden Jahres wurde in Sarajevo der österreichische Thronfolger von serbischen Attentätern ermordet.
»Bailanda, 20. Juli 1914
Liebe Benita, lieber Ludwig,
ich hatte es nicht mehr zu hoffen gewagt! Aber er ist gesund und kräftig auf die Welt gekommen, am 11. Juli, Dimitri Georgij, auf dem Foto zu sehen in den Armen seines Vaters. Sofia guckt ein wenig zweifelnd auf das kleine Wesen, aber sie wird sich schon daran gewöhnen. Wir sind glücklich, trotz alledem!
Es geht uns gut, doch. Auch wenn der ständige Terror uns keine Ruhe lässt. Die Stimmung in Russland ist explosiv, Alexei fürchtet das Schlimmste. Und nun auch noch das Attentat auf den Österreicher! Der Mord am Thronfolger könnte Folgen haben, die ich mir nicht ausmalen möchte. So ist eben kein Glück ungetrübt.
Wie geht es dem kleinen Alard? Bitte schickt ein Foto, das ist natürlich kein Ersatz für eine echte Begegnung, aber es hilft ein wenig
Eurer sentimentalen Luise«
VII
»Mondsee, Herbst 1916, im dritten Kriegsjahr.«