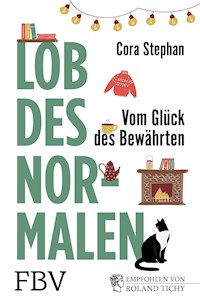Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Früher wollten Politiker handeln und entscheiden, heute wollen sie allem Anschein nach nur noch etwas emotionale Betroffenheit zeigen. Eine Arbeitseinstellung, die im vereinten Deutschland, in dem wachsende wirtschaftliche Probleme einen Abschied von der Schönwetterdemokratie verlangen, keine Anerkennung mehr unter der Bevölkerung findet. Cora Stephan plädiert für einen Rückgriff auf alte Tugenden wie Pflicht und Verantwortung und eine strikte Trennung von Privatem und Politik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cora Stephan
Der BetroffenheitskultEine politische Sittengeschichte
Edel eBooks
«Wenn es eine Dialektik des Herzens gibt,
ist sie sicherlich gefährlicher als eine Dialektik der Vernunft.
Von der Vernunft können nur wenige Gebrauch machen,
aber seinem Herzen will doch ein jeder,
auch der einfachste Mann, folgen.»
Helmuth Plessner, «Grenzen der Gemeinschaft» (1924)
Inhalt
Prolog
I Politik des Herzens
Im Glassarg
Die goldenen 80er
Politikverdrossenheit
Vom Verschwinden der Pflicht
Die Glaubwürdigkeitslücke
Gefühlssprech
Die Toskanafraktion
Gefühl und Härte
Widerstand und Gewaltmonopol
Demokratie und Förmlichkeit
Das plebiszitäre Mißverständnis
II Arbeit am Mythos: 1968 - 1989
Das allseits politisierte Individuum
«Wir waren alle keine Demokraten»
Revolte und Jugendkultur
Freisetzungen
Exkurs: Das Prinzip Ikea
Die Kinder der Mittelklasse
Das Schweigen der Eltern
Abschied vom bürgerlichen Subjekt
Lob des Opfers
Die allseits betroffene Persönlichkeit
III Das deutsche Dilemma
Im Dorfgemeinschaftshaus
Der Europäer aus der Pfalz
Exkurs: Gesinnung und Form
Die «bessere» Geschichte
Antifaschismus als Staatsräson
Exkurs: Das Märtyrertum Erich Honeckers
Die deutsche Friedensbewegung
Die Kuweit-Falle
Was ist heute deutsch?
IV Prolog
Vom Ankommen in der Gegenwart
Anmerkungen
Impressum
Prolog
Zeitenwende, Epochenende
Dies ist eine Bilanz — eine Bilanz politischer Orientierungssuche in der Zeitspanne zwischen zwei Zäsuren der bundesrepublikanischen Geschichte: 1968, das Jahr des «Aufbruchs», 1989, das Jahr der «Wende». Mit 1989 ist die Epoche von 1968 zu Ende gegangen — denn 1989 hat sich das Lebensgefühl, für das «1968» steht, als für die Analyse neuer Lagen untauglich erwiesen.
Mit dem Tag der deutschen Einheit ist nicht nur die DDR untergegangen, sondern auch ihr Antipode, die alte Bundesrepublik — ein Land, dessen Existenz im Nachhinein so märchenhaft wie unwirklich erscheint. Eine Bundesrepublik Deutschland, die es sich im Schutz des Eisernen Vorhangs zwischen Betroffenheitskult und Lebenswelt bequem gemacht hatte, deren Bürger, sympathisch und weltfremd, beträchtlichen Wohlstand mit hoher Moral zu verbinden gelernt hatten und deren Politiker sich am liebsten zwischen Provinz und Europa aufhielten — also im Niemandsland.
1968 und 1989 bezeichnen auch für mich Tage, die die Welt erschütterten. 1968 — das war noch euphorischer Ausbruch aus einer Zeit der lähmenden, fressenden Stille, und schon, mit dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Prag, Abschied von der Illusion, das Reich der Freiheit liege nur wenige Atemzüge entfernt. 1989 — auch das war Aus- und Aufbruch, dem ein Abschied folgte: von Illusionen, die man sich im bundesrepublikanischen Winkel lange Zeit hat machen können. Die Wünsche an die Zukunft werden bescheidener sein.
Warum «1968» und die Weltsicht, für die es steht, für das Begreifen von 1989 und die Folgen nicht taugen, ist Thema dieses Buches, dieser «Bilanz», was, recht betrachtet, ein etwas zu großes Wort ist für den Versuch, die politischen Orientierungen Revue passieren zu lassen, die in den letzten zwanzig Jahren gesucht, gefunden und verworfen wurden. Die Sündenbock-Theorie, wonach die «Alt-68er» schuld daran seien, dass niemand im Westen des geteilten Deutschlands mehr so recht an die Wiedervereinigung geglaubt hatte, teile ich dabei nicht — obwohl man dafür ebenso Belege ins Feld führen kann wie für die schön ungerechte Selbstbezichtigung Patrick Süskinds aus dem Jahr 1990: «Die eigentlichen Greise sind wir, wir 40jährigen Kinder der Bundesrepublik. Uns hat das Erdbeben kalt erwischt. (...) Uns treffen die Erschütterungen im denkbar ungünstigsten Moment, denn wir befinden uns in einem Lebensabschnitt, in dem der Mensch geneigt ist, eine Pause einzulegen ...»
Eine Pause, die ich hiermit für absolut legitim erklären möchte: Denn meine Generation hat eine nicht unbeträchtliche Phantasie an das Verständnis neuer Lagen verschwendet, wie sie sich aus den seit den 60er Jahren beschleunigten Modernisierungsprozessen in der Bundesrepublik Deutschland entwickelten; an soziale und politische Experimente aller Art, die Ersatz für verlorengegangene Orientierungen schaffen sollten und die selbst in ihrem Scheitern noch zwei positive Effekte für sich verbuchen können. Solche positiven Effekte erkenne ich einmal in der Selbstbefähigung einer ganzen Generation, auch ohne Herkommen, Zwänge, Vorbilder und Regeln neue, komplexere Lebensentscheidungen treffen zu können. Zum anderen im paradoxen Prozess einer Aneignung der Bonner Republik auf dem Wege ihrer Infragestellung. Wer die westdeutsche Demokratie so angegriffen und verworfen hat wie der sich politisch definierende Teil dieser Generation, weiß, meistens jedenfalls, am Ende dieses Prozesses (und, natürlich, um Jahre gereift) um so besser, warum er die nicht immer ganz ansehnliche und etwas beschwerliche Demokratie den großen menschheitsbeglückenden Utopien vorzieht. Der Partei der Grünen haben wir doch wenigstens dieses zu verdanken: dass sie solcherlei Lernprozesse öffentlich und damit nachvollziehbar gemacht hat.
Und doch sei zugegeben: Ganz verständlich war das nicht, diese 1989 bei vielen so inniglich vorgeführte neue Anhänglichkeit an einen Staat, den misstrauisch zu kontrollieren in den Szenen der Nation seit den 70er Jahren zum guten Ton gehörte. Es war nicht nur Verlustangst um die endlich doch liebgewonnene Bonner Republik, die den Jubel insbesondere in der 68er-Generation nach dem Fall der Mauer 1989 deutlich dämpfte. Andererseits: es waren nicht nur 68er, die 1989ff. meinten, die westwärts strebenden DDR-Bürger unter den Stichworten «Auschwitz» oder «DM-Nationalismus» warnen zu müssen vor allzu inniger Tuchfühlung mit dem als «soziale Marktwirtschaft» getarnten Kapitalismus westdeutscher Provenienz. Doch wie auch immer: Gemeinsam ist solcherlei Abwehr der Zumutungen von 1989ff., dass die Aussicht auf einen gemeinsamen Nationalstaat nicht mehr in die seit 1968, vor allem aber in den 80er Jahren im Westen gewonnenen Vorstellungen über das Verhältnis von Lebenswelten und Staat, von Bürger und Politiker, von Privatsphäre und Öffentlichkeit passte. Im Satz «Das Private ist politisch» hat Politik sui generis, hat staatliches Handeln, haben nationalstaatliche Optionen das Primat verloren. Das Projekt «Deutsche Einheit» aber ist nichts, was sich sozusagen naturwüchsig aus den Lebenswelten der Bürger entwickeln ließe. Im Gegenteil.
Dies ist eine Bilanz: auch der verschiedenen Versuche, das Private im Verhältnis zum Politischen — und umgekehrt — zu definieren. Der Betroffenheitskult oder, sagen wir es freundlicher, das tagtägliche Engagiertsein, ein moralisches, ein bisweilen sentimentales Verhältnis zur Welt ist insbesondere den «gutwilligen Kreisen» der Bundesrepublik zum Ersatz einer nationalen Identität geworden. Ohne die vermittelnden Instanzen und Distanzen der Politik schien das Wohl und Wehe der Republik vom moralischen Zuschnitt ihrer Bürger selbst abzuhängen — eine Vorstellung, die in der Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre einen ihrer Höhepunkte erlebte. Die politische Klasse hat spätestens im vergangenen Jahrzehnt gelernt, auf solcherlei Wünsche und Orientierungen ihrer Klientel Rücksicht zu nehmen. Auch ihre Vertreter beherrschen mittlerweile die Sprache der Betroffenheit, der Glaubwürdigkeit, der Neuen Nachdenklichkeit — einen Gefühlssprech, den man zu jenen Siegen der Geschichte und der Frauenbewegung zählen muss, vor denen es einen, ehrlich gesagt, bisweilen ziemlich gruselt.
Eine «Sittengeschichte» handelt, wie der Name schon sagt, von der Veränderlichkeit politischer Orientierungen, politischer Stimmungen, politischer Sprachbilder, politischer «Kultur». Einiges des heute Marktgängigen aber erinnert an ältere Ware. Gerade der Betroffenheitskult hat enge Verwandte unter älteren deutschen Traditionen, die klassischerweise als «protestantische Innerlichkeit», als «Gemeinschaft versus Gesellschaft» oder auch als Gegensatzpaar «Kultur gegen Zivilisation» abgehandelt werden. Tatsächlich erinnert seit 1989 in dem jetzt etwas größeren Deutschland vieles an alte deutsche Orientierungen — wobei ein angeblicher «Neonationalismus» nicht, so glaube ich, an der Wurzel des Übels rechtsradikaler Gewalt- und Terrorakte liegt. Die Frage lautet vielmehr, ob es nicht neuerdings wieder eine Mischung aus antiwestlichem Ressentiment gerade auch aus dem Osten mit einem faulen Werterelativismus der Westdeutschen ist, die eine alte Formschwäche der Deutschen, was die Demokratie betrifft, Wiederaufleben lässt: Die Verachtung der demokratischen Formen und Regularien. Nach einem Kapitel, das sich mit der Sentimentalisierung der Politik befasst und einem zweiten, das die paradoxen Wirkungen von «1968» würdigt, widme ich mich in einem dritten Kapitel deshalb solcherlei deutschen Traditionen — am Beispiel, unter anderen, von Friedensbewegung und Golfkriegsdebatte.
Eine «Sittengeschichte», der jeder ihren essayistischen Charakter anmerkt — sie ist nach oben, unten und zur Seite hin für Interpretation offen —, muss bekanntlich aus den vorgeführten Fundstücken keine neue Weltsicht meißeln, zumal es Menschen gibt, auf die man hören sollte, die von geschlossenen Weltbildern die Nase gehörig voll haben. Aber ich will nicht leugnen, dass die Anordnung des Materials nicht ohne Wünsche ist. Wenn man will, mag man aus den folgenden Kapiteln ein unzeitgemäßes Plädoyer für die Wiedergewinnung der Dimension des Politischen herauslesen - anstelle der Politisierung des Privaten und der Intimisierung der Politik. Und ein altmodisches Votum für die Demokratie mit ihrem strengen Regelwerk anstelle einer «Demokratisierung», die die Grenzen des Engagements der Bürger längst überschritten hat.
I Politik des Herzens
Im Glassarg
Hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen: seit sich der Eiserne Vorhang gehoben hat, eröffnen sich Ausblicke auf märchenhafte Landschaften. Nein, nicht nur im Osten. Auch das dem Bundesbürger (West) vertraute Ambiente hat plötzlich andere Farben angenommen und erscheint, wie bei Alice, mal putzig klein, mal unangemessen groß. Seit 1989 sieht die Welt anders aus — nicht nur, weil sie anders geworden ist. Auch ihre jüngste Vergangenheit verändert sich mit jedem neuen Blickwinkel — und nicht nur, weil man hinterher klüger wäre, was ja das mindeste ist, was man als Folge von Revolutionen verlangen kann.
1989 wirft einen Schein der Verklärung und Unwirklichkeit zugleich auf etwas, das bis 1990 als Bundesrepublik Deutschland glaubte, die Spielstätte dramatischer Stücke zu sein — von Rennern wie «1968» oder «Mescalero» über «Raketenherbst» und «Historikerstreit» bis «Die Stadt, der grüne Punkt und der Tod». Heute möchte man das alles zum Dramolettchen erklären, was manchen Betrachtern zuvor als gewichtige Entäußerungen der Weltgeschichte oder des Zeitgeistes erschienen war. Die alte Bundesrepublik—ein Puppenhaus im Wohlstandstango, bevölkert von Märchenprinzen, Quotenfrauen und Peaceniks, in dem sich die notorisch von schlechtem Gewissen gejagte Mittelschicht auf der Suche nach Sinn in aberwitzige Zukunftsszenarien hineinsteigerte — vom atomar vermittelten Weltuntergang über das Waldsterben unter dem Ozonloch bis zum kollektiven Aidstod. Diesem Angriff der bedrohlichen Zukunft auf die Gegenwart gesellten sich die Gespenster der gewalttätigen Vergangenheit des Landes hinzu; eine Mischung, die zum Unwirklichkeitsgefühl seiner Bewohner beitrug. Schuld- und Bedrohungsszenarien kumulierten sich im Laufe der Zeit zum grotesken Syndrom, dass ausgerechnet das Land der früheren Täter sich jetzt als Hort der präsumtiven Opfer fühlte, denen angesichts des Fehlens handfester politischer Eingriffsmöglichkeiten nur mehr die moralischen Instanzen der Entrüstung und der Betroffenheit zu Gebote standen.
Von 1989 aus betrachtet, verbrachte dieses Land unter der Bedingung beträchtlichen Wohlstands die ganzen langen 80er Jahre hindurch mit ebenso leidenschaftlicher wie wirklichkeitsfremder Emphase in ideologischen Sackgassen. Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung, Selbsthilfegruppe und Frauenbewegung hießen die Formen, in denen sich der prototypische mündige Bürger organisierte; Tschernobyl, das Ozonloch, Aids und sexueller Kindesmissbrauch waren die Katastrophen, mit denen auch die anderen Bewohner des Landes weit intimeren Umgang pflegten als — nur ein Beispiel! — mit dem banalen Leid der ihrer Freiheit beraubten osteuropäischen Nachbarn. Ganz und gar unwillig lugte das Land daher aus dem Faltenwurf des Mantels der Geschichte hervor, in dem es sich so erfolgreich versteckt hatte, als sich abzuzeichnen begann, dass es gezwungen sein würde, als außenpolitische Größe namens «Deutschland» wieder zum welthistorischen Geschäftsgang zurückzukehren.
Diese Sicht ist natürlich herzlich ungerecht. Denn nicht nur konnte man schwerlich voraussehen, dass es einen so erheblichen politischen Regulationsbedarf wie den durch die deutsche Einheit entstandenen jemals wieder geben würde — auch haben die vergangenen Illusionen ja weiß Gott Tugenden bewirkt. Die bundesrepublikanische Selbstvergewisserung mitsamt ihren hysterischen Extremen hat zur Zivilisierung dieses Landes Beachtliches beigetragen, die sozialen Bewegungen haben, ganz abgesehen von ihren Inhalten, dem alten Obrigkeitsstaat gründlich den Garaus gemacht. Und: die Verweigerung von Wirklichkeitswahrnehmung war 1989 ff. weitverbreitet, wozu die jüngste, die jüngere und die schon ganz schön angestaubte deutsche Geschichte weidlich beigetragen haben.
Deshalb, liebe 89er-Generation, der Böswillige gern den Ausruf unterstellen: «Sowenig Vergangenheit war nie!» — deshalb hier noch einmal, bevor wir uns endgültig in der Gegenwart wiederfinden, der Blick zurück nach vorn: Grenzen und Chancen der Bundesrepublik zum Zeitpunkt ihres Verschwindens — oder auch: Abschied von den 80ern. Denn der zweifelsohne böse Blick, den die Perspektive «1989» auf das Vorhergehende fallen lässt, ist so ungerecht wie didaktisch wertvoll: so gewinnt vielleicht Konturen, was bleibt und was zu Recht zugrunde geht.
Die goldenen 80er
In den 80er Jahren kam der Bundesrepublik Deutschland die Politik abhanden. Sowenig Staat war nie — es schien ja auch nicht viel zu regieren zu geben. Hans Magnus Enzensberger applaudierte dem «Zurückwachsen der Politik in die Gesellschaft»1, und auch andere hielten der permanenten Klage über den Kanzler oder gar über einen angeblichen konservativen Rollback entgegen, dass man sich vielmehr glücklich schätzen könne, in der Regierung von CDU/CSU und FDP unter Kanzler Kohl über die «erste realistische Regierung seit Kriegsende» zu verfügen.2 Die Bundesregierung schien den Prototypus einer zivilen Regierung zu verkörpern, deren Distanz zur Wählerschaft gering war — nicht nur, weil sie in ihrem Kanzler den deutschen Durchschnittsmann zu verkörpern schien, wie Helmut Kohl gemeinhin unterschätzt wurde, sondern vor allem, weil sie sich immer wieder in vorauseilendem Populismus den Interessen der Wähler anzupassen verstand, was zwar manchmal, aber nicht immer das Dümmste sein muss.
Der gewiefte Machtpolitiker Kohl verstand es, nicht nur im Ausland den Eindruck zu verbreiten, von Deutschland (West) gehe eine Gefahr nicht mehr aus, sondern auch den Bundesbürgern zu vermitteln, dass Politik ein pragmatisches Geschäft ist, das ohne das Schwingen von Flaggen und hehren Worten auskommt und auch der großen Führer, Staatsmänner und Helden nicht bedarf. Was manch einer heute beklagenswert findet, konnte damals als sinnvolle Arbeit an der überkommenen Staatsästhetik der Bundesbürger aufgefasst werden — die ewigen Pannen der Regierung Kohl, der Mangel an Autorität, das Defizit an politischer Führung, die unter Helmut Schmidt noch mit harter Hand und jeder Menge «Haltung» stattgefunden hatte: all diese regierungsamtlichen Funktionsmängel veranlassten die Bundesbürger, obrigkeitsstaatliche Erwartungs- und Ergebenheitspotentiale zurückzuschrauben. Der Staat, die Politik — das funktionierte wie alles andere, wie alle anderen auch: gerade so mehr oder weniger. Der Zeitgeist hatte die Untertanenmentalität erbarmungslos exorziert, der-zufolge alles vom Staat, nichts vom Bürger ausgeht.
Neben all den völlig unbestreitbaren Verdiensten, die Kohl 1989 in Sachen deutscher Einheit erworben hat, hat er sich in den Jahren zuvor um die Erziehung der Deutschen zu Bundesbürgern verdient gemacht — zu Angehörigen eines Gemeinwesens ziviler Individuen, die jeglicher Obrigkeit derart souverän und gelassen entgegentraten, dass auch deren Vertreter sich dem neuen zivilen Habitus bald anbequemten. Wir wollen diesen Fortschritt festhalten, auch wenn über seinen Preis noch zu reden sein wird.
Gerade unter konservativer Ägide erlebte die Bundesrepublik, nach den Auseinandersetzungen der 70er und zu Beginn der 80er Jahre, also einen weiteren Modernisierungsschub: Der alte deutsche Obrigkeitsstaat war verschwunden, an seine Stelle war weniger der «Ausschuss der herrschenden Klasse» getreten, wie die Linke befürchtet hatte, als vielmehr eine Art Ausschuss der Lebenswelten, eine Clearingstelle für Lobbyisten. Die These vom «Zurückwachsen der Politik in die Gesellschaft» applaudierte den zivilen Qualitäten eines Landes, in dem über die großen politischen Fragen nicht autoritär an der politischen Spitze, sondern im (alltäglichen) öffentlichen Diskurs entschieden werde. So jedenfalls feierte sich der Zeitgeist — dem selbst mächtige Wirtschaftsgruppen Reverenz erwiesen, denen die Abwesenheit von Politik einigen Spielraum bot.
Tatsächlich war die «geistig-moralische Wende», die Helmut Kohl 1982 versprochen hatte, weitgehend ausgeblieben, kam es keineswegs zu einem auf der Linken gefürchteten «großen Aufräumen», zu einer konservativen Hegemonie der Gesellschaft. Im Gegenteil: eine eher linksliberale Öffentlichkeit überprüfte die neuen politischen Machtverwalter ständig auf konservative Ambitionen, die, wagten sie sich einmal hervor, von «der Gesellschaft» geübt gekontert wurden. Des Kanzlers wiederholt in Szene gesetztes Verlangen nach «Normalisierung» erzeugte stets dialektische Effekte — namentlich die vielleicht intensivsten Debatten über den Nationalsozialismus, die es jemals in Deutschland, Ost oder West, gegeben hatte.
Die 80er Jahre erwiesen sich nachgerade als Habermas’sches Diskursparadies, waren geprägt von einer über die Medien vermittelten Selbstthematisierung der Deutschen in Vergangenheit und Gegenwart. Ob Helmut Kohl den amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan nach Bitburg vor Gräber von SS-Angehörigen beorderte oder mit Mitterrand — in versöhnender Absicht händchenhaltend - über den Gebeinen der im Ersten Weltkrieg vor Verdun gefallenen Kriegsgegner Mahnwache stand; ob es im «Historikerstreit» um «Relativierung» der deutschen Verbrechen während des Nationalsozialismus zu gehen schien oder ob der Kanzler sich und uns alle in einem «Deutschen Museum» auch der guten Seite der deutschen Geschichte versichern wollte - die kritische Öffentlichkeit ließ solcherlei Ausflüge ins positive Nationalgefühl stets in einer Zurückweisung jeglicher Beschließung deutscher Vergangenheit münden, wenn auch keineswegs immer mit einwandfreien Argumenten.
Nun mag man einwenden, dass solcherlei Gewissenserforschung gemeinhin auf die Feuilletons und auf die gebildeten Stände beschränkt bleibt — und doch hatte sich der Kampf um die Lufthoheit über bundesdeutschen Stammtischen stets auch in Meinungsumfragen niedergeschlagen. Der recht komplizierte «Historikerstreit» etwa hat in westdeutschen Köpfen fest das Unvergleichbarkeitsgebot verankert. Die Überzeugung von der Einmaligkeit deutscher Verbrechen unter dem Nationalsozialismus bestimmt noch heute die Auseinandersetzung mit den Verbrechen von Stalinismus und Kommunismus — durchweg, leider, zum Nachteil der Aufarbeitung der letzteren Vergangenheit. Die Asyldebatte, 1986 das erste Mal mit einer gewissen Heftigkeit geführt, kehrte damals die Umfrageergebnisse regelrecht um: Nachdem vorher eine starke Minderheit in der wachsenden Zahl von Asylsuchenden eine Gefahr sah, war hernach klar, dass es die Stimmung in der Bevölkerung nicht ratsam erschienen ließ, eine Asylrechtsänderung zu betreiben. Kanzler Kohl in der Weisheit eines unendlichen Opportunismus hielt sich — damals — daran.
Die «Stimmungsdemokratie» der 80er Jahre verlieh den Wählern eine bis dato in Deutschland nicht vertraute Souveränität: Von weltanschaulichen und religiösen oder anderen traditionsabhängigen Bindungen frei, trieben sie die Parteien durch zunehmend unkalkulierbares Verhalten vor sich her — der Wechselwähler und, vor allem, die Wechselwählerin wurden zum inkarnierten Schrecken der politischen Klasse. Der Allmacht der Parteien im Bereich des Politischen gesellte sich ihre Ohnmacht angesichts immer schwächerer Legitimation in immer häufiger werdenden «Entscheidungswählen» hinzu — da mehr und mehr auch Landes- und Kommunalwahlen als Indikator für den Ausgang der Bundestagswahl gelesen wurden.
Die Volksparteien der 80er Jahre reagierten mit Anpassung an das, was sie mit gutem Recht als Wählerwillen erkannten — und gaben damit immer mal auch den vernünftigeren Neigungen der Bevölkerung nach. Dass etwa die CDU — noch vor der SPD — die Frauen als zu umwerbendes Wählersegment erkannte, verdankte sich dem zunehmend «modernen» Verhalten der Wählerinnen: Sie gaben ihre Stimme nicht mehr gleichsam naturgemäß der Partei, die mit der Familie die faktische oder potentielle Subsistenzgrundlage der Mehrheit der Frauen verteidigte, sondern der Volkspartei, die Sicherung und sozialen Ausbau eines Arbeitsplatzes versprach, was seit den 70er Jahren für mehr Frauen immer wichtiger wurde. Prognostizierter Facharbeitermangel und gute Konjunktur machten die zweite Hälfte der 80er Jahre zum frauenfreundlichen Eldorado — nicht nur, wenn auch weitgehend auf symbolischer Ebene.
Überhaupt dominierten in den 80er Jahren «symbolische Politik» und «weiche Themen»: Politik, die substantiell nichts gestaltete oder veränderte, aber avancierten Lobbys (den Frauen, der neuen Mittelschicht usw.) schmeichelte — in diesem Kontext sind die Sprachkorrekturen, die der Feminismus der Politik abverlangte, von Bedeutung gewesen, ebenso wie die Verleihung des Etiketts «Frauenministerin» an Rita Süssmuth. Wir müssen es uns wohl als Erfolg anrechnen, dass seit Mitte der 80er Jahre der weibliche Plural unseren Männern auch in garantiert frauenfreien Räumen glatt von den Lippen geht.
Die populistische Attitüde der großen Parteien konnte dabei durchaus als Dominanz der Lebenswelten, als «Zurückwachsen der Politik in die Gesellschaft» gefeiert werden — was konnte schon schlimm daran sein, auch einmal aufs «Volk» zu hören, das sich ja längst nicht mehr nur als großer Lümmel gerierte, sondern ab und an durchaus mit Durchblick begabt war? Mählich setzte sich in der Bundesrepublik die Vorstellung durch, die Deutschen nicht mehr als Objekt beständiger Erziehungsarbeit in Sachen Demokratie zu betrachten, sondern als pfiffige Auskunfteien über den Geist der Zeit. Das Ausmaß dieser Veränderungen begreift wohl nur, wer noch den gegängelten Zeitgenossen der Adenauer-Ära vorm inneren Auge erstehen lassen kann, der vor jedem braven Parkuhrkontrolleur Haltung annahm.
Diese Dominanz der Lebenswelten gegenüber dem Bereich der Politik, wie sie in «symbolischer Politik» und «weichen Themen» verkörpert ist, hatte in den im Nachhinein so unendlich luxuriös und friedvoll erscheinenden 80er Jahren eine Vorstellung völlig verdrängt: Dass es Aufgabe von Politik sui generis sein muss, das als Notwendigkeit erkannte Allgemeine auch gegen mutmaßlichen Wählerwillen oder Volkes Stimmung durchzusetzen — man erinnere sich an den Beschluss zur Stationierung der Mittelstreckenraketen unter Kanzler Helmut Schmidt, eine im Nachhinein gerechtfertigt anmutende Entscheidung, die sich indes damals nur sehr geringer Beliebtheit erfreute. Den Todesstoß versetzte dieser Vorstellung von Politik Anfang der 80er Jahre Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht, als er das Atommüllendlager in Gorleben für «politisch nicht durchsetzbar» erklärte. Das mochte eine richtige Einschätzung gewesen sein, ihre Begründung war es nicht. Sie macht die Differenz noch zu den 70er Jahren indes überdeutlich: Plötzlich diktierte «die Straße» die Landespolitik — «die Straße» oder «der Pöbel», wie damals noch das abwertende Politikerwort für jene Bewegungen, Gruppen, Initiativen lautete, die man ein Jahrzehnt später als «mündige Bürger» schätzen lernte.
Auch dieses Eingeständnis der Politik gegenüber den Bürgern oder der Gesellschaft kann man nicht hoch genug veranschlagen — in all seiner Ambivalenz. Heute gilt es in Politikerkreisen als progressiv, die Bürger möglichst umfassend zu beteiligen — ehrlicher formuliert: sich gegen das Risiko, Wähler zu verstimmen, möglichst gut dadurch abzusichern, dass man ihnen weitreichende Mitsprachemöglichkeiten einräumt. Dieser Taschenspielertrick tarnt sich als das weit hehrere Anliegen, politischen Entscheidungen mehr Legitimität zu verleihen. Im Konfliktfall aber bedeutet diese Art des Populismus nicht nur eine Selbstbeschränkung der Politik auf das, was den Bürger nicht verprellt - sie fordert diesem auch ab, was man von ihm legitimerweise gar nicht verlangen kann: über die eigenen Lebensentscheidungen hinaus auch noch fürs Große Ganze zuständig zu sein. Zu Recht darf der Bürger einwenden, dass er just das an die Politiker delegiert habe.
Nun — in den goldenen 80ern forderten weder große nationale Anliegen noch andere Fragen von allgemeiner Bedeutung Repräsentanz im Politischen heraus: Jene den frei gewählten und nur ihrem Gewissen verantwortlichen Abgeordneten unterstellte und abverlangte Fähigkeit, des Bürgers Willen nicht nur einfach abzubilden, sondern ihn im politischen Verhandlungsprozess zu mediatisieren, zu verfeinern, zu veredeln von der Summe individueller, lokaler oder regionaler Egoismen zum repräsentativen Konsens — was ja weit mehr ist als der schlichte Mehrheitsentscheid. Stattdessen dominierte der Betroffenheitsgestus politischer Minderheiten, ein avancierter Lobbyismus, der die Klientel, die die Volksparteien zu befriedigen hatten, um einige weitere ergänzte, die sich zunächst vor allem bei den Grünen sammelten. Die immense Bereicherung und Erweiterung bundesdeutscher Vorstellungen vom «richtigen Leben» — denken wir nur an die toleranzfördernde Lebensstilkonkurrenz durch Schwule und Lesben — beschleunigte aber auch den Hang der Parteien zu symbolischer Politik plus Klientelbefriedigung. Die Grünen machten da vielfach den Vorreiter, deren «Basisdemokratie» besonders schnell zur «Basokratie» degenerierte, also zur durch keinerlei Kontrollmechanismen mehr begrenzten Herrschaft der mittleren Funktionäre.
All diese Prozesse waren, wie es sich gehört, von ambivalenter oder sogar dialektischer Wirkung. Der Politisierung der Bürger entsprach die Entwertung der etablierten Politik, der Demokratisierung die Minderbeachtung der Demokratie und ihres rechtsstaatlichen Formenkanons. Die 80er Jahre waren vom Verschwinden der Politik geprägt, vom Verschwinden politischer Begrifflichkeit. Bismarcks Diktum: «Entrüstung ist keine politische Kategorie», wäre damals nicht verstanden worden, denn die 80er Jahre waren überreich an Entrüstung und Betroffenheit, aber arm an Maßstäben. 1989 erwies sich, dass sich diese friedliche Zeit dem Leben in einer Nische der Weltgeschichte verdankte, in der bundesdeutsche Politik weder im Inneren noch nach außen hin im Übermaß gefordert war. Nach außen hin konnte man andere entscheiden lassen, und im Inneren hatte man es noch immer mit einer weitgehend kohärenten Gesellschaft zu tun, mit einer Gesellschaft, in der ein prosperierender Mittelstand dominierte und selbst das untere Drittel noch partizipieren konnte an der Verteilung scheinbar nicht versiegender ökonomischer Zuwächse.
Was war das, in der Summe, für ein friedliches Jahrzehnt! Dem Linksterrorismus waren die Sympathisanten ausgegangen, und die CDU, die faktisch ein konservatives Profil längst verloren hatte, hielt in aggressiven Wahlkämpfen noch immer ihre große historische Leistung der Nachkriegszeit aufrecht: den rechten Rand zu halten. Die Grünen hatten die Selbstintegration der aus der 68er-Bewegung hervorgegangenen Milieus und Szenen mit dem Heraustreiben des «Fundi-Flügels» zu einem gut reformistischen Ende gebracht und der Politik insgesamt zwei wichtige Topoi beschert: Die Ökologie als allgemeines Anliegen, als neue Gattungsfrage sozusagen, und den plebiszitären Mythos von der «Basisdemokratie», von der beständigen Durchdemokratisierung des Lebens. Das Westdeutschland der pluralen Lebensstile, der Regionen und der Szenen, des avancierten Provinzialismus3, sah gelassen seinem Aufgehen in Europa entgegen. Da verhagelte das Aufreißen des Eisernen Vorhangs uns die zivilgesellschaftliche Idylle.
Heute scheinen wir vor Fragen zu stehen, die genuin politischer Natur sind und nicht von «der Gesellschaft», von den «Lebenswelten» geregelt werden können, in die «die Politik» zurückgewachsen sei. Heute darf man fragen, ob die Demokratisierungsbewegungen dem institutionellen Gefüge der Demokratie wirklich zugute gekommen sind, ob die ubiquitäre Politisierung des Bürgers wirklich die Nachfrage nach Politik erhöht und ob das allgemein gewachsene Moralisierungsniveau wirklich das Gespür für die Vorzüge des Rechtsstaates befördert hat.
Politikverdrossenheit
Wer heute über Mangel an politischer Führung klagt, muss hinzufügen, dass just diese Ware in den hedonistischen 80ern nicht sonderlich nachgefragt war, weshalb es uns nicht wundern sollte, dass die damit einhergehenden Kompetenzen verschwunden sind. Zwar ist, wie gesagt, «die Gesellschaft» keine Ersatzkategorie für «die Politik». Aber ansonsten besteht zu Überheblichkeit kein Anlaß: Wir haben hierzulande vielleicht nicht die Politiker, die wir verdienen, wohl aber solche, die ihr Ohr dem Raunen des Zeitgeistes besonders eifrig geöffnet haben — ein Fortschritt (oder nicht?) gegenüber starrsinniger Prinzipienreiterei und konventioneller Unbeweglichkeit.
Natürlich ist das ungerecht, dieses dauernde Schimpfen auf die politische Klasse, die nörgelige Politik- und Parteienverdrossenheit von Bürgern, Wählern und Meinungsbildnern, dieses allgemeine Naserümpfen über all das, was zuvor noch als erstaunlich zivil, modern und «realistisch» durchgehen mochte. Worüber wird geklagt? Hatte der aufgeklärte westdeutsche Mensch nicht längst gelernt, den Wahlkampf der Parteien als branchenüblichen Theaterdonner zu durchschauen, die Profilierungsdebatten und Hahnenkämpfe nicht weiter ernst zu nehmen und auch politische Phrasendrescherei noch als Teil jener Demokratie westlichen Zuschnitts zu lesen, deren Nachteile groß, deren Vorteile aber noch größer sind? Woher heute die Erregung über das Menschlich-Allzumenschliche auch bei Politikern, woher der saubermännische Eifer beim Enttarnen eines Rotlicht-Lafontaine oder eines Streibl-Amigos und eines Putzfrauen-Krauses?
Nein, die Skandalaufdeckerei, jede Woche neu, ist öd und blöd — und, ehrlich gesagt: Die politische Klasse hatte schon schlimmere Verdachtsmomente gegen die junge Nachkriegsdemokratie auszuräumen. Die allzu bereitwillige Integration vieler Nazis nicht nur in die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft, was verdienstvoll war, sondern auch in die höheren Ränge der Politik - von Globke bis Filbinger —, hält noch heute bei vielen Nachkriegsgeborenen ein luxurierendes Misstrauen in die bundesdeutsche Demokratie wach. Ein Effekt, über den man auch, was den Osten Deutschlands betrifft, immer mal wieder nachdenken sollte.