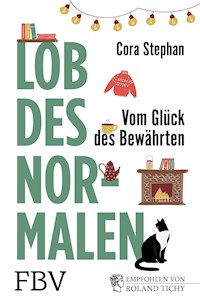Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Krieg ist das absolut Böse. Was aber treibt Männer seit Jahrtausenden dazu, dennoch voller Begeisterung in den Krieg zu ziehen - und Frauen, ihnen zu applaudieren? Das Gefährliche am Krieg ist nicht, dass er das Böse ist. Das Gefährliche ist seine Doppeldeutigkeit. Krieg weckt die Bestie und das Beste im Mann. Er verbindet Altruismus und Opferbereitschaft mit hemmungsloser Aggression. Er entfesselt die Gewalt und grenzt sie zugleich ein. Wer Krieg verstehen will, muß die positiven Gefühle begreifen, die ihn antreiben und tief zurück in die Menschheitsgeschichte reichen. Sie knüpfen an das 'Urtrauma' der Menschheit an: nicht Jäger, sondern Gejagte zu sein. Krieg ist die Re-Inszenierung dieser 'Ur-Szene': Die ältesten Mythen der Menschheitsgeschichte erzählen von Heldentaten der Krieger, aber auch vom Menschenopfer, mit dem das Raubtier beschwichtigt werden sollte. Cora Stephan untersucht die Bürgersoldaten der griechischen Polis und die Kriegereliten der mittelalterlichen Ritter, den Dreißigjährigen Krieg und den Ersten Weltkrieg. Sie setzt sich mit Clausewitz und den Folgen auseinander, mit den Regeln des Krieges und seiner 'Kultur': vom Krieg als Spiel bis zum Krieg aus Leidenschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cora Stephan
Das Handwerk des Krieges
Edel eBooks
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Der Heilige Krieg
Kapitel 2
Entscheidungsschlacht: Die Griechen
Kapitel 3
Kriegerelite: Die Ritter
Kapitel 4
Kriegsbilder: Entfesselung und Mäßigung
Kapitel 5
Krieg der Erinnerungen: Der Erste Weltkrieg
Epilog
Anmerkungen
Bibliographie
Impressum
Prolog - Janus
Krieg ist das absolut Böse. Das ist insbesondere hierzulande die einhellige Meinung. Was aber trieb Männer jahrtausendelang dazu, immer wieder und oft auch noch voller Begeisterung in den Krieg zu ziehen - und die Frauen, ihnen zu applaudieren? Die Menschen - das absolut Böse? Oder, auch nicht besser, eine Herde Verblendeter? Ausgebeuteter, Benutzter, hinters Licht Geführter?
Krieg ist keine Folge eines menschlichen Aggressionstriebes. Dazu hat er zu viel mit sozialen Institutionen zu tun. Krieg ist aber auch keine bloße kulturelle Erfindung - dazu ist er zu tief verwurzelt in der Menschheitsgeschichte. Vor allem aber: Das Gefährliche am Krieg ist nicht, dass er das absolut Böse wäre. Das Gefährliche ist seine Doppeldeutigkeit. Er weckt die Bestie - und das Beste im Mann. Er verbindet Altruismus und Opferungsbereitschaft: mit höchster Aggression. Er lässt die Liebe zu den einen in das Töten der anderen münden. Er ist Sakrament und Vernichtungswut in einem. Er ist die Bewegungsform des Patriarchats - und zugleich das Ergebnis eines uralten Geschlechtervertrags.
Wer Krieg verstehen will, muss die positiven Gefühle begreifen, die er erweckt - und die ihn antreiben. «Durch Gefühle bekommt der Krieg uns in die Klauen», sagt Barbara Ehrenreich. Und diese Gefühle reichen tief zurück in die Menschheitsgeschichte. Sie knüpfen an das an, was man das «Urtrauma» der Menschheit nennen könnte: nicht die Jäger, sondern die Gejagten, die Beute, zu sein. Krieg ist eine Re-Inszenierung dieser «Ur-Szene» und gewinnt an ihr seine Macht. Die ältesten Mythen der Menschheitsgeschichte erzählen nicht nur von den Heldentaten der Krieger, sondern auch vom Menschenopfer, mit dem das Raubtier beschwichtigt werden sollte. Dieses Menschenopfer ist der Kern, um den alle Weltreligionen kreisen. Und in diesem Kontext erhält auch der Krieg seine Heiligung.
Das erklärt, warum es im Krieg stets um mehr und um anderes ging als um die möglichst effiziente Vernichtung einer möglichst großen Masse von Menschen. Er ist auch rituelle Konfrontation, theatralisches Messen der Kräfte gewesen, ein Spiel, bei dem die eine Kultur auf Blutvergießen ganz verzichten konnte, während in der anderen das Blut in Strömen fließen musste. In Kulturen, in denen Krieg stark ritualisiert ist, lässt er sich tatsächlich als eine Art von Geschlechtervertrag lesen: Die Männer tragen Konflikte stellvertretend für alle aus, damit das Gewebe der Gesellschaft selbst nicht gestört oder zerstört wird. Das Maß für die Schrecklichkeit von Kriegen ist das unterschiedliche Ausmaß, in dem sie die Gesellschaft selbst erfassen. Von welchen Faktoren aber hängt es ab, ob Kriege mäßig sind oder entgrenzt, ja total?
Dieser Frage wird im folgenden in der Untersuchung unterschiedlicher Kriegskulturen nachgegangen - sozusagen vom Miozän bis zum Ersten Weltkrieg. Eine Geschichte des Krieges ist dabei nicht angestrebt, das wäre ein völlig unmögliches Unterfangen. Im Gang durch die Geschichte wird versucht, den Gefühlen nachzuspüren, die sich offenbar seit Urzeiten mit Krieg verbinden: Begeisterung, Altruismus, Gemeinschaftsgefühl, Opferbereitschaft. Es sind diese Gefühle, die Krieg gefährlich machen - in einem den Verstand überwältigenden Rausch. Kaum einer hat das besser ausgedrückt als Stefan Zweig in seiner Erinnerung an den Beginn des Ersten Weltkriegs: "So gewaltig, so plötzlich brach diese Sturzwelle über die Menschheit herein, dass sie, die Oberfläche überschäumend, die dunklen, die unbewussten Urtriebe und Instinkte des Menschtiers nach oben riss ( ... ) Vielleicht hatten auch diese dunklen Mächte ihren Teil an dem wilden Rausch, in dem alles gemischt war, Opferfreude und Alkohol, Abenteuerlust und reine Gläubigkeit, die alte Magie der Fahnen und der patriotischen Worte - diesem unheimlichen, in Worten kaum zu schildernden Rausch von Millionen, der für einen Augenblick dem größten Verbrechen unserer Zeit einen wilden und fast hinreißenden Schwung gab.» 1
Krieg appelliert an mächtige, tiefsitzende, archetypische Gefühlswelten. Das macht ihn schier unwiderstehlich. Zugleich aber bestand die «Kultur» des Krieges immer wieder in der Bändigung dieses Rausches. Die Männerkultur Krieg lenkt und kanalisiert Gewalt. Krieg ist die Geschichte der Entfesselung von Gewalt - und ihrer Mäßigung. Dieser «Paradoxie» des Krieges folgt das Buch von den Bürgersoldaten der Hoplitenphalanx des alten Griechenland über die Kriegereliten der mittelalterlichen Ritter bis zum ersten Medienkrieg, dem Dreißigjährigen Krieg. Es setzt sich mit den Kabinettskriegen der Zeit vor Napoleon auseinander, mit Clausewitz und den Folgen, mit den neuen Massenheeren, mit dem Ersten Weltkrieg. Es untersucht die unterschiedlichen Bewegungsformen des Männerbundes - und die Rolle, die die Frauen dabei spielen. Es untersucht die Bedeutung, die Krieg für Gemeinschaft und Gedächtnis hat. Es setzt sich mit den Gefahren einer «Moralisierung» des Krieges ebenso auseinander wie mit der Frage, ob Demokratien friedlicher sind.
«Handwerk des Krieges» ist der neueren Richtung der «Mentalitätsforschung» eher verbunden als der Militärgeschichte im strengen Sinn, in der es um Kriegsursachen, Strategie und Taktik und ums Kriegsergebnis geht. Dennoch wird in diesem Buch versucht, die Gefühlswelten mit den materiellen Voraussetzungen des Krieges in Verbindung zu setzen. Mäßigung gelingt nur dort, wo es handfestere Beweggründe dafür gibt als bloß ein Ideal.
Wird es immer Kriege geben? Vielleicht nicht. Muss Krieg geächtet werden? Besser nicht. Die Ächtung des Krieges sorgt höchstens dafür, dass er sich umso regelloser entwickelt.
Die Geschichte des Krieges zeigt, dass seine Zivilisierung immer wieder, wenn auch vielleicht nur für eine Generation, gelang. An diese Geschichte von Einhegung und Mäßigung knüpft sich eine viel bescheidenere, aber vielleicht realistischere Hoffnung als die auf das Ende jeden Kriegs: die Menschen haben sich auch für den schlimmsten aller Fälle ein Regelwerk erfunden, das sie nicht immer, aber immer wieder eingehalten haben. Wir können es uns nicht leisten, auf diese schwankenden Inseln des Humanen inmitten eines so unzivilen Geschehens wie Krieg zu verzichten.
Frankfurt, im Mai 1998
Kapitel I
Der Heilige Krieg
Warum Krieg? Und wie kam er in die Welt? Wer «wirklichen» Krieg erst mit der Staatenbildung beginnen lässt oder auf materielle Interessen mächtiger gesellschaftlicher Gruppen zurückführt, hat es leicht. Krieg ist dann eine mehr oder weniger riskante, aber doch weitgehend rationale Tätigkeit mit begrenzten Zielen und Zwecken.1 Die archaischen Riten und seltsamen Gebräuche, die ihn bis in die heutige Zeit begleiten – feierliche Schwüre und Fahnenappell, Paraden und Zapfenstreich, Uniformen und Lametta -, lassen sich dann als überkommene Verschrobenheiten behandeln; sie tun, scheint's, nichts zur Sache. Sie sind lediglich Dekorationen einer «Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln», wie in diesem Zusammenhang gern Carl von Clausewitz zitiert wird; Garnitur einer kriegsförmig verlaufenden kalkulierten Interessenpolitik.
Auch die gegenteilige Sicht der Dinge macht es sich leicht. Ihr zufolge lässt sich Krieg aus den individuellen Neigungen von Männern zu Gewalt erklären, aus «irrationalen» Motiven also, die von den rationalen Interessen anderer Männer ausgebeutet würden. Frauen sind in diesem Schema edle Seelen und unschuldiges Publikum, das aus unerklärlichen Gründen dem Männerspektakel auch noch applaudiert.
Beide Erklärungen, noch immer beliebt, vermögen die Fülle von Erkenntnissen (und Spekulation) längst nicht mehr zu integrieren, die Archäologen oder Anthropologen2 heute über Krieg in der Menschheitsgeschichte aufzubieten haben. Insbesondere, dass «wirklicher» Krieg streng vom «primitiven» Krieg zu unterscheiden sei, hat sich als falsch erwiesen. Diese Vorstellung entspringt einer Mystifizierung und Verharmlosung «primitiver» Kriegführung, der zufolge sich edle Wilde rein rituelle Schaukämpfe geliefert hätten - mäßig ernsthaft und mäßig tödlich. Davon aber kann nicht die Rede sein. Nicht nur lieferten sich unsere Vorfahren wahrscheinlich Gefechte mit einer Beteiligung der männlichen Bevölkerung und mit Todesraten, wie sie noch nicht einmal der Zweite Weltkrieg zu bieten hat.3 Auch die Rituale, das «Theater» des Krieges sind mitnichten nur ein Rudiment aus alter Zeit, das uns heute nichts mehr zu sagen hätte. Noch im Ersten Weltkrieg tauchen Topoi des Krieges auf - die Liebe, das Opfer, die Gemeinschaft -, die wenig mit rationaler Kriegführung, dafür aber viel mit einem Menschheitserbe zu tun haben, das tief in die Vorgeschichte zurückreicht.
Nein, Krieg ist kein Sündenfall der jüngeren Menschheitsgeschichte, über die wir heute immerhin einiges zu wissen glauben, sondern reicht so weit zurück, dass gesicherte Erkenntnisse über die Ursprünge des Ur-Übels nicht leicht zu haben sind. Dreierlei zumindest scheint gewiss: Krieg gehört, wie die Religion, zu den Universalien, die alle Menschheitskulturen unabhängig voneinander entwickelt haben. Er ist in den meisten uns bekannten Kulturen auf den Männerbund beschränkt.4 Und er ist ein ritualisiertes Geschehen, das sakrale Züge hat, ja nachgerade als religiöser Akt zu verstehen ist.5 Um eine These von Walter Burkert abzuwandeln: Wir müssen von der Präsenz des Heiligen inmitten des Tötens ausgehen.6
Für die Verbindung des Krieges mit tiefverwurzelten Menschheitserfahrungen, für seine Verankerung in Gefühl und Instinkt spricht, dass all diese Aspekte nicht nur dem sogenannten «primitiven» Krieg eigen sind. Sie sind auch in seinen «modernen» Formen noch aufzuspüren. Beispiele für die «Heiligung» des Krieges müssen nicht in der islamischen Form des «Jihad» gesucht werden. Sie sind für den Ersten Weltkrieg nachweisbar7 - und sogar noch für den Zweiten Weltkrieg dokumentiert.
Eine angemessene These über den Krieg - ganz zu schweigen von seiner «Theorie»8 - muss für alle drei Aspekte des Krieges eine plausible Erklärung bieten. Dabei wird man sich womöglich von alten Kontroversen verabschieden müssen - etwa, ob Krieg der Natur oder der Kultur zuzuschlagen sei. Auch die Unterscheidung zwischen «wahrem» und «primitivem» Krieg, zwischen «rationalen» und «irrationalen» Kriegsformen, greift dann nicht mehr. Tatsächlich gehört Krieg - als kulturunabhängige Universalie - weit mehr der «Natur» an, als uns behaglich ist. Tatsächlich ist er kein rationales Instrument, das man, je nach Tageszeit und Machtbedürfnis, einsetzen und, wie man dann ja hoffen dürfte, wieder ausschalten kann. Zu seinen «irrationalen» Momenten, zu seinen Gefühlsanteilen gehört indes nicht nur das schreckliche Gesicht des Krieges: die enthemmte Gewalttätigkeit des «Primitiven», von der man annimmt, dass sie noch heute in jedem Mann stecke. Krieg mobilisiert nicht nur die Bestie - sondern auch das Beste im Mann. Das «Gute» ist es, was ihn so gefährlich macht.
Krieg ist und bleibt eine Sache der Gefühle, die moderne Menschen ebenso in den Bann ziehen können wie ihre kaum den Urwäldern entwachsenen Vorfahren. «Durch Gefühle», noch einmal Barbara Ehrenreich, «bekommt der Krieg uns in die Klauen.»9 Und diese Gefühle speisen sich aus den edelsten Regungen, zu denen Menschen fähig sind. Zu Recht ist Janus, der Gott, den die Römer vor Kriegsbeginn anriefen, ein Herr mit zwei Gesichtern - einem finsteren. Und einem freundlichen.
1 - Krieg und die Testosteronhypothese
Der Menschenverstand wehrt sich dagegen, Krieg als unabänderliches Schicksal der Menschheit hinzunehmen, zumal wir seit dem Zweiten Weltkrieg zu wissen glauben, dass ein dritter uns alle vernichten wird. Wenn Krieg indes zu den Universalien gehört, die Menschen ganz unabhängig von ihrer je unterschiedlichen Kultur entwickeln, scheint es schlecht um die Hoffnung auf Frieden zu stehen - jedenfalls sofern sie sich auf die Vorstellung stützt, Krieg sei «Kultur»10, ja eine «Erfindung » (Margaret Mead).11 Was also, wenn unsere «primitiven» Vorfahren nicht friedfertig gewesen sind, wenn der Krieg nicht erst mit dem Patriarchat oder der westlichen Zivilisation in die Welt gelangt ist?
Was macht Krieg zu einem Phänomen, das allen menschlichen Kulturen gemein ist? Eine Antwort der vielen lautet: der Mann. Die «Testosteronhypothese» schließt aus der Tatsache, dass die meisten Kriege von Männern geführt werden, auf männliche Natur und männliche Triebausstattung als Ursache von Krieg. Eine scheinbar einfache Erklärung - aber tatsächlich spricht alles gegen die These, dass Krieg im biologischen Programm der männlichen Angehörigen unserer Spezies fest verankert sei, weshalb es bloß ein bisschen «Entmännlichung» oder gar «Entmännerung» brauche, um ihn aus der dann weiblich-friedlich gewordenen Welt zu verbannen.
Krieg war in der Menschheitsgeschichte stets eine überwiegend männliche Betätigung. Das aber ist den Männern nicht in die Wiege gelegt - man sehe ihn nur an, den Mann: er ist ganz offenkundig für den Krieg nicht gemacht. Unsere Vorfahren wirken im Vergleich zum Säbelzahntiger oder Mastodon erschreckend untauglich für die Aggression: sie haben weder mächtige Reißzähne noch Klauen, noch Hörner oder Geweih, also natürliche Waffen, mit denen sie Gegnern drohen können. Ausgerechnet dem Menschen, dem tödlichsten Raubtier, das die Welt kennt, sieht man dieses Talent nicht an. Auch ein gehöriger Triebschub würde daran wenig ändern: der individuelle Zornesausbruch wäre in der von Raubtieren besiedelten Savanne wahrscheinlich das letzte Lebenszeichen unseres Vorfahren gewesen.
Krieg hat mit den individuellen Voraussetzungen, die Männer dafür mitbringen, erstaunlich wenig zu tun. Er unterscheidet sich von individueller Gewalt durch seinen kollektiven Charakter - niemand zieht allein in den Krieg. Erst die organisierte Gewalt macht Menschen zu einer Bedrohung - es ist die Gruppe, der Männerbund, die eine Kraft erzeugt, die weit größer ist als die Summe dessen, was jeder einzeln zustande bringt.
Krieg ist ein kollektives Geschehen, mehr oder weniger durchdacht und kalkuliert, in dem Menschen, Material, Transport und Versorgung in ein organisiertes Verhältnis zueinander gebracht werden.12 Die Ausstattung, die Männer dafür mitbringen müssen, ist im Laufe der Jahrtausende unterschiedlich gewesen - mal war individueller Heldenmut erforderlich, mal besonderes Geschick im Umgang mit der Waffe, mal unendliche Duldsamkeit und Opferbereitschaft, mal kühles Kalkül. Mal brauchte Krieg den Haudegen, mal leidensfähiges «Menschenmaterial».13 Stets aber sind Aggression und berserkerhafte Wut eher der Störfall im Geschehen Krieg. Das Wüten des betrogenen AchilI gegen seinen geschlagenen Gegner Hektar erzürnte die Götter, widersprach also den kriegerischen Sitten und Gebräuchen auch schon in der Zeit, die durch Homer überliefert ist.14 Erst recht in der Phalanx zur Zeit der griechischen Polis bedeutete das heldenhafte Vorpreschen eines einzelnen aus dem Verband der vielen den Untergang aller - das war nicht der Beweis für Tapferkeit, sondern für Dummheit und Egoismus.15
Auch den fränkischen Rittern - eine Kriegerelite, in der Mut an oberster Stelle stand - sagt man zu Unrecht nach, sie seien nicht viel mehr als eine Horde disziplinloser Individualisten gewesen. Falsch: das Reiten im geschlossenen Verband verlangte gemeinsames Manövrieren, also Disziplin und Geschick anstelle blinder Emotion. In der ritterlichen Kultur waren «Krieg» und seine Formen vielmehr das probate Mittel, die in der Gesellschaft endemische Gewalt abzulenken, zu kanalisieren und in weniger schädliche Formen zu gießen.16 Auch das spricht nicht für die «natürliche» Verbindung zwischen männlicher «Aggression» und Krieg.
Die Soldaten, die am 25. Oktober 1415 bei Agincourt stundenlang in Kälte und Schlamm und mit Durchfall auf die Schlacht warteten17, die Infanteristen, die am 11. Mai 1745 in der Konfrontation bei Fontenoy die erste Salve ihrer Gegner regungslos über sich ergehen lassen mussten - sie waren allesamt keine reißenden Wölfe. Wahrscheinlich hatten sie Angst – mit Sicherheit aber bewiesen sie eine quälende Duldsamkeit, die zur Vorstellung von der triebgesteuerten männlichen Gewalttätigkeit nicht passt. Angst vor der Schlacht ist etwas, wovon Krieger und Soldaten aller Arten und Zeiten berichten - nicht nur das «Kanonenfutter» der Fürsten und Feldherren, das sich sein Schicksal nicht aussuchen konnte, sondern auch selbstbestimmte Elitekrieger oder Bürgersoldaten.18 Und Generationen von Generälen – von Maurice de Saxe über Wellington bis Friedrich II. - haben geklagt, wie schwer es sei, den Männern richtigen Kampfesgeist einzuflößen, kurz: ihnen ihre Tötungshemmung – wenigstens vorübergehend - abzugewöhnen.
Wenn man nach den Antworten geht, die amerikanische Infanteristen im Zweiten Weltkrieg regierungsamtlichen Historikern gegeben haben, dann muss diese Tötungshemmung auch beim bislang größten Krieg der Menschheitsgeschichte erstaunlich präsent gewesen sein. Mehr als drei Viertel der amerikanischen Soldaten wollen in der Kampfsituation von den Waffen keinen Gebrauch gemacht haben.19 Das «Rätsel der 24 000 Gewehre von Gettysburg» spricht ebenfalls für wenig ausgeprägte Lust am Töten: 90 % aller nach der dreitägigen Schlacht von 1863 auf dem Schlachtfeld gefundenen Gewehre waren noch geladen, also nicht abgeschossen worden - bei vielen fand man den Lauf mit bis zu zehn Ladungen vollgestopft. Offenbar haben die meisten Soldaten zwar die Bewegung des Ladens vollzogen, aber nicht schießen wollen.20
Dass in der Geschichte des Krieges keineswegs stets die neueste und effizienteste Waffe begeistert angenommen und eingesetzt wurde; dass sich Soldaten gegen Waffen mit dem Argument wehrten, sie seien tödlich21, ist bekannt. Selbst das, was wir heute, nach der Erfahrung zweier Weltkriege, für gesichert halten, dass es nämlich im Krieg um das möglichst effiziente Töten einer großen Anzahl von Männern gehe, ist also nicht gewiss. Nicht nur die Soldaten erwiesen sich in der Geschichte immer wieder als mäßig blutrünstig - sie erkannten im anderen selten den schrecklichen Feind, sondern einen ebenfalls leidenden Menschen. Im 18. Jahrhundert bestritten auch die berühmtesten Feldherren der Zeit die Notwendigkeit der Schlacht.22 Und so unterschiedliche kriegerische Kulturen wie die Azteken, die Hopliten und die Ritter zogen sich den Zorn der Militärhistoriker zu, weil sie sich nicht an die Effizienzkriterien der modernen «Entscheidungsschlachttheoretiker» hielten - etwa, indem sie einen Vorteil nicht bis zur völligen Niederlage oder Aufreibung des Gegners verfolgten, sondern sich mit der Schlachtentscheidung zufriedengaben. Womöglich aber kam es ihnen auf den «Entscheidungssieg» gar nicht an - Atahualpa, der mächtige Herrscher der Inka, hatte, als er 1532 ein paar entschlossenen Spaniern unter Pizarro unterlag, wahrscheinlich gar keine Vorstellung davon, dass die Spanier keinen Raubüberfall, sondern den völligen Sieg und die Unterwerfung der Inka beabsichtigten.23
Dass es eben ein Merkmal des «primitiven Kriegs» sei, auf entschiedene Überwältigung des anderen zu verzichten und es bei einer wenig mehr als symbolischen Konfrontation zu belassen, dass aber «wirklicher» Krieg derlei Rücksichten nicht kenne, wäre ein Fehlschluss - nicht nur aufgrund der oft hohen Todesraten dieser bloß «symbolischen» Kämpfe.24 Selbst ein so erfolgreicher und durchsetzungsfreudiger Feldherr wie Friedrich der Große blieb, auch wenn er hart an dessen Grenze operierte, im Rahmen des Kriegskodex, der Mäßigung gebot.25 Sogar Napoleon und seine Massenheere verletzten keineswegs alle geltenden Regeln. Spezifisch männlicher Blutrünstigkeit, muss man daraus schließen, bedarf es also nicht für den Krieg. Weshalb in der Geschichte des Krieges die passiven Männer dominieren - Männer, die erdulden, statt aggressiv zu kämpfen. Sklaven, Söldner, zum Dienst gepresste Soldaten bevölkern die Armeen der Vergangenheit. Sie waren erst recht nicht zu allem zu bewegen - vor allem nicht zu besonderer Grausamkeit denen gegenüber, die ihr Schicksal teilten.
Sie, nicht die Kriegereliten, entsprechen dem Bild von Krieg, das ihn als ein Instrument der Macht zeichnet - ein Instrument von machthungrigen Häuptlingen und korrupten Fürsten, von wahnsinnigen (Ver-)Führern, von den Kapitalisten, Imperialisten oder vom Patriarchat.26 Gegen diese Vorstellung von Krieg als Instrument der Herrschenden spricht, dass es auch in vorstaatlichen Gesellschaften keinen friedlichen «Urzustand» gibt - auch ohne feste Machtstrukturen gibt es Krieg. Auch lassen sich Menschen nicht über ein bestimmtes Maß hinaus manipulieren - zum effizienten Kriegführen gehört Freiwilligkeit: mal mehr, mal weniger. Deshalb gelten Söldner- und Sklavenheere in der Geschichte des Krieges als notorisch unzuverlässig und als ein schier unlösbares Problem für die Logistik - sie würden, nahm man an, sofort das Weite suchen, schickte man sie nach Lebensmitteln oder Futter für die Pferde.
In der Tat: am zuverlässigsten - und damit oft auch am fürchterlichsten - ist in der Geschichte des Krieges der mit seinem Gemeinwesen identifizierte Soldat, der Bürgersoldat eines Volksheeres. Dass Soldaten im Krieg nicht für «Fürstenwillkür», sondern für die eigene Sache kämpfen, entspricht sicherlich am ehesten modernen Vorstellungen von Legitimität – zumal dann, wenn es eine Demokratie ist, mit der ihre Soldaten sich identifizieren. Doch gerade diese Kriege, wo es ums Edelste zu gehen schien, kosteten weit mehr Menschenleben als manch kleine Plänkelei um Geld, Gut oder Land. Die Kriege, in denen das «Volk» in Waffen steht, entfalten einen Sog, der nicht nur die Armeen, sondern auch die Gesellschaften der Kriegführenden zu erfassen droht. Krieg macht sich selbstständig. Er ist kein Instrument.
Wenn Krieg nicht der männlichen Triebstruktur entspringt, dann bleibt immer noch zu fragen, warum er bis heute eine überwiegend männliche Angelegenheit ist. Zu Aggression und Gewalt sind Frauen ebenfalls fähig, und spätestens seit der Weiterentwicklung der Muskete zu modernen Distanzwaffen bedarf es keiner besonderen Körperkraft und keines männlichen Heldentums mehr, um in den Krieg zu ziehen. Zur passiven Duldung sind auch Frauen in der Lage - manche meinen: im Übermaß. Dennoch sind Frauen selten Kriegerinnen gewesen, es wird, über die uns bekannten Beispiele hinaus27, wohl auch keinen Kriegerinnenstamm mehr zu entdecken geben. Völlig unbeteiligt sind sie dennoch selten. Oft sind sie die Zuschauerinnen - und diejenigen, die darüber entscheiden, wer heldenhaft und wer ein Feigling ist. Sie sind die Nutznießerinnen - und die Trauernden. Die Köchinnen, Wäscherinnen und Bordellbetreiberinnen im mittelalterlichen Tross. Die Damen, für deren Ehre die Ritter kämpfen. Und sie sind immer wieder das Objekt wie das Opfer von Raub- und Kriegszügen.
Bei den nordamerikanischen Indianern wurden die Gefangenen den Frauen übergeben - zum Foltern.28 Bei anderen Stämmen - wie bei den besonders kriegerischen Yanomami – wird der weibliche Nachwuchs getötet, damit mehr Krieger nachwachsen.29 Frauen sind in den Krieg einbezogen - auch, aber nicht nur als Opfer. Bis heute stellen die meisten Opfer von Kriegen nicht die Frauen, sondern die Männer selbst.30
Was treibt sie dazu, sich wieder und wieder in ein tödliches Spiel hineinzubegeben, das sie doch offenbar so ungern betreiben - und für das sie noch nicht einmal die Entschuldigung haben, dass ein unerbittlicher Trieb sie dazu zwinge?
2 - Ökologie des Krieges
Die Materialisten unter den Kulturanthropologen argumentieren nicht mit dem Wesen des Mannes, wenn sie über die Notwendigkeit des Krieges in der Geschichte der Menschwerdung reden. Ohne Aggression hätten unsere Vorfahren nicht überlebt. Krieg, sagen sie, ist Teil der «Überlebensfitness». Und die ist, universal. Anders gesagt: wir wissen nichts über friedliche
Vorfahren. Sie sind, wie die unaggressiven Bonobos31, im Regenwald geblieben - oder ausgestorben. Materialisten32 erkennen auch im Krieg den Menschen als grundsätzlich rational kalkulierendes Wesen, das prinzipiell nur unternimmt, was ihm auch nützt. Wo liegen also die materiellen Notwendigkeiten und Anreize für Krieg? Die einfachste Antwort lautet: Krieg dient der Nahrungsbeschaffung, der Erweiterung des Genpools, der Bevölkerungskontrolle und der Gemeinschaftsbildung. Krieg ist ein lohnendes Risiko, weil er nur für wenige den Tod, für viele hingegen Leben bringt – Überleben entweder im direkten Sinn durch Nahrung oder im indirekten Sinn durch Erhöhung der Fortpflanzungschancen. In der ökologischen Sicht des Krieges sähe die Urszene etwa folgendermaßen aus: Die Vertreibung aus dem Paradies begann, als die Affen von den Bäumen stiegen - mit dem Rückzug der Regenwälder am Ende des Miozäns, das dem geruhsamen Leben auf den Bäumen, wo es essbare Früchte und Beeren, Blüten und Blätter gab, ein Ende bereitete. Während man im warmen Regenwald einfach zum nächsten Baum ziehen konnte, wenn sich ein Konkurrent näherte, gestaltete sich die Nahrungssuche schon in lichteren Baumlandschaften oder gar in der offenen Savanne weit schwieriger. Es gab weniger zu essen, man musste längere Wege zu den Nahrungsquellen zurücklegen. Mit der Verteidigung des eigenen Territoriums unter ökologischem Stress33 begannen unsere Vorfahren, die Menschenaffen – von denen die Anhänger Rousseaus stets annahmen, sie seien friedliche Vegetarier -, mit dem Vorspiel zum Krieg: dem Kampf um knappe Ressourcen. Vielleicht, so lautet eine gut begründete Spekulation über die Anfänge der Menschwerdung, stand die Wiege der Menschheit während einer langen Phase der Trockenheit auf einer Insel des Regenwaldes inmitten der sich ausbreitenden Savanne im heutigen Äthiopien. Die kleine Affenpopulation, die sich dort erhalten hatte, starb nicht aus - sie passte sich den veränderten Umständen an und entwickelte neue Fertigkeiten, sich in der feindlichen Umgebung Nahrungsmittel zu erschließen.34 Zu diesen neuen Techniken gehörte die Fortbewegung auf zwei statt vier Beinen - was womöglich weniger mit dem Vorteil, zwei «Hände» frei zu haben, zu tun hatte, sondern damit, dass die jetzt weiteren Wege zwischen verschiedenen Nahrungsquellen auf zwei Beinen energieeffizienter zu bewältigen waren. Ein Zweibeiner ist, was die Effizienz der Bewegung betrifft, in der Ebene zwar keinem Huftier, Raubtier oder Hund, aber etwa einem Schimpansen deutlich überlegen.35 Den Rest der Geschichte glauben wir zu kennen: Der aufrechte Gang ist eine der Voraussetzungen für den geschickten Gebrauch von Waffen. Waffen sind der Ersatz für die natürlichen Verteidigungsmittel, die Primaten fehlen - und die sie in den offenen Baumlandschaften und Savannen nun um so nötiger brauchen, denn das Flüchten (auf die Bäume) ist nicht mehr möglich: es gilt, den Raubtieren, etwa dem Säbelzahntiger, standzuhalten. Der Gebrauch von Waffen wiederum macht Menschen schlauer. Hirn- und Waffenentwicklung bedingen einander insofern, als das Vorhandensein bestimmter Schaltkreise im Hirn nötig ist, um das Werfen zu einer präzisen Kunst zu machen.36 Und schließlich, sieht man einmal von kollektiven Treibjagden ab, erlauben erst Waffen die Jagd. Fleisch war, insbesondere in kälteren Zeiten und Regionen, nicht allein eine angenehme Ergänzung des Speisezettels, sondern oft das einzige zur Verfügung stehende Nahrungsmittel.37 Die steinzeitlichen Jäger, die vor etwa 12 500 Jahren aus Sibirien durch die Beringstraße38 nach Nordamerika einwanderten, waren schließlich so geschickt bei der Jagd, dass sie, wie in einer bekannten Debatte behauptet wurde, in einigen hundert Jahren, in einer Art «Blitzkrieg», das zuvor mit Menschen nicht konfrontierte, arglose Mammut ausrotteten.39 Dass die Entwicklung von Waffen, die gemeinsame Verteidigung der Horde und die Kooperation bei gemeinsamer Jagd Vorbedingungen für etwas so Organisiertes wie den Krieg sind, leuchtet ein - der Mensch ist ein «kooperatives Raubtier».40 Die Jagd benötigte und beförderte soziale Strukturen in der Menschenhorde - Kooperation, Planung und Teilen der Beute, was nur Fleischfresser, nicht aber Vegetarier tun.41 Damit ist «Krieg» möglich geworden. Aber nötig? Wieder, versichern uns die Kulturanthropologen, ist ökologischer Stress der auslösende Faktor. Angesichts knapper Ressourcen beginnt der Kampf mit konkurrierenden Horden und Stämmen um das Territorium, das Nahrung bietet. Nur in isolierten Nischenkulturen mit geringer Bevölkerungsdichte in karger Umgebung, die für die Konkurrenten nicht attraktiv war, scheint Krieg nicht zum Lebensalltag gehört zu haben.42 Krieg setzt territoriale Bindung voraus - also etwas, was es zu verteidigen gilt.43 Dazu würde die Vertreibung möglicher Konkurrenten allerdings völlig ausreichen. Was also zwang unsere Vorfahren dazu, ein Tabu zu brechen, das in der Tierwelt so erstaunlich häufig eingehalten wird - warum töteten sie nicht nur Beutetiere, sondern auch Angehörige ihrer eigenen Art? Warum setzten Menschen ihre Tötungshemmung, über die sie doch offenbar verfügen, außer Kraft - anders gefragt: wodurch fühlten sie sich dazu gezwungen?
Die Antwort ist wieder: ökologischer Druck. Hunger, argumentiert etwa Marvin Harris, zwingt Menschen dazu, ihre eigene Art zum Beutetier zu machen. Menschen können auf zweierlei Weise zur Beute werden: einmal, indem sie in Ermangelung jagdbaren Wildes selbst zur Proteinquelle werden. Es ist unbekannt, in welchem Ausmaß Menschenfleisch tatsächlich zum Speiseplan unserer Vorfahren gehörte - dass die Neandertaler Kannibalen gewesen wären oder die Azteken ihre Menschenopfer gegessen hätten, behaupten die einen44, die anderen bestreiten es.45 Mit der Landwirtschaft und beginnender Vorratshaltung sind Menschen indes unzweifelhaft indirekt zur Beute geworden: sie verfügten jetzt über Nahrung, die man ihnen abnehmen konnte. Und so begann, so lautet die These, vor etwa 10 000 Jahren der jahrtausendealte Konflikt zwischen Nomaden und Sesshaften46: Die dem Jagdglück und den Jahreszeiten unterworfenen umherziehenden Jäger und Sammler hätten die ackerbauenden, sesshaften Menschen sozusagen als lebende Vorratskammer benutzt. Damit wären die Bauern zum «Beutetier » geworden, und man konnte ihnen gegenüber die Aggressionshemmungen gegen Angehörige der eigenen Art aufgeben.
Diese These klingt plausibel. Gegen sie spricht, dass Krieg nicht erst mit dem Ackerbau entstanden ist.47 Auch Sesshaftigkeit beginnt bereits vor der «neolithischen Revolution», die heutigen Forschern schon längst nicht mehr als das Paradies gilt, sondern als die Vertreibung daraus.48 Mehr noch: weit vor dem Übergang zum Ackerbau haben Menschen ihre Siedlungen befestigt - im Zweifelsfall gegen Angriffe anderer Menschen. Die Mauern von Jericho entstanden vor gut l0 000 Jahren und damit vor einer nennenswerten Ackerbaukultur im Nahen Osten.49 Nach Felszeichnungen und Skelettfunden, die entsprechende Spuren aufweisen, hat es schon im Mesolithikum vor etwa 12 000 Jahren so etwas wie Krieg gegeben. Eine Felszeichnung von der spanischen Levante zeigt Männer, die mit Pfeil und Bogen aufeinander loszugehen scheinen. Ausgrabungen in Südägypten und Ostasien förderten Skelette einer großen Anzahl von Männern gleichen Alters zutage, die Spuren von Verletzungen durch Pfeile oder Speere zeigen.50 Also: Krieg gab es vor Kain und Abel. 51 Doch auch darauf hat die These von dem ökologischen Ursprung und der ökologischen Funktion des Krieges eine Antwort: Krieg kann als Mittel zur Bevölkerungskontrolle eingesetzt werden. Wenn neue Nahrungsmittel nicht erschlossen werden können, kommt es darauf an, die Konkurrenz um knappe Nahrung möglichst zu verringern. Krieg mit einem konkurrierenden Stamm verringert auch das eigene Lager um die Zahl der gefallenen Krieger. Der Bevölkerungsdruck wird dadurch aber nur kurzfristig gemindert. Denn ohne Verhütungsmittel werden die Bevölkerungsgrößen lang- und mittelfristig von der Zahl der fruchtbaren Frauen bestimmt. Dass der Krieg auf diese Zahl sehr wohl einwirkte, allerdings indirekt, versucht Marvin Harris am Beispiel der kriegerischen Yanomami nachzuweisen.52 Dort sind tatsächlich die Frauen die primären Opfer des Krieges - bzw. der kriegerischen Kultur -, und zwar über den Umweg der Kindstötung. Bei den Yanomami werden die weiblichen Kinder getötet, damit der Stamm möglichst viele Krieger hat - und in der Tat gibt es dort, trotz der hohen Bereitschaft zu kriegerischer Auseinandersetzung, einen starken Männerüberschuss.53 Der Wunsch nach vielen Kriegern, argumentiert Harris, sei indes nur eine vorgeschobene Begründung, denn auch primitive Stämme müssten wissen, dass der Weg zu vielen Kriegern über viele gebärfähige Frauen führt. Das Töten weiblicher Säuglinge sei daher in Wirklichkeit eine bevölkerungsregulierende Maßnahme - die Verzweiflungsaktion eines um sein Überleben kämpfenden Stammes.54
Kriege können also demographische Wirkungen haben. Bewirken sie auch eine «Auslese» - etwa indem sie aggressive Männer begünstigen? Diente Krieg dazu, im Kampf der Arten dem durchsetzungsfähigeren Erbgut eine Schneise zu schlagen? Anthropologen spekulieren darüber, ob der Homo sapiens womöglich nicht nur das Verschwinden einiger primitiver Vorfahren55, sondern auch die Ausrottung des Neandertalers zu verantworten haben - als brachiale Beschleunigung des survival of the fittest.56 Das wäre dann der erste Genozid der Menschheitsgeschichte gewesen.
Ob Frauen die «natürliche Auslese» zugunsten aggressiverer Männer begünstigt haben - womit wir wieder bei der «Testosteronhypothese » angelangt wären -, ist ungewiss.57 Mit dem Geschlechterverhältnis aber hat Krieg offenkundig zu tun.
3 - Der Männerbund
Die weitverbreiteten kriegerischen Initiationsriten, mit denen Jungen in den Männerbund aufgenommen werden, zeigen, dass erst durch den Krieg der Mann zum Mann wird - und die Frau zur Frau. Krieg ist die Bewegungsform des Männerbundes. Auch dafür haben die Materialisten unter den Kulturanthropologen eine Erklärung - und überraschendes Anschauungsmaterial: die Schimpansen, unsere, wie wir heute wissen, engsten Verwandten.58
Auch Schimpansen ziehen in den Krieg gegen ihresgleichen. Schimpansen begehen Genozid. Schimpansen vergewaltigen.59 Und - sie bilden Männerbünde. Zwei amerikanische Primatenforscher, Richard Wrangham und Dale Peterson, entdeckten schon bei den Schimpansen etwas, das wir für rein menschlich halten: das Patriarchat. Schimpansenmännchen, so lautet kurz gefasst ihre These, verbünden sich deshalb miteinander, weil sie mehr Zeit als die Weibchen miteinander verbringen. Und: sie sind gewaltätig, weil Aggression sich im sozialen System der Affen auszahlt. Die Weibchen der Fleckenhyäne jagen gemeinsam. Primatenweibchen aber hindert an weiblichen Allianzen das, was unseren Vorfahren die Menschwerdung erlaubt hat: die lange Entwicklungsphase und damit Abhängigkeit des Nachwuchses. Bei zunehmendem ökologischen Druck werden Allianzen überlebensnotwendig. Gruppen bieten einen besseren Schutz vor Raubtieren und erlauben die Suche nach einem breiteren Nahrungsspektrum. Die Weibchen brauchen, in Abwesenheit von verbündeten Weibchen, die Männchen - die dominanten Männchen, denn just deren Aggressivität scheint die Gewähr dafür zu bieten, dass die Schimpansinnen und ihr Nachwuchs nicht nur von Räubern, sondern vor allem von anderen aggressiven Männchen verschont bleiben. Männchen und Weibchen kooperieren in einem Zirkel von Gewalt.60
Diese Szenerie ist der menschlichen erstaunlich nah. Mag also sein, dass der Männerbund sich aus ähnlichen Gründen lohnt. In der Geschichte des Krieges wird er evident - ja man könnte sogar behaupten, dass erst der Krieg den Männerbund zusammenschweisst und dass erst im Krieg den Frauen ihre Rolle zugewiesen wird: sein Grund und sein Ziel zugleich zu sein.
Grund: weil es sie zu schützen galt. Ziel: weil sie die Beute waren.
Krieg ist die Bewegungsform des Männerbundes. Und es ist diese «Bewegung», so unterschiedlich ihre Formen auch jeweils sein mögen, die ihm seine Intensität verleiht. Dass unerbittlicher Drill zur Entpersonalisierung von Soldaten führe, so dass sie hernach nur noch wie ein Rädchen in der Maschinerie funktionierten, wird oft zur Begründung dafür angeführt, dass Soldaten etwas durchhalten, was wir für eine unmenschliche Qual halten. William McNeill hat eine andere Hypothese entwickelt: es sei die gemeinsame Bewegung der Männer, das Marschieren oder Exerzieren, Seite an Seite - nach einem Rhythmus, im gleichen Takt, im Einklang -, was einen Zustand hervorrufe, der die individuellen Gefühle wie Angst oder Feigheit - oder auch egoistischen Heldenmut - transzendiere.61 Mit «Abgestumpftsein» wäre dieses Gefühl nicht richtig beschrieben. Mit Trance womöglich schon eher.
Wie wichtig die gemeinsame rhythmische Bewegung ist, zeigen die Kriegstänze der primitiven Stämme, über die Anthropologen berichten. Tanzen, in Verbindung mit Drogen oder Alkohol, erzeugt Trance und Euphorie. Das macht Mut und bannt die Angst. Und von Angst auch der tapfersten Krieger ist in der überlieferten Geschichte immer die Rede - der spartanische
Dichter Pindar spricht davon ebenso wie Ernst Jünger. Männer betäubten sich vor der Schlacht mit Wein - oder, wie die Azteken, mit Pulque. Die alten Skythen sollen Hanf geraucht haben.62
Womöglich war der «Rausch der Gemeinschaft» jedoch wichtiger - das Gefühl, Teil eines größeren zu sein, als man selbst es war. Die Kraft einer Phalanx ist mehr als die Summe dessen, was jeder einzelne vermag - und dieses Gefühl in Verbindung mit dem Einfluss, den Tanz oder Marschieren, also die gemeinsame Bewegung im gleichen Rhythmus, auf Menschen ausübt, scheint einen Zustand positiver Erregung, ja von Erhebung zu erzeugen - ein positives Gefühl von Gemeinsamkeit, Stärke und, wie Soldaten immer wieder behaupten: Liebe.63 Der Männerbund der Krieger dient also nicht nur der Kontrolle der einzelnen, das auch - die Hopliten haben die Mutigsten in die vorderste und die hinterste Linie gestellt und die Ängstlichen in die Mitte genommen, dorthin, wo es kein Entrinnen gab -, er verschafft seinen Teilnehmern offenbar auch eine positive Gestimmtheit, wie eine Endorphinausschüttung nach langer körperlicher Anstrengung. Dazu scheint der Rhythmus der Bewegung in Gleichklang wesentlich beizutragen.
Diese Wirkung der gemeinsamen rhythmischen Bewegung und ein anderes Phänomen, das Militärpsychologen seit dem Zweiten Weltkrieg gezielt untersucht haben64, ist Teil des paradoxen Befundes, dass Männer positive Gefühle entwickeln bei einem Handwerk, das doch, wenn man die Untersuchungen über die Tötungshemmung von Soldaten ernst nimmt, eher Widerwillen in ihnen hervorruft. Das zweite Phänomen ist, dass Männer nicht aus Angst vor den Vorgesetzten oder vor Strafen im Feld und bei der Schlacht bleiben, sondern ihrer nächsten Kameraden wegen - um der zwei, drei Männer linker und rechter Hand willen, die sie glauben nicht verlassen zu dürfen.
Offenbar ist diese Bindung unter Stress wichtiger und naheliegender als die ferne Familie und das, was in der existentiellen Situation des Kampfes als Abstraktion erscheinen muss: die Gemeinschaft, die es zu verteidigen gelte. «Der Krieg», sagte Henry de Montherlant über den Ersten Weltkrieg, «war der einzige Ort, wo man Männer leidenschaftlich lieben konnte.»65 Mit Homosexualität hat dieser Männerbund nichts zu tun, er entspringt nicht aus ihr, und er befördert sie wahrscheinlich nicht - wenngleich es über die «Heilige Schar» von Theben heißt, diese Elitetruppe habe sich aus 150 Liebespaaren zusammengesetzt.66 Soldaten aller Zeiten jedenfalls berichten von der «Hingabe» an die Kameraden, von einer Verbindung, die mindestens so intensiv sei wie die zwischen Liebenden.67 Die «Produktivkraft » des Krieges, ja Krieg selbst, scheint von diesem Männerbündnis abzuhängen, das sich im gemeinsamen Erleben, im gemeinsamen Bewegen und im gemeinsamen Ritual bestätigt.
4 - Krieg und Ritual
Krieg ist eine «anthropologische Universalie» (Burkert); fast immer und überall wird er von Männern geführt. Ebenso universell aber ist sein ritueller Charakter - etwas, das nicht notwendigerweise allein die Kriege der Primitiven auszeichnet, und ebenfalls etwas, das sie nicht notwendigerweise «mäßiger» macht.68
In der materialistischen Schule der Kulturanthropologie wird den rituellen Elementen von Krieg selten große Bedeutung zugemessen. Selbst die Opferrituale der Azteken lassen sich, wenn man Marvin Harris folgen will, ganz ohne Rücksicht auf ihre kulturelle Begründung verstehen: nicht die Götter hätten das Blut der unzähligen Menschenopfer gefordert, nicht dem Gemeinwesen wurde da geopfert (weil ohne Menschenblut der Himmel einfalle), sondern die Menschen benötigten in einer an passenden Beutetieren armen Umwelt Proteine - das Fleisch der Opfer.69 Im Schatten des Opferblocks rollten die Kadaver die Pyramide hinunter - die Priester seien die Metzger einer Kannibalengesellschaft gewesen und die Religion lediglich die beschönigende Ideologie dazu.70
Man kann es freundlicher sagen: Wenn es auch beim Menschen Tötungshemmung gegenüber der eigenen Art gibt (und gab), dann muss der ökologische Druck immens gewesen sein, der die einen zum Kindesmord, die anderen zu Kannibalismus trieb. Ritual und heilige Handlung waren dringend nötig, um die grossen Schuldgefühle der Menschen zu dämpfen, lautet eine naheliegende Vermutung.71 Insbesondere Religionsforscher weisen auf die angstlösende Funktion des Rituals hin, auf die beschwichtigende Wirkung, die der Verweis auf den göttlichen Willen haben kann.72 Zyniker würden sagen: die Menschen haben sich schon immer ihr materielles Tun durch einen ideellen Überbau veredelt.
Konrad Lorenz hat eine andere Begründung für die Bedeutung des Rituals im Krieg entwickelt. Es ist ja nicht zu übersehen, dass der Krieg der Männer verblüffend viel Ähnlichkeit mit den Schaukämpfen sexueller Rivalen aus dem Tierreich aufweist. Das kriegerische Imponiergehabe manch primitiver Stämme erinnert an den Schaukampf brünftiger Hirsche; die bunte Paradeuniform eines Generals aus dem 18. Jahrhundert an den Balzschmuck des Argusfasans. Und ist der Vergleich der Trommeln und Flöten, mit denen Armeen ins Feld zogen, mit dem Kampfgesang der Nachtigall vor den Toren ihres Reviers zu weit hergeholt? Sogar die Tatsache, dass Waffen im Krieg nicht immer ihrer Tödlichkeit entsprechend eingesetzt werden, passt zu diesem Bild: Männer, argumentiert Robert L. O'Connell, ziehen im Krieg große Waffen vor - ähnlich den Scheinwaffen, die Tiere zum Imponieren entwickelten, wie das Geweih. Wo es ums Beutemachen geht, sind die Waffen hingegen prosaisch, unauffällig und funktional.73
Gehen wir also den von der Ethologie genannten Gründen für den intra-spezifischen Schaukampf nach. Wozu ist er nutze? Der innerartliche Kampf erfüllt in der Tierwelt offenbar mehrere sinnvolle Funktionen: beim Kampf um ein Weibchen erweist sich schnell, wer der Stärkere ist und damit derjenige, der am ehesten die Brut gegen Feinde verteidigen kann; der Kampf um den Platz in der Rangordnung schafft Ordnung in der Horde, und das Verteidigen des Territoriums gegen gleichartige Konkurrenz ist insbesondere unter ökologischem Druck lebensnotwendig. Dass Angehörige der gleichen Art einander abstoßen und sich über ein weites Gebiet hinweg verteilen, ist «die wichtigste arterhaltende Leistung der intraspezifischen Aggression».74 Doch dies alles sind, sozusagen, begrenzte «Kriegsziele», die es nicht nötig machen, den anderen zu töten.
Nicht selten reichen zur Abschreckung schon die entsprechenden Drohgebärden aus, die sich zu ritualisierten Begegnungsweisen verfeinern können. Höflichkeit etwa ist auf hohem Niveau gebändigte Aggression - die ausgestreckte Hand keine Freundlichkeit, die Umarmung keine Herzlichkeit, sondern der Versuch, den anderen davon zu überzeugen, dass man keine Waffe trägt, also harmlos ist.75
Kaum jemand hat anschaulicher als Konrad Lorenz beschrieben, wie eng Liebe und Aggression beieinanderliegen: manche Befriedungshandlung, die zum Ritual geworden ist und als solche den Zusammenhalt zwischen einander Bekannten bestätigt, entstammt einer umgelenkten Aggression - so lässt sich Begeisterung als umgelenkte «soziale Verteidigungsreaktion» dechiffrieren, Lächeln aus dem Zähnefletschen herleiten und die Gänsehaut, die wir angesichts des «Erhabenen» erleben, dem in Abwehrbereitschaft gesträubten Pelz zuordnen.76 Aggression entsteht aus etwas Positivem - der Verteidigungsbereitschaft der Gemeinschaft - und entwickelt sich über ihre Ritualisierung zu einer wirkungsvollen Methode, Gemeinschaft zu bestärken. Und das ist überaus sinnvoll: denn im Verteidigungsfall überlebt die Gemeinschaft, die zusammenhält.77
Obwohl sich die Menschen von Stichling und Auerhahn deutlich dadurch unterscheiden, dass sie den einen Schritt weiterzugehen und zu wirklicher Aggression der eigenen Art gegenüber in der Lage sind, ist die Komponente des ritualisierten Kampfes nach den Regeln der «Höflichkeit» aus der Geschichte des Krieges nie verschwunden. Das Ritterturnier ist ein solcher «Kommentkampf», in dem der Stärkere ermittelt wird, ohne den Schwächeren allzu sehr zu beschädigen. Schon das Vorspiel des Drohens und Kräftemessens ermöglicht es dem Schwächeren, einen aussichtslosen Kampf rechtzeitig aufzugeben.78 Noch die Truppenaufstellung vor der Feldschlacht unter Trommelwirbel und Fahnengeknatter erinnert, obwohl es hernach alles andere als mäßig zugegangen sein dürfte, an diese Art von Kräftemessen. Auch benachbarte Schimpansentrupps bauen sich voreinander auf und üben sich im rituellen Auftrumpfen, im Posieren und lautstarken Angeben - so versuchen sie einzuschätzen, auf welcher Seite wohl der Vorteil liegt. Wer die zahlenmässige Überlegenheit des Gegners feststellen muss, kann einen riskanten Kampf noch rechtzeitig vermeiden.79
In der Geschichte des Krieges haben meistens die stärkeren Bataillone gesiegt.80 Allein ihre zunehmende Intelligenz81, wenn schon nicht ihre Tötungshemmung, hätte Primaten also davon abhalten können, bei ungünstiger Machtbalance eine Entscheidung durch gewalttätige Konfrontation herbeizuführen. Andere Anthropologen meinen, im Gegenteil, gerade ihre Intelligenz habe Primaten dazu gebracht, in das schlichte Rechenexempel von zahlenmäßiger Über- oder Unterlegenheit noch andere Faktoren einzurechnen - sie hätten sich etwa überlegene taktische Fähigkeiten eingebildet und deshalb auch in aussichtsloser Lage noch den Kampf gewagt.82 Vor allem aber: ihre Intelligenz erlaubt ihnen, Gefahren zu antizipieren, die noch gar nicht eingetreten sind. Das «Präventivschlag»-Denken hat eine uralte Geschichte.83
Lorenz selbst hat aus der Kriegsfähigkeit von Menschen auf ihre mangelnde Tötungshemmung geschlossen: sie hätte sich nicht entwickeln müssen, weil Menschen - im Unterschied zu Raubtieren - zur Zeit ihrer friedlichen Existenz als vegetarische Affen in den Bäumen des Regenwalds keine Kampferfahrung hätten sammeln und insofern auch keine Einhegung solcher Aggression hätten einüben müssen: Im Wald zog man weiter, wenn ein Konkurrent einen bedrohte.84 Man musste sich dem Kampf nicht stellen. Es wären demnach also kein angeborener Aggressionstrieb, sondern im Gegenteil unsere friedlichen Ursprünge, die uns so ungebremst gewalttätig werden lassen.85 Ein vergleichbares Argument stammt von Margaret Mead. Auch sie vermutete, dass beim Menschen «ein Mangel an instinktiven Kontrollen» vorliege, und spekulierte, dass es beim weiblichen Geschlecht, kämpfe es erst einmal, viel hemmungsloser zugehen müsse als beim männlichen, da Frauen, im Unterschied zu diesen, nie hätten lernen können, ihre Aggression zu zügeln.86
Nun haben Menschen aber erwiesenermaßen Tötungshemmung. Die These Erik Eriksons von der «Scheinartenbildung» scheint dieses Problem zu lösen. «Scheinartenbildung» heißt, dass Menschen die eigenen kulturellen Normen und Riten für biologische Merkmale nehmen, mit denen sich die eine Gruppe von der anderen unterscheidet. So kann der fremde Stamm als fremde Spezies behandelt werden. Die aber darf man töten.87
Für diese These scheint zu sprechen, dass in der überlieferten Geschichte viele Schlachten besonders blutig gewesen sind, in denen der Gegner als «entmenscht» vor- und dargestellt wurde, als schädliches Insekt, das man zertreten, als Schlange, der man den Kopf abschlagen müsse. Kulturelle Fremdheit hat womöglich die Leidenschaft erhöht: Die griechischen Phalangisten haben im Kampf gegen die persischen Heere jene regelgesteuerte Zurückhaltung durchaus vermissen lassen, die sie bei innergriechischen Kämpfen übten. Auch die christlichen Ritter scheuten sich nicht, die zu bekehrenden Heiden mit einer Brutalität zu behandeln, die sie bei Kämpfen unter ihresgleichen als unchristlich verpönten. Aus dieser «Entmenschlichung» des Gegners haben Pazifisten geschlossen, es helfe gegen den Krieg, wenn man lerne, im anderen den gleichen zu erkennen, wenn man also «Fremdheit» überwinde.
Das hat sich im Ersten Weltkrieg als schöne Illusion erwiesen. Selten womöglich waren sich Menschen kulturell und sprachlich so nahe wie am Vorabend der großen europäischen Katastrophe.88 Mangelnde Nähe macht keinen Krieg, im Gegenteil: schon immer haben benachbarte Stämme abwechselnd miteinander Handel oder Händel getrieben, kannten einander also sowohl als Freunde als auch als Feinde. Warum auch sollte ausgerechnet Homo sapiens die einzige Spezies sein, die ihresgleichen nicht erkennt?89 Und insbesondere Soldaten wissen, dass ihr Gegenüber ein Mensch ist wie sie selbst, weder Tier noch Untermensch.
Dennoch scheint das Evozieren des «Tiers» auf eine archaische Gefühlswelt zu verweisen, die Quelle heftiger Leidenschaften ist. Leidenschaften werden indes nicht vom «Beutetier» hervorgerufen, das man ja aus einem ganz pragmatischen Grund tötet, nämlich, weil man es essen will. Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, welches «Tier» statt dessen gemeint sein könnte.
5 - Der Krieg als Opferhandlung
Krieg ist ein überaus paradoxes Geschehen, in dem die Entfesselung von Gewalt mit Tendenzen zu ihrer Mäßigung korrespondiert. Ist Krieg also doch «Kultur» - nämlich die spezifische Weise, in der Männer notwendige Aggressionen zügeln, mäßigen und ihnen eine gesellschaftlich verträgliche Form geben?
Krieg ist offenkundig beides - Männerkultur, die sich zugleich mit mächtigen, aus der Tiefenschicht «kollektiver Erinnerung» herrührenden Emotionen verbindet. Diese Gefühle bestehen nicht aus aggressiven Anteilen allein; ihre Macht rührt aus Motivstrukturen, die wir als das Gegenteil von Aggression auffassen und die uns als rundum positiv erscheinen: Altruismus, Aufopferung für die Gemeinschaft. Krieg, so sehr sich seine Formen im Laufe der Jahrhunderte auch unterscheiden, mobilisiert offenbar archaische Gefühle, denen man sich weit schwerer entziehen kann als äußerer Macht, Herrschaft und Unterdrückung - weil sie für uns das Gute repräsentieren.
Auch dieser Befund, der im folgenden überprüft werden soll, ist paradox: Männer ziehen, hieße das ja, seit Menschengedenken in den Krieg - nicht, um ihr Aggressionspotential auszutoben. Nicht, weil sie Vergnügen am Töten hätten. Und noch nicht einmal ausschließlich aus Bereicherungslust. Sie sehen sich weder bei den Hopliten noch als Infanteristen im Ersten Weltkrieg als Täter oder gar als Mörder. Sondern als Opfer, das ihnen die Liebe zur Gemeinschaft: abverlangt. Männer sehen sich im Krieg nicht als Männer, die töten, sondern als Männer, die sterben - für andere.90
Wenn das ernst zu nehmen ist - und das ist es offenbar -, dann stellt sich erst recht die Frage nach der Ratio des Krieges. Wenn er nicht einem dem Mann angeborenen Trieb entspringt, ja wenn er etwas ist, wovor nicht eine Minderheit, sondern eine Mehrheit der daran Beteiligten sogar zurückschreckt, und wenn er darüber hinaus noch nicht einmal ein zuverlässiges, kalkulierbares Instrument der Macht ist - warum dann Krieg oder, besser gesagt, warum dann Krieg unter Blutvergiessen und nicht als symbolisches Ereignis oder sportliche Veranstaltung?
Man nähert sich dem Phänomen, indem man die Frage umdreht: warum bringen die Männer einander eigentlich nicht um, mit allen Konsequenzen; warum führen sie ein ausgedehntes, mit Kostümierung, Bombast und rituellen Inszenierungen angereichertes Theater auf, an dessen Ende es weit weniger Tote gibt, als der jeweilige Stand der Waffenkunst ermöglicht hätte? So lautete die verständnislose Frage des Pazifisten Georg Friedrich Nicolai angesichts dessen, was er die «sinnlose Spielerei» des Ersten Weltkriegs nannte.91 Die Antwort: dieser vom Standpunkt der Effizienz aus gesehen unnötige Budenzauber lässt darauf schließen, dass es im Krieg, sogar in seiner industrialisierten Form, immer wieder um etwas anderes geht als primär um das effiziente Töten anderer. Um was?
Warum gilt ausgerechnet der Krieg in der Menschheitsgeschichte immer wieder als eine heilige Handlung? Wie eng Krieg mit Religion verbunden ist, zeigt sich nicht nur an der
Angewohnheit der Griechen oder Römer, vor der Schlacht zu opfern - oder an den Feldgottesdiensten aller christlichen Heere. Hier liegt der Grund auf der Hand: die Götter werden um einen guten Ausgang gebeten. Dass Krieg als «heilige Handlung» gilt, die «ehrfürchtige Schauer» hervorruft:, ist im Sinne von Konrad Lorenz schlüssig als die Umwandlung des sozialen Verteidigungstriebs zu dechiffrieren: wir haben eine Gänsehaut, weil sich unter der zivilen Schale der Pelz unserer Vorfahren sträubt. «Was als 'erhaben', als 'Enthusiasmus' erlebt wird und gilt, erweist sich so als biologisch-genetisch verwurzelt, eine in früheren Stadien funktionelle Verhaltensweise zwischen Angst und Aggression, die sich in fortgeschrittener Zivilisation noch immer als 'Gefühl' manifestiert.»92
Die sakrale Aura, die Krieg seit Menschengedenken umgab, der «heilige Schauder», den er hervorruft, deuten darauf hin: er ist religiöse Opferhandlung.93