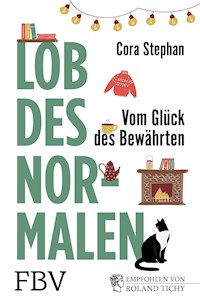9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die Geschichte zweier starker Frauen und eines ganzen Jahrhunderts Stendal in den Dreißigerjahren: Hier kreuzen sich die Wege von Margo und Helene. Margo ist Lehrling in der Buchhaltung, Helene Fotografin. Sie lieben denselben Mann, werden durch den Krieg und die deutsche Teilung getrennt und bleiben doch miteinander verbunden. Die Geschichte zweier Frauen mit einem gemeinsamen Geheimnis, berührend, fesselnd und voller Überraschungen! Margo weiß, was sie will: eine anspruchsvolle Arbeit und Verantwortung. Als sie Helene bei Photo-Werner trifft, hat diese schon viel riskiert. Sie ist im Spanischen Bürgerkrieg zwischen die Fronten geraten. Mit ihr taucht Alard von Sedlitz in Stendal auf, ein charismatischer junger Schlesier, in den sich beide verlieben. Sie werden durch Krieg und Verfolgung getrennt. Margo verliert auf der Flucht 1945 ihr Kind und beinahe ihr Leben. Mit Henri, dem der Krieg alle Illusionen geraubt hat, baut sie sich eine neue Existenz in Westdeutschland auf. Helene, die Buchenwald überlebt hat, wird in Ostberlin von der Stasi zur »Kundschafterin des Friedens« ausgebildet. Auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs treffen beide wieder aufeinander, verbunden durch ein Familiengeheimnis und gelenkt durch die Stasi. Doch selbst das Ende der DDR bedeutet kein Ende ihrer dramatischen Verstrickung, die noch bis ins letzte Jahr des 20. Jahrhunderts reicht. Cora Stephan erzählt Zeitgeschichte als Familiengeschichte und entwirft Charaktere, denen man voller Spannung folgt, getrieben von dem Wunsch, dem Rätsel von Liebe, Verwandtschaft und Verrat auf die Spur zu kommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 790
Ähnliche
Cora Stephan
Ab heute heiße ich Margo
Roman
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Cora Stephan
> Über dieses Buch
> Impressum
> Klimaneutraler Verlag
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Ein ausführliches Personenverzeichnis finden Sie am Ende des Buches.
Der Familie
Ein Knie geht einsam durch die Welt.
Es ist ein Knie, sonst nichts!
Es ist kein Baum! Es ist kein Zelt!
Es ist ein Knie, sonst nichts.
Christian Morgenstern
– Buch 1 –Im Dritten Reich
(1936 bis 1945)
Margo
I
Stendal – An einem Sonntagnachmittag im Winter 1936 beschloss Margarete Hegewald, kein Kind mehr zu sein. Vor dem Spiegel im Nähzimmer machte sie Inventur: Der Faltenrock musste weg, die Kniestrümpfe und die Strickjacke, vor allem aber die Zöpfe.
Den Rest hatte man wohl hinzunehmen: Der Nasenrücken war ein wenig zu breit, das Kinn ein wenig zu herrisch. Dafür waren ihre grauen Augen schön, das sagten alle. Sie lockerte den rechten Zopf, den ihre Mutter heute früh viel zu straff gebunden hatte, und hielt ihn so, dass ihr das Haar in einem weichen Bogen über das Ohr fiel. Mit kurzen Haaren und einer leichten Welle sähe sie aus wie die große Schwester von Waltraud, ihrer Banknachbarin in der Schule, und die war schon zwanzig.
Neben ihr auf Mutters Nähmaschine lag, dunkelgrün und genoppt, ein Stück Wollstoff. Ihr Weihnachtsgeschenk. Er war bereits zugeschnitten, nach einem Schnittmuster, das sie sich selbst ausgesucht hatte. Wenn ihre Mutter den Saum tief genug ansetzte, sähe das Kleid richtig erwachsen aus. Elegant. Und dazu trug man keine Zöpfe.
Sie holte tief Atem. Sie liebte dieses Zimmer, in das eigentlich niemand hineindurfte, vor allem Vater nicht. Sie liebte den Duft der Bügelwäsche, die neben der Tür im Korb lag. Und sie liebte den mannshohen Spiegel, der ihr zeigte, wie andere sie sahen. Margarete griff zu der Schere, die auf dem Tisch neben der Nähmaschine lag.
»Gretl! Wo bleibst du denn, Kind?« Mutter stand in der Tür. »Dein Vater hat schon nach dir gerufen!«
Nenn mich nicht Kind. Und Vater kann rufen, bis er schwarz wird. Sie drehte sich um.
Ihre Mutter schlug sich die Hand vor den Mund. »Was hast du getan?«, flüsterte sie. »Was hast du mit deinen Haaren gemacht?«
Margarete lief durch den dunklen Flur, in dem es nach Sauerkraut roch, und blieb in der Tür zum Wohnzimmer stehen. Sie wusste, was sie erwartete. Eine Standpauke, wenn nicht gar Schlimmeres.
Hugo Hegewald saß wie so oft im Sessel, las, die Beine von sich gestreckt, in der Zeitung und paffte eine Zigarre. Er stammte aus Straßburg und bildete sich etwas auf seine Lebensart ein, war aber als Finanzbeamter in Stendal nur eine ganz kleine Nummer. Erst recht in der Partei, was ihn besonders wurmte, weil er dort Karriere machen wollte.
»Was stehst du da rum?« Er deutete auf den Hocker vor der Vitrine. »Setz dich. Ich habe mit dir zu reden.«
Er wusste es. Sie hielt die Luft an. Aber das konnte nicht sein. Sie hatte mit niemandem darüber gesprochen. Nur mit Waltraud Skrodzki, der einzigen ihrer Schulkameradinnen, die verstand, was sie bewegte. Waltrauds Vater hatte im Gefängnis gesessen, weshalb die Eltern meinten, sie wäre kein guter Umgang. Aber was konnte sie schon für ihren Vater? Niemand konnte etwas für seinen Vater.
Waltraud jedenfalls behielt Geheimnisse für sich, also musste es sich um etwas anderes handeln. Sei’s drum, der Alte fand für jeden seiner Wutausbrüche einen Anlass. Und wenn er erst sah, was sie mit ihren Haaren gemacht hatte!
»Ich möchte bloß wissen, wer dir solche Flausen in den Kopf gesetzt hat. Wenn du ein Junge wärst, könnte ich das ja noch verstehen. Aber so …« Er blätterte geräuschvoll um, ohne von der Zeitung aufzublicken.
Ja, sie hatte ein Junge werden sollen, das hatte er ihr oft genug gesagt. Gerwulf hätte der Erbprinz heißen sollen, alter germanischer Adel sozusagen. Stattdessen war sie gekommen. Aus lauter Enttäuschung darüber hatte Vater eine Woche lang kein Wort mit seiner Frau gesprochen, das wusste sie von Tante Mienchen. Zwei Jahre später kam endlich ein Junge, sie tauften ihn Gernot, doch das Kind starb vier Wochen später an Diphtherie. Und dann wurde Gerda geboren, wieder ein Mädchen, was schlimm genug war. Noch schlimmer: Das Kind hatte eine Versteifung am linken Fuß, keine wirkliche Behinderung, aber Vater gab Mutti die Schuld daran.
Seine verkniffenen Augen unter den buschigen Augenbrauen, seine Mundwinkel, die immer nach unten zeigten – manchmal hasste sie ihn. Sie war dreizehn gewesen, als sie ihre Mutter auf dem Friedhof gefunden hatte, weinend neben Gernots Grab, eine Glasscherbe in der Hand. Seither wusste Margarete, dass sie auf sie aufpassen musste. Abends trank er oft mehr, als er vertrug. Sie hörte ihre Mutter nachts leise weinen, wenn er wieder geschimpft und getobt hatte.
»Weitere Schuljahre sind Zeitverschwendung«, bellte er hinter seiner Zeitung, über der Zigarrenqualm aufstieg. »Wenn du Glück hast, heiratet dich jemand, dafür braucht man keine höhere Bildung.«
Heiraten? Wovon redete er bloß?
»Hörst du mir überhaupt zu?« Endlich sah ihr Vater auf.
Margarete hielt die Luft an. Nein, sie würde den Blick nicht senken, nein, sie würde nicht klein beigeben. Sie hob das Kinn.
»Was glotzt du so? Konzentrier dich gefälligst, wenn ich mit dir spreche! Kaum zu glauben, dass deine Lehrerin dich bis zum Abitur auf der Schule lassen will!«
Margarete starrte ihm sekundenlang ins Gesicht, das sich zu röten begann. Und dann hätte sie beinahe gelacht. Darum ging es also! Fräulein Tenzer hatte Vater wieder einmal von ihrer Begabung vorgeschwärmt. Sie hätte der Lehrerin gleich sagen können, dass er auf diesem Ohr taub war.
»Ich werde deinen Vater davon überzeugen, dass du studieren musst, Margarete.« Die Tenzer hatte leuchtende Augen und gerötete Wangen gehabt. »Tenzer auf Mission«, nannten sie das in der Klasse. Und vielleicht wäre es ihr ja auch gelungen – Vater liebte Schmeicheleien. Aber in diesem Fall war nicht er das entscheidende Hindernis. Es war Margarete selbst, die nicht mehr zur Schule gehen wollte. Sie hatte andere Pläne.
»Fräulein Tenzer …«
Er fuhr ihr ins Wort. »Was dein Fräulein Lehrerin sagt, interessiert mich nicht. Du beendest in diesem Jahr die Schule.«
»Ja, Vater«, sagte sie.
»Außerdem wirst du zu Hause gebraucht. Schluss der Debatte.«
Das sagte er immer, wenn er etwas entschieden hatte, selbst wenn es niemand gewagt hatte, ihm zu widersprechen.
»Deine Mutter kommt kaum noch nach mit den einfachsten Dingen.«
Seine Frau konnte ihm nie etwas recht machen. Was war das kürzlich für ein Theater gewesen, als er Klümpchen in der Suppe gefunden hatte! Oder als sie vergessen hatte, ihm seine Zigarre zurechtzuschneiden!
»Auf deine Schwester kann sie nicht zählen.«
Natürlich nicht, dachte Margarete. Die muss ja geschont werden.
»Und was hast du überhaupt mit deinen Haaren gemacht? Du siehst aus wie eine aus der Gosse. Morgen möchte ich dich mit einem vernünftigen Haarschnitt sehen.«
»Ja, Vater«, sagte sie und versuchte, nicht allzu erleichtert auszusehen.
In der Küche umfing sie der Dampf aus Kochtopf und Abwaschschüssel. Mutter hatte die roten Arme tief im schaumigen Wasser versenkt.
»Fang!« Gerda warf ihr ein Geschirrtuch zu. »Hat er dir den Kopf abgebissen? Du siehst ziemlich ramponiert aus!«
Ihre Mutter reichte Margarete einen tropfnassen Teller. »Sie hat sich die Zöpfe abgeschnitten«, seufzte sie. »Ihre schönen langen Haare.«
»Auweia. Und? Was hat er gesagt?«
»Nichts.« Margarete wienerte den Teller, bis er quietschte. »Außer dass ich von der Schule abgehen soll.«
»Oh«, machte Gerda.
»Ist mir nur recht. Ich habe mich um eine Stelle beworben.«
»Soso«, murmelte Mutter und reichte ihr eine seifige Kaffeetasse. Sie hatte wieder einmal nicht zugehört.
»Als Friseuse, nehme ich an. Wenn man dich so sieht.« Gerda ließ Messer und Gabeln geräuschvoll in die Besteckschublade fallen.
»Ja, ich weiß, du hast die Intelligenz mit Löffeln gefressen, Schwesterchen«, antwortete Margarete spitz.
»Hört auf zu streiten. Wir bekommen nachher Gäste. Die Gläser müssen poliert werden. Und Margarete, stell bitte den Sherry und den Portwein raus.«
»Und vergiss nicht Vaters stinkende Zigarren.« Gerda rümpfte die Nase.
Margarete stellte die Tasse zu den anderen auf dem Tisch. »Übrigens habe ich bereits eine Lehrstelle. Falls das jemanden interessiert.«
»Wie bitte? Das nenn ich Mut.« Gerda hatte etwas völlig Ungewohntes im Blick. Es sah fast wie Anerkennung aus.
»Ab dem 1. April. Bei Photo-Werner. Im Büro. Ich werde Bürokaufmann.«
»Margarete!« Jetzt endlich war ihre Mutter bei der Sache. »Das ist nicht dein Ernst, Kind. Weiß Vater davon?«
»Nein.« Margarete seufzte tief auf. »Ich dachte, du …«
»Ich?« Ihre Mutter wurde erst rot, dann weiß im Gesicht. »Ich werde mich hüten. Die Suppe löffelst du selber aus. Er schätzt keine Eigenmächtigkeit, das weißt du doch.«
Oh ja. Er würde seine Wut erst an ihr und dann an Mutti auslassen.
»Außerdem kann ich deine Hilfe im Haushalt gut gebrauchen. Hast du denen in diesem Foto-Laden etwa zugesagt?«
»Nein. Ja. Ich dachte, ich frag erst einmal, ob sie mich überhaupt wollen.«
Ihre Mutter trocknete sich die Hände an der Schürze ab und schüttelte den Kopf. »Was du willst und was die wollen, spielt keine Rolle. Was dein Vater will, ist das Entscheidende.«
Margaretes Mut verflog. Mutter hatte recht. Sie brauchte seine Zustimmung, und das schon bald, denn eine Lehrstelle bei Photo-Werner war begehrt.
»Mutti …« Sie zögerte. Merkte sie denn gar nicht, dass ihre Älteste als Hausfrau völlig ungeeignet war? Spürte sie nicht, dass sie unabhängig sein musste? Dass sie nicht so enden wollte – wie ihre Mutter?
»Ich bekomme 13 Mark 20«, sagte sie schnell. »Im Monat. Im zweiten Lehrjahr 21 Mark. Und im dritten Lehrjahr …«
Mutter schüttelte noch immer den Kopf. Aber man sah ihr an, dass sie nachdachte. Geld war das Zauberwort. Geld war immer ein Thema zu Hause. Hugo Hegewald wollte so leben, wie er glaubte, es verdient zu haben, auch wenn sein Gehalt beim Finanzamt dem nicht entsprach. Für seine Stammtischbesuche im Damhirsch musste Geld da sein, ebenso für Zigarren oder ein neues Hemd. Vielleicht war genau das der richtige Ansatz?
»Ich möchte zu unserem Lebensunterhalt beitragen«, sagte sie vorsichtig. »Das müsste er doch einsehen, oder?«
»Wenn du für Kost und Logis bezahlst …« Man sah ihrer Mutter an, dass sie im Kopf durchrechnete, was sie dafür ansetzen konnte. Endlich nickte sie. »Ich rede noch heute Abend mit Vater. Wenn die Gäste gegangen sind.«
Und wenn er genug Portwein getrunken hat, um zutraulich zu werden, aber nicht zu viel für einen Wutanfall. Man muss mit Männern geschickt umgehen, pflegte Mutti zu sagen. Diplomatisch. Als ob das bei diesem Mann jemals funktioniert hätte.
»Aber morgen gehst du zum Friseur und lässt dir die Haare in Ordnung bringen.«
Margarete drückte Gerda das feuchte Geschirrtuch in die Hand und fiel ihrer Mutter um den Hals.
Endlich waren die Gäste gegangen, um die ihr Vater herumscharwenzelt war, wohl, weil er hoffte, Sturmbannführer Wilhelm Gärtner, der in Uniform gekommen war, würde bei der Partei ein gutes Wort für ihn einlegen. »Man möchte doch seinen Teil beitragen zum Wohle des Vaterlandes.«
Margarete lag noch lange wach im Bett und lauschte bang den Geräuschen aus dem Schlafzimmer nebenan. Sie hörte Mutti murmeln, ihr Vater bellte zurück, dann klatschte es und ihre Mutter gab einen leisen Schmerzenslaut von sich. Am liebsten wäre sie aufgestanden, hinübergegangen, und … Und was? Mutter war nicht zu helfen.
Dennoch hatte sie ein schlechtes Gewissen. Wo war ihr Mut geblieben? Wieso hatte sie ihrem launischen Vater nicht ins Gesicht geblickt und ihm ihre Pläne gestanden? Sie schlief viel zu spät ein und träumte schlecht von einer Heirat mit Sturmbannführer Gärtner, diesem unansehnlichen Frosch, der viel zu alt für sie war und längst eine Ehefrau hatte.
Am nächsten Tag schwänzte sie den Unterricht, denn so, wie sie jetzt aussah, konnte sie sich in ihrer Klasse nicht blicken lassen. »So schöne Haare«, seufzte Meister Hoffmann, als sie ihm die abgeschnittenen Zöpfe gab. »Schade drum.« Sie sah ungerührt in den Spiegel, als er die Schere ansetzte.
Der elegante Kurzhaarschnitt, links gescheitelt mit leichter Welle, stand ihr, so sah sie beinahe erwachsen aus. Und genauso fühlte sie sich auch.
30. Dezember 1936
Liebes Tagebuch,
das neue Jahr muss, es wird herrlich werden! Ich bin meinen Lebenszielen ein großes Stück näher gerückt.
Am 1. April beginnt meine Lehrzeit bei Photo-Werner, Photo-Handlung und –Atelier, in der Adolf-Hitler-Straße 77. Monatslohn: 13 Reichsmark und 20 Pfennige. Vater wird fast alles davon einkassieren. Aber er hat zugestimmt. In drei Monaten bin ich frei! Ich kann es gar nicht erwarten.
Ich habe mir geschworen, mich von nichts und niemandem abhängig zu machen. Mutti zeigt mir, wohin das führt, wenn man einem Manne untertan ist: in die Sklaverei. Welcher Mann kann schon eine Frau respektieren, die nicht auf eigenen Beinen steht? Jedenfalls keiner, den ich respektieren kann.
Waltraud fiebert mit mir. Die anderen verstehen mich nicht, diese braven Mädchen mit ihren Zöpfchen. Ihre höhere Bildung wird ihnen nichts nützen. Im neuen Deutschland brauchen wir keine Putzfrau, die fließend Französisch spricht, und keine Haushälterin, die den »Faust« auswendig kann. Das ist nicht das, was der Führer will. Die deutsche Frau soll die Gefährtin des Mannes sein, seine Kampfgenossin!
Wer immer er ist, wann immer er vor mich tritt, der Mann, der zu mir gehört: Ich werde ihn erkennen, und ich werde alles tun, um sich seiner würdig zu erweisen.
II
In der Schule wurde die neue Frisur bestaunt. Nicht von den Lehrern, natürlich. »Aber Kind! Deine schönen Zöpfe!« Fräulein Tenzer. Was die wohl sagen würde, wenn sie erführe, dass ihre ach so begabte Schülerin am 1. April eine Lehre begann?
In der großen Pause zeigte sich, wer auf Margaretes Seite stand und wer nicht. Die Gärtner-Zwillinge mit ihren festgezurrten blonden Zöpfen und blütenweißen Kniestrümpfen an den drallen Beinen würdigten sie keines Blickes. Zum zehnten Geburtstag der beiden war sie einmal bei den Gärtners eingeladen gewesen, in ihre Villa in bester Lage am Adolf-Hitler-See. Von der Küche im Souterrain ging ein Speiseaufzug hoch zum Esszimmer in der Beletage, das hatte sie damals sehr beeindruckt. Auch dass es nicht nur ein Herren-, sondern auch ein Damenzimmer gab und eine Bibliothek mit Bücherregalen bis an die Decke, an jeder Wand. Das wäre was für Gerda gewesen, den Bücherwurm. Im Eingangsbereich war der Boden mit Terrazzo ausgelegt, oben gab es Parkett. Kein Vergleich mit der Etagenwohnung, in der die Hegewalds wohnten.
Erst recht kein Vergleich mit Waltraud Skrodzkis Lebensumständen. Waltrauds Eltern kamen ursprünglich aus Ostpreußen, aber die Familie hatte ein abenteuerliches Leben geführt: Zuerst waren sie nach Argentinien ausgewandert und enttäuscht zurückgekehrt. Nach der Rückkehr hatte Waltrauds Vater erst ein Kino in Anklam gepachtet und dann in Nordhausen am Harz einen Gemüseladen betrieben. Schließlich waren die Skrodzkis nach Stendal umgezogen.
Margarete hatte Waltraud ein einziges Mal besucht, als sie eine Karte für eine Musikaufführung übrig hatte, und war tief erschrocken gewesen. Die ganze Familie hauste in zwei Dachkammern, zu denen man nur über einen Trockenboden gelangte, in dem allerhand Gerümpel stand. Waltrauds Mutter war dünn und blass und hatte kein Wort gesagt, ihr Vater hatte zur Begrüßung bloß genickt, ohne dem Besuch die Hand zu geben. Margarete hatte so getan, als ob sie das ganz normal fände. Aber sie wusste nun, warum Waltraud ihre intimsten Gedanken mit ihr teilte: Sie war die Einzige, die gesehen hatte, wie die Freundin lebte, und sie hatte das nie auch nur erwähnt, schon gar nicht vor anderen.
Waltraud stand zu ihr, die blonde Waltraud mit den wasserblauen Augen, die immer in dicken Wanderschuhen herumlief. Sie wollte das Gleiche, was Margarete wollte: unabhängig sein und frei.
»Dein alter Herr hat also nichts dagegen?«
»Mutti hat ihn überredet. Mein Lehrgeld geht zu drei Vierteln in die Haushaltskasse. Das war das schlagende Argument.«
»Dann muss dein Reichtum wohl noch ein bisschen warten.« Waltraud grinste.
»Aber der Tag wird kommen!« Margarete hob die Hand wie zum Schwur.
»Na, ihr Klatschtanten?« Toni Seliger stand hinter ihr, Margarete hatte sie nicht kommen sehen.
Toni, die eigentlich Antonia hieß, war ein ganz anderer Menschenschlag als Waltraud, doch auch sie war eine Außenseiterin, obwohl jeder in Stendal ihre Eltern kannte. Besser gesagt: weil ihre Eltern bekannt waren wie Paradiesvögel.
Vater sah es nicht gern, dass Margarete mit Toni verkehrte. »Das ist kein Umgang für Leute wie uns«, pflegte er zu sagen. »Politisch unzuverlässig«, hatte er die Seligers mal genannt. Aber wahrscheinlich gefiel ihm nur nicht, dass sie so ganz und gar unbürgerlich waren. Herr Seliger leitete das Theater von Stendal, ein unscheinbares Fachwerkhaus hinter dem Mönchskirchhof, und trug sein schwarz gefärbtes Haar schulterlang über theatralisch weiten, kragenlosen weißen Hemden. Frau Seliger gab Gesangsunterricht und liebte wallende Gewänder. Während andere zu einer Abendgesellschaft einluden, hieß das bei Seligers »Soiree«, mit Musik und »gepflegter Unterhaltung«, wie Tonis Mutter das nannte. Margarete hoffte seit Langem auf eine Einladung – und fürchtete sich zugleich davor.
Der Grund war Henri. Sie kannte Tonis Bruder seit Urzeiten, als er noch aufs Gymnasium ging und seine Schulmütze verwegen schräg trug. Damals hatte er sich für die »albernen Gören«, die seine Schwester mit nach Hause brachte, nicht die Bohne interessiert. Das hatte sich gründlich geändert.
»Du hast einen Verehrer«, hatte Waltraud ihr zugeflüstert, als er vor ein paar Wochen Toni von der Schule abholte.
»Ach was, das ist Henri, der ist harmlos«, hatte sie geantwortet und zu ihm hinübergeschielt. Er war gewiss kein germanischer Held, sondern eher kurz und dunkel geraten, aber er hatte sich verändert, seit er in Breslau Jura studierte. Er war richtig männlich geworden. Und es stimmte: Er machte ihr schöne Augen. Sie hatte ihm den Rücken zugekehrt. Klar mochte sie ihn, er war ein netter Kerl. Aber mehr auch nicht.
Henri war nicht der Mann, auf den sie wartete. Sie wusste, wie es sich anfühlen würde, wenn der Richtige vor ihr stünde. Bei Henri spürte sie rein gar nichts.
»Das muss der Neid dir lassen: Die neue Frisur kleidet«, sagte Toni und strich sich eine glänzende Haarsträhne aus dem Gesicht. »Mein Fall wäre das allerdings nicht.«
Natürlich nicht. Toni sah aus wie Schneewittchen: Haare schwarz wie Ebenholz, Haut weiß wie Schnee und Lippen so rot wie Blut. Zu der passte kein moderner Haarschnitt.
»Außerdem frage ich mich, was du uns mit deiner Verwandlung sagen willst?«
»Nichts, Toni. Nur, dass man alte Zöpfe auch abschneiden kann.« Margarete lächelte unschuldig.
»Gretl verabschiedet sich so langsam von uns«, sagte Waltraud. »Wir sind ihr zu kindisch.«
Der Gong ertönte. »Damit dürfte sie recht haben, jedenfalls, was dich betrifft.« Toni drehte sich um und schlenderte zum Schulportal.
Die nächsten Wochen vergingen viel zu langsam. Die Schulkameradinnen wurden ihr von Tag zu Tag fremder mit ihrer kindlichen Bravheit und dem ganzen altklugen Geplapper. Nein, sie empfand keinen Abschiedsschmerz, und als der Zeitpunkt näher rückte, gab es keine Gelegenheit mehr zum Abschiednehmen. Eine Typhusepidemie sorgte dafür, dass alle Schulen geschlossen wurden, sodass ihr die mitleidvollen Blicke der einen und die hämischen Bemerkungen der anderen erspart blieben. Sie gehörte schon jetzt nicht mehr zu ihnen.
In ein paar Wochen war sie Mitglied der arbeitenden Klasse. Dann würde sie zum ersten Mal pünktlich um Viertel vor acht vor der Tür von Photo-Werner stehen. Dann konnte das wahre Leben beginnen. Bis dahin genoss sie etwas gänzlich Ungewohntes: Freiheit.
III
Margarete schlief bei offenem Fenster und zurückgezogenen Vorhängen, damit sie von der aufgehenden Sonne geweckt wurde, von dieser unbeschreiblich zartgoldenen Röte, die seit Tagen den Morgenhimmel verzauberte. In der Zeitung stand, dass der März 1937 der sonnigste März seit Menschengedenken sei. Noch nie war ihr Stendal so großartig vorgekommen. Die Luft war mild und weich, ein sanfter Wind wehte, die Bäume und Sträucher am Adolf-Hitler-See bedeckten sich mit zartem Flaum und die Forsythien prangten in strahlendem Gelb. Sie genoss die ungewohnte Freiheit, durchstreifte die Stadt, vom Rathaus mit dem Roland zu den Kasernen, vom Alten Dorf mit dem Winckelmann-Denkmal bis zur Windmühle in Wahrburg.
Bereits zweimal war sie die Strecke abgegangen, die sie künftig täglich gehen würde, von der Wohnung in der Blumenthalstraße 47 zu Photo-Werner in der Adolf-Hitler-Straße 77. Dreimal die Sieben! Das musste ja Glück bringen! Sie brauchte exakt achtzehn Minuten, wenn sie durch die Nicolaistraße und am Dom entlangging, und eine Viertelstunde, wenn sie sich beeilte. Bei ihrem zweiten Besuch hatten alle Häuser in der Straße geflaggt. Der Führer beschützt mich, dachte sie, es gefiel ihr, sich einzubilden, dass das Rot der Hakenkreuzfahnen sie willkommen hieß.
Lange stand sie vor dem Geschäft mit der beeindruckenden Fensterfront. Satt glänzendes dunkles Holz rahmte die beiden Schaufenster, der obere Teil der Eingangstür war aus Milchglas, in das Blumengirlanden eingeätzt waren. Auf dem hölzernen Baldachin über den Fenstern und der Tür stand in goldenen Lettern »Photographie«, im holzgetäfelten Aufgang zum Laden konnte man auf der rechten Seite »Photographische Bedarfs-Artikel« lesen und links »Photokunst-Studio Otto Werner«.
Zwei opake Kugellampen beleuchteten die Auslagen in den beiden Fenstern. In der Mitte des linken Fensters thronte eine Kamera, Margarete hatte ihren Namen auswendig gelernt: eine Voigtländer Superb mit zwei Linsen. Neben dem aktuellen Deutschen Kamera-Almanach lag eine Agfa-Box und davor, auf rotem Samt, eine Leica, die so winzig war, dass sie bequem in eine Damenhandtasche passte.
Margarete verstand nichts von der Technik des Fotografierens, aber sie glaubte fest daran, dass dem Fotografieren die Zukunft gehörte. Alle wichtigen Ereignisse, von der Geburt bis zum Tod, konnten mit dem Fotoapparat in Sekundenschnelle für die Nachwelt festgehalten werden. Während man früher den Maler bezahlen musste, damit er ein Porträt anfertigte, auf dem man sich hoffentlich ähnlich sah, ging man heute zum Fotografen und musste mit der Wirklichkeit zufrieden sein, aber wenigstens erkannte man sich wieder. Die Reichen hatten ihre kunstvollen Büsten und Gemälde, die Armen würden sich irgendwann eine Fotografie leisten können. In ein paar Jahren würde jeder fotografieren.
Edel sahen sie aus, die Porträtfotos in der Auslage des rechten Fensters, von Täuflingen und Jubilaren und Hochzeitspaaren. Ob man Otto Werner um ein Porträt bitten konnte? Oder war das zu teuer? Sie nahm sich vor, jeden Monat etwas dafür zurückzulegen.
Doch da gab es auch ein paar Kleinigkeiten, die sie unsicher machten. Keiner der Männer auf den Fotos trug eine Uniform, und das Bild des Führers stand versteckt hinter einem Reklameschild für Agfa. Geflaggt hatte Otto Werner auch nicht. Musste man sich Sorgen machen, was seine Zuverlässigkeit betraf? Doch war das nicht egal, solange er sich als guter Fotograf erwies?
Endlich war der Tag gekommen. Mit klopfendem Herzen stand sie vor der Ladentür, nicht eine Minute zu früh oder zu spät. Sie wollte nicht gleich am ersten Tag auffallen, und das war ihr wohl gelungen, denn niemand nahm auch nur Notiz von ihr. Nur eines der Mädchen, das zehn Minuten später kam, hielt ihr die Hand hin, eine Blonde mit auffallend weiblichen Rundungen und einem strahlenden Lächeln: »Ich heiße Marianne. Labor, zweites Lehrjahr.«
Otto Werner stürmte erst eine Stunde später herein, sagte »Ah, da ist ja die Neue«, und stürmte gleich wieder hinaus, nach seiner Frau Inge rufend, von der es hieß, sie sei »die Seele des Geschäfts«.
Margarete hatte zwar befürchtet, dass es eine Art Rede geben würde und sie so etwas wie ein Treuegelöbnis abzulegen hatte, aber dass nun rein gar nichts passierte, war ihr auch nicht recht. Denn laut Lehrvertrag war der Lehrherr verpflichtet, in seinen Schutzbefohlenen »die für einen deutschen Kaufmann und Volksgenossen notwendigen charakterlichen Kräfte zu wecken und zu pflegen, insbesondere sie zur Treue, Ehrbarkeit und Arbeitsamkeit anzuhalten«. Dazu gehörte ja wohl mehr als eine flüchtige Begrüßung! Der Empfang enttäuschte sie ein bisschen.
»Bei der Chefin musst du aufpassen«, flüsterte Marianne ihr zu. »Die tut scheißfreundlich, aber wenn du wirklich mal was verbockst, gibt’s eine Gardinenpredigt, bei der dir die Ohren abfallen.«
Endlich nahm Frau Werner ihren neuen Lehrling zur Kenntnis, sagte: »Ach, da sind Sie ja«, und schickte sie zum Fensterputzen nach draußen. Es war ein kühler Tag, aber Margarete schwitzte in ihrem weißen Kittel. Sie hoffte inständig, dass keine ihrer ehemaligen Klassenkameradinnen sie bei solch beschämender Arbeit ertappte.
Nein, so hatte sie sich die Sache mit der Lehre nicht vorgestellt, doch so ging es in den nächsten Tagen weiter. Obwohl der Laden jeden Abend um 19 Uhr geschlossen wurde, blieb sie länger, weil sie auch die Geschäftsräume zu reinigen und zu bohnern hatte.
Ihre Mutter wusste, dass sie ungern putzte. Als Margarete sich eines Abends nach einem langen Tag mit Feudel und Seifenlauge bei ihr beklagte, sagte sie: »Nichts lernt man besser kennen als das, was man putzen muss.« So hatte sie das noch gar nicht gesehen, doch genauso war es. Nach zwei Wochen wusste Margarete, wo der Chef eine Flasche mit Nordhäuser Korn versteckte, die Chefin ihre Modezeitschriften und Marianne die Schokolade. Sie kannte alle Ecken von Photo-Werner, auch wenn sie gewiss noch längst nicht alle Geheimnisse gelüftet hatte.
Wer den Laden betrat, landete als Erstes in einem nicht sehr geräumigen Vorraum, in dem sich eine hohe Theke mit einer imposanten silbernen Registrierkasse befand. An der Wand hinter der Theke gab es ein Regal mit schmalen Fächern, jedes gerade so groß, dass einer der flachen Kartons für die entwickelten Fotos bequem hineinpasste. Die Fächer waren in alphabetischer Reihenfolge ausgezeichnet, sodass die Kartons unter dem Kundennamen abgelegt werden konnten. Neben der Theke stand ein bequemer Polsterstuhl, fast schon ein Sessel, mit grünem Chenille bezogen, auf dem die Kunden saßen und warteten, die fotografiert werden wollten.
Ins »Atelier« gelangte man durch eine Tür links vom Eingang. Der Raum, ein großzügiger, beinahe quadratischer Raum, hatte bodentiefe Fenster mit schweren braunen Gardinen, die meistens zugezogen waren. Für das nötige Licht sorgten zwei Scheinwerfer auf hölzernen Beinen, denen sich Margarete höchst respektvoll näherte, sie hatte Angst, sie mit dem Schrubber umzustoßen. An der Wand rechts standen Kulissen, bewegliche Wände aus Holzleisten und dicker Pappe, die man hinter ein mit rotem Samt bespanntes Sofa schieben konnte, sofern man nicht die verputzte und hellbraun getönte Wand als neutralen Hintergrund bevorzugte. Photo-Werner hatte die Alpen, ein Stadtpanorama, das Meer und das Bild einer mit mächtigen Folianten bestückten Bibliothek zur Auswahl. Margarete fand alle Hintergrundbilder gleich scheußlich, fast so schlimm wie das Sofa mit seinen Troddeln und den verschnörkelten und vergoldeten Armlehnen.
Für Einzelporträts gab es einen Stuhl, der nicht ganz so geschmacklos war. Wenn es nach ihr ginge, hätte man das Atelier längst gründlich entstaubt und ein wenig auf den Stand der neuen Zeit gebracht – weniger Kitsch, mehr klare Linien! Immerhin musste sie hier nicht allzu viel bohnern, da unter dem Sofa ein Teppich lag, der wurde nur alle paar Wochen ausgeklopft.
Zum Labor musste man zurück in den Laden gehen und dann durch eine Doppeltür nach hinten. Obwohl zwischen Laden und Labor ein Flur lag und die Tür zum Labor verstärkt und abgedichtet war, drangen die chemischen Dämpfe in alle Räume. Das Labor musste Margarete nicht putzen, sie durfte es ja noch nicht einmal betreten, worüber sie froh war, denn die mit dem Fotografieren verbundenen chemischen Prozesse waren ihr unheimlich.
Zu den Büros führte der Flur rechts hinter dem Laden. Dort, wo sie hoffentlich bald arbeiten würde, in der Buchhaltung, war am wenigsten Platz, was an den vielen Akten lag. An jeder der Wände standen Regale bis hoch an die Decke. Die Regalbretter bogen sich unter dem Gewicht des Papiers, an die oberen drei Reihen gelangte man nur mit einer Leiter.
Sie betrachtete ihren künftigen Arbeitsplatz mit einer Mischung aus Scheu und Respekt. Ohne präzise Buchführung war jedes Unternehmen zum Scheitern verurteilt, das wusste sie aus der Schule. Also würde sie für Photo-Werner ihr Bestes geben.
Schon nach wenigen Wochen musste sie nicht mehr putzen, sie schien ihre Feuerprobe bestanden zu haben. »Als Erstes kümmern Sie sich um die Ablage, Fräulein Hegewald«, meinte Inge Werner. »Danach sehen wir weiter. Wenn Sie sich nicht allzu dumm anstellen …«
Nein, das würde sie ganz gewiss nicht. Auf größere Aufgaben freute sie sich. Sie verstand etwas von Zahlen und von Organisation – die Bilanzen müssen stimmen, hatte Fräulein Tenzer immer gesagt, das ist das A und O, im Leben wie in der Buchhaltung.
IV
Die Zeit raste. Im Mai flöteten die Amseln in den blühenden Rotdornbäumen und die Mauersegler fegten mit schrillem Schrei durch die Luft. Zur Spargelzeit kamen Scharen von polnischen Landarbeitern in die Stadt und im Herbst, zur Zuckerrübenernte, zogen süßliche Schwaden aus der Actien-Zucker-Fabrik durch die Gassen.
Margarete ging ganz in ihrer Arbeit auf, sie sah wenig von Marianne und dem anderen Lehrling, Gudrun, denn ins Labor durfte sie ja nicht. Die Chefin guckte ihr zwar manchmal auf die Finger, aber Herr Werner war dauernd unterwegs und fotografierte Hochzeitspaare. Nur für Porträtaufnahmen kam er ins Atelier. Selbst die Mittagspause verbrachte Margarete meist allein in ihrem Büro und vergaß manchmal sogar, die von Mutti liebevoll belegten Brote auszupacken.
Doch an einem klaren Oktobertag lockte sie die Sonne, von der sie in diesem Jahr noch viel zu wenig gesehen hatte, und sie beeilte sich, mit ihrer Brotbüchse an die frische Luft zu kommen, hinaus in den Hinterhof, ein Geviert, in dem die Mülltonnen und der Ascheimer standen. Immerhin gab es außer geborstenem Pflaster ein ummauertes Stück Rasenfläche, über das eine Teppichstange führte, und am Zaun hinten in der Ecke stand ein Haselnussstrauch mit dunkelrotem Blattwerk.
Als sie durch die Hintertür ins Freie trat, hörte sie eine Stimme »Wieder mal keine Spur von der Ablage« sagen. »So eine Streberin!« Die Stimme gehörte zu Marianne, der Blonden aus dem Labor. Margarete begriff erst, als Marianne bei ihrem Anblick »Ah, welch Glanz in unserer Hütte!« rief und sie spitzbübisch anfunkelte, wer gemeint war: sie.
Einen hässlicheren Spitznamen als »Ablage« konnte sie sich schwerlich vorstellen. Und das von Marianne, die sich selbst als »Rasse erster Klasse« bezeichnete, was auch nicht gerade geschmackvoll war! Überhaupt: Wieso war sie eine Streberin? Sie wusste nicht, ob sie gekränkt sein oder lachen sollte. Zögernd setzte sie sich neben die Ältere auf das Mäuerchen.
»Ich tue meine Arbeit, das ist alles.«
»Wenn du nicht aufpasst und öfter mal rausgehst, wirst du blass und blutarm.« Die Blonde lachte sie an. »So wie wir. Findest du nicht auch, Gudrun?«
Gudrun saß abseits über eine verbeulte Blechbüchse gebeugt. Sie war ein ernstes, dünnes Mädchen, mausgrau wie ihr Pferdeschwanz, und sie hatte es nicht gern, wenn man ihr beim Essen zusah. Sie sah kurz hoch und schüttelte den Kopf.
»Jedenfalls ist es schön, dich auch mal hier draußen zu sehen.«
Margarete öffnete ihre Brotbüchse. Graubrot mit Teewurst. Schon war ihr der Appetit vergangen.
»Wollen wir tauschen?« Marianne hielt ihr ihre Büchse entgegen. Weißbrotschnitten mit Käse. Margarete zögerte. Konnte sie das annehmen? Ein Blick in Mariannes Gesicht sagte ihr, dass das gar keine Frage war: Es war selbstverständlich.
Marianne aß das Wurstbrot mit sichtlichem Genuss. »Ich weiß, dass die Chefin große Stücke auf dich hält«, sagte sie nach einer Weile. »Aber du arbeitest zu viel. Im Vergleich mit dir sehen wir wie die Bummelanten aus.«
Margarete brauchte eine Weile, bis sie begriff. Das war es also. Ihre Arbeitsauffassung setzte die anderen unter Druck. »Verstehe. Daran habe ich nicht gedacht. Mir macht meine Arbeit Spaß, das ist alles.«
»Ich behaupte ja nicht, dass du dich einschmeicheln willst, aber du setzt Maßstäbe.« Marianne lächelte noch immer, aber deutlich kühler.
»Ich darf Verantwortung übernehmen, und das empfinde ich nicht als Arbeit, sondern als Ehre.« Und das machte sie zur Streberin? In ihren Augen war das fast ein Kompliment.
»Klar, am Anfang gibt man sich Mühe. Aber später …« Mariannes Lippen kräuselten sich.
Darum geht es nicht, wollte Margarete sagen. Es ist keine Mühe, es ist …
»Kommst du am Samstag mit ins Kino?« Gudrun hatte ihre Mahlzeit beendet und war aufgestanden. »Sie spielen gerade ›Der zerbrochene Krug‹ mit der Flickenschildt. Wenn du es auf dem Rasiersitz aushältst: Da kostet es nur 30 Pfennig.«
Die sonst so unauffällige Gudrun hatte eine Leidenschaft: Kino und die UFA-Stars. Beim Putzen hatte Margarete eine stattliche Sammlung von Autogrammkarten in ihrem Spind gefunden. Sie wollte schon zusagen, als die Tür hinter ihnen aufging und die Chefin erschien. »Genug geschwätzt! An die Arbeit!«
»Sklaventreiberin«, murmelte Marianne. Sie legte den Arm um Margarete, während sie zurück an ihre Arbeitsplätze gingen.
Ab jetzt achtete Margarete darauf, die Mittagspause mit den Mädchen zu verbringen. Auch begann sie, im Laden auszuhelfen, wenn zu viele Kunden auf einmal im Vorraum standen. Fotoapparate durfte sie nicht verkaufen, sie verstand ja nichts davon, aber sie konnte den Kunden die entwickelten Filme und die Abzüge aushändigen. Schon nach kurzer Zeit war sie an die Dämpfe gewöhnt, die aus der Dunkelkammer bis nach vorne an die Verkaufstheke drangen. Am intensivsten roch die Essigsäure, mit der die entwickelten Fotos gewässert wurden, am ekligsten stank die Lösung aus Fixiersalz. »Schwefel«, hatte Marianne ihr lachend erklärt. »Das, wonach es in der Hölle riecht.«
»Ist es – giftig?«
Marianne hob ihre Hände. »Noch zittern sie nicht«, sagte sie.
Das Mädchen hatte Mut. Natürlich war die ganze Chemie giftig. Niemandem bekam die Arbeit im Labor. Dafür erfuhr man dort Dinge, von denen nicht jeder in Stendal wusste. Eines Mittags – Margarete saß mit den anderen im Atelier, es war kein Wetter für den Hof – kam Marianne mit erhitzten Wangen hereingestürzt und schwenkte einen noch feuchten Abzug.
»Habt ihr das gesehen?« Die anderen drängten sich um sie, als sie das Foto auf den Tisch legte.
Die Frau hatte ein enormes Hinterteil, das sie dem Fotografen entgegenreckte. Die Strapse des schwarzen Mieders schnitten in ihre weißen Schenkel, über die Strümpfe aus schwarzer Spitze quoll das Fleisch. Die dicke Blonde kniete auf einem geblümten Sessel, trug eine schwarze Maske über den Augen und lächelte mit geschminkten Lippen über ihre Schulter hinweg in die Kamera. Jeder kannte sie. Es war die Frau des Apothekers.
Von nun an teilten Marianne und Margarete sich den Heimweg. Wenn es die Zeit erlaubte, bummelten sie vorher noch Arm in Arm durch die Adolf-Hitler-Straße. »Bummeln« war etwas, das Lehrer und Eltern gar nicht schätzten, aber alle jungen Leute in Stendal taten es, Mädchen und Jungen, meist paarweise. Erst war es Margarete peinlich, wenn Marianne die jungen Männer, die ihnen entgegenkamen, auffordernd anlächelte, aber manchmal wünschte sie sich, ähnlich unbefangen zu sein.
Es war ein Freitagabend, als vor ihnen ein Trupp SA-Männer mit wehenden roten Hakenkreuzfahnen über die Straße marschierte. Marianne hisste schmissig den Arm, ihr »Heil Hitler!« klang, als ob es aus vollem Herzen käme. Margarete fand das »Heil«-Schreien albern, die aufgerissenen Münder, die roten Gesichter und verzückten Blicke. Doch diesmal ertappte sie sich dabei, dass sie laut mitbrüllte. Der Führer hatte dem Reich Glück gebracht. Da durfte man auch mal Gefühle zeigen.
»Sind sie nicht großartig, unsere Männer?« Marianne blickte dem Trupp schwärmerisch lächelnd hinterher.
Margarete nahm sie am Arm. »Könntest du dich trotzdem mal langsam von dem Anblick losreißen? Ich muss nach Hause.«
Bis zur Prinzenstraße gingen sie gemeinsam. Das war sehr unterhaltsam, denn in Stendal pflegte man abends die Fenster zu öffnen, Kissen auf die Fensterbretter zu legen und auf die Straße zu schauen. Einige der meist älteren Herrschaften schauten mürrisch hinunter, wenn die beiden vorbeikamen, doch die meisten grüßten zurück, wenn Marianne zu ihnen hochwinkte. Marianne verbreitete Fröhlichkeit, und das tat gut.
Der Kontakt zu den Schulfreundinnen war weitgehend eingeschlafen. Toni Seliger und Waltraud Skrodzki gingen weiter in die Schule und hatten freie Zeit, wenn Margarete noch arbeitete. Nur Waltraud hielt Kontakt. Ihr zuliebe opferte sie einen ihrer seltenen freien Samstage. Eigentlich hatte Margarete keine Lust gehabt auf den Kurs vom Bund Deutscher Mädel, zu dem Waltraud sie unbedingt mitnehmen wollte. Das Thema war »Wohnkultur«, das interessierte sie nicht, sie war nicht sonderlich häuslich. Aber wenn Waltraud darauf bestand …
Der Raum, in dem der Kurs stattfand, war kühl. Margarete sah mit Erleichterung, dass nur drei der anderen Mädchen Uniform trugen. Gruppenführerin Erna Stowalter ließ sie strammstehen, während sie ihre Ansprache hielt: »Selbst ist die Frau! Es muss auch mal ohne die Männer gehen. Sie haben wichtigere Aufgaben, als sich um häusliche Dinge zu kümmern.«
»Zum Beispiel Krieg spielen«, flüsterte Waltraud.
»Shhhht!«, machte eines der älteren Mädchen.
»Was das zweckmäßige und moderne Wohnen betrifft, so sollte das deutsche Mädel vor dem Heiraten wissen, wie man ein deutsches Heim gestaltet. Heute lautet unser Thema: Aus Alt mach Neu!«
»Gold gab ich für Eisen.« Waltraud konnte es einfach nicht lassen.
»Ja? Haben Sie einen Vorschlag zu machen, Fräulein Skrodzki? Ihre Familie ist ja bekannt für ihre praktische Ader«, sagte Erna Stowalter eisig. Einige der Mädchen kicherten.
Margarete blickte zur Seite und sah, dass Waltraud rot wurde.
»Also keinen. Das wundert mich nicht.«
Warum machte man sie so zum Gespött? Weil ihre Eltern arm waren? Weil ihr Vater früher Sozialdemokrat gewesen sein soll? Sie war doch eine Volksgenossin! Rang und Klasse spielen keine Rolle mehr, hatte der Führer gesagt. Das war ja das Großartige an der neuen Zeit.
Die Stowalter verzog den Mund zu einem Haifischlächeln. »Gut. Dann können wir endlich beginnen.«
Sie durften sich setzen, während die Gruppenführerin einen Stuhl in die Mitte des Raumes stellte, einen fein gedrechselten Stuhl, wie er auch im »Herrenzimmer« von Margaretes Vater stand.
»Alles Verschnörkelte ist Kitsch. Die moderne Frau bevorzugt klare Linien.«
Vor allem, wenn man Staubwischen hasst. Margarete lächelte in sich hinein. Ihr kam die Sache mit den klaren Linien entgegen.
Erna Stowalter hob den Stuhl an und drehte ihn um. Dann ging sie zu einem Tisch, auf dem ein Werkzeugkasten stand. Mit einer Säge in der Hand kam sie wieder. Alle schauten gebannt zu, als sie die Säge ansetzte. In wenigen Minuten war aus dem einen der kitschigen Stuhlbeine eine »klare Linie« geworden. Sehr viel schöner war das eigentlich nicht.
»Ich glaube, ich bin lieber doch keine moderne Frau«, flüsterte Margarete. Waltraud grinste spöttisch. Sie hatte zwei linke Hände, und wenn es nach ihr ging, gab es in der neuen Zeit Wichtigeres zu tun.
V
Zu Hause war die neue Zeit jedenfalls noch nicht angebrochen. Vater schien nur das Geld zu interessieren, das Margarete nach Hause brachte, und die stehende Wendung ihrer Mutter war »Isst du auch genug?«. Gerda starrte den ganzen Abend in irgendwelche Bücher, »die wird mal ein Blaustrumpf«, hatte Mutter gesagt, was nun wirklich kein Kompliment war.
Doch erfreulicherweise wurden die Stunden immer seltener, die sie im Kreis der Familie verbringen musste. Sie fühlte sich deshalb nicht einsam, ganz im Gegenteil. Sie fühlte sich reich beschenkt. Das schlug sich sogar in ihrem Portemonnaie nieder, sie hatte ja kaum Gelegenheit, etwas von ihrem spärlichen Restlohn auszugeben. Bis zu ihrem 19. Geburtstag.
Zu diesem Anlass lud sie Mutter und Schwester ins Café Winckelmann ein, in ein gemütliches, kleines Fachwerkhaus im Alten Dorf, benannt nach dem berühmten Archäologen.
»Ich finde nicht, dass das ein passendes Thema ist, also nicht für junge Mädchen.« Mutti rührte energisch in ihrer Kaffeetasse, während Gerda breit grinste.
Du vorlautes Balg schaffst es noch, mir meinen Festtag zu verderben, dachte Margarete und trat ihrer Schwester unter dem Tisch ans Bein.
»Johann Joachim Winckelmann ist ein großer Sohn der Stadt Stendal«, sagte Mutti streng. »Man muss nicht jedes dumme Geschwätz glauben.«
Irgendeine lokale Nazigröße verbreitete neuerdings, Winckelmann sei anormal gewesen und habe sich zum gleichen Geschlecht hingezogen gefühlt. Liebe unter Männern? Margarete fand so etwas ganz und gar unvorstellbar, es war – ja: es war abartig und die Partei hatte recht, solche Menschen zu ächten. Auch wenn ihr nicht ganz klar war, wieso man damit deutsches Blut schützte. Die Ehre – schon eher.
»Ich hab ja gar nicht behauptet, dass er Männer liebte«, sagte Gerda. »Das hat Fräulein Strümpel im Kunstunterricht gesagt. Und dass so was bei den Griechen Sitte gewesen wäre.«
»Können wir bitte …?« Mutter machte ein gequältes Gesicht.
Herr Kieschel näherte sich, der Ober, ein feiner Herr, der auch junge Damen respektvoll behandelte, weshalb sie alle gern hierherkamen. Er stellte die Kuchenteller formvollendet vor ihnen ab, verneigte sich und verschwand wieder.
Margarete legte beruhigend die Hand auf die ihrer Mutter. »Hauptsache, es schmeckt euch. So etwas Gutes gibt es so bald nicht wieder.«
Das Café Winckelmann war bekannt für seine Torten. Mutter aß Sachertorte, Margarete eine Linzer Schnitte und Gerda stocherte in ihrem Käsekuchen herum.
»Schön, dass du uns eingeladen hast, meine Große, man kriegt ja kaum noch etwas von dir zu sehen«, sagte Mutti und sah sie liebevoll an. »Arbeite dich nicht kaputt, hörst du?«
»›Zum Werke, das wir ernst bereiten, geziemt sich wohl ein ernstes Wort; wenn gute Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort‹«, deklamierte Gerda mit vollem Mund. »Schiller.«
Margarete legte die Kuchengabel beiseite und starrte ihre Schwester an. »Bist du sicher, dass höhere Bildung gut für den Verstand ist?«
Gerda verschluckte sich fast vor Lachen. »Auf jeden Fall hat man damit in Gesellschaft immer ein passendes Zitat bei der Hand.«
»Wie praktisch.«
»In der Tat. Aber du hast wohl kaum Bedarf dafür, du kommst ja nie raus aus deinem Laden.«
»Ich arbeite, Schwesterchen, im Unterschied zu dir. Ich liege meinen Eltern nicht auf der Tasche.«
»Gibt es nichts anderes in deinem Leben als Arbeit? Kennst du keine höheren Werte als Zahlen? Ist bei dir alles nur Buchhaltung und schnöder Mammon?« Gerda hielt die Kuchengabel in der Faust wie eine Fahnenstange.
»Kinder, jetzt mäßigt euch«, flüsterte Mutter mit nervösem Blick zum Nebentisch.
»Ich weiß, was mir meine Unabhängigkeit bedeutet, vielen Dank.«
Gerda machte ein Gesicht wie Fräulein Tenzer bei der Zeugnisausgabe. »Ich frage nach Werten. Nach Idealen. Nach Träumen.«
»Ich träume nicht«, beschied Margarete sie. »Ich tue meine Pflicht. Wenn das alle tun …«
»Wenn das alle tun, und nicht mehr, wird Deutschlands Rolle in der Welt …«
Margarete hört ihre Mutter tief Luft holen. »Schluss jetzt«, sagte sie leise. »Gerda, du bist undankbar. Du verdirbst deiner Schwester ihre Geburtstagsfeier.«
»Lass nur, Mutti. Mir kann sie nichts verderben«, sagte Margarete und lächelte Gerda spöttisch an. »Meine Ideale sind praktischer Art. Die Theorie überlasse ich gerne meiner kleinen Schwester. ›Eine kleinliche Natur wird durch den Verkehr mit großer Gesinnung um keinen Zoll größer werden.‹ Falls du’s nicht gemerkt hast: Goethe.«
VI
Margarete wusste nicht genau, was ihr Vater auf seiner Stelle beim Finanzamt machte, er sprach nicht darüber, und wenn, dann schimpfte er. Alle stiegen offenbar auf, nur er nicht. Wieder war einer an ihm vorbei befördert worden, eine Ungerechtigkeit, über die er sich bitter beklagte. Selbst die Partei, auf die er große Hoffnung setzte, schien nicht an ihm interessiert.
»Weil ich einen einzigen Fehler in meinem Leben gemacht habe.« Mutter hatte, um ihn aufzuheitern, Königsberger Klopse serviert, und ausnahmsweise schien das seine Stimmung zu heben. »Nur weil Hans mich damals eingeladen hat, zu einer Sitzung seiner Loge zu kommen.« Er schob sich einen halben Klops in den Mund. »Woher sollte ich damals wissen, dass Freimaurer heute verboten sind? Am Montag gehe ich zum Ortsgruppenleiter. Das muss ein Ende haben.«
»Du machst das schon«, sagte Mutti mit diesem bewundernden Lächeln, das Margarete nicht leiden konnte.
»Na und ob!« Vater kaute zufrieden.
Gerda, clever wie immer, nutzte die Gunst der Stunde. »Meinst du nicht, dass es Zeit für einen Volksempfänger ist, Vati? Damit wir immer informiert sind über alle wichtigen Ereignisse!«
»Der Führer siegt auf ganzer Linie. Das weiß ich auch ohne Rundfunkgerät.« Er hielt seiner Frau den Teller hin, damit sie ihm einen Nachschlag auftun konnte.
In dieser Hinsicht gab Margarete ihm recht. Sie lebten in wahrhaft großen Zeiten. Ihr wurde schwindelig, wenn sie daran dachte: Im März hatte man Österreichs Anschluss ans Deutsche Reich gefeiert, Ende September endete die Münchner Konferenz mit einem Sieg des Führers, und das Sudetengebiet wurde wieder deutsch. Das eigene Leben war so unbedeutend im Vergleich zu den großen Dingen, die sich im Deutschen Reich abspielten! Dass man daran teilhaben konnte!
»Wir fahren am nächsten Samstag mit dem ganzen Betrieb nach Tangermünde«, sagte sie. »Die Graf Zeppelin II wird vorbeifliegen, das muss man gesehen haben, hat Otto Werner gesagt. Ein Triumph deutscher Ingenieurskunst.«
»Der Führer hat die Arbeitslosigkeit abgeschafft und unsere Wirtschaft floriert – und woran liegt’s? Deutschland rüstet auf, egal was das Ausland dazu glaubt meinen zu dürfen.« Vater wischte sich mit der Serviette über den Mund. »Der Krieg ist der Vater aller Dinge.«
»Si vis pacem, para bellum«, murmelte Gerda.
»Was sagst du? Sprich deutsch, wenn du an meinem Tisch sitzt. Und nicht mit vollem Mund.« Der Alte schob geräuschvoll seinen Stuhl zurück und erhob sich. Der Friede schien schon wieder vorbei zu sein.
Eigentlich hatte sie längst damit herausplatzen wollen, aber nun hob Margarete sich ihre Überraschung für einen späteren Zeitpunkt auf. Seit vergangenem Sonntag gehörte sie einer besonderen Gruppe von Menschen an. An diesem Tag hatte sie andachtsvoll eine rote Marke in die gelbe Sparkarte geklebt, damit war der erste Schritt getan. Sie war nun eine von denjenigen, die auf den KdF-Wagen sparten, auf das erste Auto fürs Volk. Zwei Wochen lang hatte man ein Modell des »Volkswagens« auf dem Marktplatz von Stendal besichtigen können, 990 Reichsmark sollte er kosten. Aber wer hatte schon so viel Geld? Doch damit alle ihren Volkswagen bekamen, fasste der Führer einen genialen Plan: Jeder Volksgenosse, der wöchentlich Sparmarken im Wert von fünf Mark kaufte, würde bei Erreichen der Kaufsumme bevorzugt beliefert werden. Margarete hatte sich das Auto mit der geschwungenen Karosserie und den runden Scheinwerferaugen lange angeschaut. Als Otto Werner sie ein paar Tage später endlich einmal zur Kenntnis nahm und für ihre Arbeit lobte, wagte sie den großen Schritt.
Ende des Jahres würden die ersten 3000 Kilometer des Reichsautobahnnetzes fertiggestellt sein. Margarete musste noch fast vier Jahre auf ihr erstes Auto warten, aber sie war fest davon überzeugt, dass der Führer die Autobahnen und das größte Autowerk der Welt auch für sie baute. Für die Freiheit von Menschen wie Margarete Hegewald.
Die Zukunft sah in jeder Hinsicht rosig aus. Stendal verlor zwar das Reiterregiment Nr. 3, was wirtschaftliche Einbußen bedeutete, doch die erste Fallschirmjägertruppe in der deutschen Geschichte, die auf dem Flugplatz Stendal-Borstel Station bezogen hatte, war mehr als nur Ersatz. Hinzu kamen eine Aufklärungsabteilung mit Panzer-Spähwagen und ein Infanterie-Regiment.
Das war gut für Deutschland. Es war gut für Stendal. Und es war gut fürs Geschäft.
Alle Soldaten fotografierten, die meisten mit einer Boxkamera von Agfa, und alle brachten ihre Filme zum Entwickeln zu Photo-Werner. Besonders oft kamen die Fallschirmspringer, die dank »Sprungzulage« über mehr Geld als andere verfügten. Mittlerweile drängten sich auch die anderen Mädchen darum, im Laden bedienen zu dürfen. Es gab niemanden, der von den schneidigen Männern in ihren knapp sitzenden Uniformen nicht beeindruckt war.
Otto Werner behauptete, in Stendal kämen auf jedes Mädchen zwischen 18 und 21 Jahren 5½ Soldaten. Jedenfalls gab es nun nicht mehr nur Hochzeitsbilder, sondern Fotos ganzer Kompanien. Das waren sichere Umsätze, und eigentlich hätte der Chef sich darüber freuen müssen. Aber er pflegte die jungen Männer »dumme Jungs« zu nennen, obwohl sie doch Soldaten waren.
Marianne, die seit einigen Wochen immer öfter von einem gut aussehenden jungen Mann in der Uniform eines SS-Hauptsturmführers abgeholt wurde, weshalb Margarete allein nach Hause gehen musste, hörte solche Bemerkungen gar nicht gern.
»Ich finde, er sollte unsere Männer respektieren«, sagte sie eines Tages streng, während der Mittagspause, die sie wieder einmal im Hof verbrachten.
»Warum hat er was gegen Soldaten?«, fragte Margarete. »Sie dienen dem Vaterland und sie verschaffen Photo-Werner großartige Umsätze.«
»Er ist nicht wehrtauglich«, entgegnete Marianne.
Die sonst so schüchterne Gudrun fuhr ihr über den Mund. »Er ist im Ersten Weltkrieg verletzt worden, deshalb! Er trägt das Eiserne Kreuz!«
»Dann sollte er sich dessen auch würdig erweisen!«
Keines der Mädchen hatte bemerkt, dass Otto Werner in den Hof gekommen war, um etwas in die Mülltonne zu werfen.
»Es ist ein Granatsplitter in der Hüfte, um genau zu sein«, sagte er mit seiner leisen, präzisen Stimme. »Das Eiserne Kreuz kann mich mal.«
»Aber Sie sind doch ein Held«, stotterte Gudrun.
»Was ist heldenhaft daran, in einem stinkenden Schlammloch zu hocken, aus dem du nicht davonlaufen kannst? Übrigens sieht nach drei Tagen Trommelfeuer keine Uniform mehr schick aus.«
»Es tut mir leid.« Man sah Marianne an, dass ihr die Sache peinlich war.
»Macht nichts. So ein Granatsplitter hat auch seine Vorteile. Wenn das Bein wehtut, ändert sich das Wetter. Kinder: Morgen gibt’s hitzefrei!«
»Juhu!«, rief Marianne begeistert.
»In Afrika«, sagte Otto Werner gemütlich und verschwand wieder im Haus.
Alle lachten. »Er ist schon eine Marke. Unser Kugelblitz.« Den Spitznamen hatte ihm Marianne verpasst. Keiner konnte treffender sein.
Margarete hatte nichts gegen Uniformen und Soldaten, es gab sogar zwei Verehrer, die immer wieder nach ihr fragten. Aber sie ließ sich auf keinen ein. Sie wartete auf den Richtigen.
VII
Der Brief war eine Überraschung. Mit dieser Einladung hatte sie nicht gerechnet. »… erlaube ich mir, Dich auch im Namen meiner Eltern zu einer Abendveranstaltung am 27. Januar einzuladen« – das formvollendete Schreiben stammte von Antonia Seliger. Von der hatte sie lange nichts mehr gehört oder gesehen, auch nicht von ihrem Bruder Henri, der sich an der Universität in Breslau sicher lieber aufhielt als in dem zugegeben nicht sehr aufregenden Stendal. Fast war sie ein bisschen enttäuscht, dass Henri damals nicht intensiver um sie geworben hatte. Aber hatte er sich überhaupt für sie interessiert? Vielleicht hatte Waltraud etwas gesehen, das gar nicht existierte?
Seinetwegen jedenfalls hatte sie kein Herzklopfen. Aber aufgeregt war sie schon. Eine Soiree bei den Seligers war noch immer etwas Besonderes, obwohl ihr Ansehen in Stendal gelitten hatte. Das hing mit einer Theateraufführung zusammen, sie wusste nicht genau, worum es dabei gegangen war, aber ihr Vater hatte die Sache einen Skandal genannt und ihr den Umgang mit »diesen Leuten« verboten. Menschen wie die Seligers galten bei ihm als »verkommen« oder »entartet«, das waren die Begriffe, in die er alles fasste, was ihm nicht gefiel. Allein schon der Name! Der sei doch eindeutig jüdisch!
Also würde sie nicht hingehen dürfen. Sie legte den Brief beiseite. Andererseits: Der 27. Januar war ein Freitag, und wenn sie sich richtig erinnerte, war Hugo Hegewald an diesem Abend zu einer Parteiveranstaltung eingeladen, davon redete er seit Tagen, er schien unmäßig stolz darauf zu sein. Sie nahm den Brief wieder auf. Sie würde hingehen, auf jeden Fall – weil es im Leben nicht nur Arbeit geben darf.
Vater war dann auch schuld, dass sie ein wenig zu spät bei Seligers eintraf, sie hatte warten müssen, bis er aus dem Haus war. Sonst war er immer so pünktlich. Warum musste er sich ausgerechnet heute so viel Zeit lassen? Sie war in Windeseile in das dunkelblaue Kleid mit den Biesen geschlüpft, das eigentlich nur für gut war. Man zog sich eben etwas feiner an, wenn man zu Seligers ging.
Allerdings möglichst nicht zu fein. Seligers waren modern, das sah man schon an ihren Möbeln. Geschwungene Formen überall, helle Farben, keine Kaiser-Wilhelm-Schnörkel. Fräulein Stowalter, der Frau mit der Säge, hätte auch dieser Stil nicht gefallen. Er war zu elegant – dekadent geradezu.
Das Hausmädchen nahm ihr den Mantel ab und führte sie in den Salon. Alle hatten bereits auf der Couch und auf den gepolsterten Stühlen Platz genommen, es herrschte eine fast feierliche Stimmung, was nicht zuletzt an den brennenden Kerzen lag, die auf den Tischen und dem Klavier und den Fensterbänken standen. Frau Seliger legte den Finger auf den Mund und deutete auf den Stuhl neben sich. Margarete machte sich ganz schmal und huschte hinüber zu ihr, es war ihr peinlich, zu spät zu kommen. Toni saß bereits am Klavier, neben ihr ein schlanker Mann, der die Versammlung überragte und überstrahlte, obwohl alles an ihm dunkel zu sein schien: das Haar, die Augen. Der Mann war sicherlich schon älter als fünfundzwanzig, er hatte etwas an sich, etwas ganz Besonderes – eine Aura, dachte Margarete.
»Sonate für Klavier zu vier Händen D-Dur, op. 6, von Ludwig van Beethoven«, flüsterte Frau Seliger.
Aber Margarete hörte nicht zu. Sie sah nur noch den Mann mit den schmalen Fingern, wie er sich zur Musik bewegte, biegsam, geschmeidig. Wer war das? Sie hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Fast hätte sie vergessen zu applaudieren, als die beiden fertig waren und der Mann sich leicht verbeugte, Toni an der Hand nahm und mit ihr aufstand. War das – Tonis Bekannter? Sie spürte einen scharfen Stich im Magen.
Mittlerweile waren alle aufgestanden, nur sie saß noch immer wie angenagelt auf ihrem Stuhl. Das Mädchen hielt ihr ein Tablett hin, auf dem langstielige Gläser standen. Sie nahm eines herunter, ohne nachzudenken, trank einen Schluck und spürte, wie ihr heiß wurde. Das musste Sekt sein, den hatte sie bisher nur einmal probiert, bei Tante Mienchens Geburtstag.
Der Klavierspieler war nirgendwo zu sehen. Wer freudestrahlend auf sie zusteuerte, war Henri – in Uniform. Er musste wohl seinen Wehrdienst ableisten, den der Führer wiedereingeführt hatte. Aber er schien sich in der Kluft nicht wohlzufühlen, was Wunder, sie stand ihm nicht sonderlich gut.
»Margarete! Das ist aber eine Freude!«, sagte er und nahm ihren Arm. »Hast du schon etwas gegessen? Nein? Dann lass uns zum Büfett gehen, Mutter hat ihr Bestes gegeben.«
Henri bahnte ihr den Weg durch die Menge, widerstrebend ging sie mit – und mit einem Mal stand er vor ihr. Der Mann mit den dunklen Augen und den schmalen Fingern.
»Alard!«, rief Henri.
Alard. Er hieß also Alard. Sie horchte dem Klang hinterher. Das hatte etwas Edles, Männliches.
»Margarete, darf ich dir meinen Freund Alard von Sedlitz vorstellen?«
Er war adelig! Aber er wirkte doch ganz und gar nicht dekadent oder arrogant? Margarete schüttelte ihr Unbehagen ab. Warum sollte nicht auch ein Adliger ein guter Volksgenosse sein?
»Wir haben uns in Breslau kennengelernt, an der Universität, im Unterschied zu mir hat er sogar ernsthaft studiert.«
Einen Moment lang blickte Margarete in die dunklen, warmen Augen des aufregendsten Mannes, der ihr je begegnet war. Dann beugte sich Alard von Sedlitz über ihre Hand. Wie altmodisch. Und wie magisch.
»Margarete ist mit meiner Schwester befreundet«, plapperte Henri. Sie hörte kaum hin. »Sie macht eine Lehre beim ersten Fotografen der Stadt.«
»Sie interessieren sich für Fotografie, gnädiges Fräulein?«
Margarete wurde ein ganz klein wenig schwindelig. Was für eine Stimme! Nicht so jungenhaft wie die Henris, sondern tief und schwingend. Charaktervoll.
»Nein«, stammelte sie. »Ja, ich meine: ich arbeite in der Buchhaltung, da hat man mit dem Fotografieren wenig zu tun.«
»Verstehe.« Er schien enttäuscht zu sein.
»Aber ich bekomme natürlich viel mit, wenn Otto Werner vom Fotografieren kommt oder ich mit den Mädchen aus dem Labor Mittagspause mache.« Ihre Stimme erstarb, als er sie wieder ansah.
»Erzählen Sie! Das klingt doch spannend!«
»Wir entwickeln alle Filme, die uns die Soldaten bringen. Und der Chef fotografiert Hochzeiten, geheiratet wird ja immer.«
»Ja, das sind die wirklich wichtigen Dinge im Leben!«
Meinte er das ernst? Sein Lächeln machte sie verlegen. Und dann fiel ihr auch noch der dicke Hintern der Apothekersfrau ein, dieses unsittliche Foto, das Marianne herumgezeigt hatte. Hoffentlich errötete sie jetzt nicht auch noch.
»Ist er ein guter Fotograf, der Herr Werner?«
Was war denn das für eine Frage? »Der Beste«, beeilte sie sich zu sagen. Jedenfalls in Stendal.
»Darf ich sie ein wenig entführen?« Alard lachte Henri an, legte Margarete die Hand unter den Ellbogen und führte sie in die hinterste Ecke des Raums, dort, wo ein Sofa stand, das die Frau mit der Säge sofort in Angriff genommen hätte: Es hatte gekrümmte Beine und sah irgendwie kriegsversehrt aus.
Sie setzte sich, wie unter Zwang, er platzierte sich schräg neben sie, legte den Arm auf die Rückenlehne, sie spürte seine Wärme, fühlte sich umarmt. Was passiert hier mit mir?, dachte sie, doch im Grunde ihres Herzens war sie bereit, alles geschehen zu lassen, was es auch war, solange er in ihrer Nähe war. Alard.
»Erzählen Sie, Margarete. Was treiben Sie den ganzen Tag? Was bewegt Sie? Wovon träumen Sie?«
Seine Augen und seine Stimme, aber vor allem diese letzte Frage machten sie sprachlos. Noch nie hatte jemand von ihr wissen wollen, wovon sie träumte.
»Ich habe keine Zeit zum Träumen. Ich arbeite«, erwiderte sie und ärgerte sich zugleich über ihr Ungeschick. Hätte sie ihm nicht etwas Aufregenderes erzählen können? »Ich – ich spare auf den Volkswagen.«
Er hob die Augenbrauen. »Sie fahren Auto?«
»Noch nicht.«
»Aber Sie werden Auto fahren. Sie werden fliegen. Sie werden alles tun, was Sie sich nur wünschen«, sagte er. »Sie werden frei sein. Ich spüre das.«
Margarete erschrak. Wie war das möglich, dass jemand sie und ihre Lebenswünsche erkannte, dem sie nie zuvor begegnet war? Sie versuchte zu lächeln, aber sie fürchtete, dass sie dabei aussah wie ein verstörtes Kaninchen.
Alard lachte. Lachte er sie aus?
»Henri hat mir viel von Ihnen erzählt. Und wenn ich Sie so vor mir sehe – er hat in allem recht gehabt. Sie sehen entzückend aus. Gar nicht wie eine Gretl oder ein Gretchen. Darf ich Sie Margo nennen?«
Margo. Wie das klang. Sie nickte benommen.
»Ich bin Alard. Oder Ali, wenn Sie Spitznamen mögen. Und jetzt, schöne Margo …« Er nahm ihre Hand. Margarete stieg die Hitze ins Gesicht. Bloß nicht erröten. Bloß nicht verlegen werden wie ein Schulmädchen.
»Sagen Sie mir: Ist dieser Otto Werner ein guter Lehrherr? Kann man sich auf ihn verlassen?«
Der Zauber des Moments zerplatzte. Warum wollte er das wissen? Wieso interessierte er sich so für Otto Werner? Horchte er sie etwa aus? Gab es womöglich Zweifel an Otto Werners politischer Zuverlässigkeit?
»Herr Werner ist ein echter Künstler«, antwortete sie steif. »Man darf von ihm nichts erwarten, was den künstlerischen Belangen im Weg stehen könnte.«
Alard legte ihre Hand sacht zurück in ihren Schoß. Margarete wagte nicht, ihn anzusehen. Es war vorbei. Sie hatte etwas Falsches gesagt. Sie hatte alles zerstört. Jemand lachte. Unsicher blickte sie auf. Henri stand vor ihnen, und hinter Henri lauerte Toni.
»Na? Hat er sein diplomatisches Geschick an dir ausprobiert?« Lachte Henri sie etwa aus? »Alard ist im Diplomatischen Dienst, beim Auswärtigen Amt in Berlin. Hat er dir schon erzählt, was er da Aufregendes macht?«
Der Mann neben ihr seufzte tief auf. »Akten bewegen. Den Staub der Jahre einatmen. Darüber gibt es wenig zu erzählen.«
»Komm tanzen, Ali«, rief Toni, die sich neben Henri gedrängt hatte und Margarete einen bitterbösen Blick zuwarf.
»Gute Idee. Und Gretl tanzt mit mir.« Henri reichte ihr die Hand und zog sie hoch. Mit steifen Knien folgte sie ihm auf die Tanzfläche. Was, wenn sie jetzt in Ohnmacht fiele?
Es war warm geworden in Seligers Salon, ihr Kopf fühlte sich an wie bei 39 Grad Fieber, das musste der Alkohol sein. Hermann Seliger hatte eine Schallplatte mit einer Musik aufgelegt, die alle Tänzer um sie herum zu rhythmischen Zuckungen verleitete. So etwas konnte man doch nicht Tanzen nennen!
Henri wirbelte sie über die Tanzfläche. Ich heiße nicht mehr Gretl, dachte sie, obwohl ihr schwindelig war. Ich bin Margo und er ist Alard. Niemand darf ihn »Ali« nennen. Schon gar nicht Toni.
»Nenn mich Margo«, flüsterte sie Henri ins Ohr. »Sonst bin ich dir böse.«
»Was immer du befiehlst«, flüsterte er zurück und legte seine Wange an ihre.
Natürlich würde sie Henri niemals böse sein. Sie musste ihm dankbar sein, auf ewig. Er hatte ihr Alard gebracht.
Am nächsten Tag wollte Mutti haarklein erzählt bekommen, was es zu essen gegeben hatte. Was für eine Frage! Sie konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, etwas gegessen oder getrunken zu haben. Sie erinnerte sich nur an Alard von Sedlitz, an seine dunklen Augen und an seine starke männliche Stimme. An die Wärme seiner Hand, die jedes Fleckchen ihrer Haut noch immer spürte. Und an dieses andere, das ihr vertraut war und doch ein stetes Rätsel blieb: Da war ein Schatten, der ihn begleitete. Eine Spur jener Traurigkeit, die sie viel zu gut kannte, die sie fürchtete und verfluchte und die doch zu ihr gehörte, womöglich für immer.
Konnte das sein? War Alard ein Seelenverwandter?
»Schnittchen mit was drauf«, antwortete sie. »Und ab heute heiße ich Margo.«
VIII
23. Mai 1939
Ich habe in den letzten Wochen so viel verpasst! Eben war noch Winter, jetzt ist schon Frühling, das Fieber ist zwar vorbei, aber ich bin immer noch nicht kräftig genug, um allein in den Park zu gehen.
Ich erinnere mich nur schwach an die Zeit, als ich im Bett lag und nicht bei Sinnen war. Und das ist sicher besser so. Mutti meint, ich hätte entsetzlich gelitten, zwei Wochen hat sie um mich gebangt. Aber bei Mutti ist Bangen der Normalzustand.