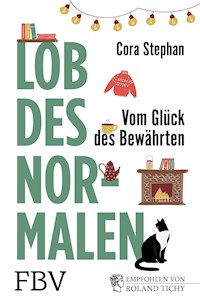9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Jeder Mensch hat eine Mutter. Jana Seliger hatte zwei. Cora Stephan erzählt die Geschichte zweier außergewöhnlicher Frauen und eines geteilten Landes über vier Jahrzehnte. Ein großer Roman über die Suche nach dem Glück in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und die Frage, was man opfern muss, um es zu finden. Leonore Seliger wächst in den 1960er-Jahren in der norddeutschen Provinz auf. Sie ist eine Außenseiterin, unangepasst, rebellisch. Trost findet sie bei Clara, einer Brieffreundin aus der DDR, die sie in einem Pioniercamp der DDR getroffen hat. In einem verrauchten Jugendclub in Osnabrück lernt Leonore die Musik der Beatles kennen, nach dem Abitur in England die freie Liebe. Während sie im Deutschen Herbst in Frankfurt studiert und durch eine verhängnisvolle Affäre ins Visier der Polizei gerät, bereitet sich Clara in Ostberlin auf eine große Aufgabe vor. Im Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit soll sie in den Westen gehen, um dort für die Genossen die Augen aufzuhalten. Kurz bevor sie die DDR verlässt, bekommt sie eine Tochter und ist gezwungen, eine nahezu unmögliche Entscheidung zu treffen. Das Schicksal führt Leonore und Clara wieder zusammen. Die beiden, die unterschiedlicher nicht sein könnten, verbindet ein Geheimnis. Jahrzehnte später kommt eine junge Frau diesem Geheimnis auf die Spur und begibt sich auf eine aufwühlende Reise in die Vergangenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Ähnliche
Cora Stephan
Margos Töchter
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Cora Stephan
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Motto
Teil 1
Jana
Sie liebt dich (yeah, yeah, yeah)
Revolution No. 9
Jana
Eve of Destruction
Jana
Wind of Change
Jana
Teil 2
Clara
Über sieben Brücken musst du gehn
Teil 3
Jana
Dank
Personenverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
Robert Frost
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
Jana
Osterholz, Herbst 2011
Jeder Mensch hat eine Mutter. Jana Seliger hatte zwei. Eine war ihr nah, obwohl sie fern war, von der anderen wusste sie nur, dass sie von zweifelhaftem Charakter sein musste. An die eine dachte sie oft. An Leonore. Die andere hatte sie zu vergessen versucht. Bis heute.
Der Samstag hatte in himmlischer Ruhe begonnen. Max war übers Wochenende in Berlin geblieben, und die Kinder machten mit der Klasse einen Schulausflug. Jana trank in Ruhe Kaffee und genoss die Stille. Nur die Spatzen lärmten draußen in der Kletterhortensie. Sie hatte alle Zeit der Welt. Es gab nichts Dringendes zu erledigen, außer dem, was man so treibt, wenn man mal nicht zur Arbeit muss. Einkaufen. Aufräumen. Durch den Garten schlendern und an den Rosen riechen. Für alles andere beschäftigten sie einen Gärtner, Max hatte keine Zeit für »so was«, und sie erst recht nicht, obwohl sie Spaß daran hätte. Aber es gab ja nicht nur den Beruf, ihr Mann überließ ihr meistens auch die Kinder.
Max war oft in Berlin. Dort saß der wichtigste Kunde ihrer Firma, das Fraunhofer IPK, mit dem hatte Maxdatex einen dicken Fisch an Land gezogen. Maxdatex war für innovative Softwarelösungen bekannt, und Max galt als so unentbehrlich, dass er manchmal auch übers Wochenende blieb, es gab ziemlich oft ein Softwareproblem, das angeblich nur er lösen konnte. Ob das die ganze Wahrheit war? Lieber nicht darüber nachdenken.
Sie stand auf, ging in den Flur und öffnete die Haustür. Die Morgensonne ließ den Steinfußboden tiefrot glänzen, ein kühler Wind wehte weiße Rosenblätter herein. Frieden. Dafür sorgte der Geist des Hauses, und der war ihnen wohlgesonnen. Es war der Geist von Margo und Henri Seliger, der Großeltern.
An ihren ersten Besuch hier in Osterholz erinnerte sich Jana nicht, natürlich nicht, 1979 war sie noch nicht einmal zwei Jahre alt gewesen. Es war wohl auch besser, sich daran nicht zu erinnern.
An spätere Besuche dachte sie gern, sie war oft hier gewesen, bei den Großeltern, im alten Kotten in der Moosbeeke 9, den die beiden vor einem halben Jahrhundert vor dem Verfall gerettet hatten. Und im Garten, Margos Paradies, in dem zu jeder Jahreszeit etwas blühte, von gelbem Winterjasmin und zartem Hamamelis bis zu den späten Rosen.
Von Margo hatte sie die wohlklingenden Namen der Pflanzen gelernt, die deutschen und die botanischen, von Henri Gedichte. Sie war ihm oft gefolgt, wenn er mit der Schaufel über der Schulter durch den Garten ging, ganz so wie das Rotkehlchen, das begriffen hatte, dass Würmer und anderes Getier zutage traten, wann immer er die Schaufel ansetzte. Henri behandelte Jana stets wie eine Erwachsene, und er wusste für jede Gelegenheit ein Gedicht, von Eugen Roth oder Christian Morgenstern oder Theodor Storm. Sicher, Margo war die Strategin, sie plante, wälzte Pflanzenkataloge, orderte Stauden, Sträucher, Bäume. Doch Henri erledigte die Arbeit mit Schaufel, Harke, Rasenmäher, mit immer gleicher Freude und Bereitschaft.
Als Studentin in Berlin hatte sich Jana für eine Großstadtpflanze gehalten und sich nicht vorstellen können, einmal hier auf dem Land zu leben. Dabei war es das beste Geschenk, das die Großeltern ihr und Max machen konnten.
Sie setzte sich auf die Bank neben der Haustür und sog die kühle Morgenluft ein, als draußen eine Wagentür zuschlug. Max! Ihr Herz schlug höher, er war zurück. Nein, war er nicht. Das Auto fuhr bereits wieder weg, und es klang auch nicht nach dem BMW von Max, sondern nach dem VW des Postboten. Sie lehnte sich zurück und schloss die Augen. Es wäre auch zu schön gewesen, ein ganzes Wochenende mit ihrem Mann verbringen zu dürfen.
Nach einer Weile stand sie auf, nahm den Schlüssel vom Schlüsselbrett und ging zum Tor. Ein Brief lag im Kasten, an Jana Seliger, das graue Kuvert sah nach einem Behördenschreiben aus, war sie mal wieder zu schnell gefahren? Sie drehte den Umschlag um. Der Absender überraschte sie. Dass sie einen Brief vom Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen bekam, war ungewohnt, man telefonierte normalerweise miteinander, schließlich arbeiteten sie seit Jahren an einem gemeinsamen Projekt. Und warum war der Brief an sie und nicht an Maxdatex adressiert?
Das Projekt war ihrem Softwareunternehmen Maxdatex, eingetragen auf Jana Seliger und Max Bajohr, damals wie ein Geschenk des Himmels vorgekommen, auch, aber nicht nur aus ökonomischen Gründen: Sie sollten als externe Berater am »e-Puzzler« mitwirken. Das war ein vom Berliner Fraunhofer IPK entwickeltes Computerprogramm, mit dem man die Hinterlassenschaft des MfS aufarbeiten und die Geheimnisse entschlüsseln konnte, die in den Millionen von Schnipseln steckten, in die Stasileute nach dem November 1989 viele der Akten zerrissen hatten, erst mit dem Reißwolf und dann, nachdem einer nach dem anderen heiß gelaufen war, mit der Hand. Der »e-Puzzler« vermochte eingescannte Schnipsel zu erkennen, zu sortieren und zusammenzufügen. Eine phantastische Sache. Ein Abenteuer. Und auch wenn das ein wenig makaber klang: Sie hatten es damals für eine Art Schatzsuche gehalten. Allerdings gab es im Laufe der Zeit mehr Probleme als Erfolge.
Sie riss den Brief auf und zog das graue Behördenpapier heraus, während sie zurück zum Haus ging.
»Bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 7. März 2002«. Das war mehr als neun Jahre her, mit einer Antwort hatte sie längst nicht mehr gerechnet. Jana ließ sich auf die Bank neben der Haustür fallen, plötzlich atemlos. Sie hatte den Antrag auf Einsicht in Unterlagen des MfS, Leonore Seliger betreffend, kurz nach der Unterzeichnung des Vertrags mit dem Fraunhofer IPK gestellt.
Max hatte es stets abgelehnt, bei der Stasiunterlagenbehörde einen Antrag auf Auskunft über seinen Vater Jon Bajohr zu stellen. »Vergangen ist vergangen.« Er arbeitete an dem Projekt, weil es eine Herausforderung war, nicht, weil er wissen wollte, was das Ministerium für Staatssicherheit in seinem Wahn, die eigenen Bürger zu kontrollieren, über sie herausgefunden und gesammelt hatte – und erst recht nicht, was die Stasi über den Gegner im Westen in Erfahrung gebracht hatte. »Was geht es mich an, welche seiner Sekretärinnen mein Vater gevögelt hat?«
Jon Bajohr war kein treuer Ehemann gewesen. Manchmal, wenn sie an allem zweifelte, am Leben, an der Welt, an der Möglichkeit, glücklich zu sein, fragte Jana sich, ob sein Sohn ihm auch darin ähnlich war. Ganz gewiss hatte Max den Unternehmergeist seines Vaters geerbt, Weitblick verbunden mit der Lust am Risiko. Vielleicht auch mit der Lust am Seitensprung?
Sie hatte ihm von ihrem Antrag auf Akteneinsicht nichts erzählt, auch nichts von der Antwort der Behörde, derzufolge es laut Kartei einen Vorgang gab. Jetzt aber hatte man mehr als nur einen Vorgang gefunden, jetzt gab es auch die dazugehörige Akte.
Sie ließ den Brief sinken, lehnte sich zurück und schloss die Augen. Über dem Wäldchen am Horizont kreiste ein Greifvogel und schrie. In der Ferne hörte man die Kirchturmglocken vom Nachbarort. Jana dachte an Leonore Seliger, die eine, die einzige, die wahre Mutter, auch wenn sie nicht die leibliche war.
Sie würde zur Akteneinsicht nach Berlin fahren müssen. Was würde sie dabei erfahren? Etwas, das sie lieber nicht wissen wollte? Oder käme dann endlich heraus, warum Leonore gestorben war, gerade mal zweiundvierzig Jahre alt?
Ein Tag im Mai. Jana ist dreizehn, als sie zu den Großeltern fahren, Leonore und sie, ohne Alexander, die Eltern haben sich furchtbar gestritten. Alexander hat sich in eine andere Frau verliebt, und die ist schwanger geworden. Jana hat noch den Schrei ihrer Mutter in den Ohren: »Ihr hast du ein Kind gemacht! Obwohl du weißt, dass ich keine mehr bekommen kann!« Deshalb also bin ich ein Einzelkind geblieben, dachte sie damals.
Sie stand auf, holte ihre Handtasche mit dem Autoschlüssel und schloss die Haustür hinter sich ab. Ein leichter Wind spielte in den Zweigen der Buchen, es roch nach Herbst, nicht nach Feuchtigkeit und verrottendem Laub, sondern nach reifen Äpfeln und nach Rosen, die ein letztes Mal in diesem Jahr in unfassbarer Fülle blühten.
Sie wollte nicht mit leeren Händen kommen, griff nach der Gartenschere, die sie gestern auf der Bank liegengelassen hatte, und ging über die Wiese hinauf zum Rosenspalier. Unter dem Baum lagen die letzten Äpfel, kleine, knorzige Boskop, die der Wind über Nacht von den Zweigen geschüttelt hatte. Zwei hob sie auf. Von der weißen Kletterrose am Rosenspalier schnitt sie drei Zweige ab.
Dann ging sie zurück zum Haus, legte die Schere wieder auf die Bank, öffnete das Gartentor, ging zurück zur Garage, stieg in ihren Kombi und fuhr auf die Straße hinaus, Richtung Ostercappeln. Hier musste auch Leonore entlanggefahren sein, an diesem Tag im Mai 1991. Sie hatte in Osnabrück etwas erledigen wollen. Worum es sich handelte, hatte sie nicht verraten. Kurz vor Ostercappeln musste sie auf die B 51 abgebogen sein, Richtung Osnabrück. Sie hatte noch gut sieben Kilometer zu leben. Auf der Höhe von Belm überquerte ihr Auto die Mittellinie und fuhr frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Dessen Fahrer überlebte. Leonore nicht. Sie war nicht angeschnallt gewesen.
Jana war nie darüber hinweggekommen, dass ihre Mutter sie aus freiem Willen alleingelassen hatte. Aber vielleicht war es kein freier Wille gewesen?
Die Äpfel und die Rosen auf dem Beifahrersitz verströmten einen Duft, wie ihn nur der Herbst kannte. So riecht Abschied, dachte Jana. Wie in Trance fuhr sie die vertraute Strecke entlang, nach Ostercappeln hinein, zur Kirche, und parkte am Straßenrand. Sie nahm die Äpfel und die Rosenzweige und stieg aus. Auf dem Friedhof war sie zum ersten Mal gewesen, als Leonore begraben wurde. Dabei musste ihr Max begegnet sein, mit dem sie nun schon seit über elf Jahren verheiratet war, aber sie erinnerte sich nicht an seine Anwesenheit. Sie bekam auch sonst nicht viel mit von Leonores Beerdigung, sie weinte die ganze Zeit. Nur, dass der Himmel bedeckt war, es aber nicht regnete, wusste sie noch.
Früher war Ostercappeln ein bescheidener Flecken ohne größere Attraktionen gewesen, heute brüstete sich der Ort mit seiner Nähe zum Schauplatz der Varusschlacht. Seit 2002 gab es im gut fünfzehn Kilometer entfernten Kalkriese ein Museum, sie waren schon mehrmals mit den Zwillingen dort gewesen. Jon und Henri waren, typisch Jungs, von Kampf und Krieg fasziniert und trotz elterlicher Einwände und Richtigstellungen fanatisch auf der Seite der Germanen. Zehnjährigen beizubringen, dass es in der Geschichte mehr Grau als Schwarz oder Weiß gibt, war eine Herausforderung.
Sie folgte dem Mittelweg auf knirschendem Kies, frisch geharkt. Manche Gräber waren bereits winterfest gemacht, viele mit Heide bepflanzt worden, einige mit Tannenzweigen abgedeckt. Hier und da blühte noch eine Rose.
Sie hatte es damals nicht geglaubt, und sie glaubte auch heute nicht, dass Leonore Selbstmord begangen hatte, obwohl alle Anzeichen dafür sprachen. Sie hätte mich niemals verlassen, dachte Jana.
Beinahe wäre sie am Grab vorbeigelaufen. Die Rose, die sie vor Jahren gepflanzt hatte, war eingegangen, sie hatte wohl den Schatten nicht vertragen, den der benachbarte Nadelbaum warf. Nur das weiße Fingerkraut hatte überlebt, das Grab war mittlerweile davon überwuchert. Sie musste die Grabstelle neu bepflanzen, sie war viel zu lange nicht mehr hier gewesen.
Die Herbstsonne verlieh dem Stein aus rosenfarbenem Granit warmen Glanz. »Leonore Seliger, 8. Februar 1949 – 13. Mai 1991. Geliebte Tochter. Geliebte Mutter. Es trauern: Henri, Margo und Jana Seliger.«
Jana legte Äpfel und Rosen behutsam vor den Stein. »Du fehlst mir, Mutti.«
Margo hatte Leonores Mädchennamen eingravieren lassen, obwohl sie noch mit Alexander Seidensticker verheiratet gewesen war. Sie gab Leonores Ehemann die Schuld am Tod seiner Frau. Das taten alle. Alle glaubten, Leonore habe Selbstmord begangen, weil er sie verlassen wollte. Dieser Gedanke trieb Jana damals zur Verzweiflung: Wie konnte sie mich nur alleinlassen? War ihr Alexander so viel wichtiger als ich? Obwohl er doch ihr Vater war, fand sie es richtig, dass sein Name ausgelöscht wurde.
Damals wusste sie noch nicht, dass Leonore nicht ihre leibliche Mutter war. Ihre biologische Mutter hatte sie im Alter von nur anderthalb Jahren bei Margo und Henri in Osterholz zurückgelassen und war ohne ein Wort verschwunden. Alexander und Leonore hatten sie adoptiert. Aber was änderte das schon? Leo war die einzige Mutter, die sie kennengelernt hatte, und sie vermisste sie noch immer.
Auf dem Rückweg fuhr sie viel zu langsam, das Auto hinter ihr bohrte sich fast in ihren Kofferraum. Sie sah im Rückspiegel, dass der Fahrer ungeduldig mit den Armen fuchtelte. Er hatte ja recht, man sollte beim Autofahren nicht grübeln, aber sie wollte nicht schneller fahren, sie musste sich fassen. In einer Hofeinfahrt hielt sie an, um den Mann vorbeizulassen. Doch worüber dachte sie eigentlich noch nach? Sie würde nach Berlin fahren müssen, so bald wie möglich.
Langsam fuhr sie wieder an. Es war Samstag, es hatte keinen Sinn, bei der Stasiunterlagenbehörde anzurufen, um einen Termin zu vereinbaren. Sie musste mit jemandem reden. Sie brauchte Max.
Sie war viel zu nervös, um das Auto in die Garage zu fahren, und ließ es im Hof stehen, ging ins Haus, holte das Telefon und setzte sich auf die Bank vor der Haustür.
Es dauerte, bis er ihren Anruf annahm. »Hallo, was gibt’s?« So kühl begrüßte er sie normalerweise nicht, er war also nicht allein. Er amüsiert sich, dachte Jana und spürte, wie das Misstrauen wieder in ihr hochstieg. Sie hatte schon lange den Verdacht, dass nicht die Arbeit allein der Grund dafür war, dass er so oft auch am Wochenende in Berlin blieb.
»Du musst nach Hause kommen.« Sie klang ungeduldig, das war ungeschickt.
»Ich habe hier noch so viel zu tun, das weißt du doch.« Er versuchte, nicht allzu genervt zu klingen.
»Es tut mir leid, Max, aber ich brauche dich.« Jana legte ein wenig mädchenhafte Hilflosigkeit in ihre Stimme, vielleicht half das ja. Jetzt hörte sie ihn nur noch gedämpft, er schien die Hand aufs Telefon gelegt zu haben, sagte irgendetwas zu irgendwem.
»So. Ich habe mich mal in eine stille Ecke zurückgezogen. Jetzt erzähl. Ist was mit den Kindern? Ist alles in Ordnung mit dir?«
Das klang schon besser. So hörte sich der liebevolle Mann an, mit dem sie verheiratet war und der versprochen hatte, dass er sie immer beschützen würde.
»Ich habe Post von der Stasiunterlagenbehörde bekommen. Sie haben was über Leonore gefunden. Ich muss nach Berlin.«
Er schwieg. Warum sagt er nichts, dachte sie. »Verstehst du? Es gibt einen Vorgang, und sie haben jetzt auch die Akte dazu.«
»Ach, Jana.« Ein Seufzer, der erkennen ließ, dass er die Nachricht keineswegs so wichtig nahm wie sie. »Lass die Vergangenheit ruhen. Wenn es nicht unser Leben finanzieren würde, hätte ich unsere Firma längst aus dem Projekt zurückgezogen. Was hilft es den Menschen, wenn sie erfahren, dass nicht nur der Staat ihr Feind war, sondern auch ihr Nachbar, ihr Lebensgefährte, ihre Eltern, ihre Kinder?«
»Du verstehst nicht.« Sie suchte nach den richtigen Worten. »Es könnte etwas in der Akte stehen, das ihren Tod erklärt. Ich muss das wissen.«
»Liebling, ich weiß, dass du ihren Tod nie verkraftet hast. Aber die Wahrheit ist, dass sie nicht angeschnallt war und das Auto auf die Gegenseite gesteuert hat.«
»Aber warum? Warum sollte sie das tun? Nur wegen Alexander?«
»Ist das so unvorstellbar?«
Ja. Nein. Max verstand sie nicht.
»Jana. Liebling.«
Komm nach Hause, dachte sie und brach das Gespräch ab.
Die Ankunft der Zwillinge lenkte sie ab. Die Jungs waren ausgehungert, gaben sich aber mit Spaghetti und Tomatensauce zufrieden und zogen dann mit den Fahrrädern ab zu ihren Freunden im Nachbardorf, was ihr nur recht war. So konnte sie in Ruhe eine Zugverbindung raussuchen, ein Zimmer in einer Pension buchen und den Koffer packen. Aus irgendeinem Impuls, über den sie nicht nachdachte, stieg sie danach die Treppe hinauf zum Speicher. Er stand schon seit Jahrzehnten dort, unverrückbar: der dunkelrot lackierte Kleiderschrank, in dem im Sommer die Wintersachen und im Winter die Sommersachen untergebracht waren. In der hintersten Ecke des Schranks hing das, was Max »Pietät« nannte: zwei von Margos Abendkleidern, die sie zum Juristenball oder zu Betriebsfesten getragen hatte. Ihre räudigen Pelzjacken, aus Ozelot und Luchs, die mittlerweile unters Artenschutzgesetz fielen, hatten sie damals entsorgt, als Max und sie ins Haus gezogen waren. Sie griff hinein in den Schrank, schob die beiden Kleider zur Seite, bis ihre Hand zartes Gewebe ertastete. Vorsichtig zog sie das Kleid heraus, es war mürbe geworden in den vergangenen zweiundvierzig Jahren. Das lange, fließende indische Hippiegewand hatte Leonore während ihrer Zeit in London getragen, 1969, in der Hochzeit von Swinging London, sie hatte so oft davon geschwärmt. Jana legte ihr Gesicht in den dünnen Stoff und atmete tief ein. Natürlich roch das Kleid nicht mehr nach Patchouli und Räucherstäbchen und auch nicht nach der Leonore, die sie kannte, und doch fühlte sie sich ihr nah.
Schon am frühen Abend kam Max nach Hause, er musste kurz nach ihrem Gespräch aufgebrochen sein. Jana war so froh darüber, dass sie zu schmollen vergaß. Hauptsache, er war da und hörte ihr zu und stellte die richtigen Fragen.
Jon und Henri waren schon oben in ihrem Zimmer, wo sie irgendwelche geheimnisvollen Dinge trieben, Jana saß auf dem Sofa im Wohnzimmer, die Beine angezogen, in eine Decke gekuschelt, und Max hantierte in der Küche, sie hörte die Kühlschranktür und das Geräusch, mit dem ein Korken aus der Flasche ploppte. Er kam mit zwei Gläsern Wein zurück. Sie war unendlich dankbar für seine Fürsorge und ein bisschen Alkohol. Als sie anstießen, blickte er ihr mit so viel Wärme in die Augen, dass sie sich für ihr Misstrauen schämte.
»Kann es sein, dass es dir nicht nur um Leonore geht, sondern dass du auch etwas über deine leibliche Mutter erfahren willst?«, fragte er nach einer Weile.
Sie blickte in ihr Glas. Das war nicht die richtige Frage. Sie wollte nichts über ihre biologische Mutter wissen, das war die falsche Mutter. Sie schüttelte den Kopf.
Er legte seine Hand auf ihr Knie. »Dann solltest du die Akte zulassen. Du wirst womöglich nur Dinge erfahren, die wehtun.«
»Ich bin kein Feigling.« Aber das stimmte nicht. Sie war den Tränen nah.
»Lass es. Es tut nicht gut, in der Vergangenheit zu wühlen. Bleib in der Gegenwart und denk an die Zukunft unserer Kinder.«
Das beruhigte sie nicht, im Gegenteil, seine Gelassenheit machte sie wütend. »Als ob es für unsere Kinder nicht wichtig wäre, zu wissen, woher sie kommen. Auch wenn es vielleicht nicht angenehm ist, zu erfahren, was ihre Vorfahren so alles getrieben haben.«
»Zum Beispiel?« Er hob die Augenbrauen.
Das machte sie noch wütender. Ironie konnte sie gerade überhaupt nicht vertragen. »Etwa, dass ihr Großvater väterlicherseits ein notorischer Fremdgänger war und dass sich das womöglich vererbt.«
»Jana! Was ist denn das für ein Unsinn? Wie kommst du denn auf so was?« Max wollte sie in den Arm nehmen. Aber sie wehrte ihn ab.
»Menschen wollen wissen, von wem sie abstammen, ob von Verbrechern, von Irren. Oder von Heiligen.«
»Du stammst von einer Frau ab, die dich zurückgelassen hat, als du ein kleines Mädchen warst. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein Verbrechen, sie wusste dich ja in guten Händen, aber musst du wirklich noch mehr über so jemanden wissen?«
Leonore hat mich auch verlassen, dachte sie. »Und was ist mit einer, die ihr Kind verlässt, weil ihr offenbar nur ihr Mann etwas bedeutet?«
»Das weiß ich nicht, aber du bist nun mal nicht Leonores Kind, Jana«, sagte er leise.
Sie verstummte. Das war der Pfeil, der sie ins Herz traf. Wie konnte er nur so grausam sein.
Grausam?, fragte eine leise Stimme in ihrem Kopf. Nur, weil es die Wahrheit ist?
»Bin ich jemand, den man zurücklässt?«, flüsterte sie. Den man verlässt, Max?
Er nahm ihre Hand. »Ich will nicht, dass du dich quälst. Ich will nicht, dass du etwas erfährst, das dir wehtut. Was, wenn bei Leonores Tod die Stasi ihre Finger im Spiel hatte?«
Sie starrte ihn an. Er wusste also, was sie insgeheim befürchtete.
»Was, wenn deine leibliche Mutter dahintersteckt? Möchtest du das wirklich wissen? Und möchtest du, dass deine Söhne, die auch meine Söhne sind, das erfahren?«
Das nahm ihr den Wind aus den Segeln.
»Und noch eins. Willst du wirklich wissen, wer dein Vater ist? Denk nach. Was, wenn es einer von der Stasi war?«
Sie sah ihn an. Er war grausam. Doch, er war grausam. Sie versuchte, ihm ihre Hand zu entziehen, aber er hielt sie fest.
»Jana, Liebling. Lass die Vergangenheit ruhen. Du wirst in drei Wochen vierunddreißig, und ich möchte, dass wir etwas Schönes unternehmen, nur wir beide, ohne die Zwillinge.«
Das war ein Friedensangebot, natürlich, aber es kam zu früh. »Bevor ich über so etwas nachdenke, will ich nach Berlin. Ich werde am Montag Akteneinsicht beantragen. Dann wissen wir mehr.«
Sie liebt dich (yeah, yeah, yeah)
I
Osnabrück, Sommer 1964
Leonore blickte auf das Schwarzweißfoto, das ihre Mutter ihr lächelnd über den Tisch geschoben hatte. Wann hatte das begonnen? Wann war aus dem fröhlichen blonden Kind, das sie einmal gewesen sein musste, dieses zusammengekrümmte Wesen geworden, mit stumpfen Augen, Pisspotthaarschnitt und in Strickstrumpfhosen?
Ihre Mutter war ausnahmsweise einmal nicht bei der Arbeit, in »der Firma«, von der sie sprach, als ob sie ihr gehörte, dabei war es der Betrieb von Jon Bajohr. Margo Seliger war unendlich stolz auf den Laden, sie hatte ihn ja mit aufgebaut, wie sie gern betonte: Nach dem Krieg hatte Bajohr Radios verkauft, aber erfolgreich wurde er erst mit Fotoapparaten und allem, was dazugehörte. Das war Margos Idee gewesen – auch die Sache mit der Datenverarbeitung ein paar Jahre später war auf ihrem Mist gewachsen. Ein Geschäft mit Zukunft. Worum genau es da ging, verstand Leonore nicht. Es interessierte sie auch nicht.
Sie fühlte sich gestört, wenn ihre Mutter zu Hause war, sie wusste sie lieber weit weg. Noch schlimmer war, wenn sie ihr helfen sollte, bei was auch immer. Und jetzt saßen sie bei geöffnetem Fenster am Esstisch im Wohnzimmer, während Margo Fotos sortierte. Weil der Umzug anstand, hatte sie sich frei genommen, um »Ordnung in die Dinge« zu bringen, wie sie es nannte. Sie hatte zwei große Margarinekartons mit Fotoabzügen auf den Esstisch gestellt und wühlte darin herum. Leonore ekelte sich vor dem Muff von Staub und Asche, der ihr aus den Kartons entgegenströmte.
Die Kartons mussten schon lange unberührt unter dem Sofa gestanden haben, denn mit ihnen war ein winzig kleiner Schulranzen zum Vorschein gekommen. Der hatte zu Leonores Käthe-Kruse-Puppe gehört, Susi, ein Weihnachtsgeschenk, über das sie sich unter den erwartungsvollen Blicken der Eltern ganz besonders hatte freuen sollen, die Puppe sei »nicht gerade billig« gewesen. Sie hatte Susis weichen Stoffkörper bei einer missglückten Blinddarmoperation ziemlich lädiert, was ihre Mutter mit einem vorwurfsvollen »Man kann dir aber auch gar nichts in die Hand geben« quittierte. Leonore erinnerte sich ein wenig beschämt daran, was sie für ein Theater gemacht hatte, als der kleine Ranzen damals verschwunden war, zumal er einen Schokokeks enthielt. Sie hatte nachgeschaut: Der Schokokeks steckte noch im Ranzen, zerbröckelt und unappetitlich.
Margo Seliger fotografierte schon immer ohne Rücksicht auf ihre Opfer. Sie verdanke ihre Karriere dem Fotoapparat, pflegte sie feierlich zu sagen. Aber deshalb musste man doch nicht alles erlegen, was man vor die Linse kriegt? Leonore hasste es, fotografiert zu werden. Aber geradezu inbrünstig hasste sie dieses Foto, das vor ihr auf dem Tisch lag, je länger sie es betrachtete. Es musste kurz nach dem Umzug nach Osnabrück entstanden sein, aufgenommen auf dem jämmerlichen Spielplatz gegenüber, der außer einem Sandkasten und einem quietschenden Karussell nichts zu bieten hatte. Das Karussell durfte man nicht benutzen, weil sein Quietschen die Nachbarn störte. Warum störten sich die Nachbarn eigentlich nicht am durchdringenden Jammerlied der Kreissäge aus der Schreinerei? Darüber beklagte sich niemand, auch nicht über die Schreie der Schweine aus der Metzgerei. Jedenfalls wirkte das Kind auf dem Bild so jämmerlich wie der Spielplatz: trotzig-traurige Augen und schlaff herabhängende Arme, die aus der Winterjacke hervorlugten, aus der es offenbar längst herausgewachsen war.
Das Karussell stand noch heute auf dem Platz neben dem Sandkasten, verbogen und verrostet, es quietschte schon lange nicht mehr, kein Kind traute sich auf das kaputte Ding, nur manchmal saßen abends die Halbstarken darauf, tranken Bier und rauchten und lachten ihr heiseres Jungslachen.
Ein warmer Wind trug den Duft von trockenem Laub und den Geruch von frischen Sägespänen ins Wohnzimmer. Leonore legte das Bild zur Seite. Irgendetwas musste geschehen sein. Irgendetwas oder irgendwer hatte dem Kind, das sie einmal gewesen war, das Leuchten genommen.
Mutter sah auf. »Erinnerst du dich an die Rubuschs? Zwei Etagen über uns?«
Natürlich. Die hatten schon vor Jahren ein besseres Zuhause gefunden.
»Zu denen bist du immer gelaufen, wenn du Angst hattest, allein zu sein.« Mutter lächelte, als ob sie das völlig unverständlich fände.
»Wenn ihr im Kino wart, ohne mir etwas zu sagen.« Das war ihr so rausgerutscht, peinlich, es klang weinerlich.
»Wir dachten, du schläfst, Leonore. Und wir wollten schließlich auch mal ein bisschen Spaß haben.«
Verstehe. Ich war die Spaßverderberin. Leonore schob das Foto über den Tisch zurück zu ihrer Mutter. »Das ist ein schreckliches Bild.«
Die nahm es auf und betrachtete es. »Ja, da siehst du wirklich aus wie das wandelnde Elend. Das muss im Frühjahr nach diesem eisig kalten Winter gewesen sein, Henri hat sich damals auf dem Weg ins Gericht Frostbeulen geholt. Du hattest die Lungenentzündung wohl noch nicht lange überstanden, und das sieht man dir an. Gut, dass du bald nicht mehr in diesem feuchten Loch schlafen musst.«
Im sogenannten Kinderzimmer war gerade mal Platz für ein Bett und eine Kommode. Ganze zehn Jahre hatte sie in diesem dunklen und ungeheizten Kämmerchen geschlafen, das eigentlich kein richtiges Zimmer, sondern lediglich der Unterbau für die Terrasse war, auf der sich die Vermieterin im Sommer sonnte. Eine dürre Alte mit schriller Stimme. Leonore schüttelte sich bei der Vorstellung, wie sie ihr nacktes Gestell von der Sonne gerben ließ. Nach unten drang die Sonne selten, das verhinderte der Pflaumenbaum vor dem Fenster. Sie hatte unter stets klammen Federbetten gelegen, im Winter wenigstens mit Wärmflasche. Nach der Lungenentzündung. Den Eltern war das Loch nicht zuzumuten. Dem Kind schon.
An die Krankheit erinnerte sie sich nicht, nur an den glänzenden Tisch, auf den sie sich hatte legen müssen, und an die eiskalte Platte, die sich über sie senkte, fürs Röntgenbild, wogegen sie sich brüllend wehrte.
Vielleicht hatte es damit angefangen? Vielleicht verliert man so das Vertrauen ins Leben und die Menschheit?
Über der Schale mit den Äpfeln schnarrte ein blau glänzender Brummer. Leonore schaute gebannt zu. Das Vieh schien nach faulen Stellen zu suchen. Seltsam, dass Mutter nichts merkte. Sie reagierte auf Fliegen sonst fast so hysterisch wie auf Bienen und Wespen.
Leonore blickte auf den gesenkten Kopf ihrer Mutter. Sie musste zum Friseur, am Ansatz wurde das Haar mausgrau, Margo achtete doch sonst immer auf ihr Äußeres. »In meiner beruflichen Position muss man gepflegt aussehen.« Deshalb war sie normalerweise einmal die Woche beim Friseur und feilte sich jeden Abend die Nägel. Wofür auch immer das wichtig war, wenn man die Finanzchefin der Firma war, die seit ein paar Monaten Maxdatex hieß. Vielleicht, weil man in einer solchen Position ab und an die Krallen zeigen muss? Sie musste grinsen bei der Vorstellung, wie ihre Mutter dem Direktor der Hausbank zeigte, was eine Harke ist.
»Schau mal.« Ihre Mutter schob ein anderes Foto über den Tisch. »Da siehst du auch nicht wirklich fröhlich aus.«
Leonore nahm das Bild auf. Sie hatte recht, zum Lachen war das nicht. Man sah ein bleiches Gesicht mit spitzer Nase, ein strahlend weißes Bett, und unter der Bettdecke ragte ein Gipsbein hervor. Ihr rechtes Bein war bis zur Hüfte eingegipst, dabei hatte es nur den Knöchel erwischt, aber es sei ein komplizierter Splitterbruch, hatten sie im Krankenhaus gesagt. Ja, das war wirklich ein Grund gewesen, an der Welt zu verzweifeln.
Wenn Uschis Bruder nicht gewesen wäre! Der schleppte regelmäßig Bücher aus der Leihbibliothek an, lesen war das Einzige, was das Leben ertragen half. Uschis Bruder. Ausgerechnet. Dabei war doch auch Uschi unter den Verrätern gewesen. Aber vielleicht kam er ja deshalb? Um etwas wiedergutzumachen? Obwohl er doch gar nichts dafür konnte?
Die ganze Clique war wie immer nach der Schule losgezogen, zum Neustädter Platz, auf dem es eine große Wippe gab, ein schwerer Holzbalken, auf dem zehn Kinder sitzen konnten, auf jeder Seite fünf. Uschi war dabei, klein, dunkel und immer am Lachen, und Inge mit den langen roten Zöpfen. An die anderen erinnerte sich Leonore nicht. Es ging hoch und runter, hoch und runter. Und mit einem Mal sprangen alle ab, die vier vor ihr und die fünf auf der anderen Seite.
Nur ich nicht, dachte Leonore. Sie hatte nicht aufgepasst, nicht mitgekriegt, dass die anderen sich abgesprochen hatten. Oder hatten sie es darauf abgesehen? Dass die blöde Ziege mit der Pisspottfrisur und den Strickstrümpfen wieder mal nichts kapierte?
Die schwere Wippe sauste hinab, sie saß noch drauf, den rechten Fuß nach innen gedreht. Den traf der Balken mit voller Wucht. Komplizierter Splitterbruch, genau. Sie hatte vor Schmerz geschrien wie am Spieß, aber die anderen waren in Windeseile abgehauen, ohne sich um sie zu kümmern.
»Ich verstehe noch immer nicht, wie das passieren konnte.« Mutter legte das Foto auf eines von vier Häufchen, sie sah nicht auf, aber Leonore glaubte, einen leisen Vorwurf zu hören. »Warum tust du mir das an?«, hatte ihre aus dem Büro herbeigeeilte Mutter damals ausgerufen. Wo sie doch stets so furchtbar viel um die Ohren hatte!
Schreiend hatte Leo neben der Wippe gelegen, bis sich ein junger Kerl ihrer erbarmt, sie auf die Arme genommen und nach Hause getragen hatte. Sie wusste noch heute, was sie unter Tränen gestammelt hatte: »Mein Bein, mein armes Bein!« Exakt das, was das böse Mädchen in dem Kinderbuch rief, als es seine gerechte Strafe bekam! Lesen bildet, dachte Leonore. Eigene Worte hatte sie offenbar nicht gehabt. Und wofür war sie eigentlich bestraft worden?
»Sie sind abgesprungen. Die anderen.«
Jetzt sah Mutter auf. »Ohne dir etwas zu sagen? Aber das macht man doch nicht!«
Wie so vieles andere auch, dachte Leonore. Aber so ist wohl das Leben.
Nach sechs Wochen im Krankenhaus, wo sie der Liebling aller alten Tanten gewesen war, musste sie mühsam wieder gehen lernen. Wenn sie müde war, zog sie das Bein noch heute ein wenig nach. Ihrer Clique ging sie danach aus dem Weg. Es gab ja Bücher.
Ihre Mutter war erfreulicherweise zu selten zu Hause, um sie mit Sprüchen wie »Nun geh doch mal an die frische Luft!« oder »Willst du ein Bücherwurm werden?« oder »Du verdirbst dir noch die Augen!« zu nerven. Vater hingegen war heilfroh, wenn er sich nicht um seine Tochter kümmern musste. Er kochte das Mittagessen, stärkte sich dabei mit diversen Schnäpsen, hielt nach dem Essen sein Schläfchen und zog sich nachmittags zum »Aktenstudium« ins Herrenzimmer zurück. Als Richter durfte er zu Hause arbeiten. Leonore erinnerte sich nicht daran, jemals eine dieser »Akten« gesehen zu haben.
Jetzt wehte ein anderer Duft durchs Fenster hinein, es roch nach kalter Asche. Jemand war am Mülleimer, entleerte wahrscheinlich den Aschekasten. Die Seligers hatten schon lange keinen Kohleofen mehr, die beiden Öfen im Wohnzimmer und im Esszimmer wurden mit Öl betrieben, was praktisch war, denn das gab weniger Staub und Ruß, und man musste keine Asche zum Mülleimer bringen. Dafür roch es nach dem Heizöl, das Vater täglich mit einer Kanne aus dem Tank im Keller holte, wobei immer was danebenging. Leonore hasste den Geruch – und ihre Mutter hasste es, wenn er kleckerte und hinterher nicht aufwischte.
Der Hinterhof mit den Mülleimern lag auf der Schattenseite des Hauses, links und rechts von Backsteinmauern begrenzt, auf der einen Seite lag die Schreinerei, auf der anderen die Metzgerei. Hier wuchs nichts außer einem Haselnussstrauch und dem Pflaumenbaum, ansonsten gab es nur einen schon lange nicht mehr benutzten Sandkasten und eine Teppichstange über einem stoppeligen Rasenstück.
Dort hatte sie im Frühjahr gestanden und eine Reval geraucht, als ihre Mutter aufgekreuzt war, die seit Wochen zum wiederholten Mal versuchte, sich das Rauchen abzugewöhnen. Leonore hatte ihr stumm die Schachtel hinübergereicht, und sie hatten gemeinsam geraucht, schweigend. Dasselbe am nächsten Tag und am übernächsten. Plötzlich herrschte verschwörerischer Frieden zwischen ihnen, das hatte es seit Monaten nicht gegeben, was ihre Mutter darauf schob, dass ihre Tochter »in die schwierigen Jahre« gekommen sei. An ihren eigenen Anteil an der schlechten Stimmung zu Hause dachte sie natürlich nicht, das tat sie nie. Jedenfalls hielt das bisschen Frieden nicht lange.
Ja, es hatte seine Vorteile, Osnabrück und die Wiesenbachstraße zu verlassen. Sie würde nicht mehr »eben mal schnell« zu Wucherpfennig in der Kurzen Straße hinüberlaufen müssen, weil keine Butter mehr im Haus war oder Eier benötigt wurden. Oder mit der Alukanne zu Hermann Obrock, dem Milchmann, wobei sie das früher ganz gern getan hatte. Sie hatte sich von Uschis Bruder abgeguckt, wie man die Kanne so schwenkte, dass sie sich überschlug, und die Milch trotzdem in der Kanne blieb. Nur einmal hatte sie nicht stark genug ausgeholt und einen ganzen Liter ins Gesicht gekriegt. Sie hätte beim Gedanken daran beinahe laut aufgelacht, aber Mutter missdeutete ihr Schnauben.
»Nicht traurig sein. Ich weiß ja, du wirst deine Freunde vermissen.«
Leonore schüttelte den Kopf.
»Das Kino. Das Eis bei Toscanini. Den Kaffee beim Eduscho, wenn du wieder mal die Schule geschwänzt hast.«
Mutter mit einem Lächeln zwischen Vorwurf und Verzeihen. Das konnte sie gut. Und wahrscheinlich kommt sie gleich wieder mit dem britischen Soldaten und dem Motorrad und dem Unfall, dachte Leonore, dabei war kaum was passiert. Nur ein gebrochenes Schlüsselbein.
»Und erst die Gitarrenstunden!«
Machte sie sich lustig? Leonore hatte Cello lernen sollen, wie Vater, und hatte die Gitarrenstunden heimlich genommen. Wieder schüttelte sie den Kopf.
»Deine Freunde können uns doch mal besuchen kommen.«
Aufs Land, zu den stinkenden Schweinen? Mutter kapierte wirklich gar nichts.
»Zu den Kätzchen!«
Ach ja, die Kätzchen. Auch so ein Drama. Eine Katze hatte ihre Kinder auf dem Heuboden des Kottens bekommen, dieser Bruchbude auf dem Land, an der die Eltern nun schon seit zwei Jahren herumbastelten und die ihre neue Heimat werden sollte. Das Kleinste der drei Kätzchen war eines Tages in die Jauchegrube am Haus gefallen, und obwohl Leonore es herausgeholt und gewaschen und trockengerieben hatte, war es in der Nacht gestorben. Nichts blieb. Alles ging verloren.
Leonore stand auf. »Ich packe die Bücher ein«, sagte sie.
»Die Bücher. Ja, natürlich, das ist das Wichtigste«, murmelte ihre Mutter und widmete sich wieder den Fotos. Das kleinere Häufchen würde sie ins Album kleben. Wobei nicht mehr geklebt wurde, man steckte die Bilder heute in durchsichtige Fotoecken, Mutter maß den Abstand mit dem Lineal aus. So war sie, Margo Seliger, erfolgreiche Geschäftsfrau. Immer genau. Immer präzise. Immer ordentlich.
Die Ehebrecherin.
Leonore stieg die Hitze ins Gesicht, wenn sie daran dachte, wie sie ihre Mutter erwischt hatte. Sie war bei Markus vorbeigegangen, warum, wusste sie nicht mehr. Um die Noten abzuholen für irgendein Lied, das sie im Singekreis einstudieren wollten? Vielleicht. Egal. Das war nicht mehr wichtig. Auch Markus war nicht mehr wichtig, obwohl sie ihn gemocht hatte. Ja, vielleicht war sie sogar ein bisschen in ihn verliebt gewesen. Markus Vormbaum war Jugendpfarrer in der evangelischen Johanniskirche, alle Mädchen schwärmten für ihn. Aber ihr hatte er zugehört, ihr, nicht den anderen, er hatte wirklich und wahrhaftig zugehört. Seine sanften braunen Augen schienen auf den Grund ihrer Seele zu schauen. Sie hatte ihm vertraut.
Das war vorbei. Nur eines verdankte sie ihm: ein paar Wochen in der DDR in einem Jugendcamp – und damit die Freundschaft mit Clara Pinkus.
Ach, Markus. Ihre Mutter stand vor seiner Haustür, mit glänzenden Augen, die Frisur war hinüber. Sie versuchte, Leonore daran zu hindern, bei Markus zu klingeln. Vergebens, Leonore war schneller. Und da kam er schon die Treppe herunter, in Jeans, mit nacktem Oberkörper, und säuselte »Hast du was vergessen, Liebling?«.
Ihre alte Mutter, der »Liebling« des Jugendpfarrers. Urkomisch.
Ob Vater davon wusste? Vielleicht. Aber Henri Seliger interessierte das wahrscheinlich nicht. Seine Frau konnte machen, was sie wollte, auch stundenlang mit ihrem Chef im Auto vorm Haus stehen und palavern, während er das Abendbrot auf den Tisch stellte. Ganz der Küchenbulle, wie er sich nannte. Er ist ein Waschlappen, dachte Leonore.
Dabei hatte sie ihn eigentlich gern. Er wusste sonderbare Gedichte auswendig und erzählte schmutzige Witze, schon um seine Frau zu ärgern, die so sehr auf »Manieren« achtete. Doch vor allem ließ er sie in Ruhe. Wenn Margo nicht da war, musste er nicht kochen, dann schmierte er dick belegte Stullen, und sie saßen einträchtig beisammen, er las die Zeitung, sie las ein Buch. Für diese friedlichen Stunden mochte sie ihn. Nur seine Launen waren schrecklich, man wusste nie, woran man war, seine Stimmung konnte ohne Vorwarnung in Sekunden umschlagen. Was gab das für ein Theater, wenn sie heimlich in der Küche das Radio angemacht und auf den BFBS gestellt hatte, ohne danach wieder zum NDR zurückzukurbeln, wo es meist Operette gab.
Alles in allem war es gut, Osnabrück zu verlassen.
Leonore ging in ihr Zimmer und zog die Tür hinter sich zu. Auch hier war das Fenster weit geöffnet. Auf dem Pflaumenbaum, dessen Blüten im Frühjahr so wunderbar dufteten, saß eine Amsel und jubilierte. Leonore wurde die Kehle eng. Wenn sie auch so singen könnte, so ganz aus der Tiefe der Seele heraus. Der Gedanke ließ sie unwillkürlich grinsen. Seit wann konnten Seelen singen?
Wie ein Echo drangen aus dem Wohnzimmer vertraute Klänge: Mutter hatte das Bruchkonzert aufgelegt, das liebte sie. Früher hatte Leonore sich dabei aufs Sofa gekuschelt und war selig eingeschlafen. Auch das war vorbei.
Sie zog das Transistorradio unter dem Kopfkissen hervor, das Henri ihr geschenkt hatte. Er musste irgendwie mitgekriegt haben, wie es ihr ging – oder er wollte bloß verhindern, dass sie den Sender im Küchenradio verstellte. Egal. Gut, dass es den britischen Soldatensender gab, gleich wurden die Top Ten der englischen Hitparade vorgestellt, sie schrieb jede Woche mit.
Seit sie »It’s over« von Roy Orbison gehört hatte, oder »She’s not there« von den Zombies oder »Needles and pins« von den Searchers, wusste sie, wie sich Liebe anfühlte: wie der Schmerz, wenn sie vorbei ist. Seit Neuestem gab es einen Song, der alle anderen übertraf, der so todtraurig war, dass ihr die Tränen gekommen waren, als sie ihn das erste Mal gehört hatte. »We’ve already said – goodbye.« Die Moody Blues. »Go now.«
Clara Pinkus, ihre Brieffreundin aus Ostberlin, würde das sicher für dekadent halten, ihre Begeisterung für diese Musik, die da plötzlich in ihr Leben eingebrochen war wie eine Verkündigung aus dem Paradies, süß und verheißungsvoll und unendlich traurig.
»Du musst das alles vom Klassenstandpunkt her sehen«, hatte in Claras letztem Brief gestanden. »Woran du leidest, ist nicht deine Mutter. Du leidest an der Entfremdung in der kapitalistischen Klassengesellschaft.«
Vielleicht. Aber was konnte der Kapitalismus für diese unbestimmte Sehnsucht, unter der sie litt, und die sie dennoch nicht missen mochte?
II
Osterholz, im Herbst
Wie stellte man es an, unter Margo Seliger nicht zu leiden?
Leonore hasste das geblümte Kleid und das kratzige grüne Strickjäckchen, das sie zur Feier des Tages hatte anziehen müssen. Sie hasste es, herumzustehen in der großen Halle, die früher die Tenne des Kottens gewesen war, dieser Bruchbude, wie sie das neue Heim heimlich nannte, auf das ihre Eltern so stolz waren. So stolz, dass es eine Einweihungsfeier geben musste, man will ja zeigen, was man hat, auch wenn es nur ein auf rustikalen Schick aufgemöbeltes Arme-Leute-Haus war.
Und natürlich hatte ihre Mutter Glück mit dem Wetter. Bis vorgestern hatte es geregnet, tagelang. Gestern war es bedeckt gewesen, aber windig – und heute schien die Sonne. Margos Optimismus hatte über Henris und Leonores düstere Wetterprognosen gesiegt.
»Leolein!«, flötete Margo.
Leonore kannte den Ton. Das war höchste Alarmstufe und bedeutete: »Jetzt steh da nicht so rum, sondern komm her und tu was!« Und dann auch noch »Leolein«! Sie wollte Leo genannt werden, hatte sie vor einiger Zeit beschlossen, nicht mehr Leonore. Musste sich ihre Mutter schon wieder über sie lustig machen?
Margo unterhielt sich mit einigen der Gäste am anderen Ende des großen Raums, vor den verglasten Türen, die so groß waren wie früher das Scheunentor. Widerwillig setzte sich Leo in Bewegung.
»Leonore, Liebes, frag doch mal unsere Gäste, was sie trinken wollen«, rief ihre Mutter mit dieser angestrengten Heiterkeit, mit der sie zu übertönen versuchte, dass sie unter Druck stand. Weil ja alles klappen musste. »Es gibt Gin Tonic, Whisky Soda und Orangensaft mit oder ohne Sekt.« Bei Seligers musste immer alles klappen, und zwar sofort, selbst wenn es sich um etwas handelte, wofür man Zeit und Geduld brauchte. Etwa für Menschen oder Tiere.
Leonore kannte kaum einen der Gäste. Einige von Henris Kollegen vom Landgericht waren dabei, Herren mit straffen Frisuren, in Anzügen, aber ohne Schlips, man war ja auf dem Land, da durfte es lässig zugehen. Die anderen waren das, was Mutter hochtrabend »meine Geschäftspartner« nannte. Die sahen allerdings auch nicht lebendiger aus. Nur drei der Herren hatten ihre Frauen mitgebracht, das wunderte sie ein wenig. Die Damen sahen aus, als ob sie sich nicht recht wohlfühlten in Margo Seligers Gegenwart. Vielleicht fürchten sie um ihre Männer, dachte Leonore. Vielleicht hat Margo einen gewissen Ruf?
Ihre Mutter hatte sich jedenfalls wieder gut in Szene gesetzt, war extra noch beim Friseur gewesen und hatte sich die Haare nachfärben lassen. Ihr altrosafarbenes Kostüm hatte genau den Schick, den Leonore so gar nicht mochte. Aber Margo konnte sich gegenüber den anderen Trutschen noch immer sehen lassen, das musste man ihr zugestehen, obwohl sie auch nicht jünger wurde.
Früher hatte sie ihre Mutter leidenschaftlich verteidigt, wenn die Mütter ihrer Freundinnen ihr mitleidig über das Haar strichen, sie »armes Schlüsselkind« nannten und tadelnd fragten, ob die Seligers es denn wirklich nötig hätten, dass die Frau arbeiten geht. Nur, damit sie sich ein paar schicke Kleidchen kaufen könne.
Sie machte die Runde, fragte jeden Einzelnen der Gäste nach seinen Wünschen und hatte Bestellungen für zwei Sekt mit Orangensaft, drei Whisky Soda und ein Wasser gesammelt, als Margo Seliger die Stimme erhob.
»Damit das alles ein wenig schneller geht: Wer möchte Whisky Soda?« Fünf Hände hoben sich. »Wer Sekt mit Orangensaft?« Wozu Leo noch etliche Minuten länger gebraucht hätte, das erledigte ihre patente Mutter in Nullkommanix. Warum hatte sie das nicht gleich getan? Leo stand da und spürte, wie ihr die Hitze ins Gesicht stieg. Sie wünschte sich weit weg. Es war ihrer Mutter egal, ob sie ihre Tochter demütigte. Es war ihr immer schon egal gewesen.
Eine der Damen schien die Szene bemerkt zu haben, eine Kollegenfrau, wenn Leonore richtiglag. Sie trug ein wadenlanges Cocktailkleid aus einer Art Brokat, silbergrau, mit einem kurzen Jäckchen. Leonore fand, sie war ein wenig übertrieben fein gemacht für eine Stehparty in einem ehemaligen Landarbeiterhaus.
»Du bist Leonore, nicht wahr?«
Sicher, wer denn sonst. Leo nickte.
»Mein Mann ist ein Kollege deines Vaters. Der muss sich ja rührend um dich kümmern!«
Rührend? Naja.
»Weißt du, für welchen Spruch er im Gericht bekannt ist? ›Meine Herren, die Sitzung ist beendet, ich muss nach Hause, die Kartoffeln aufsetzen.‹ Ist das nicht nett?«
Die Frau klang eigentlich nicht, als ob sie das wirklich nett fände. Leo wusste, dass sie jetzt höflich lachen sollte. Aber ihr war dieser Spruch entsetzlich peinlich. Ja, Henri war der Küchenbulle, er kochte das Mittagessen und stellte das Abendbrot auf den Tisch. War das wirklich so bemerkenswert?
»Und du gehst noch zur Schule? Aufs Gymnasium, nicht wahr? Na, dann hast du ja noch ein bisschen Zeit, bevor der Ernst des Lebens beginnt.«
Die Dame kniff das linke Auge zu, neckisch, als ob sie einen Scherz gemacht hätte. Aber wenigstens fragte sie nicht, was Leonore einmal werden wollte.
»Ihr habt ja so viele Chancen heute. So viel mehr als wir.«
Leonore blickte hoch, ins Gesicht der Frau, ein weiches, rosa geschminktes Gesicht unter blonden Haaren, die sie kunstvoll aufgetürmt trug, die Augen blassblau unter den hellen Wimpern. Eine Spur Lippenstift war in die Furche gelaufen, die vom Mundwinkel Richtung Kinn führte.
»Für uns war so vieles nicht möglich.«
Diese Leier nun wieder, dachte Leonore. »Meine Mutter ist mit fünfzehn von der Schule abgegangen, und aus ihr ist trotzdem was geworden.« Der Satz war raus, bevor sie sich bremsen konnte.
»Ja. Natürlich. Sie hat Glück gehabt. Jon Bajohr hält ja große Stücke auf sie. Und wenn unser Unternehmer des Jahres das sagt …« Die Frau in Brokat nickte und lächelte ein unechtes Lächeln.
»Sie wusste immer, was sie wollte. Sie hätte das auch ohne Bajohr geschafft.«
Leonore hörte sich zu, wie sie ihre Mutter verteidigte. Ausgerechnet sie. Dabei konnte sie Margos Heldenlegende schon längst nicht mehr hören: dass ihre Lehrerin sie aufs Gymnasium schicken wollte, woran sie nicht interessiert war. Dass sie ihr eigenes Geld verdienen wollte. Dass sie gegen ihren strengen Vater durchgesetzt hatte, eine Lehre als Bürokaufmann in einem Fotoatelier beginnen zu dürfen. Dass der Krieg ihre Pläne zunichtemachte und dass sie nie das Auto bekam, auf das sie gespart hatte. Dass sie auf einem Bauernhof in Schlesien hart arbeiten musste, dass sie während der Flucht fast umgekommen wäre, dass sie gefroren und gehungert und Schnaps geschmuggelt hatte, um sich und ihre Mutter und Schwester durchzubringen.
Wir hätten uns die Finger danach geleckt, hieß es, wenn Leonore das Gulasch nicht mochte, weil es fettig war und sehnig und man die weißen Adern sah. Du weißt nicht, wie gut du es hast. Sei dankbar, dass du das alles nicht erleben musstest. Wir bekamen nichts geschenkt. Wir haben hart gekämpft, und wir lassen uns das Erreichte nicht mies machen.
Sie konnte die Sprüche ihrer Eltern im Schlaf herunterbeten. Dabei wusste sie natürlich, dass sie auf ihre Mutter stolz sein sollte.
Ja, ich war stolz auf sie, dachte Leonore. Bis ich endlich begriffen habe, was für ein egoistisches Miststück sie ist.
»Und du? Weißt du auch schon, was aus dir mal werden soll?«
Also doch. Bevor sie die verhasste Frage beantworten konnte, tauchte ein Mann neben der blonden Frau auf und legte ihr den Arm um die Taille. »Wie schön, dass ihr euch so angeregt unterhaltet«, sagte er. »Aber du solltest ein paar Worte mit Hansi Mohr reden, Evchen, daran läge mir.«
Evchen nickte und lächelte. »Eine gute Ehefrau ist die halbe Karriere«, sagte der Mann und küsste sie auf die Wange.
Leonore stand nun wieder allein in der großen Halle und blickte auf dunkle Hosen, gebauschte Röcke, Füße, die aus engen hochhackigen Schuhen quollen. Auf nickende Köpfe einer bähenden und mähenden Herde von Menschen. Als Margo in die Hände klatschte, bewegte sich die Herde und trampelte auf Leonore zu. Erschrocken trat sie zur Seite.
»Wir machen eine Gartenrunde«, rief Margo fröhlich. »Bist du so lieb und sammelst die Gläser ein? Frau Henke kann in der Küche sicherlich ein wenig Hilfe gebrauchen!« Leonore senkte den Kopf und nickte.
Wenigstens musste sie nicht mit in den Garten, der bislang vor allem in der Phantasie ihrer Mutter existierte. Außer einer großen Wiese, auf der früher die Schweine weideten, gab es dort nicht viel: einen Kirschbaum, einen Apfelbaum, dessen graugrüne schartige Äpfel wunderbar säuerlich schmeckten, einen Pflaumenbaum und einen wuchernden Holunder. Doch Margo würde den Gästen ihre Pläne sicher farbenfroh ausmalen: Welche Bäume und Sträucher wohin gehörten, wie die Gartenwege verlaufen sollten und wo das Rosenbeet sein musste. Nur der Gemüsegarten sollte Henri überlassen bleiben, den würde sie wahrscheinlich gar nicht erst erwähnen.
Manchmal hörte Leonore eigentlich ganz gerne zu, wenn ihre Mutter die lateinischen Namen der Gewächse aufsagte, die sie bestellen und pflanzen wollte, andächtig, weil sie ihr nur schwer über die Lippen gingen. Cimicifuga racemosa. Silberkerze. Viburnum tomentosum. Japanischer Schneeball. Oder Hydrangea aspera sargentiana. Samthortensie. Margo hatte die Namen aus »Kreuzers Gartenpflanzenlexikon, kurz und bündig« und aus den anderen Gartenbüchern, die sie nach Feierabend wälzte. Sie hatte Stapel davon, und perfektionistisch, wie sie war, lernte sie die Namen auswendig.
Leonore stellte die leeren Sektgläser akkurat nebeneinander aufs Tablett. Auf die Schweinewiese hatte der Gärtner kürzlich »Mutterboden« ausgebracht, ein Wort, das bei Leo unliebsame Assoziationen weckte. »Humus« war ihr lieber, das klang weich und moosig, heimelig, nach Geborgenheit. Außerdem liebte sie Fremdwörter.
Sie sammelte die Whiskygläser ein, gerade Gläser ohne Stiel, die mochte sie am liebsten.
Ihre Mutter ging die Gartenplanung ganz systematisch an. Es sollte zu jeder Jahreszeit etwas blühen oder doch wenigstens Farbe zeigen. Sie berechnete die zu erwartenden Wuchshöhen, damit keine Pflanze den Blick auf eine andere verstellte. Vor allem Rosen und Rhododendren wollte sie pflanzen, ganz wie in den englischen Gärten, die sie mit einem Verein namens »Rosenfreunde« im vergangenen Herbst besichtigt hatte: Sissinghurst Castle und Sandringham House. Als ob sich ein niedersächsischer Kotten mit einem königlichen Park messen könnte.
Rosen hatten schöne Namen: Es gab Gallicarosen und Albarosen, Damaszener- und Zentifolienrosen, Noisetterosen und Bourbonrosen. Die modernen Züchtungen hießen Floribunda und Polyantha und Rosa rubiginosa. Leonore war vergesslich, behauptete ihre Mutter, aber Wörter, die ihr gefielen, vergaß sie nie.
»Fräulein Leonore?«
Frau Henke stand in der Tür zur Küche. Beinahe hätte Leo das Tablett mit den Gläsern fallengelassen.
»Lassen Sie nur.« Die Frau mit dem Dutt und den Brombeeraugen nahm ihr das Tablett aus der Hand. »Ich erledige das schon.«
Das machte Leo verlegen. Dass man sie siezte und Fräulein nannte. Und dass sich ihre Eltern von jemandem bedienen ließen, als ob sie zu den oberen Schichten gehörten.
»Obere Klassen«, würde Clara sagen. »Vergiss die Klassenfrage nicht.«
Leonore schlüpfte in ihr Zimmer, das von der großen Halle abging. Sie zog sich das Kleid über den Kopf und warf es aufs Bett. In Jeans und Pullover verließ sie das Haus. Die Herde um Margo stand oben am Rand der Schweinewiese, niemand sah sie entwischen.
Leo überquerte die Straße, die sich wellte wie eine nasse Klopapierrolle, und ging durch die Felder hinauf zum Wäldchen. Ein richtiger Wald war das nicht, es gab ein paar Lärchen und Buchen und struppigen Ginster am Wegesrand. Eine sandige Lichtung war übersät mit Löchern im Boden, Eingänge zu Fuchs- oder Dachsbauten. Man habe die Füchse vergasen müssen, hatte Henri behauptet, wegen der Tollwut. Sie fand das ungerecht, zumal auch alle Dachse am Gas gestorben waren. Ihr Vater war bei dem Thema mitleidlos, wie immer. Die einzigen Tiere, die er geradezu vergötterte, waren seine Vögel. Manchmal wünschte sich auch Leo einen Vogel, einen weisen Raben, der auf ihrer Schulter säße und ihr guten Rat einflüsterte.
Es war seltsam, wie die Gedanken vorwärtsdrängten, auseinanderflossen, sich wieder zusammenballten und Form annahmen, während sie ohne Ziel und Absichten durch die Gegend lief. Das war das Schöne am Alleinsein.
Über ihr kreisten drei Raubvögel. Der Himmel war eher grau, aber das war sie gewohnt, das war typisch für diese trostlose Gegend. Sie nahm den Feldweg durch Äcker und Wiesen zu einem verlassenen Kotten, den sie bei einer ihrer Wanderungen entdeckt hatte. Im einstigen Bauerngarten überwucherten Winden und Brombeerranken die Skelette dreier Johannisbeersträucher, sie sahen wie bepelzte Skulpturen aus. Vor der Haustür stand eine von Sonne und Regen narbig geprügelte Bank, auf der man sitzen und träumen konnte. Das gehörte zu ihren Lieblingsbeschäftigungen: sich wegträumen von allem, in eine andere Welt, in eine andere Zeit. An einen anderen Ort.
Als Leonore die Augen wieder öffnete, hatte der Himmel die Farbe gewechselt und eine müde Sonne durchgelassen. Sie schüttelte sich und stand auf. Man würde sie zu Hause zwar nicht vermissen, aber es ihr dennoch übelnehmen, wenn sie nicht bald zurück wäre. Und genauso war es auch.
»Wo warst du«, zischte Margo, »und wie siehst du aus?« Die Gäste verabschiedeten sich gerade.
»Na, da ist ja Ihr Wildfang«, sagte der Mann der Blonden und lachte, »die geht nicht verloren. Die passt aufs Land.«
Leonore war sich sicher, dass ihre Mutter das ganz und gar nicht gerne hörte. Das entschädigte sie dafür, dass es ihr ebenso ging: Ein »Mädchen vom Land« nahm niemand so richtig ernst. Sie drehte ihr den Rücken zu und ging in ihr Zimmer.
Seit sie sich den ganz und gar finsteren Gedanken erlaubte, dass sie ihre Mutter hasste, war Leo sehr viel wohler. Ein verbotenes Gefühl, das groß und wunderbar war und das Clara nicht verstehen würde, es passte nicht zu einem soliden Klassenstandpunkt, wonach das Individuum und seine Gefühle nichts, die Solidarität und der Kampf für Frieden und Völkerverständigung alles waren.
Die Sache mit dem Pfarrer würde sie Margo niemals verzeihen.
III
Leonores Zimmer war einst ein Stall gewesen, »bestimmt ein Schweinestall«, scherzte ihre Mutter gern, der es nie aufgeräumt genug sein konnte. Es gab ein Bett, einen Schreibtisch und einen Kleiderschrank, Leo fand alles hässlich, aber niemand war auf die Idee gekommen, sie beim Einkauf mitzunehmen. »Das fehlte gerade noch«, wäre die Antwort gewesen, hätte sie darum gebeten. »Wer zahlt, schafft an« – auch so eine elterliche Weisheit. Wenigstens hatte sie ein paar Poster an die Wand pinnen dürfen, besonders das schwarzrote Filmplakat von »Alexis Zorbas« mit Anthony Quinn und Irene Papas verlieh der Bude ein bisschen Farbe.
Das Beste aber war: Das Zimmer hatte eine Heizung. Endlich nicht mehr frieren müssen, dachte Leonore, kuschelte sich ins Federbett und lauschte. Es war schon seit November richtig kalt, der Wind strich ums Haus, raufte die Buchen, die ächzten und seufzten, aber der Nachtvogel in ihren Ästen ließ sich nicht beirren und stieß ein hohles Pfeifen aus. Ein Käuzchen, meinte Henri, den sie nach dem Laut gefragt hatte, damit kannte er sich aus, er hatte in seiner Jugend einen Waldkauz großgezogen. Sie zog sich die Bettdecke bis unters Kinn. Draußen folgte auf ein gedehntes Huuu ein böses Kichern. Sie spürte eine wohlige Gänsehaut, nein, bei diesem Sturm und diesen Lauten wäre sie nicht gerne nachts unterwegs, umso gemütlicher war es hier drinnen.
Über ihr knarrten die Balken. Das waren nicht die Mäuse, deren Trappeln kannte sie. Es war das Haus. Es bewegte sich. Reckte sich. Streckte sich. Wollte sich losreißen und das Weite suchen. Verständlich, dachte Leonore schläfrig.
Doch beim nächsten Ton war sie hellwach.
Draußen schrie es, wie ein Kind, ein schrecklicher, anhaltender Jammerton. Sie suchte nach dem Lichtschalter, stand auf, öffnete das Fenster und klatschte in die Hände. Zwei dunkle Schatten sprangen davon. Katzen schrien so, allerdings nicht vor Schmerz, sondern wenn sie um ihr Revier kämpfen. Sie wusste das, aber das Gewimmer ging ihr dennoch durch Mark und Knochen.
Alles war anders hier in Osterholz, sie war nicht mehr umgeben von den vertrauten Geräuschen der Stadt: betrunkene Stammtischbesucher auf dem Nachhauseweg, anfahrende Autos, streitende Familien, schreiendes Schlachtvieh, singende Sägen. Alles war hier weiter und näher zugleich – so weit und so nah wie der Sehnsuchtslaut, den die Dampflok vor dem Zug ausstieß, der von Hamburg nach Dortmund über die Gleise hämmerte, dadamm dadamm, die Strecke war wenige Kilometer entfernt, aber nur nachts hörte man den Zug so deutlich.
Sie schlüpfte zurück unters Plumeau und schaltete das Licht aus. Doch sie konnte nicht mehr einschlafen. In Osnabrück hatte sie sich fremd gefühlt, und fremd fühlte sie sich auch in Osterholz. In Osnabrück waren die Seligers Fremde gewesen, weil sie nicht zu den alteingesessenen Familien gehörten. Den Dünkel war sie gewohnt. Doch auch die Bauern auf dem Land musterten sie misstrauisch, wenn sie ihnen begegneten, bei denen hießen Leute wie sie »tolopen Pack«, das hatte ihr eine Mitschülerin erzählt. Dahergelaufenes Pack. Freundlich war das nicht.
Leo griff nach dem Kofferradio und schaltete es ein, aber es gab nur ein mattes Rauschen von sich. Die Batterien waren schon wieder leer. Henri würde ein Gesicht ziehen. »Wie schaffst du das nur? Ich habe dir doch erst vor Kurzem …« Ja doch. Hatte er. »Die nächsten zahlst du von deinem Taschengeld.« Klar. Wenn noch etwas davon übrig war, sie gab das meiste für Kaffee beim Eduscho und für Kippen aus.
Sie versuchte, sich in den Schlaf zu träumen, während der Wind draußen ums Haus tobte und mit den Dachziegeln spielte. Das half eigentlich immer: sich ganz weit wegdenken. Oft an einen Ort, an dem ein Mann mit dunklen Haaren und braunen Augen ihr heiße Blicke zuwarf, was sie natürlich kaltließ, bis sie endlich, endlich, einen dieser Blicke erwiderte, und dann …
Und dann fragt er dich nach der Telefonnummer deiner Freundin, wetten?
Das war im Sommer gewesen, im Freibad, im »Moskau«, das lag nicht weit entfernt von der Osnabrücker Wohnung. Er trug eine schwarze Hose und ein weißes Hemd, hatte dunkle, gelockte Haare und wollte ihr Schachspielen beibringen. Sie sei doch so intelligent.
Wenn sie nur ein wenig schlagfertig wäre, hätte sie ihn gefragt, ob er das überhaupt beurteilen könne. Aber sie fühlte sich geschmeichelt – wie kindisch! Am nächsten Tag traf sie ihn wieder. Glücklicherweise wartete er nicht lange, bevor er sie nach Juttas Telefonnummer fragte. Und du dummes Schaf hast sie ihm auch noch gegeben, dachte Leo.
Sie stand auf und setzte sich im Nachthemd an ihren Schreibtisch. Es gab etwas, das immer half: schreiben. Aufschreiben, was ist, sagte Clara immer.
Clara war ihr ein Rätsel. Leo hatte sie im vergangenen Sommer kennengelernt, im Ferienlager mit dem etwas seltsamen Namen »Pionierrepublik Wilhelm Pieck«. In der DDR