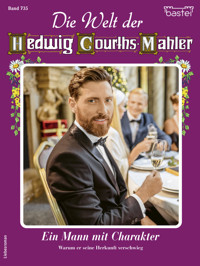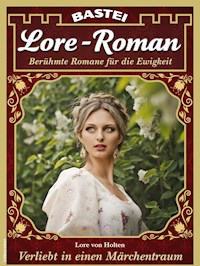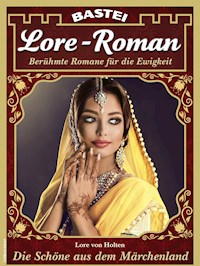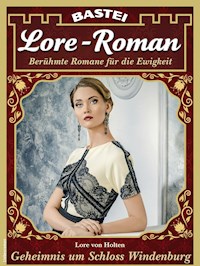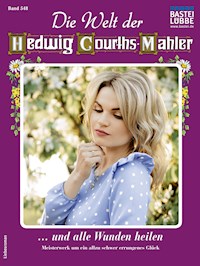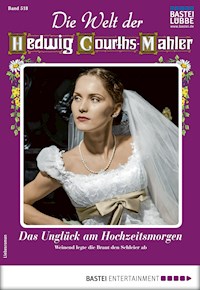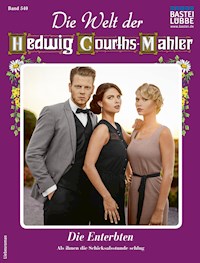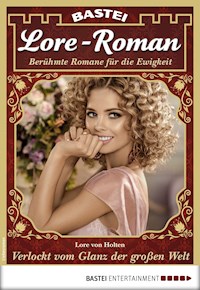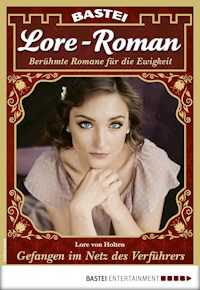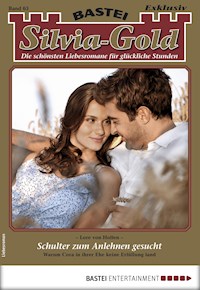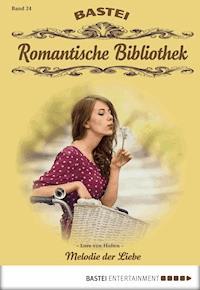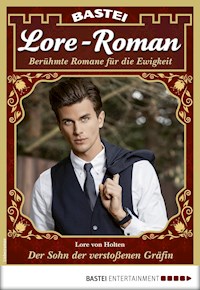
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lore-Roman
- Sprache: Deutsch
Roland Burger lebt einsam in einem kleinen Verwalterhaus und verdient seinen Lebensunterhalt als Maler. Eines Tages erscheint ein alter Herr bei ihm, der sich als Graf Cavensburg vorstellt - und mit einem Mal wird für Roland die Vergangenheit wieder lebendig. Er erinnert sich an seine Mutter, die Komtess Cavensburg, die um ihrer Liebe willen von ihrem hartherzigen, adelsstolzen Vater aus dem Haus gewiesen wurde.
Und nun steht ebendieser kaltherzige Mann - sein Großvater - vor Roland und fleht ihn an, die Familienehre der Cavensburgs zu retten. Auf den jungen Roland wartet ein schicksalhaftes Abenteuer ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Der Sohn der verstoßenen Gräfin
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Unique Vision / shutterstock
eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 9-783-7325-9701-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Der Sohn der verstoßenen Gräfin
Er kam als Diener in sein Schloss
Von Lore von Holten
Roland Burger lebt einsam in einem kleinen Verwalterhaus und verdient seinen Lebensunterhalt als Maler. Eines Tages erscheint ein alter Herr bei ihm, der sich als Graf Cavensburg vorstellt – und mit einem Mal wird für Roland die Vergangenheit wieder lebendig. Er erinnert sich an seine Mutter, die Komtess Cavensburg, die um ihrer Liebe willen von ihrem hartherzigen, adelsstolzen Vater aus dem Haus gewiesen wurde.
Und nun steht ebendieser kaltherzige Mann – sein Großvater – vor Roland und fleht ihn an, die Familienehre der Cavensburgs zu retten. Auf den jungen Roland wartet ein schicksalhaftes Abenteuer …
Es sah aus, als hätte niemand das kleine, windschiefe Häuschen haben wollen, weder die Dörfler noch die Gutsherren.
Man wusste nämlich nicht so recht, wohin man das kleine Haus, das von einem winzigen Garten umgeben war und sich hinter einem halbhohen Jägerzaun verstecken wollte, nun eigentlich rechnen sollte. Zum Dorf nicht, denn das endete jenseits des großen Weihers, und von dem hatte man bis zum Häuschen immerhin noch an die dreihundert Meter zu gehen. Zum Gut auch nicht, denn dessen Liegenschaften begannen erst hinter dem kleinen Waldstück, an das das Häuschen sich direkt anlehnte.
Das Gebäude war alt, das war auf den ersten Blick zu erkennen. Die Fenster waren klein, das Dach teilweise mit Moos bewachsen, und die beiden steinernen Stufen, über die man das Innere erreichen konnte, waren schon reichlich abgetreten.
Ein jeder, der das Häuschen zu Gesicht bekam, fragte sich, wie in diesem winzigen Gebäude überhaupt jemand leben konnte, denn es schien höchstens einem kleinen Zimmer und vielleicht auch noch ein oder zwei Kammern Platz zu bieten.
Doch dieser flüchtige Eindruck täuschte, was allerdings einem Trick zu verdanken war.
Im Erdgeschoss des Häuschens waren alle Zwischenwände herausgerissen worden. Ein einziger, nun aber wirklich nennenswerter Raum war entstanden, und weil in ihm die Stützbalken stehen geblieben waren, die die Konstruktion des Hauses trugen, besaß dieser Raum einen ganz besonderen Reiz.
Das änderte sich auch nicht durch die Tatsache, dass sich in einer Ecke eine Kochnische befand, dass in einer anderen Ecke, hinter einem Vorhang verborgen, ein Waschbecken und eine Dusche zu finden waren, und auch die alte steile Holztreppe, die gleich neben der Eingangstür in die Höhe führte, vermochte den originellen Eindruck dieses Raumes nicht zu zerstören – im Gegenteil, die Treppe erhöhte noch den Reiz der Behausung.
Oben unter dem steilen Dach erkannte man auch heute noch, wie zwergenklein früher einmal die Räume dieses Gebäudes gewesen waren.
Oben gab es nämlich zwei Kammern, in denen gerade die beiden Bauernbetten, je ein altersschiefer Schrank und je ein Stuhl Platz hatten. Das war aber auch schon alles, und man musste sich tüchtig drehen und wenden, wenn man sich in eines der Betten legen wollte.
Trotz dieser sehr beengten Verhältnisse war das Häuschen auch heute noch bewohnt.
Die Einheimischen wussten natürlich, wohin das Häuschen gehörte. Zum Gut Blankenberg natürlich, dessen Liegenschaften jenseits des kleinen Waldstückes begannen, und ebenso wussten die Einheimischen bis auf den heutigen Tag, für wen und weshalb dieses kleine Haus gebaut worden war.
Ein Baron Blankenberg hatte es für seinen damaligen Gutsverwalter errichten lassen.
Der Bau dieses Hauses hatte unter den Gutsbediensteten und unter den Dörflern eine Menge Aufsehen erregt, denn ein jeder wusste, dass der Verwalter im Obergeschoss der Rentei eine hübsche Wohnung zur Verfügung gehabt hatte. Dort hatte er bisher auch gewohnt, aber das gefiel dem damaligen Baron Blankenberg auf einmal nicht mehr.
Dieser Baron Blankenberg, ein kleiner, rundlicher Mann mit einer roten Nase und einem kahlen Kopf, war nämlich ein sehr lebenslustiger Herr gewesen.
Fast jeden Abend feierte er in seinem Schloss rauschende Feste, bei denen der Wein in Strömen floss, bei denen geschlemmt und getrunken und getanzt wurde, bis der Hahn den ersten Morgensonnenstrahl verkündete. Merkwürdige Freunde pflegten der Baron und seine nicht minder lebenslustige Frau um sich zu versammeln, Leute, die die Welt für einen einzigen Vergnügungspark hielten – vor allem dann, wenn sie sich auf Kosten eines Freundes verlustieren konnten. Und da der Baron in dieser Hinsicht äußerst spendabel war, brauchte er sich über einen Mangel an solchen Freunden nie zu beklagen.
Das hart arbeitende Gutsvolk und die Dörfler, die von dem Baron tüchtig ausgeschröpft wurden, damit er sich sein vergnügtes Leben leisten konnte, kannten dies alles nur vom Hörensagen oder aus ihrer Phantasie, denn wenn abends im Schloss die Geigen erklangen, war von dem niederen Volk kaum mehr jemand in der Nähe.
Das Dorf lag abseits, ebenso die primitiven Bauten, in denen das Gutsvolk lebte. Und die paar Bediensteten, die bei den rauschenden Festen der Herrschaft alles heranschleppten, wonach diese begehrte, waren verschwiegen bis ins Grab – einzig und allein der Verwalter, der in der Rentei wohnte, konnte von diesem wüsten Treiben der Herrschaft etwas mitbekommen.
Der Verwalter, der bisher dort gewohnt hatte, hatte daran keinen Anstoß genommen, denn er war alt und taub und halbblind gewesen, und so hatte er gar nicht mitbekommen, was da im Schloss vor sich ging.
Doch der neue Verwalter, der nach dem Tode seines Vorgängers in die Rentei einzog, war wesentlich jünger, konnte gut hören und scharf beobachten, und so brauchte er nur wenige Tage, um dahinterzukommen, was nach Sonnenuntergang im Schloss geschah.
Zuerst dachte er sich nichts weiter dabei, doch als er merkte, dass der Baron und seine Frau sich auf Kosten ihrer Bediensteten und der Dörfler amüsierten, dass die feinen Herrschaften sogar nicht davor zurückschreckten, liederliche Weiber und Musikanten ins Schloss bringen zu lassen, damit das Treiben noch ausgelassener und noch wüster sein konnte, da erhob der Verwalter mahnend seine Stimme.
Er tat es nur ein einziges Mal.
Zu einer Wiederholung hatte er keine Gelegenheit, denn der Baron jagte ihn auf der Stelle vom Gutshof, die Hunde hetzte er sogar hinter dem Mann her, und der nächste Verwalter kam erst ein Vierteljahr später in den Betrieb – in dem Augenblick nämlich, in dem das kleine Häuschen jenseits des Wäldchens errichtet war.
Dieses Häuschen hatte der Baron in der Zwischenzeit extra für den neuen Verwalter bauen lassen, damit dieser weit vom Schuss war und nicht noch einmal auf die Idee verfiel, sich in Dinge zu mischen, die ihn nichts angingen.
Die Sache klappte, denn der Verwalter sah und hörte nichts, er konnte sich so manches denken, aber der Wahrheit kam er nie auf die Spur, denn im Schlosspark liefen bissige Bluthunde herum, die sich auf jeden stürzten, der von außen zum Schloss vorzudringen versuchte.
Im Übrigen erledigte sich der Fall von selbst, denn nicht ganz zwei Jahre später wurde der Baron bei einem besonders wüsten Gelage vom Schlag getroffen. Er war tot, und der Schreck darüber fuhr seiner Frau so sehr in die Glieder, dass sie von einem Tag auf den anderen ihre Lebenslust vergaß, unglaublich fromm wurde, den Hof einem Verwandten übergab und sich in ein Kloster zurückzog, um dort für ihr sündiges Leben Buße zu tun.
Oder sich heimlich und sehnsüchtig an die vergangenen lustigen Tage zu erinnern, ganz wie man es sehen wollte.
Doch das war nicht so wichtig, und es war auch schon sehr, sehr lange her. Wichtig war einzig und allein, dass das Häuschen bis auf den heutigen Tag die Unterkunft des Gutsverwalters geblieben war, wobei es kaum mehr jemand gab, der sich an die Ursprünge dieser Kuriosität erinnerte.
Da stand das kleine Häuschen also immer noch, schmiegte sich schutzsuchend an das benachbarte kleine Wäldchen, dann und wann kräuselte Rauch aus dem winzigen Schornstein, und es wunderte einen schon, dass es eine Lichtleitung gab, die an der Straße entlang angelegt war und das Haus mit Strom versorgte.
Dafür gab es keine Wasserleitung, denn im Garten des Häuschens befand sich ein alter Brunnen, aus dem der Bewohner bis auf den heutigen Tag noch das Wasser schöpfte, das er brauchte. Und an ein Telefon, auf das die Leute heutzutage angeblich überhaupt nicht mehr verzichten konnten, wagte der Mann gar nicht zu denken.
***
Wer hatte unter diesen Bedingungen schon Lust, in einem solchen alten Haus zu wohnen?
Na, wer schon?
Ein junger Mann lebte in dem kleinen Haus. Er war groß, hatte breite Schultern, dichtes braunes Haar, sein Gesicht war von der Sonne gebräunt, und seine Augen waren scharf und lebhaft.
Wenn er durch die Tür ins Freie trat, konnte man fast meinen, er würde mit seinen breiten Schultern das ganze Häuschen ein wenig in die Höhe heben, weil er sonst die Tür nicht hätte passieren können.
Wenn seine laute, kräftige Stimme durch das Häuschen schallte, meinte man, die Wände beben und knacken zu hören, und wenn seine Schritte die Treppe herunterkamen, von droben aus der Schlafkammer, fürchtete ein jeder, die Treppe müsse unter der Wucht seiner Schritte zusammenbrechen.
Im Moment freilich befand sich das kleine Verwalterhäuschen am Waldrand nicht in Gefahr, denn der kräftige junge Mann, der es bewohnte, hatte das Haus verlassen und war in den Garten gegangen – genauer gesagt, in jenen Teil des Gärtchens, der hinter dem Haus verborgen war.
Dort stand er nun, trug eine kurze, etwas schmutzige Hose, ein buntes Hemd, das am Hals offen stand, ließ den leichten Sommerwind durch sein braunes dichtes Haar streichen und hielt in der einen Hand eine Palette und in der anderen Hand einen Pinsel.
Der junge Mann stand vor einer Staffelei.
Eine Leinwand war auf die Staffelei gestellt, und obwohl diese stellenweise noch weiß und unberührt war, hätte ein Beobachter doch schon erkennen können, was für ein Bild da entstehen sollte.
Der Hintergrund des Bildes, das war klar, wurde von einer sehr schönen Waldkulisse gebildet. Der Vordergrund, auch schon recht gut auszumachen, bestand aus einer von vielen Blumen buntbestickten Wiese, und in der Mitte lagerte nämlich, äußerst appetitlich anzusehen und von Blumen, Gräsern, Büschen und Waldbäumen und Sonnenschein lieblich eingerahmt, ein junges Mädchen.
Es war blond, hatte blaue Augen, spielte versonnen mit einer besonders farbenprächtigen Wiesenblume. Im Evaskostüm, grade so, wie der Herrgott es geschaffen hatte, lag es auf der blumengeschmückten Wiese.
Gerade jetzt trat der junge Mann ein paar Schritte von der Staffelei weg, kniff ein Auge halb zusammen, legte den Kopf ein wenig schief und betrachtete sein Werk mit kritischen Blicken.
„Wie lange dauert das denn noch?“, fragte ihn plötzlich eine junge Frauenstimme.
„Verakind, wir haben gerade erst angefangen“, erwiderte der junge Mann, ohne den Blick von der Leinwand zu wenden.
„Kann ich mich denn wenigstens mal bewegen?“
„Bewegen? Wozu?“
„Mich kitzelt etwas am Rücken. Da kriecht wahrscheinlich eine Ameise herum.“
Der junge Mann grinste. „Du kannst sie ruhig wegscheuchen, denn sie hat es nicht anders verdient. Wenn ich eine Ameise wäre, Vera, würde ich ganz woanders herumkrabbeln als ausgerechnet auf deinem Rücken.“
Das Mädchen kicherte und wischte mit einer schnellen Handbewegung das Tierchen weg.
Dass es von einer Ameise belästigt wurde, war kein Wunder, denn das Mädchen lag auf dem Erdboden, hatte sich seitlich aufgestützt und betrachtete eine bunte Blume, die es in der Hand hielt.
Zudem lag Vera nicht auf einer üppig blühenden Wiese, sondern zwischen ein paar ausgeschossenen Salatköpfen, eingerahmt von Petersilie und austreibenden Zwiebeln auf der einen und von ein paar Rhabarberstauden auf der anderen Seite.
Er hatte das Modell nur so naturgetreu wie möglich auf die Leinwand zu bannen brauchen, und schon würde es kaum einen Betrachter geben, der es fertigbrachte, das Bild nur mit einem flüchtigen Blick zu bedenken.
Jetzt war der junge Mann mit der kritischen Prüfung seines Werkes fertig. Er trat wieder an die Staffelei und malte an der blonden Lockenpracht herum.
„Halte ich die Hand wieder richtig, Roland?“, fragte Vera indessen.
„Ganz genau. Du bist das geborene Modell, habe ich dir das schon mal gesagt?“
Das Mädchen kicherte wieder. „Lass das bloß meine Eltern nicht hören, Roland! Sie würden mich auf der Stelle hinauswerfen! Oder in das nächste Kloster stecken!“
„Das wäre jammerschad.“ Der junge Mann malte nun den Mund des Mädchens nach. „Hast du dir schon einmal überlegt, was du später einmal werden möchtest, Vera?“
„Keine Ahnung. Ich mache ja erst im nächsten Jahr mein Abitur, und bis dahin wird mir schon etwas einfallen.“
„Willst du nicht auch Lehrer werden wie dein Vater, Vera? Nicht Oberstudiendirektor, wie er es ist, sondern einfach Studienrätin für … für irgendetwas Lustiges.“
Das Modell verzog den Mund. „Lustiges gibt es in der Schule nicht, nur Doofes“, gab es zurück. „Außerdem habe ich keine Lust, mich mit den Gören anderer Leute herumzuschlagen. Du glaubst ja gar nicht, wie frech die Schulkinder heute sind.“
„Du auch?“
„Ich lasse mir nichts gefallen.“
„Komische Jugend!“
„Rede keinen Quatsch, Roland“, beklagte Vera sich. „Früher, ja, da habt ihr stumm und steif vor euren Lehrern gesessen, und ihr habt ihnen alles geglaubt, was sie euch erzählt haben. Was ist dabei herausgekommen? Die Menschen sind immer wieder übereinander hergefallen, haben sich gegenseitig umgebracht … Hör doch auf, so etwas ist doch Käse!“
„Und du meinst, dass so etwas nicht mehr passieren wird, wenn ihr euren Lehrern das Leben zur Hölle macht und euch von ihnen nichts mehr sagen lasst?“
„So ungefähr.“
Der junge Mann, der Roland hieß, malte weiter an seinem Werk. Das Mädchen mit dem Namen Vera lag zwischen den Salatstauden, hielt die Blume in der Hand, und gerade überlegte es, was es wohl mit den zwanzig Mark anfangen könnte, die es für diese Sitzung von Roland zu bekommen hatte.
„Brauchst du mich morgen auch wieder?“, fragte es ein paar Augenblicke später.
„Sicherlich.“
„Wann ist das Bild fertig?“
„Übermorgen.“
„Hast du schon einen Käufer!“
„Ja, natürlich. Ich bringe das Bild noch übermorgen weg, und ich werde mein Honorar sofort kassieren können.“
Das Mädchen kicherte einmal mehr.
„Wenn die Leute sehen würden, wo ich hier liege, während du mich auf einer Wiese malst!“, amüsierte es sich.
Roland lachte. „Zum Glück können sie ja auch nicht hören, was das hübsche Modell alles so redet, während ich eine bezaubernde Wiesenfee aus ihm mache.“
Das Mädchen kicherte schon wieder.
„Roland – glaubst du, dass ich später einmal, wenn ich das Abitur habe, in die Stadt gehen und dort als Modell arbeiten könnte?“, fragte es jetzt.
„Das könntest du, aber ich würde es dir nicht raten. Wenn ich die Möglichkeit hätte, es zu verhindern, würde ich es auf jeden Fall tun. Und wenn ich dazu Gewalt anwenden müsste.“
„Warum?“
„Weil es in der Stadt Leute gibt, die dich nicht nur malen wollen, wie ich es tue, und die dabei aufpassen, dass dir nichts passiert, sondern die in der Stadt wollen wahrscheinlich noch viel mehr von dir.“
„So? Was denn?“
„Das weißt du genauso gut wie ich, Vera. Also halte jetzt deinen hübschen Mund, sonst mache ich noch eine Hexe aus dir.“
Vera schwieg tatsächlich und beobachtete eine Raupe, die dicht vor ihr über den Boden kroch.
Plötzlich lachte sie wieder.
„Was ist denn jetzt schon wieder los?“, erkundigte sich der junge Maler.
„Ich habe mir vorgestellt, was passieren würde, wenn meine Eltern mal zu jemand ins Haus kämen, der eines der Bilder an der Wand hängen hat, die du von mir gemalt hast.“
Roland grinst. „Sie würden dich gar nicht erkennen, denn du weißt, dass ich dein Gesicht immer ein bisschen verändere. Ganz so unschuldig wie meine Wiesenmädchen, die ich verkaufe, siehst du nämlich gar nicht aus.“
„Ich bin aber ganz brav.“
„Weil ich auf dich aufpasse, du Schäfchen.“
Das klang sonderbar, aber es stimmte. Vera wusste es, deswegen hielt sie nun mal wieder den Mund. Sehr oft kam das nicht vor, und es dauerte auch nicht lange, bis sie sich von Neuem meldete.
„Du hast mir Kaffee und Kuchen versprochen – wann gibt es das denn nun endlich?“, erkundigte sie sich.
„Sobald wir hier fertig sind.“
„Wann ist das?“
„In spätestens einer halben Stunde.“
Vera verzog das hübsche Gesicht. „Das ist mir viel zu lange“, behauptete sie. „Mein Magen knurrt nämlich schon mächtig. Heute Mittag gab es bei uns nur Graupensuppe, und die kann ich auf den Tod nicht ausstehen.“
„Dass dein Magen knurrt, ist nicht schlecht, denn auf diese Weise vertreibst du mir das Ungeziefer aus dem Garten“, scherzte Roland. „Dass du Graupensuppe nicht isst, ist töricht, denn die kann sehr gut schmecken. Aber das wirst du später noch mal von selbst merken.“
„Blöder Affe“, sagte Vera aus der Tiefe ihres Herzens. „Wenn ich nicht bald Kaffee und Kuchen bekomme, werde ich ganz mager, und dann kannst du mich nicht mehr malen.“
„Das wäre tatsächlich schlimm“, lachte Roland. „Magere Frauen kann ich nämlich nicht ausstehen. Du bist gerade richtig.“
„Richtig? Die anderen Mädchen in der Schule behaupten, ich wäre viel zu dick. Und du kannst auch in jeder Zeitung lesen, dass man als Frau besser dünn als dick sein soll.“
„Lass dir einen solchen Unsinn nicht einreden, Vera“, setzte Roland dagegen. „Kannst du dir vorstellen, dass es einen Mann gibt, der an einem lebenden Knochengerüst Interesse hat? Denk mal an Mannequins. Die armen, abgehungerten Dinger können einem eher leidtun.“
„Sabine will aber auch so werden wie sie.“
„Wer ist Sabine?“
„Eine in unserer Klasse. Die Tochter vom Bürgermeister genau gesagt. Sie hat vor ein paar Wochen mit dem Hungern angefangen, sie ist schon ziemlich dünn, aber jetzt auf einmal ekelt sie sich vor dem Essen. Wenn ihre Eltern sie zwingen, etwas zu sich zu nehmen, gibt sie es heimlich wieder von sich.“
„Findest du das vielleicht schön?“
„Schön vielleicht nicht, aber es ist konsequent.“