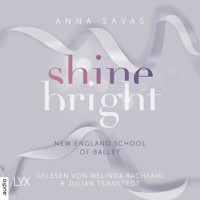3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
**Wenn Liebe und Verlust nah beieinander liegen…** Everly ist ganz und gar nicht begeistert davon, dass sie künftig mit Liam, dem arroganten und draufgängerischen Sohn von Familienfreunden, unter einem Dach leben soll. Aber als sie herausfindet, dass die kleine Buchhandlung ihrer Eltern kurz vor dem Aus steht, ist es ausgerechnet Liam, der ihr Hilfe verspricht. Während sie gemeinsam versuchen den Laden vor der Schließung zu bewahren, gelingt es ihm nach und nach, die schüchterne Everly aus ihrem Schneckenhaus zu locken. Doch gerade als sie glaubt, ihm wirklich vertrauen zu können, stößt er sie zurück. Nur langsam erfährt sie von Liams Vergangenheit und womit er zu kämpfen hat... //»Loving or Losing. Als du in mein Leben kamst« ist ein in sich abgeschlossener Roman.// //Weitere bewegende Liebesgeschichten der Erfolgsautorin Anna Savas: -- Forbidden Love Story. Weil ich dir begegnet bin -- Heartbroken Kiss. Seit du gegangen bist//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Anna Savas
Loving or Losing. Als du in mein Leben kamst
**Wenn Liebe und Verlust nah beieinander liegen …** Everly ist ganz und gar nicht begeistert davon, dass sie künftig mit Liam, dem arroganten und draufgängerischen Sohn von Familienfreunden, unter einem Dach leben soll. Aber als sie herausfindet, dass die kleine Buchhandlung ihrer Eltern kurz vor dem Aus steht, ist es ausgerechnet Liam, der ihr Hilfe verspricht. Während sie gemeinsam versuchen den Laden vor der Schließung zu bewahren, gelingt es ihm nach und nach, die schüchterne Everly aus ihrem Schneckenhaus zu locken. Doch gerade als sie glaubt, ihm wirklich vertrauen zu können, stößt er sie zurück. Nur langsam erfährt sie von Liams Vergangenheit und womit er zu kämpfen hat …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Anna Savas wurde 1993 in Herne geboren und studierte Komparatistik und Geschichte in Bochum. Schon als junges Mädchen entdeckte sie ihre Liebe zu Büchern und dem Verfassen eigener Geschichten, die immer länger wurden, bis schließlich ihr erster Roman entstand. Mit dem Schreiben bringt sie Ordnung in ihr Gedankenchaos, daher würde sie das Haus nie ohne ihr kleines Notizbuch verlassen.
Für meine Herzensmenschen Julia und Ann-Kathrin
Kapitel 1
Everly
Das Blut rauschte mir in den Ohren, ich fühlte meinen Herzschlag in jeder Faser meines Körpers, während ich versuchte zu begreifen, was hier gerade vor sich ging.
»Everly, jetzt sag doch was!«
Ambers besorgte Stimme riss mich brutal zurück in die Realität. Ich blinzelte, mein Blick klärte sich und ich sah, dass sie mich mit hochgezogenen Augenbrauen musterte.
Ich suchte vergebens nach der Sorge in ihrem Blick, die ich gerade noch zu hören geglaubt hatte und mir wurde klar, dass Amber sich gar nicht dafür interessierte, ob es mir gut ging. Sonst hätte sie sich während der letzten Wochen vollkommen anders verhalten.
Wir saßen in einem kleinen Eiscafé in der Innenstadt. Dort gab es zwar das beste Eis der Welt, ich ging jedoch trotzdem nicht gerne hierhin. Mir war hier alles zu viel, es war zu laut und meistens vollkommen überfüllt. Was Amber wusste. Trotzdem hatte sie das Café als Treffpunkt vorgeschlagen. Noch dazu war heute einer der wenigen heißen, sonnigen Tage in diesem Sommer, sonst hatte es fast nur geregnet. Deswegen saßen um uns herum noch mehr Menschen als üblich und mein Eis war in den letzten Minuten zu einer undefinierbaren Masse zusammengeschmolzen.
Ich brachte noch immer kein Wort heraus und weil das Schweigen zwischen uns von Minute zu Minute unangenehmer wurde, brach Amber es schließlich. Wie jedes Mal.
»Hör zu, ich weiß, dass du ihn nicht magst und es tut mir ehrlich leid, dass ich dir noch nichts davon erzählt habe, aber es ist einfach so passiert. In den letzten Wochen war so viel los, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin«, sagte sie, klang aber gar nicht so, als würde ihr irgendwas leidtun. Und dass die Sache mit ihr und Jay einfach so passiert war, bezweifelte ich doch ganz stark.
In den Sommerferien geschah absolut gar nichts einfach so. Die meisten Leute aus der Schule bekam man in den Ferien gar nicht zu Gesicht, weil sie es sich in Ferienlagern oder an Stränden gut gehen ließen. Und das wiederum bedeutete, dass Amber und Jay sich verabredet haben mussten. Meine kombinatorischen Fähigkeiten waren wirklich genial. Fast hätte ich die Augen über mich selbst verdreht. Doch dann setzte mein Herz einen Schlag aus, als ich erkannte, was das Ganze bedeutete: Amber hatte mich die ganzen Ferien für Jay versetzt. Einen Jungen, den ich absolut nicht leiden konnte. Er war zu glatt, zu charismatisch und hatte immer einen blöden Spruch auf den Lippen. Von Anfang an hatte ich ein komisches Gefühl gehabt was Jay anging, ich konnte nicht einmal genau sagen, wieso. Denn abgesehen von mir mochte ihn beinahe jeder an der Schule. Noch vor ein paar Wochen war Amber auch meiner Meinung gewesen, aber so schnell konnte sich das ändern, wenn plötzlich einer der beliebtesten Jungen der Schule auf einen stand. Aber damit hätte ich leben können. Vielleicht hätte ich Jay sogar gemocht, wenn ich mich mal richtig mit ihm unterhalten hätte. Doch dazu würde es nicht mehr kommen, das wusste ich.
Mit großen Augen starrte ich Amber an und mir wurde klar, dass ich dieses Mädchen gar nicht mehr kannte. Die Amber von früher hätte sich nie so verhalten. Sie hätte mir alles erzählt und sich auch niemals wochenlang nicht bei mir gemeldet.
Amber und ich waren seit der ersten Klasse beste Freundinnen gewesen, wir hatten unsere gesamte Kindheit miteinander verbracht, bis wir auf die weiterführende Schule gekommen waren. Fast wären wir in diesem Jahr getrennt worden. Ambers Eltern hatten beschlossen sie auf eine Privatschule zu schicken, weil sie glaubten, so hätte sie bessere Chancen für ihr späteres Studium. Außerdem hatten sie das nötige Kleingeld dafür, also warum nicht? Für mich war der Gedanke, meine Teenie-Zeit ohne Amber durchstehen zu müssen, unerträglich gewesen. Sie war meine einzige Freundin, die Einzige, die mich wirklich kannte und die damit klarkam, dass ich so still und schüchtern war. Ich hatte mich immer gefragt, warum Amber sich für mich entschieden hatte, als wir Kinder gewesen waren. Mit dreizehn hatte ich sie einmal danach gefragt und sie hatte lachend erwidert, dass sie damals mit fünf Jahren einfach gewusst hatte, dass wir Seelenverwandte waren. Trotzdem hätte man kaum unterschiedlicher sein können als wir beide. Aber vielleicht hatten wir uns gerade deshalb immer so gut verstanden. Wir ergänzten einander.
Amber war von uns beiden die Auffällige, die Hübsche, das Mädchen, das jeder mochte und mit dem jeder befreundet sein wollte, weil sie einfach so unfassbar nett und liebenswert war. Sie war offen, aufgeschlossen und für jeden Spaß zu haben.
Ich dagegen war einfach nur ich. Das Mädchen, das den Mund nicht aufbekam und bei jeder sich bietenden Gelegenheit knallrot anlief. Und während Amber vor Selbstbewusstsein nur so strotzte, war mein eigenes kaum vorhanden.
Bis gerade eben hatte ich unsere Unterschiedlichkeit immer als etwas Gutes betrachtet.
Das war dann jetzt wohl vorbei.
Als vor ein paar Jahren die Entscheidung wegen der High School angestanden hatte, waren wir noch ein Herz und eine Seele gewesen und ich hatte meine Eltern angefleht mich auch auf die Privatschule gehen zu lassen. Ich wollte einfach nicht, dass Amber und ich getrennt wurden, denn ich hatte nicht nur Angst davor Amber zu verlieren. Schon immer hatte ich mich schwer damit getan neue Freunde zu finden und je älter ich wurde, desto schwieriger wurde es.
Meine Eltern waren gegen die Privatschule gewesen, vor allem deshalb, weil wir uns die Schule nicht leisten konnten. Aber dann hatte ich ein Stipendium bekommen und das hatte alles geändert. Wir waren also zusammen auf die neue Schule gewechselt und obwohl Amber sich sofort mit einigen Mädchen angefreundet hatte und am Wochenende oft mit ihnen auf Partys gegangen war, waren wir trotzdem immer noch ein Team gewesen.
Bis jetzt. Noch nie im Leben hatte ich mich so betrogen gefühlt wie in diesem Moment. Die ganzen Ferien über hatte Amber sich nicht bei mir gemeldet, meine Nachrichten und Anrufe ignoriert, weil sie mit Jay und seinen Freunden unterwegs gewesen war.
»Everly, ernsthaft, du musst jetzt mal was dazu sagen!« Aufgebracht sah Amber mich an und rang die Hände. Mir fiel auf, dass sie inzwischen Gelnägel hatte, etwas, das sie früher immer verabscheut hatte. Sie war auch stärker geschminkt als noch ein paar Wochen zuvor. Insgesamt sah sie den Mädchen aus unserer Stufe viel ähnlicher als vor den Sommerferien.
»Hattest du deshalb den ganzen Sommer keine Zeit für mich?«, fragte ich scharf, obwohl ich genau wusste, dass es stimmte. Aber ich wollte es aus ihrem Mund hören. Amber zuckte überrascht zusammen und ich war unwillkürlich ein kleines bisschen beeindruckt von mir selbst. Normalerweise war ich nicht so direkt und in diesem Ton sprach ich für gewöhnlich auch nicht. Aber je mehr Zeit verging, je länger ich darüber nachdachte, was für eine grauenhafte Freundin Amber geworden war, desto mehr spürte ich, wie die Taubheit, die mich vorhin erfasst hatte, allmählich abebbte und ich wütend wurde.
»Ja. Hör zu, es tut mir auch echt leid. Aber wir haben so viel unternommen, auch mit den anderen. Da hatte ich einfach keine Zeit«, antwortete Amber und versuchte sich an einem zerknirschten Gesichtsausdruck, der jedoch kläglich misslang.
»Okay«, erwiderte ich leise, obwohl ich eigentlich etwas anderes hätte sagen sollen: Und warum hast du mich dann nicht gefragt, ob ich auch mitkommen möchte? Ich bin deine beste Freundin, Amber! Du hättest mich fragen müssen!
Dummerweise wusste ich ganz genau, was Amber geantwortet hätte. Dass ich sowieso Nein gesagt hätte, weil ich mich unter so vielen Menschen einfach nicht wohl fühlte und weil ich Jay und seine Freunde nicht mochte. Noch blöder war, dass sie damit Recht hatte. Die ganze Gruppe schüchterte mich furchtbar ein. Diese Leute hielten sich für so verdammt cool und schlau und glaubten, dass ihre Sprüche witzig waren und nicht verletzend. Mit keinem von ihnen hatte ich bisher wirklich geredet, außer vielleicht mal in einer Gruppenarbeit in der Schule und das hatte mir gereicht. Jedes Mal, wenn ich mich dann doch mal getraut hatte den Mund aufzumachen und was zu sagen, hatten sie mich angeschaut, als hätten sie vergessen, dass ich überhaupt da war. Als wäre ich unsichtbar für sie. Wahrscheinlich war ich das auch.
»Okay?«, fragte sie. Unglauben schwang in ihrer Stimme mit. Erneut hatte ich sie überrascht. Dieses Mal war ich allerdings kein bisschen stolz auf mich.
»Was willst du denn von mir hören?«, fauchte ich, doch sie antwortete nicht und zuckte nur unschlüssig mit den Schultern. Das war ja so klar gewesen. Im Grunde war mein Okay doch ganz genau das gewesen, was sie hatte hören wollen. Ich machte es ihr leicht, viel zu leicht.
Zwar hätte ich sie gerne gefragt, ob sie sich heute auch dann mit mir getroffen hätte, wenn ich ihr in den letzten Wochen nicht unzählige Nachrichten geschrieben hätte, aber ich kannte die Antwort und die Frage auszusprechen würde nichts ändern. Es würde nur noch mehr wehtun. Und ich hatte genug.
Mit einem Ruck schob ich den Stuhl zurück – die Stuhlbeine schrammten mit einem schrillen Quietschen, das in den Ohren wehtat, über die Steine – und stand auf. »Ich muss jetzt los«, sagte ich kühl. »Mum braucht mich in der Buchhandlung.«
»Okay, aber … ich ruf dich an, Everly, in Ordnung? Dann können wir uns die Tage treffen und über alles nochmal in Ruhe reden, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast.«
Ich erwiderte nichts, aber ich konnte die Lüge in ihren Augen sehen. Sie würde mich nicht anrufen. Sie hatte sich nicht nur einen neuen Freund, sondern auch neue Freunde gesucht. Eine Clique, in die ich nicht reinpasste und es auch nie tun würde. Das wollte sie gar nicht.
Ohne eine Antwort wandte ich mich ab und ging. Meine Wut war mit einem Mal verschwunden, stattdessen fühlte ich mich unendlich erschöpft.
***
Meine Eltern besaßen eine Buchhandlung direkt in der Innenstadt, die jedoch nicht wirklich gut lief – der vielen Buchhandelsketten und Onlinehändler wegen. Jane’s World of Books war zwar eine recht kleine Buchhandlung, aber für mich war sie schon immer ein Tor zu unzähligen anderen Welten gewesen und musste deswegen auch nicht viel größer sein.
Meine Mum, nach der das Geschäft benannt war, hatte es von meinen Großeltern übernommen. Schon als sie noch klein gewesen war, war sie ihren Eltern behilflich gewesen und nach dem Literaturstudium hatte sie dann angefangen, in Vollzeit dort zu arbeiten. Sie lernte meinen Dad in der Buchhandlung kennen und lieben, als er nach Büchern für sein Studium und schon allein deswegen war es für mich ein ganz besonderer Ort.
Dad hatte früher ein paar Jahre als Lehrer gearbeitet, aber nach dem Tod meiner Großeltern seinen Job gekündigt, um Mum mit dem Geschäft zu helfen. Sie hatte ihn wirklich gebraucht, trotzdem wünschte ich mir manchmal, er hätte es nicht getan. Dann wären wir jetzt nicht so abhängig vom Erfolg der Buchhandlung. Aber vor ein paar Jahren hatte alles noch anders ausgesehen und auch wenn vielleicht abzusehen gewesen war, wie sich der Onlinebuchhandel entwickelte, hatten meine Eltern doch immer die Hoffnung gehabt, dass alles gut gehen würde. Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich diese Hoffnung erfüllte oder …
Ich wagte nicht den Gedanken zu Ende zu denken. Als kleines Mädchen hatte ich – genau wie Mum früher – praktisch jede freie Minute in der Buchhandlung verbracht. Zum einen, weil ich es geliebt hatte, zum anderen, weil meine Eltern den ganzen Tag dort gewesen waren und wir so trotz ihrer Arbeit Zeit miteinander verbringen konnten. Irgendwann war mir dann die Schule in die Quere gekommen und ich hatte nicht mehr die Zeit gehabt, oft in die Buchhandlung zu gehen und mich dort ganze Nachmittage hinzusetzen, zu lesen oder meine Mum zu unterstützen. Stattdessen konnte ich nur noch in den Ferien aushelfen. Doch selbst die kurze Ferienzeit hatte gereicht, um mitzubekommen, dass es nicht gut lief. Wie auch, wenn die Leute ihre Bücher übers Internet bestellten, weil es praktischer war sie liefern zu lassen als selbst vor die Tür zu gehen? Es war schwierig mit Onlinehändlern zu konkurrieren.
Dabei gab es nichts Schöneres, als in kleinen Buchhandlungen neue Schätze zu entdecken. Geschichten, die einen in neue Welten mitnahmen, weinen und mitfiebern ließen, einem das Herz öffneten. In Buchhandlungen konnte man so viel mehr entdecken als im Internet. Da wurde nicht das Kaufverhalten analysiert, sondern Buchhändler empfahlen Bücher, die sie wirklich liebten und von denen sie sich von Herzen wünschten, dass sie ein neues Zuhause fanden.
Meine Mum war so ein Mensch. Sie war die Beste und fand für jeden einen neuen literarischen Schatz, sogar für den schlecht gelauntesten Kunden. Sie war die gute Seele der Buchhandlung, während Dad sich um die Büroarbeit kümmerte.
Noch vor zwei Monaten hatte Clara meiner Mum geholfen, aber dann hatten meine Eltern sie entlassen müssen, weil einfach das Geld fehlte, um eine Vollzeitkraft bezahlen zu können.
Mum drehte den Kopf zur Tür und begrüßte mich kurz mit ihrem typisch sanften Lächeln, als ich, nur ein paar Minuten nachdem ich die Eisdiele verlassen hatte, die Buchhandlung betrat. Dann widmete sie sich wieder Mrs Gallagher, einer Stammkundin, die immer einen ganzen Stapel Bücher mitnahm, wenn sie die Buchhandlung verließ.
Die meisten Leute, die mich und meine Mum zusammen sahen, konnten kaum glauben, dass wir Mutter und Tochter waren. Wir waren uns so unähnlich wie zwei Menschen es nur sein konnten, die blutsverwandt waren. Mum hatte welliges, goldblondes Haar, das ihr bis zum Kinn reichte. Ihre Augen waren graugrün und ich beneidete sie, seit ich in die Pubertät gekommen war, um ihre vollen Lippen. Mein Haar dagegen war lang, hellbraun und hing mir glatt bis zur Taille. Meine Augen waren dunkelbraun und obwohl ich mich schon als hübsch bezeichnen würde, war ich im Gegensatz zu Mum ziemlich unscheinbar. Das Einzige, das wir gemeinsam hatten, waren die Sommersprossen auf unseren Wangen. Sonst kam ich mehr nach meinem Dad. Auch meine ruhige Art hatte ich von ihm, genauso wie meine Vorliebe, alleine in meinem Zimmer zu sitzen und zu lesen, anstatt mich unter Leute zu mischen.
Zum Glück dauerte ein Gespräch mit Mrs Gallagher immer ein bisschen länger als mit anderen Kunden, so hatte ich noch einen Moment, um mich zu sammeln, damit Mum nicht merkte, dass ich immer noch vollkommen aufgelöst war.
Ich liebte meine Eltern, sie waren die Allerbesten und es brach mir jeden Tag fast das Herz zu sehen, wie sehr sie darunter litten, dass die Buchhandlung so schlecht lief. Deswegen hatte ich auf dem Weg hierher beschlossen ihnen nichts von der Sache mit Amber zu erzählen. Ich wollte nicht, dass sie sich zusätzlich auch noch Sorgen um mich machten. Sie hatten gerade wichtigere Dinge, um die sie sich kümmern mussten.
Dad war mit Sicherheit hinten im Büro. Eigentlich brauchten meine Eltern ganz dringend eine Aushilfe. Ich hätte ihnen gerne geholfen, doch jetzt, wo mein letztes Schuljahr anfing, fanden sie, ich müsste meine Prioritäten anders legen. Das hieß im Klartext: Ich war meinen Job in der Buchhandlung los und zwar nicht erst nach den Ferien. Sie sagten, ich sollte meine letzten Sommerferien genießen, einmal nichts tun. Nicht arbeiten, nicht lernen, einfach nur entspannen. Ich wusste, dass sie Recht hatten. Das letzte Jahr würde anstrengend werden, vollgestopft mit Prüfungen und Vorbereitungskursen für das Studium im nächsten Jahr.
Trotzdem würde mir der Job fehlen. Die Buchhandlung war einer der wenigen Orte, an denen ich mich vollkommen wohlfühlte. Ein Ort, an dem ich zu hundert Prozent ich selbst sein konnte. Ich wusste nicht, ob es daran lag, dass ich hier praktisch aufgewachsen war, aber hier, inmitten hunderter Geschichten und Figuren, die alle meine Freunde waren, war ich lockerer, entspannter und nicht so furchtbar gehemmt wie sonst. Zwar sprach ich auch hier nicht gerne mit fremden Leuten und ich hasste Smalltalk wie die Pest, aber viele der Leute, die hierherkamen, waren gar nicht mehr fremd für mich. Die meisten kannte ich mit Namen und viele von ihnen hatten mir dabei zugesehen, wie ich groß geworden war. Neue Kunden waren vor allem junge Mütter, die mit ihren Kindern hierherkamen, denn meine Mum hatte die beste Kinderbuchabteilung der ganzen Stadt. Es wurde nicht darauf geachtet, ob alles penibel aufgeräumt war – es war wichtig, dass die Kleinen Spaß hatten und ihre Liebe zu Büchern entdecken konnten.
Leider war ich selbst nicht besonders gut darin unsere Kunden beim Buchkauf zu beraten. Oft fand ich einfach nicht die richtigen Worte, selbst dann nicht, wenn ich das Buch selbst gelesen und toll gefunden hatte. Zumindest war das bei den Erwachsenen so. Bei den Kindern war das anders. Ihnen konnte ich stundenlang von den neuesten Büchern vorschwärmen, während sie mit vor Begeisterung glitzernden Augen zu mir hochsahen. Tatsächlich war das ein ganz guter Trick – die Mütter fanden es toll, dass ich mich um ihre Kinder bemühte und ich konnte meinem verlegenen Stottern aus dem Weg gehen, indem ich mich nicht direkt an die Mütter wenden musste.
Einen Moment lang schloss ich die Augen und atmete tief den unverwechselbaren Duft von Jane’s World of Books ein. Es war eine Mischung aus dem einzigartigen Geruch der Bücher nach Papier und Druckerschwärze sowie dem Duft verschiedener Blumen. Im Moment waren es Rosen, im Frühling meistens Tulpen oder Flieder. Mum bestand auf diese Blumensträuße, auch wenn sie in letzter Zeit immer kleiner geworden waren, weil das Geld fehlte. Doch sie war der Ansicht, dass sie zur Atmosphäre der Buchhandlung beitrugen und einen Besuch bei uns zu etwas Besonderem werden ließen.
Ich liebte diese Mischung, der Geruch versetzte mich jedes Mal zurück in meine Kindheit. Hier zu stehen, mit diesem Duft in der Nase, schenkte mir einen Augenblick von Frieden. So wie immer.
»Na Süße, hattet ihr Spaß, du und Amber?« Mums fröhliche Stimme ließ mich zusammenzucken. Ich öffnete die Augen und zwang mich zu einem Lächeln. Der Gedanke an Amber verscheuchte das friedliche Gefühl, das sich gerade noch in mir ausgebreitet hatte.
»Ja, war toll. Alles gut. Wie kann ich helfen?«, wechselte ich hastig das Thema und betete, dass Mum nicht nachhakte. Zum Glück ließ sie es auf sich beruhen.
»Schatz, du brauchst nicht immer zu helfen, wenn du hier bist. Wir hatten das doch besprochen. Das sind deine letzten Sommerferien und die sollst du genießen!«
Ich verdrehte die Augen und grinste sie an. »Jetzt sag einfach, was ich tun kann, Mum. Ich hab Zeit und nichts zu tun.«
»Von mir aus. Kannst du die Kasse machen?«
»Klar.« Ich nickte und verzog meine Lippen zu einem breiteren, dieses Mal echten Lächeln.
»Das ist lieb von dir, danke!« Sie gab mir einen Kuss auf die Stirn, als die Glocke über der Tür bimmelte und einen neuen Kunden ankündigte.
Seufzend stellte ich mich hinter die Kasse. Meine Gedanken schweiften zurück zu Amber und ich bekam einen Kloß im Hals. Ich glaubte nicht daran, dass sie sich in den nächsten Tagen melden würde. Schließlich hatte sie das die ganzen Ferien nicht getan. Nur noch drei Wochen, bis die Schule wieder anfangen würde und nur noch ein paar Tage, bis ich wieder für das Training der Schulmannschaft zurückmusste.
Im Grunde wären meine Ferien schon fast vorbei, sobald das Training wieder anfing, aber das störte mich nicht. Was mich störte, war der Gedanke an die Zeit, wenn die Schule wieder richtig anfangen würde, die Zeiten zwischen Unterricht und Training. Die Pausen. Das war es, wovor es mir jetzt schon graute. Mein Herz zog sich zusammen. Ich zweifelte daran, dass es nach den Ferien besser werden würde mit Amber und mir. Wir waren zusammen mit Jay und seinen Freunden in einer Stufe und wenn ich schon in den Ferien ausgetauscht worden war, würde das in der Schule wohl nicht anders werden.
Kapitel 2
Everly
Tief unter mir glitzerte das Wasser. Ich starrte nach unten, meine Zehen bogen sich um die Kante. Für einen Moment schloss ich die Augen und atmete tief durch. Ich konnte förmlich hören, wie das Wasser nach mir rief. Ein tiefes Seufzen entwich mir. Dann hob ich die Arme und sprang. Ich wirbelte durch die Luft, pfeilschnell, jeder Muskel war zum Zerreißen gespannt. Meine Fingerspitzen berührten die Oberfläche zuerst, nur einen Sekundenbruchteil, bevor ich vollständig untertauchte. Das Wasser umfing mich, hieß mich willkommen, verschluckte alle Geräusche und auch das Licht blieb an der Oberfläche zurück und kam nur gedämpft am Grund an.
Leider konnte ich nicht ewig hier unten bleiben. Dabei war es so schön. Und vor allem ruhig. Doch früher, als mir lieb war, schrien meine Lungen nach Sauerstoff. Meine Füße berührten inzwischen den Boden, ich stieß mich mit aller Kraft ab und schoss nach oben.
Nach Luft schnappend durchbrach ich die Wasseroberfläche. Der Geruch nach Chlor stieg mir beißend in die Nase, aber das störte mich schon lange nicht mehr.
»Everly, jetzt mach schon! Es wollen auch noch andere springen«, hörte ich Mila laut und ziemlich genervt von oben rufen und ich beeilte mich an den Beckenrand zu schwimmen und hinaus zu klettern. Sie war eine meiner Teamkameradinnen, aber wir waren nie Freundinnen geworden. Auch mit den anderen Mädchen hatte ich außer unserem täglichen Training nach dem Unterricht nie viel zu tun. Wir lebten aneinander vorbei, grüßten uns zwar, wenn wir uns im Schulflur begegneten, aber das war es dann auch schon. Bis vor ein paar Wochen war mir das total egal gewesen. Da hatte ich Amber allerdings auch noch gehabt.
Coach Weldon streckte mir seinen hochgereckten Daumen entgegen, bevor er sich Mila zuwandte, die oben auf dem Turm stand. Mein Bademantel lag noch an Ort und Stelle und ich schlüpfte erleichtert hinein. Denn obwohl es warm war, fror ich plötzlich.
Amber schob sich ungebeten in meine Gedanken, wie so oft in den letzten zwei Wochen. Sie hatte sich tatsächlich nicht mehr bei mir gemeldet. Stattdessen hatte sie mich offensichtlich voll und ganz aus ihrem Leben gestrichen.
Doch leider war das inzwischen nicht mehr mein einziges Problem. Als ich vor zehn Tagen nach dem Training nach Hause gekommen war, hatten meine Eltern bereits auf mich gewartet. Was ungewöhnlich gewesen war, da sie den Laden sonst nicht so früh schlossen. Schon als ich mich zu ihnen in die Küche gesetzt hatte, merkte ich, dass irgendetwas nicht stimmte.
***
»Everly, wir müssen dir etwas sagen«, begann Dad. Mit einem Ruck setzte ich mich auf, plötzlich ziemlich nervös, und ich merkte, dass ich meine Hände unwillkürlich zu Fäusten geballt hatte.
»Was ist denn los?«, fragte ich alarmiert. Mir schossen so viele schreckliche Gedanken durch den Kopf, dass ich kaum einen zu fassen bekam. Meine Eltern ließen sich scheiden, die Buchhandlung musste geschlossen werden, ich würde mein Stipendium verlieren und noch so viele mehr, dass mein Herz zu rasen begann. Was dann kam, hätte ich jedoch nie erwartet.
»Erinnerst du dich noch an meinen Studienfreund Andrew?«
Die Frage kam so unerwartet, dass ich Dad einen Moment lang nur perplex anstarren konnte. Ich kramte in meinem Gedächtnis nach einer Erinnerung und irgendwo ganz tief hinten war auch etwas. Doch sie war zu vage, als dass ich ein klares Bild zutage hätte fördern können. Also schüttelte ich den Kopf.
»Andrew und seine Frau Karen sind Ärzte. Sie werden für ein Jahr nach Afrika gehen, um dort zu helfen eine Klinik aufzubauen. Die beiden haben schon immer geholfen, wo sie konnten.« Dad schmunzelte. Dann räusperte er sich und fand zum Thema zurück. »Jedenfalls haben die beiden einen Sohn. Liam. Ihr beiden habt als Kinder miteinander gespielt, aber wahrscheinlich erinnerst du dich nicht mehr daran, es ist auch schon etliche Jahre her. Inzwischen ist er siebzehn und – er wird das nächste Jahr bei uns wohnen.«
Ich brauchte einen Moment, bis diese Information und ihre volle Bedeutung richtig bei mir ankamen. »Bitte was?!«, stieß ich dann entgeistert hervor.
»Schätzchen, ich weiß, dass das schwer zu verdauen ist, aber …«
»Warum?«, unterbrach ich meine Mum, noch immer vollkommen verwirrt. »Warum muss er ausgerechnet bei uns wohnen?«
Mum und Dad wechselten einen von diesen verschwörerischen Elternblicken, die mir jedes Mal ein entnervtes Augenrollen entlockten.
»Es gibt sonst niemanden, der sich um ihn kümmern kann und er hat im letzten Jahr einiges durchgemacht. Er sollte nicht allein sein«, sagte Mum schließlich so nachdrücklich, dass ich wusste, ich brauchte gar nicht erst nachzufragen, was passiert war.
»Hat er keine Freunde?« Das mochte ziemlich unsensibel klingen für ein Mädchen, das inzwischen selbst keine Freunde mehr hatte, aber ich konnte und wollte mir nicht vorstellen, dass wir die einzige Alternative für Liams Situation sein sollten.
»Everly!«, sagte Dad warnend. »Liam hat Freunde. Seine Eltern sind allerdings der Ansicht, dass ihm ein neues Umfeld guttun würde. Er braucht diese Veränderung gerade einfach.«
»Aber warum muss er dann bei uns wohnen?!«
»Auch wenn wir uns in den letzten Jahren nur sehr selten gesehen haben, weil wir nicht so nah beieinander wohnen und alle viel zu tun haben, sind wir immer noch gute Freunde. Sie würden das Gleiche für dich tun, wenn es nötig wäre.« Er sagte das in genau dem Tonfall, den ich noch von früher kannte, wenn er mir deutlich machen wollte, dass jede weitere Diskussion zwecklos war.
»Toll. Ganz toll«, murmelte ich beleidigt und starrte mit verkniffenem Gesicht auf den Tisch. »Und wann kommt er?« Ich gab mir nicht einmal Mühe, den bissigen Unterton in meiner Stimme zu unterdrücken.
»In knapp zwei Wochen. Der genaue Termin steht noch nicht ganz fest. Wir wissen, dass das alles schwierig zu verstehen ist und dass die ganze Aktion sehr kurzfristig geplant ist, aber es gab keine andere Möglichkeit und deshalb halten wir es alle so für das Beste.«
Wir alle. Damit konnten sie doch nur sich selbst und vielleicht noch Liams Eltern meinen. Ich jedenfalls hatte das Gefühl, einfach übergangen worden zu sein.
»Und was heißt das jetzt genau?«
»Liam wird mit dir zusammen zur Schule gehen und hier im Gästezimmer wohnen. Der Rest wird sich ergeben.« Dad wich meinem Blick aus, sah dafür aber Mum an, während mir das Blut aus dem Gesicht wich.
Das Gästezimmer gehörte mir! Natürlich nicht wirklich, es war schließlich immer noch ein Gästezimmer, aber es war trotzdem mein kleines Reich. Meine Eltern und ich waren in das Haus meiner Großeltern gezogen, nachdem Grandpa gestorben und Grandma in eine kleine Wohnung gezogen war, bevor sie vor drei Jahren auch verstarb. Für uns drei war dieses Haus zu groß gewesen, mit drei Schlafzimmern, Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Küche und einem großen Badezimmer. Deshalb hatte Mum ein Gästezimmer eingerichtet, für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand für längere Zeit zu Besuch kommen würde. Gekommen war bisher niemand und so war das Gästezimmer im Laufe der Zeit zu meinem Kreativzimmer geworden. In diesem Raum bastelte und malte ich. Es war einfach etwas anderes hier meine Kreativität rauszulassen, als mein eigenes Schlafzimmer dafür zu nutzen. Ich könnte meine Basteleien nicht unvollendet vor mir liegen sehen und nicht an ihnen weiterarbeiten, wenn ich sie in meinem Zimmer aufbewahren würde.
Und das sollte ich jetzt aufgeben? Für irgendeinen Jungen, den ich nicht kannte?!
»Aber das Gästezimmer ist doch …« Ich brach ab und schaute nach unten auf meine ineinander verknoteten Hände, damit meine Eltern nicht merkten, wie sehr mich diese Verkündung traf. Aber Protest hatte keinen Zweck. Ich war kein Mädchen, das Probleme machte. Und meine Eltern hatten wirklich genug Sorgen.
»Das wissen wir doch, Liebling. Wir haben uns überlegt, dass wir den Dachboden für deine Arbeit herrichten könnten? Was hältst du davon?« Dad lächelte mich an und er wirkte so hoffnungsvoll, dass ich gar nicht anders konnte, als zu nicken und ebenfalls zu lächeln, obwohl in meinen Augen Tränen brannten.
***
Seufzend kehrte ich zurück in die Gegenwart, merkte, dass meine Teamkameraden sich schon auf den Weg in die Umkleiden gemacht hatten und dass das Training ganz offensichtlich beendet worden war, ohne dass ich es gemerkt hatte. Hastig folgte ich den anderen Mädchen in die Umkleiden, ging duschen und machte mich schließlich nach einem gemurmelten Abschied auf den Weg nach Hause.
Als ich zwei Stunden zuvor mit dem Fahrrad zur Schule gefahren war, hatte noch die Sonne geschienen. Jetzt verdunkelte sich der Himmel. Wind kam auf und es schien, als würde es jeden Augenblick anfangen zu regnen.
Es war einer von diesen Nachmittagen, die ich sonst immer mit Amber im Kino verbracht hatte. Schon am Anfang der Ferien hatten wir uns jedes Jahr einen Ferienpass geholt, mit dem wir während der kommenden sechs Wochen günstiger ins Kino gehen konnten. Weil das Wetter hier auch im Sommer allgemein eher schlecht war, war das ein ziemlich gutes Ferienprogramm gewesen. Was gab es schon Besseres, als den lieben langen Tag mit der besten Freundin einen Haufen Filme zu gucken, Popcorn zu essen und Limonade zu trinken? Oft hatten wir ganz allein in den Kinosälen gesessen, sodass es niemanden gestört hatte, wenn wir den halben Film lang geredet und über Sachen gelacht hatten, die mit der Handlung, die vor uns über die Leinwand flimmerte, gar nichts zu tun hatten.
Mühsam schluckte ich meine Enttäuschung darüber, dass wir wohl nie wieder einen von diesen Nachmittagen miteinander verbringen würden, herunter.
Inzwischen hatte ich unser Zuhause erreicht. Ich liebte dieses kleine Haus, das Mum aller protestierenden Nachbarn zum Trotz weinrot hatte anstreichen lassen. Zusammen mit der weißen Haustür und den weißen Fensterläden strahlte es pure Gemütlichkeit aus.
Schon als ich den Flur betrat, konnte ich das Curry riechen, das Mum gerade kochte und ein wohliges, warmes Gefühl breitete sich in mir aus. Leise schloss ich die Haustür und lehnte mich dagegen, während mein Blick durch den Flur hin zum Wohnzimmer wanderte, dem Herzstück unseres Hauses.
Wenn man Buchhändler als Eltern hatte, bedeutete das zwangsläufig, dass das ganze Haus gefüllt war mit Büchern. Jede freie Fläche war mit Regalen vollgestellt, die fast aus allen Nähten platzten, so viele Bücher versuchten dort ihren Platz zu finden. Ich liebte unser Haus noch mehr als die Buchhandlung, denn das hier war wirklich voll und ganz mein Ort, mein Zuhause, ohne jede Einschränkung, wo es keine Unsicherheit und Schüchternheit gab. Hier war niemand, vor dem mir irgendwas unangenehm sein musste. Ein tiefes, zufriedenes Seufzen kam über meine Lippen.
Suchend schaute ich mich nach Dad um, doch er war nirgends zu entdecken. Wahrscheinlich war er noch oben im Arbeitszimmer und brütete über den Zahlen der Buchhandlung. Ich wollte ihn nicht stören, also ging ich zu Mum, die summend in der Küche am Herd stand.
Ich umarmte sie und drückte ihr einen Kuss auf die Wange.
»Hallo Schätzchen, alles in Ordnung?«, fragte sie und lächelte mich liebevoll an.
Ich nickte und stibitzte ein Stück Möhre, das vor ihr auf einem Brettchen lag. Kauend musterte ich sie, während sie im Topf herumrührte. Auf der hinteren Herdplatte kochte der Reis. Mum wirkte heute seltsam angespannt, ganz anders als sonst, und ich war mir ziemlich sicher, dass es nichts mit dem Geschäft zu tun hatte. Denn das ließ sie sich vor mir nur sehr selten anmerken. Sorge breitete sich in mir aus und ich musste unwillkürlich an die Zeit denken, als es Mum gar nicht gut gegangen war. Energisch schob ich den Gedanken zur Seite und atmete tief durch. Es ging ihr gut, sie war gesund, ich musste mir keine Sorgen machen. Nicht mehr.
»Und bei dir?«, fragte ich zurück. »Wie war es heute in der Buchhandlung?«
»Wie immer. Hör mal, Everly, wegen morgen …« Sie verstummte abwartend, während ich mich sofort versteifte. Morgen. Das war es also. Morgen war es soweit. Liam würde kommen und mir graute jetzt schon davor.
»Was ist mit morgen?«
»Freust du dich wenigstens ein kleines bisschen?« Hoffnungsvoll sah Mum mich an und ich knickte ein. Wie immer.
»Ich werde es versuchen, wenn er da ist«, versprach ich und zwang mich zu einem Lächeln, das zumindest ansatzweise echt wirkte.
»Das reicht mir. Ich nehme, was ich kriegen kann.« Mum lachte und ich fühlte mich sofort besser. Wenn sie lachte, konnte man gar nicht anders, als es zu erwidern.
Ich holte Teller und Besteck aus dem Küchenschrank und deckte den Tisch, bevor ich nach oben ging, um meinen Dad zum Essen zu holen. Mit schiefgelegtem Kopf und vor der Brust verschränkten Armen blieb ich im Türrahmen stehen und beobachtete ihn. Dads Arbeitszimmer war noch genau so, wie Grandpa es vor Jahren zurückgelassen hatte. Sogar der alte, zerschlissene Ledersessel in der Ecke gegenüber der Tür und der schwere dunkle Schreibtisch waren dieselben. Rechts an der Wand stand ein hohes Bücherregal, aus dem gleichen dunklen Eichenholz, aus dem auch der Schreibtisch gefertigt war. Hier im Arbeitszimmer standen auf den Regalbrettern jedoch keine Bücher, sondern unzählige Ordner, in denen alle Unterlagen, die in irgendeiner Weise die Buchhandlung betrafen, abgeheftet waren.
Dad saß am Schreibtisch, die Stirn in Falten gelegt. Seine Brille war seine Nase hinuntergerutscht und ich musste unwillkürlich lächeln, während ich ihn betrachtete. Seit wir hier wohnten, saß Dad jeden Abend vor dem Essen an diesem Schreibtisch, mit dem immer gleichen Ausdruck auf dem Gesicht und kümmerte sich um die Büroarbeit. Er war der unerschütterliche Fels in der Brandung, die Ruhe selbst und der perfekte Gegenpool zu meiner vor Energie sprühenden Mutter. Dad fand immer einen Weg absolut alles in Ordnung zu bringen und egal, was noch auf uns zukommen würde, mit Liam oder mit der Buchhandlung, ich wusste, auf ihn würde in jedem Fall Verlass sein.
***
Nach dem Essen ging ich zuerst in den Keller, um mein Badetuch und meinen Badeanzug aufzuhängen, und dann nach oben auf den Dachboden. Zwar war es schon zwei Wochen her, seit wir darüber gesprochen hatten, doch bis heute hatte ich mich davor gedrückt mir den Dachboden näher anzuschauen. Jetzt erinnerte ich mich auch wieder, wieso.
Seufzend blieb ich auf der letzten Stufe stehen und überblickte das Chaos, das dort herrschte. Hier oben lag alles, was sich in den letzten Jahren angesammelt hatte. Alte Schulsachen und Spielzeug von mir, Dekoration für jede Jahreszeit, sogar noch Sachen von Grandma, bei denen wir es bisher nicht übers Herz gebracht hatten sie wegzuwerfen. Und hier sollte ich mein kleines Reich einrichten? Das würde ein Haufen Arbeit werden. Ein großer Haufen. Aber ganz sicher nicht mehr an diesem Abend.
Ich kehrte dem Dachboden den Rücken zu und lief nach unten in mein Zimmer. Es war klein und vollgestopft, aber gemütlicher ging es kaum. Von den Wänden war nicht viel zu sehen, denn wie überall im Haus wurden sie von Bücherregalen verdeckt, die bis obenhin vollgestopft waren. Vor dem Fenster befand sich mein Schreibtisch, im Moment ordentlich aufgeräumt – zumindest bis die Schule wieder anfangen würde. Daneben stand mein Bett und über meinem Bett fanden sich auch die einzigen freien Plätze an den Wänden.
Vor drei Jahren hatte ich meine kreative Ader entdeckt und es war erst einige Monate her, dass ich die freien Flächen meines Zimmers dunkelblau gestrichen hatte. Über mein Bett hatte ich einen zunehmenden Mond gemalt und einhundertsiebzehn verschieden große Sterne, die jetzt von einer Menge Lichterketten angestrahlt wurden. Wenn es dunkel war, wirkte es so, als würden wirklich Sterne in meinem Zimmer erstrahlen.
Früher war meine Grandma jedes Mal, wenn mich Albträume aus dem Schlaf gerissen hatten, nachts mit mir in den Garten gegangen und hatte Sterne gezählt. Sie hatte mir Sternenbilder gezeigt, so lange, bis ich wieder müde genug gewesen war, um einschlafen zu können. Noch heute stellte ich mich in schlaflosen Nächten an mein Fenster und beobachtete den Sternenhimmel.
Doch mein ganzer Stolz war das riesige Mobile, das an der Zimmerdecke hing. Genau 73 Origamischwalben flogen dort oben. Es hatte Ewigkeiten gedauert alle zu falten und am Anfang war ich oft so frustriert gewesen, dass ich mehrere Male fast aufgegeben hatte. Doch mit der Zeit wurden die Schwalben immer besser und jetzt hatten alle ihren Platz gefunden. Nach den Wänden war die Decke dran gewesen, die ich in einem hellen Blau gestrichen hatte, sodass es jetzt aussah, als würden die Schwalben wirklich am Himmel fliegen. Ich liebte diese Vögel. Sie strahlten eine solche Anmut und Eleganz aus, wenn sie in Schwärmen über den Himmel zogen. Und deswegen flogen sie jetzt auch in meinem Zimmer.
Auf der Fensterbank standen meine selbstgemachten Kerzen. Es waren noch die ganz simplen, einfarbigen, ohne Duft, die ich gerade aufbrauchte. Drüben im Gästezimmer warteten die bunten, glitzernden und duftenden darauf endlich zu leuchten. In einer großen Kiste im Gästezimmer sammelten sich mehr Geburtstags- und Weihnachtskarten, als ich je verschicken können würde. Das Handlettering hatte, genauso wie das Falten von kleinen Origamitieren, etwas absolut Beruhigendes an sich und für mich gab es nach einem stressigen Tag kaum etwas Besseres, als mich im Gästezimmer an meinen zweiten Schreibtisch zu setzen und die Welt für ein paar Stunden hinter mir zu lassen.
Was ich ab morgen dann wohl vergessen konnte.
Am liebsten hätte ich mich in mein Bett gekuschelt, mir ein Buch genommen und mich für den Rest des Abends verkrochen, aber ich wusste, dass das nicht drin war.
Als hätte sie meine Gedanken gehört, klopfte genau in diesem Augenblick Mum an meine Tür, bewaffnet mit Staubsauger und Putzeimer, obwohl ich das Gästezimmer regelmäßig saubermachte. Doch das reichte jetzt anscheinend nicht.
»Hilfst du mir?«
»Oh ja. Genauso habe ich mir meine letzten Ferientage vorgestellt«, gab ich ironisch zurück, lächelte aber, um meinen Worten die Schärfe zu nehmen.
»Tut mir leid, Schatz, ich weiß ja, dass du dir das anders wünschen würdest. Und ich weiß auch, dass das alles sehr plötzlich kommt. Aber es war eine ziemlich komplizierte Situation und es stand lange nicht fest, welche Lösung wir überhaupt dafür finden würden. Ich verstehe, dass du sauer bist, weil wir dir erst davon erzählt haben, als im Grunde schon alles feststand. Aber wir wollten nicht, dass du dir zu viele Gedanken machst. Ich kenne dich doch, Everly!« Mum wirkte ernsthaft geknickt und ich bekam sofort ein schlechtes Gewissen.
»Ich weiß, Mum. Außerdem … Liam ist bestimmt nett und wir werden uns schon gut verstehen.« Ich legte allen Optimismus, den ich aufbrachte, in meine Stimme. Vielleicht würden wir uns ja wirklich gut verstehen. Dann würde ich mein letztes Schuljahr doch nicht allein verbringen müssen. Zumindest konnte ich mir das einreden.
***
Doch als ich Liam dann zum ersten Mal begegnete, war klar, dass jeder Optimismus vergebens war. Er war so eindeutig nicht darauf aus hier irgendwelche Freunde zu finden, dass es mir kalt den Rücken hinunterlief.
Ich beobachtete die Ankunft von Liam und seinen Eltern von meinem Fenster aus. Die ganze Familie stieg aus einem kleinen roten Auto, Andrew und Karen ziemlich beschwingt. Liam dagegen war ziemlich deutlich anzusehen, dass er überall lieber wäre als hier. Sein Gesicht konnte ich nicht erkennen, weil er sich die Kapuze seines Sweatshirts tief ins Gesicht gezogen hatte. Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt und die Schultern hochgezogen.
Unsere Eltern begrüßten sich freudestrahlend, dann holte Andrew zwei große Koffer aus dem Kofferraum des Autos und sie kamen ins Haus.
Eigentlich wäre es jetzt meine Aufgabe als gute Tochter gewesen hinunter zu gehen und unseren Gast zu begrüßen, aber ich wollte ein erstes Treffen um jeden Preis hinauszögern. Ich hasste es neue Leute kennen zu lernen und tat mich jedes Mal unendlich schwer damit, weil ich einfach sauschlecht darin war.
Leider war Mum da nicht auf meiner Seite. »Everly!«, rief sie laut von unten. »Kommst du?«
Ich seufzte schwer und überlegte, ob ich einfach so tun sollte, als hätte ich sie nicht gehört. Aber so etwas war nicht meine Art. Also verließ ich mein Zimmer und ging nach unten.
Abrupt blieb ich stehen, als ich die letzte Treppenstufe erreichte und direkt in Liams Gesicht sah. Er saß mit gesenktem Blick auf dem Sofa gegenüber der Treppe und befand sich so direkt in meinem Blickfeld. Mum stand bei Andrew und Dad, der seinem alten Freund eine Hand auf die Schulter gelegt hatte, während die beiden sich angeregt unterhielten. Karen saß neben Liam und musterte ihren Sohn besorgt. Aber ich konnte mir gar keine Gedanken darüber machen, warum sie sich Sorgen machen könnte, denn Liam blickte auf, schaute mich an und mein Denkvermögen setzte aus.
Er sah gut aus, verdammt gut sogar mit den dunklen Haaren, den durchdringenden blaugrünen Augen und Lippen, die jedes Mädchen zum Küssen einzuladen schienen. Aber ich konnte mich ebenso wenig auf sein gutes Aussehen konzentrieren, wie ich mich fragen konnte, warum seine Mutter sich sorgte.
Noch nie in meinem Leben hatte mich jemand so angesehen wie Liam und das brachte mich vollkommen aus dem Konzept.
Kapitel 3
Liam
Schon bevor ich hier angekommen war, hatte ich mir ein Bild von Everly gemacht. Meine Eltern hatten mir ohne Ende von ihr vorgeschwärmt, obwohl sie sie gar nicht wirklich kannten. Wahrscheinlich, um die ganze beschissene Situation irgendwie schönzureden. Aber das hatte nicht geholfen, es hatte einfach nur extrem genervt. Was allerdings noch mehr nervte, war, dass sie vermutlich recht hatten.
Everly Thomson, die gerade am Fuß der Treppe stehen geblieben war und mich anstarrte, als hätte sie einen Geist gesehen, wirkte wie die Perfektion in Person. Ihr hellbraunes Haar war zu einem ordentlichen Zopf geflochten. Sie trug enge Jeans, die ihre langen Beine betonten, dabei aber nicht zu eng waren und eine weiße Bluse, auf der nicht einmal die kleinste verfluchte Falte zu sehen war. Sogar aus einigen Metern Entfernung konnte ich erkennen, dass sie tiefbraune Augen hatte, die seltsam traurig wirkten. Ein Umstand, den ich sofort zu ignorieren versuchte. Das Einzige, was an Everly chaotisch war, waren die Sommersprossen, die wild auf ihren hohen Wangenknochen, ihrer Nase und Stirn tanzten. Aber das war es dann auch schon. Sogar ihre Körperhaltung, gerade, aufrecht und anmutig, grenzte an Perfektion.
Meine Eltern hatten mir erzählt, dass sie Turmspringerin war und so wie sie dastand, konnte man ihr diesen Sport definitiv ansehen. Unwillkürlich fragte ich mich, ob sie wohl auch mal lockerlassen konnte. Andererseits … wenn ich sie mir so ansah, erschien mir das ziemlich unwahrscheinlich. Ich konnte mir ein abfälliges Schnauben nicht verkneifen. Glaubten meine Eltern tatsächlich, dass es so einfach werden würde? Sie setzten mir ein langweiliges Strebermädchen vor die Nase und ich würde wie durch ein Wunder mein Leben in den Griff bekommen? Das konnten sie aber sowas von vergessen. Ich war gerade mal drei Minuten hier und hasste es jetzt schon wie die Pest.
Everly machte drei schnelle Schritte ins Wohnzimmer, ihre Wangen hatten sich leuchtend rot verfärbt und ich hatte den leisen Verdacht, dass sie mein Schnauben gehört hatte. Der Junge, der ich noch vor einem Jahr gewesen war, hätte sich geschämt und entschuldigt. Oder nein … er hätte sich überhaupt nicht so verhalten. Doch dem, der ich jetzt war, war es vollkommen egal, ob er ihre Gefühle verletzt hatte.
Mit glühendem Gesicht begrüßte sie meine Eltern, murmelte anschließend auch ein leises Hallo in meine Richtung – wobei sie mir allerdings nicht in die Augen sah – und setzte sich dann auf den Platz, der am weitesten von mir entfernt war. Mehr sagte sie nicht, stellte sich auch nicht vor und da es mir ohnehin egal war, was sie von mir dachte, brauchte ich es auch nicht zu tun. Ich beschloss, dass es definitiv Wichtigeres gab, als mich mit diesem Mädchen zu beschäftigen und wandte mich an meine Eltern.
»Ist das wirklich nötig? Ich bin echt alt genug, um allein zuhause zu bleiben«, sagte ich, darum bemüht meine Stimme möglichst gelangweilt und unbeteiligt klingen zu lassen. Wir hatten diese Diskussion schon unzählige Male geführt und ich hatte jedes Mal verloren. Wenn ich schon achtzehn wäre, dann hätten sie es mir erlaubt, hatten sie jedes Mal gesagt, was totaler Quatsch war. Auch dann hätten sie mich niemals allein zuhause gelassen. Was auch in Ordnung gewesen wäre. Wenn sie den ursprünglichen Plan durchgezogen hätten. Ich wusste nicht einmal, was sie dazu veranlasst hatte sich umzuentscheiden. Ich hatte mich nicht besser und nicht schlechter benommen als vorher, ihnen absolut keinen Grund gegeben von unserem ursprünglichen Plan abzuweichen. Bis vor knapp vier Wochen war geplant gewesen, dass ich während des letzten Schuljahres bei meinem besten Freund Simon unterkommen würde. Es wäre der absolut perfekte Plan gewesen und sogar seine Eltern hatten sich gefreut, dass ich bei ihnen wohnen sollte, vor allem, da sein großer Bruder erst letztes Jahr ausgezogen war.
Doch dann hatten Mum und Dad aus irgendwelchen Gründen, die sie mir bis heute nicht verständlich erklären konnten, ihre Meinung geändert. Die letzten Wochen waren ein einziger Kampf gewesen, sie wieder umzustimmen und ich hatte wirklich jede Diskussion zu dem Thema verloren. Auch jetzt glaubte ich nicht ernsthaft daran, dass meine Eltern sich noch umstimmen lassen würden, erst recht nicht, da wir schon bei den Thomsons angekommen waren, aber ich wollte allen klarmachen, dass ich mit dieser Lösung absolut nicht einverstanden war.
Mum warf mir einen scharfen Blick zu und strich sich das kinnlange dunkle Haar hinter die Ohren. Zum ersten Mal fielen mir vereinzelte graue Strähnen auf. Sie atmete einmal tief durch, bevor sie mir antwortete und ich hatte den Verdacht, dass sie sich zwingen musste mich nicht anzuschreien. »Es muss sein, Liam, und das weißt du!«
Ich verdrehte die Augen. »Das ist doch Bullshit! Kelsey wohnt nur zehn Minuten von Simon entfernt, da wären wir sogar näher beieinander, als wenn ich zuhause geblieben wäre.« Dabei war ich mir ziemlich sicher, dass meine Schwester absolut keine Lust hatte sich neben der Uni auch noch um ihren kaputten kleinen Bruder zu kümmern. »Und wenn ich einfach bei Simon hätte wohnen dürfen, hätten wir uns die ganze Diskussion sparen können.«
»Liam«, sagte Dad warnend und ich verkniff mir einen weiteren bissigen Kommentar. Ich sah, wie Nicolas und Jane einen Blick austauschten und konnte das leise Triumphgefühl, das in mir aufstieg, nicht unterdrücken. Das hatten die beiden sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Ich würde wetten, dass meine Eltern mich ihnen als netten Jungen verkauft hatten, der nur ein paar Probleme hatte. Nichts Ernstes. Hahaha. Wenn ich eins nicht war, dann das. Nicht mehr.
Ich warf einen kurzen Blick rüber zu Everly, die noch immer unsicher auf den Tisch starrte und sich nicht traute zu mir hochzusehen. Plötzlich überkam mich das dringende Bedürfnis sie so richtig zu ärgern. Aber dann hätten meine Eltern mich schneller auf dieses verfluchte Psychointernat geschickt, als ich blinzeln konnte. Das war nämlich meine Alternative hierzu gewesen. Nicht mein bester Freund und seine Familie, nicht mein bekanntes Umfeld. Sondern ein scheiß Internat. Und wenn es einen Ort gab, an dem ich noch weniger sein wollte als hier, dann war es diese Schule.
Everly hob den Kopf, sah mich an und zuckte zusammen. Unwillkürlich verdrehte ich die Augen und sie lief schon wieder feuerrot an. Also irgendwas war mit ihr definitiv nicht in Ordnung. Sie wirkte mehr als nur ein bisschen unsicher, auch wenn ich ihr zugestehen musste, dass sie meinem Blick dann doch für einen Moment standhielt. Zumindest, bis ich die Augenbrauen hochzog. Da sprang sie auf, fragte leise, ob irgendjemand etwas trinken wollte und verschwand in der Küche.
»Also Liam«, setzte Nicolas an und ich war überrascht über die Freundlichkeit in seiner Stimme, die ich mir mit meinem bisherigen Verhalten hier definitiv nicht verdient hatte. »Ich bin mir sicher, dass die ganze Situation nicht einfach für dich ist, aber ich denke, du wirst dich hier gut einleben. Vielleicht möchtest du dir erstmal dein Zimmer ansehen?«
Ich zuckte gleichgültig mit den Schultern. Über mein Zimmer hatte ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Es war mir bisher schlicht und ergreifend egal gewesen. Was mir nicht egal war, war die Tatsache, dass sie offenbar doch Bescheid wussten. Über das, was mir passiert war und was ich erlebt hatte. Sie wussten, wie kaputt ich wirklich war. Ich hasste es, wenn Leute davon wussten. Sie hatten dann alle den gleichen Ausdruck in den Augen. Diesen »Oh Gott, was musste der arme Junge nur durchmachen«-Blick, der in mir jedes Mal den Drang weckte mich augenblicklich zu übergeben. Ja, ich hatte ziemliche Scheiße erlebt. Ja, ich wünschte, ich könnte die Vergangenheit ungeschehen machen. Konnte ich aber nicht. Ich war am Arsch. So einfach war das.
Aber Nicolas und Jane hatten diesen Blick nicht. Sie schauten mich einfach nur offen und freundlich an, kein Mitleid, gar nichts. Nur pure Freundlichkeit.
Everly dagegen … Ich war mir nicht sicher, ob sie genauso Bescheid wusste. Sie hatte mich vorhin auch nicht so angesehen wie die meisten anderen, aber bei ihr konnte das auch durchaus einen anderen Grund haben. So wie sie sich benahm, wirkte sie nicht so, als würde sie andere Leute überhaupt gerne anschauen.
»Dann los«, forderte Nicolas mich auf und ich erhob mich widerstrebend. Als er und Jane mich nach oben führten – meine Eltern folgten uns – wurde mir klar, dass ich mir doch Gedanken über mein Zimmer hätte machen sollen.
Entsetzt keuchte ich auf, als ich durch die Tür in den Raum trat, in dem ich die nächsten zwölf Monate würde leben müssen. Das war doch wohl hoffentlich nicht ihr Ernst!
Eigentlich war es ein schlichtes, unaufgeregtes Zimmer, das zwar deutlich kleiner war als mein Zimmer zuhause, aber das störte mich nicht. Ich brauchte nicht viel Platz. Das Zimmer wäre vollkommen in Ordnung gewesen, wenn da nicht die hellgelben Wände wären, die mich jetzt schon in den Wahnsinn trieben. Das war die fröhlichste Farbe, die ich je gesehen hatte und zwar so ekelhaft fröhlich, dass ich mich am liebsten direkt übergeben hätte.
So wie Mum neben mir grinste, traute ich ihr zu die Thomsons dazu angestiftet zu haben die Wände in genau dieser Farbe zu streichen, nur um mich zu ärgern.
»Es ist nichts Besonderes, aber ich denke, es wird reichen«, sagte Jane sanft.
Wieso zum Teufel waren hier alle so nett? Erst Nicolas, dann Jane und ich konnte mir nicht vorstellen, dass Everly nicht nett war.
»Everlys Zimmer ist direkt nebenan, das Badezimmer ist den Flur hinunter, die letzte Tür auf der rechten Seite«, fuhr Jane fort. »Das Schlafzimmer von Nicolas und mir ist unten. Hier oben sind sonst nur noch ein Arbeitszimmer und die Treppe zum Dachboden.«
Na großartig. Das würde die Zeit meines Lebens werden.
»Dann hole ich wohl mal mein Zeug hoch«, sagte ich in der Hoffnung, dass meine Eltern den Wink verstehen und endlich verschwinden würden. Ich wollte jetzt einfach nur meine Ruhe haben.
Wir verließen mein neues Zimmer wieder und ich musste mich zwingen mich nicht angewidert zu schütteln, als wir den Flur hinunter gingen. Aus dem Augenwinkel sah ich gerade noch, wie nebenan die Tür zuging. Anscheinend hatte ich Everly erfolgreich vertrieben.
Unten verabschiedeten meine Eltern sich dann tatsächlich, nachdem wir die letzten beiden Kisten aus dem Auto geholt hatten, die neben den beiden Koffern ihren Platz im Kofferraum gefunden hatten. Viel war es nicht, nur Klamotten und Schulsachen, mein Laptop und diverser Kleinkram. Das Wichtigste hatten wir zu Hause lassen müssen, weil es schlicht und ergreifend nicht ins Auto gepasst hätte.
Mum und Dad umarmten zuerst Jane und Nicolas, bevor sie sich an mich wandten. Meine Mum schlang ihre Arme so fest um mich, dass mir für einen Moment der Atem stockte, obwohl sie fast einen ganzen Kopf kleiner war als ich.
»Das ist gut für dich, Liam. Da bin ich mir ganz sicher!«, flüsterte sie mir zu. Ausnahmsweise widersprach ich nicht, obwohl ich ganz anderer Meinung war. »Du kannst hier wieder zu dir selbst finden.«
Jetzt musste ich lachen. Es war ein gequältes Lachen, aber immerhin. War ja klar, dass sie es wieder mit solchen Lebensweisheiten versuchen würde. »Mum, sieh es endlich ein. Ich werde nie wieder derselbe sein, der ich war.«
Sie strich mir über die Wange und sah mich aus traurigen Augen liebevoll an. »Ich weiß. Aber vielleicht kommst du hier endlich darüber hinweg.«
Ich stöhnte auf und verdrehte genervt die Augen. Immer dieselbe Leier. Als ob das so einfach wäre. »Mum!«
»Jaja, schon gut. Wir sind schon weg. Sei lieb, ja? Ich weiß, dass du das kannst.« Sie lächelte mich noch einmal an und küsste mich auf die Wange. »Und tu mir den Gefallen und melde dich zwischendurch. Auch wenn es nur eine ganz kurze E-Mail ist. Ich hab dich lieb.«
Mein Ich dich auch blieb mir im Hals stecken. Seit fast einem Jahr hatte ich diese Worte nicht mehr über die Lippen gebracht. »Passt auf euch auf!«, sagte ich stattdessen.
***
Und dann waren sie weg und ich war allein. Allein bei dieser seltsam netten Familie, in diesem fürchterlichen gelben Zimmer, das mich mit seiner Fröhlichkeit geradezu zu verhöhnen schien. Ich warf mich auf mein Bett und fasste den Entschluss, dass ich dieses Jahr irgendwie überstehen würde. Ich würde alles tun, damit ich in Ruhe gelassen wurde und ich würde niemanden in dieser Familie näher kennenlernen als nötig. Ich hatte kein Bedürfnis nach einer Ersatzfamilie und wenn sie dachten, ich wäre freiwillig hier und würde mich schon eingewöhnen und dann auftauen, tja, dann hatten sie sich getäuscht.
***
Der erste Abend war grauenvoll. Beim Essen saßen wir alle gemeinsam in der Küche. Es war so unangenehm, dass ich es fast lustig gefunden hätte. Jane und Nicolas gaben sich wirklich Mühe ein Gespräch in Gang zu bringen, aber ich war nicht sonderlich interessiert und Everly schien in meiner Gegenwart der Mut zu fehlen den Mund aufzumachen. Auf Fragen meiner Gastgeber antwortete ich nur äußerst knapp. Ich war nicht in der Stimmung so zu tun, als wollte ich hier sein. Denn es gab nicht viel, das ich weniger wollte.
Das alles hier war vollkommen falsch. Ich sollte zuhause sein, bei meinen Freunden. Bei den Menschen, die mir Halt gaben. Das zumindest hatte ich versucht meinen Eltern weiszumachen. Dass sie mich nach allem, was passiert war, nicht auch noch aus meiner vertrauten Umgebung reißen und von meinen Freunden fernhalten durften. Genützt hatte es nichts. Was unter anderem daran lag, dass sie es für eine ausgesprochen gute Idee gehalten hatten, wenn ich mich nicht länger mit meinen Freunden herumtreiben konnte, die ihrer Meinung nach einen so schlechten Einfluss auf mich hatten.
Dabei waren gar nicht sie es, die mich beeinflussten. Es war genau anders herum. Ich war derjenige, der die anderen auf dumme Ideen brachte und sie mitzog. Ich war derjenige, der Mist baute, nur um den Kopf freizubekommen und für ein paar kurze Augenblicke alles vergessen zu können. Den ganzen Scheiß, den ich im letzten Jahr durchgemacht hatte und der mich immer noch verfolgte und nicht losließ, egal was ich versuchte.
Da nützte es auch nichts mich in eine andere Stadt zu verfrachten. Es würde nicht helfen. Ich hatte eher den Verdacht, dass dadurch alles schlimmer werden würde. Aber meine Eltern hatten nicht auf mich gehört. Gut, ganz verdenken konnte ich es ihnen nicht. Ich hatte es nicht so mit vernünftiger Argumentation. Im letzten Jahr war ich dafür oft viel zu wütend gewesen und hatte stattdessen viel rumgeschrien.
Und deshalb saß ich jetzt hier, in einer Küche, die ich nie hatte sehen und mit Menschen, die ich nie hatte kennenlernen wollen.
Doch schlimmer noch als dieses gezwungene Abendessen war die erste Nacht in meinem neuen Zimmer. Ich wälzte mich von einer Seite auf die andere und fand keinen Schlaf. Als würde ich mich noch nicht mies genug fühlen, stürmten Bilder auf mich ein, von denen ich mir gewünscht hätte, ich könnte sie einfach vergessen.
Und mit den Bildern kam der Schmerz. Der rein körperliche, von dem ich dachte, er würde langsam, aber sicher verschwinden, was er dann doch nie tat. Das heiße Brennen in meiner Brust, das sich jedes Mal so anfühlte, als würde meine Haut wieder aufreißen. Und dann war da noch der emotionale Schmerz, von dem ich wusste, dass er nie ganz verschwinden würde. Beides tat auf seine ganz eigene Weise höllisch weh und war manchmal kaum voneinander zu unterscheiden. So wie heute.
Die erste Welle traf mich unerwartet und ließ mich aufkeuchen. Mein Herz begann zu rasen, ich fühlte das hektische Pulsieren in jeder Faser meines Körpers. Dann bekam ich keine Luft mehr. Es war immer nur ein kurzer Moment, aber doch jedes Mal lange genug, um mich in nackte Panik zu versetzen. Dabei kannte ich die ganze Prozedur zur Genüge. Sie kam immer wieder. Und ließ sich nicht aufhalten.
Am ganzen Körper zitternd und nach Atem ringend, schlug ich die Bettdecke zurück, stand taumelnd auf und riss das Fenster auf. Nachts war es schon ziemlich frisch, obwohl der September noch nicht einmal begonnen hatte und die Luft traf kalt auf meine erhitzte, von Schweiß bedeckte Haut. Ich presste eine Hand auf mein rasendes Herz, nur Zentimeter von der langen Narbe entfernt, die sich von meiner Brust hinunter zu meinem Bauch zog. Mit der anderen Hand stützte ich mich am Fensterbrett ab und zwang mich stehen zu bleiben, während sich vor meinen Augen alles zu drehen begann.
Es dauerte eine ganze Weile bis der Schmerz abebbte, der in Wellen durch meinen Körper schoss und mich zittern ließ. Erst als mein Körper aufgehört hatte unkontrolliert zu beben, stolperte ich ungelenk zurück zu meinem Bett und ließ mich auf die Matratze fallen.
Das Fenster ließ ich auf. Die Luft fühlte sich inzwischen nicht mehr so kalt an, sie war eher eine federleichte Berührung, die über meine Haut strich. Gequält schloss ich die Augen, während die Bilder immer undeutlicher und schwächer wurden.
Was für ein absolut beschissener Start in einem absolut beschissenen Zimmer!
Kapitel 4
Everly
Ich bemühte mich, bemühte mich wirklich, aber es ließ sich nicht schönreden: Liam war ein Arsch. Ich gab mir während der ersten Tage redlich Mühe nett zu ihm zu sein, denn wenn ich etwas war und etwas wirklich gut konnte, dann war es nett zu sein. Auch wenn man das vielleicht nicht sofort merkte, weil ich nicht viel redete und am ersten Tag kaum ein Wort herausbekommen hatte.
Leider nützte das trotzdem herzlich wenig, wenn man es mit jemandem zu tun hatte, der einfach keine Lust hatte zu reden.
Am dritten Tag nach Liams Ankunft saß ich schon früh am Morgen mit Block und Brushpens bewaffnet am Küchentisch und arbeitete an einem Lettering, als er hereinkam. Seine Haare standen wild von seinem Kopf ab, er trug Sweatshirt und Jogginghose und sah auch sonst aus wie ein ganz normaler Junge. Ein Junge, mit dem man sich unterhalten könnte. Aber der missmutige Zug um seinen Mund hatte schon oft verhindert, dass ich mich traute ihn anzusprechen. Für heute hatte ich mir allerdings fest vorgenommen mich nicht wieder abschrecken zu lassen.
Liam warf mir einen kurzen Blick zu, zog die Augenbrauen hoch, als er die Stifte entdeckte und ging dann zum Kühlschrank, um sich was zu trinken einzuschütten.