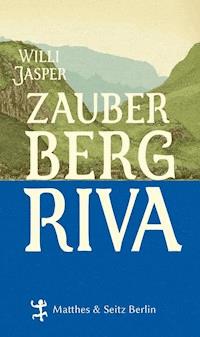Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BeBra Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 7. Mai 1915 torpedierte ein deutsches U-boot den Passagierdampfer "Lusitania", der von New York nach Liverpool unterwegs war. Binnen weniger Minuten versank das Schiff in den eisigen Fluten des Atlantiks und riss fast 1.200 Menschen in den Tod, darunter viele Kinder und Frauen. Mit dieser kaltblütig herbeigeführten Schiffskatastrophe bestätigten die Deutschen ihren Ruf als "Barbaren" und provozierten die USA zum Eintritt in den Ersten Weltkrieg. Gestützt auf anschauliche Zeitzeugenberichte und umfangreiches Archivmaterial legt Willi Jasper erstmals eine spannend geschriebene Kulturgeschichte dieses welterschütternden Ereignisses und seiner Folgen vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Willi Jasper
Lusitania
Kulturgeschichte einer Katastrophe
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CDROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
ebook im be.bra verlag, 2015
© der Originalausgabe:
be.bra verlag GmbH
Berlin-Brandenburg, 2015
KulturBrauerei Haus 2
Schönhauser Allee 37, 10435 Berlin
Lektorat: Robert Zagolla, Berlin
Umschlaggestaltung: Fernkopie, Berlin
ISBN 978-3-8393-0122-7 (epub)
ISBN 978-3-89809-112-1 (print)
www.bebraverlag.de
Inhalt
Einleitung
Bericht an Noah
Reeder und Admirale
Mythos »Titanic«
Moderne Wikinger?
Die »Risikoflotte«
»Wir fahren gegen En-ge-land«
Protokoll der Katastrophe
Die Tragödie der »Lusitania«
Die Gräber von Queenstown
Gospel in New York
Jubel und Entsetzen
Thomas Mann hat »nicht geflennt«
Erich Mühsam: »Übergreuelung der Greuel«
Karl Liebknechts Flugblatt
Täter und Opfer
Das Ende der »U-20«
Kriegswende und Mythen
»Malice in Kulturland«
»Unpolitische Betrachtungen« und Sonderwege
Zivilisationsliteraten
Kriegsmaler und Künstlerprotest
Epilog: »Entgrenzung« und Kontinuität
Quellen und Literatur
Der Old Head of Kinsale mit seinem markanten Leuchtturm.
Einleitung
Der Anblick des schroff in den Atlantik hineinragenden Felsens Old Head of Kinsale an der Südwestküste Irlands ist faszinierend. Die archaische Landschaft mit ihren Ruinen und dem weithin sichtbaren Leuchtturm als Wahrzeichen weckt Erinnerungen an die keltische Geschichte und ihre maritimen Mythen. Man glaubt aus dem Meeresrauschen und den Sphärenklängen des Windes uralte Gesänge herauszuhören. Selbst der mondäne amerikanische Golfclub, der hier seit einigen Jahren residiert, hat diese geheimnisvolle Atmosphäre nicht zerstören können. Seit über 2 000 Jahren ist der Old Head of Kinsale vor allem eine Aussichtsplattform für Küstenwachen und Landmarke für Seefahrer. Die Spitze der felsigen Halbinsel war vermutlich schon in vorchristlicher Zeit Standort eines Leuchtfeuers. Im 17. Jahrhundert übernahm ein einfaches Cottage mit offenem Kohlenfeuer auf dem Dach die Signalfunktion – und seit 1853 der elektrisch betriebene Leuchtturm mit seiner Feuerhöhe von 72 Metern. Doch nicht immer war dieser romantische Ort ein friedlicher und sicherer Wegweiser – er erinnert auch an furchtbare Schiffskatastrophen.
So fielen im September 1588 Tausende von spanischen Seesoldaten der Schlacht um England zum Opfer. Vor den Küsten Irlands und Schottlands verlor die spanische Armada fast die Hälfte ihrer Schiffe. Seeleute und Soldaten ertranken unter Deck oder kenterten mit ihren Landungsbooten. Andere sprangen über Bord und tauchten nie wieder auf. Im tobenden Meer klammerten sich Verzweifelte an Fässer und Balken. Aufgewirbeltes Treibgut zerschlug ihnen die Glieder und manchem Kapitän, Offizier oder katholischem Würdenträger wurde das Gewicht der am Leib getragenen Goldketten und Geldbeutel zum Verhängnis. Es waren weniger die englischen Kanonen, vielmehr ein gewaltiger Sturm mit turmhohen Wellen, der die schwerfälligen spanischen Dreimaster versenkte und Wracktrümmer und Leichen von der Bantry Bay bis zum Old Head of Kinsale spülte. Am Ufer hatten sich Einheimische und Soldaten der englischen Königin, die auch über Irland herrschte, versammelt. Einige tanzten vor Freude über den Untergang der Spanier, andere verfluchten die protestantische Macht.
In besonderem Maße aber sind die modernen Tragödien der beiden britischen Riesendampfer »Titanic« und »Lusitania« im historischen Bewusstsein der Menschen dieser Küstenregion verwurzelt. Für beide Schiffe sollte der Leuchtturm zu einem trügerischen Fanal werden – der Aufbruchshoffnung ebenso wie der Ankunftsfreude. Nicht nur Friedhöfe, Museen und Denkmäler erinnern an diese Schiffslegenden, sondern auch Touristenshops, Pubs, Restaurants und Hotels. Das Zentrum des Erinnerungskultes bildet die Hafenstadt Cobh (früher Queenstown) mit ihrem Museum zur Geschichte der irischen Diaspora (»Cobh Heritage Centre«), einem organisierten »Titanic-Trail«, dem monumentalen Ehrenmal für die Opfer der »Lusitania«-Katastrophe sowie mit den markierten Grabstätten auf dem »Clonmel Cemetery«.
Cobh war die letzte Station der »Titanic« vor ihrer schicksalhaften Atlantiküberquerung und wurde auch zum Friedhof für die Opfer der »Lusitania«. Von hier aus hat in den beiden letzten Jahrhunderten fast die Hälfte der insgesamt sechs Millionen irischen Emigranten ihre Heimat verlassen. Auch die »Titanic« hatte als Passagiere der dritten Klasse eine größere Gruppe von Auswanderern aufgenommen. Als das Schiff dann am 11. April 1912 den Leuchtturm von Old Head of Kinsale passierte, winkte man zum Abschied, ohne zu ahnen, dass nie wieder Land in Sicht kommen würde. Die »Titanic« sollte ihren Zielhafen New York nicht erreichen. Nach der Kollision mit einem Eisberg in der Nacht vom 14. zum 15. April versank das für »unsinkbar« erklärte Technik-Wunder nicht nur im fast 4 000 Meter tiefen, eiskalten Wasser vor Neufundland, sondern auch im kollektiven Unterbewusstsein der Zeitgenossen. Von den 2 207 Menschen, die an Bord waren, überlebten nur 712.
Anders als frühere Schiffskatastrophen, die kaum zur Mythenbildung taugten, wurde die »Titanic«-Tragödie zur modernen Menschheitsfabel. Auch Deutschland, Englands Hauptkonkurrent auf der Transatlantik-Route, zeigte sich betroffen. »Das größte Schiffsunglück der Welt trifft die ganze Menschheit«, schrieb das Hamburger Fremdenblatt – hoffte aber dennoch, dass die Menschheit sich »in ihrem prometheischen Drange durch keine Schicksalsschläge« vom »Glauben an den Fortschritt« und die »Bezwingung der Naturkräfte« zurückhalten lassen würde.
Drei Jahre später ereignete sich nur elf Seemeilen vor dem Old Head of Kinsale eine ähnlich bewegende Katastrophe. Sie traf den Passagierdampfer »Lusitania«, der sich auf der Fahrt von New York nach Liverpool befand. Auch er fuhr unter britischer Flagge und war – was Größe, Technik und Ausstattung betraf – mit der »Titanic« vergleichbar. Doch Vorgeschichte und Umstände des Untergangs der »Lusitania« waren andere und die Konsequenzen folgenreicher. 1915 befand sich die Welt im zweiten Kriegsjahr. Es ging längst nicht mehr nur um einen friedlichen technischen Wettbewerb zur »Bezwingung der Naturkräfte«, sondern um eine mörderische Konkurrenz sowohl in der Waffenproduktion als auch in der Effizienzsteigerung bei der Massenvernichtung von Menschen. Für die Durchbrechung der englischen Seeblockade waren die deutschen U-Boote zur wichtigsten und unheimlichsten Waffe des Reichsmarinechefs Alfred von Tirpitz geworden. Mit der Praktizierung des unbeschränkten U-Boot-Krieges wurden auch zivile Schiffe bedroht.
So kam es gegen Mittag des 7. Mai 1915 vor der irischen Küste zu jener schicksalsschweren Begegnung zwischen der »U-20« und der »Lusitania«. Ohne Vorwarnung gab der deutsche U-Boot-Kapitän den Feuerbefehl. Der Torpedo traf das Passagierschiff steuerbords, knapp hinter der Brücke, zwischen dem ersten und zweiten Schornstein. Wenig später ereignete sich eine zweite Explosion im Innern des Schiffs, der Ozeanriese geriet sofort in eine Schräglage und sank binnen 18 Minuten. Zum Vergleich: Die »Titanic« brauchte fast drei Stunden für ihren Untergang. Zum geordneten Herunterlassen der Rettungsboote blieb auf der sinkenden »Lusitania« kaum Zeit, eine unvorstellbare Panik brach aus. Während im chaotischen Gedränge einige Rettungsboote umstürzten und Menschen unter sich begruben, sprangen andere Passagiere ohne Schwimmwesten ins kalte Wasser. Der überlebende amerikanische Geschäftsmann Michael G. Byrne berichtete: »Ich wartete, bis das Wasser in gleicher Höhe mit dem Hauptdeck war, und sprang dann über Bord. Im Wasser war der Anblick von Frauen mit Kindern und Babys in ihren Armen fürchterlich. Die Luft war von Schreien erfüllt, und Mütter flehten Personen in den Booten an, ihre Babys zu übernehmen.« 1 198 Menschen, darunter 270 Frauen und Kleinkinder, versanken mit dem Schiff. Unter den Toten waren auch 128 amerikanische Staatsbürger.
Während die Menschen zu Tode stürzten, ertranken und die See sich langsam mit Leichen und Leichenteilen füllte, betrachtete der deutsche U-Boot-Kapitän die Szene durch sein Periskop. Als er genug gesehen hatte, ließ er abtauchen. Ein derartiges Geschehen, die kaltblütige Torpedierung eines großen Passagierdampfers ohne Vorwarnung, hatte es in diesem Krieg noch nicht gegeben. Dass der versenkte britische Dampfer den antiken Namen einer hispanischen Provinz trug, der an die Seeschlacht von 1588 erinnerte, ist in diesem Zusammenhang nicht ohne makabre historische Symbolik.
In Deutschland, wo man sich über den Untergang der »Titanic« noch schockiert gezeigt hatte, brach jetzt überwiegend Jubel aus. Kronprinz Wilhelm telegrafierte aus seinem Hauptquartier an den kaiserlichen Vater: »Hier große Freude über die Torpedierung der Lusitania … Je rücksichtsloser der U-Boot-Krieg geführt wird, desto schneller wird der Krieg beendet sein.« Auch viele deutsche Zeitungen brachten triumphierende Kommentare, so zum Beispiel die Westfälische Tageszeitung: »Endlich ist unseren U-Booten ein großer Fang gelungen … Wir Deutschen freuen uns von ganzem Herzen über den gelungenen Schlag und sehen dem allgemeinen Wutgeheul und Entrüstungsschrei kühl lächelnd entgegen … Keine Sentimentalität; Kampf bis aufs Messer mit dem gemeinen Krämervolk …!« Selbst Thomas Mann schloss sich dem schaurigen Jubel über den Untergang der »Lusitania« an.
Denkmal in Cobh zu Erinnerung an die Opfer der »Lusitania«-Katastrophe.
Demgegenüber wurde die Nachricht von der Versenkung der »Lusitania« von der Presse in Großbritannien, den USA und in anderen Krieg führenden oder neutralen Ländern mit Fassungslosigkeit aufgenommen. In den unterschiedlichsten politischen Lagern herrschte nicht nur maßlose Empörung über das ungeheure menschliche Ausmaß der Katastrophe, sondern man zeigte sich vor allem entsetzt über das Ende des bisher praktizierten Unterschieds zwischen Kombattanten und Zivilisten. Beispielhaft fasste der Präsident der Universität von Virginia die amerikanischen Empfindungen zusammen: »Es gab ein betäubtes Erstaunen darüber, dass eine derartig demonstrative Rohheit und Grausamkeit das Vorgehen einer großen Nation prägen kann.« Titelseiten von Zeitschriften brachten Zeichnungen, auf denen die ertrunkenen Kinder als anklagende Geister den deutschen Kaiser verfolgen. Die aufgestauten Emotionen entluden sich im gesamten angelsächsischen Bereich in deutschfeindlichen Ausschreitungen.
Vor dem Untergang der »Lusitania« hatte es keine organisierte politische Kraft in den Vereinigten Staaten gegeben, die eine Teilnahme am Krieg befürwortete. Der Tod der 128 Amerikaner verschob die politischen Gewichte nun dramatisch. In den Augen der schlagartig wachsenden Gruppe der Militanten war der Konflikt zwischen amerikanischer Demokratie und deutscher Autokratie nun unausweichlich geworden.
Der Untergang der »Lusitania« beschäftigt die Öffentlichkeit wie die Wissenschaftler seit nunmehr 100 Jahren. Aber wichtige Fragen sind immer noch nicht beantwortet worden. Bezeichnenderweise haben sich bisher nur angelsächsische Autoren mit der Thematik befasst. Ihnen ging es fast ausschließlich um die Be- oder Widerlegung von Verschwörungstheorien, so vor allem um die Rolle Churchills in der britischen Admiralität. Man warf ihm vor, er habe den Untergang des Schiffes absichtlich inszeniert, um die Amerikaner gegen Deutschland aufzubringen. Mit großem technischen und publizistischen Aufwand wurden Taucherexpeditionen organisiert, um im Wrack der »Lusitania« nach belastenden Munitionskisten und anderen Spuren von Verstößen gegen das Kriegsrecht zu suchen. Aber bis heute dreht sich diese Debatte im Kreis. Eine umfassende Aufarbeitung der Kulturgeschichte dieser Katastrophe (zumal aus deutscher Sicht) fehlt immer noch, obwohl der Untergang der »Lusitania« mehr als andere Ereignisse eine symbolhafte und konkrete Bedeutung für die Wende im Krieg hatte. Es ging nicht nur um die militärische Erweiterung der Kriegsparteien, Konfliktbereiche und Schlachtfelder, sondern vor allem um eine neue ideologische, moralische und religiöse Dimension des Kampfes »deutscher Kultur« gegen »westliche Zivilisation«. Die Radikalisierung einer verhängnisvollen Kulturmission und Bildungsreligion setzte sich fort und sollte eskalieren. Betrachtet man den Ersten Weltkrieg mit dem amerikanischen Diplomaten und Historiker George F. Kennan als »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts«, dann könnte man die folgenreiche Versenkung der »Lusitania« als »Urkatastrophe« beider Weltkriege ansehen – als Beginn der »Entgrenzung« totalitärer Gewalt.
Bericht an Noah
Reeder und Admirale
Schon Planung und Bau der »Lusitania« gehören zur (Kultur-) Geschichte des militanten Wettstreits der Großmächte. England, seit Ende des 17. Jahrhunderts die führende Seemacht, sah sich um die Wende zum 20. Jahrhundert einer wachsenden Konkurrenz aufstrebender Staaten wie des Deutschen Reichs und der USA ausgesetzt. Neben den Aktivitäten der »Hamburg-Amerika-Linie« (HAPAG) und des »Norddeutschen Lloyd« war es der Monopolisierungsdrang des amerikanischen Bankiers John Pierpont Morgan (so durch dessen Übernahme der »White Star Line« im Jahr 1902), der die englische Vorherrschaft im internationalen Reeder-Geschäft in Frage stellte. Bedroht sah sich vor allem die Cunard-Linie. Sie war 1840 von dem kanadischen Kaufmann Samuel Cunard zusammen mit einigen kapitalkräftigen Partnern in Southampton als »British and North American Royal Mail Steam Packet Company« gegründet worden. Mit ihren ersten Schiffen »Britannia«, »Acadia«, »Caledonia« und »Columbia« beförderte sie nicht nur die englisch-amerikanische Überseepost, sondern operierte bald als weltweites Unternehmen der Passagier- und Frachtschifffahrt. 1877 wurde die Reederei in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und nannte sich fortan »Cunard Steamship Company Ltd«. Mit diesem Namen verband sich nicht zuletzt ein guter Ruf in Auswandererkreisen. Durch ihren Beitrag zur Entwicklung der Dampfschifffahrt hatte die Cunard-Linie auch erheblichen Anteil an der Verbesserung des Loses der Auswanderer.
Die große Auswanderungswelle von Irland nach Amerika um die Mitte des 19. Jahrhunderts war noch unter katastrophalen Bedingungen erfolgt. Hunderttausende wurden von einer durch Misswirtschaft und Willkür der Großgrundbesitzer verursachten Hungersnot zur Emigration gezwungen. Für die Überfahrt mussten sie sich nicht selten sogenannten »schwimmenden Särgen« anvertrauen: Es gab genügend skrupellose Schiffseigner, die die Not der armen Menschen ausnutzten, indem sie kaum seetüchtige, hölzerne Windjammer für ihr Auswanderungsgeschäft einsetzten. Die »Passagiere« wurden wie Vieh in enge Zwischendecks gepfercht und mussten je nach Wetterlage eine qualvolle Reisedauer von 40 bis 80 Tagen erdulden. Allein zwischen 1847 und 1853 gingen auf der Überfahrt von Irland/England nach Amerika 60 Auswandererschiffe unter. Selbst wenn die morschen Schiffe ihr Ziel erreichten, bestand für die Auswanderer die Gefahr, aufgrund der elenden hygienischen Bedingungen und der schlechten Ernährung an Typhus, Cholera oder Ruhr zu erkranken.
Der technische Fortschritt, den die eisernen Dampfschiffe bedeuteten, begünstigte natürlich die Auswanderungsmöglichkeiten erheblich. Man war jetzt relativ unabhängig von Wind und schlechter Witterung und fand an Bord auch menschenwürdigere Unterbringung. So konnte Cunards erster Eisendampfer »Persia«, der mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 13,41 Knoten im April 1856 das »Blaue Band« – die Auszeichnung für die schnellste Überquerung des Atlantiks – eroberte, »bei einer Ladungsfähigkeit von 3 600 Tonnen«, so ein begeisterter Bericht des »Polytechnischen Journals«, »sehr bequeme Räumlichkeiten für 260 Cajütenpassagiere« anbieten. Beeindruckend erschien dem Journal vor allem die Zuverlässigkeit des noch mit Schaufelrädern ausgestatteten Dampfers. Die »Persia« bestärke den guten Ruf der Cunard-Linie, »deren Schiffe die Reise zwischen Liverpool und New York in einem Zeitraum von beiläufig zehn Tagen mit solcher Pünktlichkeit zurücklegen, dass, sollte eins von ihnen nur eine Stunde über die festgesetzte Zeit ausbleiben, dies alsbald Unruhe in der Handelswelt von London, Liverpool, Manchester etc. erzeugen würde. Sie ist das größte Dampfschiff, welches bis jetzt einen See befahren hat, und unter Schiffen dieser Compagnie das erste aus Eisen gebaut, da die britische Regierung in Berücksichtigung, dass diese Schiffe möglicherweise zu Kriegszwecken verwendet werden könnten, früher nicht gestattete solche Schiffe aus Eisen herzustellen – eine Ansicht, die allmählich aufgegeben worden ist.«
Traditionell dominierten britische Reedereien den transatlantischen Personenverkehr. Plakat der Cunard-Linie aus dem Jahr 1875.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts konnte die Dauer einer Atlantik-Überquerung auf sechs bis sieben Tage heruntergedrückt werden. An diesen Geschwindigkeitsrekorden waren die Cunard-Schiffe maßgeblich beteiligt, so auch die »Lucania«, die 1894 das »Blaue Band« erhielt. Als diese begehrte Trophäe dann ausgerechnet 1897, im Jubiläumsjahr der Krönung von Königin Victoria, an den deutschen Lloyd-Dampfer »Kaiser Wilhelm der Große« fiel (der sie 1900 an die »Deutschland« der HAPAG weitergab), traf das den britischen Stolz schwer. Daher bat der Cunard-Präsident Lord Inverclyde die Regierung um effektivere finanzielle Unterstützung. Auch die Admiralität der Royal Navy befürwortete das Ersuchen, da sie sich vom Bau neuer Schnelldampfer selbst Nutzen versprach. Am 13. August 1903 beschloss das Unterhaus, für den Bau zwei moderner Schiffe einen Kredit in Höhe von 2,6 Millionen Pfund Sterling mit einem niedrigen Zinssatz für eine 20-jährige Laufzeit zu gewähren. Gleichzeitig sicherte sich die Admiralität in einem geheimen Zusatzabkommen mit Cunard ihre militärischen Interessen. Darin ging es in erster Linie um Auflagen zum Schutz der Maschinen und die Gewährleistung einer Requirierung der Schiffe im Kriegsfall. Um einen möglichen feindlichen Granatenbeschuss zu erschweren, sollten alle wichtigen technischen Anlagen vollständig unterhalb der Wasserlinie angeordnet und zusätzlich durch vorgelagerte Kohlenbunker geschützt werden.
Mit den zentralen Entwürfen wurde der Schiffsbauingenieur Leonard Peskett beauftragt – den Bau der »Lusitania« übernahm die Werft »John Brown & Co« im schottischen Clydebank, das Schwesterschiff »Mauretania« entstand bei »Swan Hunter & Co« im nordenglischen Newcastle upon Tyne. Die beiden neuen Cunard-Schiffe sollten selbstverständlich die größten, schnellsten und luxuriösten Schiffe der Welt werden. Erstmals wagten die Konstrukteure den Einsatz der neuen Dampfturbinen-Technologie und eine Anordnung von vier Schrauben bei Schiffen dieser Größenordnung. Die technische Ausstattung und die Maße beider Schiffe waren nahezu identisch.
Die »Lusitania« lief am 7. Juni 1906, fünf Monate vor ihrer »Schwester«, vom Stapel. Sie bot 2 000 Passagieren und 850 Besatzungsmitgliedern Platz und war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich das größte Schiff der Welt. Die »Lusitania« erreichte eine Länge von 240 und eine Breite von 27 Metern, ein Volumen von knapp 32 000 Bruttoregistertonnen (BRT) sowie eine Maschinenleistung von 76 000 PS. Die Turbinen erhielten ihre Energie aus insgesamt 25 Kesseln, die pro Tag etwa 1 000 Tonnen Kohle benötigten und pro Minute mit 250 000 Litern Wasser gekühlt werden mussten. Da der Reederei die Geschwindigkeit das Wichtigste war, verlangte sie von der Werft die Garantie eines Limits von 24,5 Knoten. Bei Unterschreitung dieser Leistung sollte jeder verfehlte Zehntelknoten mit einer Konventionalstrafe von 10 000 Pfund Sterling belegt werden. Die geforderte Geschwindigkeit wurde schon bei der ersten Probefahrt in der Irischen See mit 26,4 Knoten übertroffen, doch dabei stellte sich ein Konstruktionsmangel heraus: Das Heck des Schiffes begann bei hoher Geschwindigkeit so heftig zu vibrieren, dass Stahlplatten und Träger in einem Bereich der Zweite-Klasse-Kabinen kräftig durchgeschüttelt wurden.
Bei ihrer Jungfernfahrt im Herbst 1907 war die »Lusitania« das größte Passagierschiff der Welt. Auf 240 Meter Länge bot sie 2 000 Passagieren Platz.
Innerhalb eines Monats gelang es den Ingenieuren Rumpf und Aufbauten der »Lusitania« in diesem kritischen Bereich mit neuen Verstrebungen so zu verstärken, dass schließlich insgesamt vier Millionen Nieten das Schiff erschütterungsfrei zusammenhielten. Bei der »Titanic« waren es einige Jahre später »nur« drei Millionen.
Auch im Hinblick auf Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit lag die »Lusitania« vorn. Ihr Wendekreis umfasste nur 870 Meter, während die »Titanic« 1 175 Meter benötigen sollte. Besonders angetan waren Fachleute von der Möglichkeit, das Unterschiff per elektrischem Knopfdruck durch Quer- und Längsschotten wasserdicht abzuschließen. Dadurch sei die »Lusitania«, wie die New York Times schrieb, »so unsinkbar, wie ein Schiff nur sein kann«. Das hatte man auch von der »Titanic« behauptet. Robert D. Ballard, der Entdecker des »Titanic«-Wracks, glaubt jedoch, dass die »Lusitania« stabiler als die »Titanic« gewesen sei und eine vergleichbare Eisbergkollision überstanden hätte.
Für die Innenausstattung der beiden Cunard-Schwesterschiffe waren zwei verschiedene Innenarchitekten zuständig – der Schotte David Millar für die »Lusitania« und der auch als Gartendesigner bekannte Harald A. Peto für die »Mauretania«. Beide waren bemüht, das Beste an Materialien, Entwürfen und Handwerkskunst zu liefern, was ihre Zeit zu bieten hatte. Für die Dekoration der Gesellschaftsräume der Ersten und Zweiten Klasse wurden unter anderem afrikanisches Mahagoni, französische Walnuss, österreichische Eiche und spanische Platane verarbeitet.
Während Peto bei der »Mauretania« mit dunklen Holzfarben eine eher konservativ-britische Tradition betonte, orientierte sich Millar auf der »Lusitania« mit vielen weißen Elementen am italienischen und französischen Stil. So erinnerte der weiß-goldene Speiseaal der Ersten Klasse mit seiner hohen stuckverzierten Kuppel unverkennbar an das Versailler »Petit Trianon« Ludwigs XIV. Auch die anderen öffentlichen Räume auf dem Deck der Ersten Klasse waren mit riesigen zylindrisch gewölbten und kunstvoll verzierten Buntglasdächern ausgestattet, durch die wunderbar farbiges Licht einfiel. Das Verandacafé mit seinen Pflanzen und Palmenkübeln glich einem eleganten südlichen Straßencafé – und das Foyer, der Rauchsalon, die Lounge (mit Musikdarbietungen) und vor allem die beiden mondänen »Royal Suites«, zu denen neben zwei Schlafzimmern, Bad und separater Toilette noch ein eigenes Esszimmer sowie ein privater Salon gehörten, konnten mit jedem Luxushotel konkurrieren. Das hatte natürlich seinen Preis: Für eine einfache Passage in der »königlichen« Suite verlangte Cunard 4 000 Dollar, das war damals mehr als das Hundertfache eines durchschnittlichen Arbeiterlohns.
Die Innenausstattung der »Lusitania« konnte mit jedem Luxushotel konkurrieren. Zeitgenössische Darstellung des Speisesaals der Ersten Klasse.
Auch die Zweite Klasse im hinteren Teil des Schiffes gab sich mit ihrem ebenfalls kuppelgekrönten Speisesaal, einem Rauchsalon sowie einem Leseraum »für Damen« einen überaus glanzvollen Anstrich. Selbst die Dritte Klasse im vorderen Schiffsteil verfügte über separate öffentliche Aufenthaltsräume, auch wenn die 4- bis 6-Bett-Kabinen gegenüber dem First-Class-Luxus relativ spartanisch erscheinen mochten. Im Vergleich zu den unhygienischen Massenunterkünften in den Zwischendecks älterer Schiffe, bedeuteten aber auch sie zweifellos eine erhebliche Verbesserung des Komforts. In den riesigen Kombüsen des Schiffes – mit ihren zusätzlichen Teeküchen, Bäckereien, Speisekammern und Kühlräumen – wurden täglich bis zu 10 000 Mahlzeiten zubereitet. Die Menü-Angebote in der Ersten und Zweiten Klasse unterschieden sich durch die Raffinesse der Zubereitung, aber kaum durch Qualität – und auch für die Dritte Klasse wurde nahrhafte Kost garantiert. Die medizinische Betreuung an Bord der »Lusitania« war für alle Passagiere kostenlos. Es gab ein Schiffslazarett mit vier Abteilungen und sogar eine Isolierstation für ansteckende Krankheiten. Auswanderinnen, die ein Kind erwarteten, planten ihren Ausreisetermin oft so, dass sie mit einer ärztlichen Geburtshilfe an Bord der »Lusitania« rechnen konnten. Diese ungewöhnliche Verbindung von Luxus und Solidargemeinschaft veranlasste den US-Senator George Sutherland anlässlich der Jungfernfahrt im Jahr 1907 zu dem Lob: »Die ›Lusitania‹ ist schöner als Salomons Tempel und groß genug, all seine Frauen und Schwiegermütter zu beherbergen.«
Als das bewunderte Schiff am Abend des 7. September 1907 zur ersten großen Fahrt aufbrach, hatten sich im Hafen von Liverpool Tausende von jubelnden Menschen und eine große Zahl von Presseleuten zum Abschied versammelt. Sie alle hofften auf die Rückeroberung des »Blauen Bandes« schon bei der Jungfernfahrt. Doch unerwartet schlechte Wetterbedingungen verhinderten eine Entthronung der »Deutschland«. Nur 30 Minuten fehlten der »Lusitania« an einem neuen Rekord, als sie am 13. September in New York eintraf. Dennoch war auch hier die Begeisterung groß. Als das Schiff vor seiner Rückreise zur Besichtigung freigegeben wurde, war der Ansturm der Schaulustigen kaum zu bewältigen.
Zu den Bewunderern gehörte auch Mark Twain, der seiner Begeisterung über den Sicherheitsstandard der »Lusitania« eine mythische Dimension verlieh: »Ich denke, ich werde Noah davon erzählen müssen, wenn ich ihm begegne.« Der weltberühmte Autor konnte auf eigene Erfahrungen als Lotse und Steuermann auf einem Mississippi-Dampfer zurückblicken und hatte sein Schriftsteller-Pseudonym »Mark Twain« (das Rufsignal für »zwei Faden Wassertiefe«) bewusst der Seemannssprache entlehnt. Sein Hinweis auf die Arche Noah war jedoch nicht nur als Lob der modernen Technologie und des multikulturellen Milieus auf dem Auswandererschiff »Lusitania« gedacht, sondern auch als Erinnerung an die Doppeldeutigkeit des biblischen Wortes »Arche« als Palast und Sarg.
Das »Blaue Band« holte sich die »Lusitania« dann bei ihrer zweiten Linienfahrt im Oktober. Sie erreichte eine Dauergeschwindigkeit von über 24 Knoten und benötigte für die Atlantiküberquerung weniger als fünf Tage. Vier Wochen später berichten die Zeitungen über einen weiteren Rekord des Schiffs – diesmal ging es um den Wert der Fracht. Im November 1907 transportierte der Cunard-Liner eine Ladung von 20 Tonnen Gold im Wert von 2,5 Millionen Pfund Sterling (heute etwa 650 Millionen Euro) unbeschadet über den Ozean. Im Februar 1909 bekam die »Lusitania« aber auch Gelegenheit, sich im Sinne Mark Twains als sichere Arche zu beweisen. Sie traf in New York erst zwei Tage später als geplant ein, weil sie unterwegs von bis zu 25 Meter hohen Wellen bedrängt worden war. Zwar ging der Steuerbordanker verloren, und die Brecher beschädigten die Kommandobrücke, Teile der Aufbauten und die Funkantenne, doch Crew und Passagiere kamen mit dem Schrecken davon. Der Ruf der »Unsinkbarkeit« der »Lusitania« war nach dieser Fahrt gefestigt. Konkurrenz machte ihr nur die Schwester »Mauretania«, die ihr auch im September 1909 das »Blaue Band« abnahm. Doch dieser Wettbewerb in der eigenen Familie schadete in keiner Weise den Geschäftsinteressen der Reederei. Anders wurde die Situation für Cunard, als 1910/1911 bei der »White Star Line« mit der »Olympic« und der »Titanic« zwei Schiffe vom Stapel liefen, deren Größe und Ausstattung neue Maßstäbe setzten. Allerdings stand ihr Einsatz von Anfang an unter einem unglücklichen Stern.
Kapitän Edward John Smith, der später auch das verhängnisvolle Kommando über die »Titanic« übernahm, schrammte schon während der Probefahrten mit der »Olympic« den Hafenkai von Liverpool. Und im September 1911 kollidierte das neue Schiff vor der Isle of Wight mit dem Panzerkreuzer »Hawke«, was eine Reparatur von mehrmonatiger Dauer zur Folge hatte und auch die Fertigstellung der »Titanic« verzögerte. Und als die Jungfernfahrt der »Titanic« schließlich am 10. April 1912 beginnen konnte, sollte sie vier Tage später in der Eisberg-Katastrophe enden.
Mythos »Titanic«
Warum haben die Deutschen den Untergang der »Titanic« beweint und die Versenkung der »Lusitania« bejubelt? Die »Titanic« war nicht »einzigartig«, sondern erst ihr Untergangs-Mythos machte sie dazu. Aber wie entstand er? Was war das Mythische am Untergang der »Titanic«? Havarien von Passagierdampfern auf der Nordatlantik-Route und selbst Kollisionen mit Eisbergen waren damals nichts Außergewöhnliches. Allein im Jahr 1903 stießen 20 größere Schiffe mit Eisbergen zusammen, zwölf von ihnen versanken. 1907 geriet auch der deutsche Dampfer »Kronprinz Wilhelm« unverhofft in ein unübersichtliches Eisfeld, kam aber mit einigen Schrammen und Beulen davon. Und fast völlig vergessen ist das Schicksal der »Empress of Ireland«, die am 29. Mai 1914 nach einer Kollision mit dem norwegischen Frachter »Storstad« im Sankt-Lorenz-Strom sank und dabei 1 012 Menschen in den Tod riss. Trotz dieser tragischen Dimension wurde diese Schiffskatastrophe nicht als weltbewegendes Drama registriert und taugte auch nicht für Legenden. Es war der Ausbruch des Weltkrieges, der vier Wochen später ins Zentrum des Interesses der Zeitungen und Telegrafenbüros rücken sollte.
Die Tragik der »Titanic« fand hingegen einen günstigeren Zeitpunkt, um den Nerv der Zeit zu treffen. Das Drama ihres Untergangs vermochte den alten Mythos vom vergeblichen Kampf des Menschen gegen die Naturgewalten beispielhaft zu beleben. Von der Reederei war die »Titanic« zum »unsinkbaren« Flaggschiff des Fortschritts erklärt worden, doch auch für sie galt die historische Gesetzmäßigkeit, dass Schiff und Schiffbruch eine symbolische Einheit bilden.
Das Schiff ist eine der größten Erfindungen der Menschheit – aber mit der Geschichte der Seefahrt verbinden sich nicht nur die Erfolgserlebnisse von Eroberung und Handel, sondern ebenso die Tragik des Scheiterns: der Schiffbruch. Wie nahe Erfolg und Scheitern zusammenliegen, musste schon Christopher Columbus erfahren, der bei seiner ersten Entdeckungsreise im Winter 1492 sein Flaggschiff »Santa Maria« wegen ihrer Havarie-Anfälligkeit verfluchte und nur mit großem Glück lebendig auf dem kleineren Ersatzschiff nach Spanien zurückkam. Der romantische Maler Caspar David Friedrich hat die Metaphorik des Untergangs an Beispielen von im Eismeer gekenterten Segelschiffen ästhetisch dokumentiert und als distanzierter Zuschauer moralisch kommentiert. Und der Philosoph Hans Blumenberg kommt in seiner historischen Untersuchung »Schiffbruch mit Zuschauer« zu der Erkenntnis, »dass in aller menschlichen Seefahrt ein frivoles, wenn nicht blasphemisches Moment steckt, das verglichen werden kann mit dem Vorstoß gegen die Unverletzlichkeit der Erde, das Gesetz der ›terra inviolata‹«.
Angelegt ist der «Titanic«-Mythos bereits in der orakelhaften Namensgebung. Titanentum gilt als unangemessene Hybris. In der griechischen Mythologie erhoben sich die »Titanen«, Nachfahren des Uranos, himmelstürmerisch gegen den olympischen Gott Zeus und wurden zur Strafe in den gewaltigen Abgrund Tartaros gestürzt. So war sich der Baptist Courier von South Carolina auch ziemlich sicher in seinem Urteil über die Schiffskatastrophe: »Für uns ist das Desaster ein Gottesurteil«.
Der Untergang der »Titanic« wurde jedoch erst durch die besonderen Zeitumstände zum globalen Medienereignis. Noch bevor die Überlebenden den Hafen von New York erreicht hatten, noch ehe erste Augenzeugenberichte vorlagen, kursierten bereits Vermutungen über die Ursachen der Katastrophe. So entstand praktisch ein »Live«-Bericht, der weltweit die Emotionen eines »kollektiven« Publikums bewegte. Ohne den Einsatz der modernen drahtlosen Telegraphie, ohne die schnellen Verbreitungsmöglichkeiten von Bildern und Tönen unmittelbar nach dem Unglück, ohne die neuen Telefonnetze und die Nachwirkung im und durch das Medium Film (bis hin zum monumentalen Epos von James Cameron) hätte es den »Titanic«-Mythos kaum gegeben. Nicht nur im Kino lebte er fort, sondern auch als große Literatur, so zum Beispiel im Roman des norwegischen Schriftstellers Erik Fosnes Hansen als »Choral am Ende der Reise« oder auch in Hans Magnus Enzensbergers dichterischem »Gesang« vom »Untergang der Titanic«.
Besonders betroffen über die Katastrophe im Eismeer zeigten sich die Deutschen. Angesichts ihrer eigenen nationalen Desorientierung wurde das Bild vom schlingernden »Staatsschiff« eine prophetische Metapher, mit der man den Kurs des Kaiserreichs mit der Schicksalsfahrt der »Titanic« vergleichen konnte. Symbolisch erscheint in diesem Zusammenhang eine Anekdote des preußischen Diplomaten Philipp zu Eulenburg über die Nordlandfahrt des Kaisers: »Na, fragte ich den Steuermann, wohin geht die Fahrt des Kaisers? – Norden? Süden? Osten? Westen? –