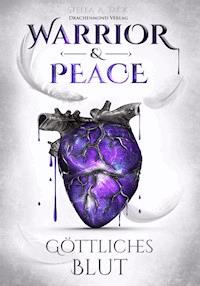9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herzsprung Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
In einem dunklen Kampf um den Thron der Unterwelt scheint alles verloren, bis verborgene Gefühle erwachen, die die Macht besitzen, alles zu verändern. „Also schön, dann bin ich eben verdammt“, knurrte ich grimmig und entschied mich. Triumphierend hob der Teufel seinen Kopf und begann zu lachen. Bittersüße Genugtuung in der honigweichen Stimme, während die brennenden Flammen der Hölle über unseren Köpfen zusammenschlugen. Als die junge Evening einem sprechenden, orange-roten Kater mit Teufelshörner über den Weg läuft, ahnt sie noch nicht, dass ihre Welt nie wieder dieselbe sein wird. Schon bald muss sie erkennen, dass Teufel, Hexen und Dämonen nicht nur in Märchen existieren, sondern diese auch in den dunklen Gassen von Iuvavum umherstreifen. Unaufhaltsam wird sie zum Spielball im blutigen Machtkampf um die Hölle, in dem sie sich entscheiden muss: Wählt sie den Tod oder wird sie selbst zu einem Wesen des Bösen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
o
Luzifer des Teufels Sünden
Stella A. Tack
o
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet - www.herzsprung-verlag.de
© 2022 – Herzsprung-Verlag GbR
Mühlstr. 10, 88085 Langenargen
Alle Rechte vorbehalten. Taschenbuchauflage erschienen 2016.
Lektorat: Melanie Wittmann
Herstellung: CAT creativ - www.cat-creativ.at
Cover-Hintergrund: © Kreos / lizensiert Adobe Stock Foto
Cover-Katze: © otsphoto / lizensiert Adobe Stock Foto
Cover-Foto + -Gestaltung: Anne Haggenmüller
ISBN: 978-3-96074-008-7 – Taschenbuch
ISBN: 978-3-96074-569-3 – E-Book
*
Inhalt
Prolog
Hexe: Ein Jahr zuvor / Iuvavum / Jahr 1415 / Frühling
Pech und Schwefel: 600 Jahre später / Höllenstadt Dis / Jahr 2015
Hexe: Iuvavum / Jahr 1415 / Frühling
Luzifer: Höllenstadt Dis / Jahr 2015
Hexe: Iuvavum / Jahr 1415 / Sommer
Das Herz eines Unschuldigen: Marktplatz der Höllenstadt Dis / Jahr 2015
Conversio potentiae: Höllenstadt Dis / Jahr 2015
Hexe: Dorfrand von Iuvavum / Jahr 1415 / Sommer
Ein Teufel mit Herz: Menschenwelt / 2015
Gejagte: Müllhalde in der Menschenwelt / Jahr 2015
Hexe: Iuvavum / Jahr 1415 / Sommer
Kopfgeld: Menschenwelt / Jahr 2015
Hexe: In den Wäldern von Iuvavum / Jahr 1415 / Sommer
Des Todes Hintertürchen: Bei Adam und Eva in der Menschenwelt / Jahr 2015
Hexe: Luzifers Anwesen / Untersberg nahe Iuvavum / Jahr 1415 / Sommer
Gargoyles: Friedhof in der Menschenwelt / Jahr 2015
Hexe: Luzifers Anwesen / Untersberg nahe Iuvavum / Jahr 1415 / später Sommer
Himmelstore: Friedhof in der Menschenwelt / Jahr 2015
Hexe: Luzifers Anwesen / Untersberg nahe Iuvavum / Jahr 1415 / später Sommer
Wer hat Gott getötet?: Bibliothek des Obersten / Himmel / Jahr 2015
Hexe: Luzifers Anwesen / Untersberg nahe Iuvavum / Jahr 1415 / später Sommer
Die Stimmen der Toten: Tower von London / Viktorianisches Zeitalter / Jahr 1840
Hexe: Alter Friedhof am Untersberg / Jahr 1415 / später Herbst
Hexe: Luzifers Anwesen / Untersberg / Jahr 1415 / später Herbst
Ein teuflischer Plan: Menschenwelt / Jahr 2015
Hexe: Dorfzentrum von Iuvavum/ Jahr 1415 / später Herbst
Hexe: Hexengrube von Iuvavum / Jahr 1415 / später Herbst
Der Aufstieg der Gefallenen: Palast in der Höllenstadt Dis / Jahr 2015
Hexe: Kirche von Iuvavum / Jahr 1415 / Winter
Des Teufels Exodus: Palast in der Höllenstadt Dis / Jahr 2015
Hexe: Kirche von Iuvavum / Jahr 1415 / Winter
Die Teufelsbraut: Palast in der Höllenstadt Dis / Jahr 2015
Hexe: In den Wäldern von Iuvavum / Jahr 1415 / Winter
Epilog: Palast in der Höllenstadt Dis / Jahr 2015
Die Autorin
Unser Buchtipp
*
Prolog
Mit wehenden Röcken lief ich über den vereisten Grund. Die Kälte stach mir in die ungeschützte Haut, als ich hektisch keuchend durch den stillen Wald rannte. Warmer Atem schwebte vor meinem Gesicht, als ich mich zitternd an einen dunklen Baumstamm lehnte, dessen raue Rinde meine klamme Haut aufriss.
„Ich kann nicht mehr!“, japste ich erschöpft und versuchte angestrengt, meinen Atem unter Kontrolle zu bringen, während ich gleichzeitig bemüht war, so leise wie möglich zu sein. Mein hämmernder Puls raste mir in den Ohren und legte einen salzigen Geschmack auf meine Zunge.
Schmerzerfüllt unterdrückte ich ein Schluchzen, als mein Blick hektisch den finsteren Wald absuchte, während fahles silbernes Licht sich wie Spinnfäden auf dem kniehohen Schnee niederließ. Ängstlich presste ich meinen Rücken gegen den rauen Baum hinter mir, wobei sich meiner Kehle ein ächzendes Husten entrang, das nach blutigem Schleim schmeckte. Eisiger Wind fuhr durch die kahlen Äste und brachte das Mondlicht zum Tanzen, als einzelne Schneeflocken auf meinem Haupt landeten.
„Himmel, was habe ich getan?“, stieß ich krächzend hervor, wobei mir dicke Tränen über die Wange quollen. Was hatte ich nur getan?
Meine Taten waren in meine Gehirnwindungen eingebrannt. Schmerzhaft fraßen sie sich durch meine Erinnerungen, wo sie wie eine offene Wunde mein Fleisch zerrissen.
„Verdammter Teufel!“, keuchte ich und krümmte mich ächzend unter einem erneuten Hustenanfall, der dunkles Blut auf meine Arme spritzen ließ.
Bebend starrte ich auf meine Hände hinab, die durch das fahle Licht beinahe geisterhaft wirkten. Die schmalen Finger wurden vor Kälte bereits taub, wobei sich die feinen Adern unter der Haut wie Flussstriche auf einer Landkarte entlangzogen. Eine einfache Hand, die sich langsam zur Faust zusammenballte, als der Schmerz mich zu verschlingen drohte.
Früher war ich voller Unschuld gewesen. Jetzt klebte an meinen Händen Blut. Zum Teil war es das meine, zum größten Teil jedoch das vieler anderer.
Braun sammelte es sich bereits unter meinen Fingernägeln und verkrustete, während mir das restliche Blut die Kleider verschmierte. Genau genommen klebte es überall an mir! Ekelhaft haftete es an meinen langen Haaren, die so dunkel waren, dass sie mit der Nacht verschmolzen. Es verschmierte mein blasses Gesicht, strömte mir den Hals hinunter, während es in kitzelnden Bogen über mein Brustbein rann.
„Was habe ich nur getan?“, stieß ich erneut hervor und spürte den Selbsthass tief in meiner Brust rumoren. Lautes Hundegebell schreckte mich auf. Entsetzt riss ich den Kopf nach oben.
„Verdammt!“
Fluchend stieß ich mich von dem alten Baum ab und rannte weiter. Kalter Schnee drang mir in die leichten Lederschuhe. Schluchzend stürmte ich tiefer in die Dunkelheit des Waldes hinein, der aus einem einzigen Leib gefrorener Bäume zu bestehen schien. Kahle Äste ragten wie Krallen in den Himmel und kratzten in stummer Verzweiflung am Horizont. Das Bellen der Hunde zerriss die Nacht, nur unterbrochen von dem lauten Gebrüll der Männer, die mich wie einen Fuchs durch den finsteren Wald hetzten. Lichter kamen näher, brennende Fackeln, die scharf die Dunkelheit durchstießen und mich zischend schneller laufen ließen.
Mit rasendem Herzen spürte ich die Männer hinter mir, während ich den schnappenden Lefzen ihrer Hunde davonlief. Fast kam es mir so vor, als könnte ich ihren nach Aas stinkenden Atem in meinem Nacken spüren.
„Sie ist hier lang!“, hörte ich eine Stimme, grob und tief. Die Fackeln zuckten schneller, begleitet von den dunklen Umrissen der Männer, die mich verfolgten. „Holt sie euch!“, befahl dieselbe Stimme, in der sich unverhohlener Hass wiederfand.
Frustriert biss ich mir auf die Unterlippe, die nach Eis und Blut schmeckte, und hetzte weiter. Bis ich knietief in der frisch gefallenen Schneedecke versank.
„Da ist sie. Wir haben sie!“, rief eine aufgeregte Stimme, die von dem lauten Gebell der Hunde untermalt wurde.
Ich spürte sie. So nahe.
Meine Beinmuskeln brannten, meine Brust schmerzte von den hektischen Atemzügen und dennoch beschleunigte ich meine Schritte. Mit übermenschlicher Anstrengung schnitt ich eine blutige Schneise in den Schnee, der die Hunde erbarmungslos folgen würden.
Ich konnte gar nicht entkommen.
Dafür würde er sorgen.
Hass verdunkelte mein Herz, als ich spürte, wie sich pechschwarze Tränen in meinen Augen sammelten. Schluchzend wischte ich mir über das gefrorene Gesicht und hinterließ einen roten Streifen schmierigen Blutes.
Stolpernd kam ich ins Stocken. Der Schnee hielt mich fest. Er durchweichte meine Röcke, bis diese so schwer wurden, dass ich die kalten Beine nicht mehr heben konnte. Fluchend raffte ich den schweren Stoff zusammen und wollte weiterlaufen. Doch etwas hinderte mich daran.
Nein, nicht etwas.
Jemand.
Er stand vor mir, als hätte er schon die ganze Zeit auf mich gewartet. Sein großer Körper verschmolz beinahe mit der Nacht, die ihn umgab, während sein feuerrotes Haar wie angezündet leuchtete. Ein träges Lächeln umspielte seine vollen Lippen, die genau wussten, was sie tun mussten, um eine Frau in ihr Verderben zu stürzen, während geschwungene Hörner aus der brennenden Haarflut emporsprossen. Katzengoldene Augen lächelten mich an, als ich schreiend meine nassen Röcke fallen ließ.
„Ich sagte doch, du wirst zu mir zurückkommen“, schnurrte er, die Stimme so samtweich wie flüssiger Honig.
„Nein“, flüsterte ich und meine Schultern bebten, während die brüllenden Männer immer näher kamen.
„Komm zu mir, Hexe!“, schrie jene hasserfüllte Stimme hinter mir.
Verächtlich verzog ich das Gesicht, als ich meinen Blick von dem Rothaarigen abwandte und stumm dem Mann entgegensah, der aus der stillen Nacht trat. Eine Fackel in der grobschlächtigen Faust, die sich knirschend fester schloss, als er meine dunklen Augen auf sich ruhen spürte. Das stechende Licht der Fackel brannte sich in meine Netzhaut, als ich voller Abscheu meinen Ehemann musterte.
„Verflucht seist du, Höllenweib, was hast du getan?“, schrie er mich an, das grobschlächtige Gesicht rot vor Zorn, während ihm der Speichel von den aufgeplatzten Lippen spritzte.
„Das, was ich tun musste!“, brüllte ich zornig zurück.
Der rothaarige Mann hinter mir lachte amüsiert. Doch ich ignorierte ihn.
„Du Hexe wirst sterben!“, keuchte mein Ehemann, während er auf mich zustolperte, die Pupillen vor Erregung geweitet. Sirrend zog er eine Klinge aus seinem Gürtel und hielt sie mir an die Kehle. „Du wirst sterben“, keuchte er ein weiteres Mal. Sein ranziger Mundgeruch nach Selbstgebranntem stach mir in der Nase.
„Das muss nicht sein“, flüsterte hinter mir der Rothaarige. „Komm mit mir, du hast die Chance zu wählen.“
Ein angestrengtes Keuchen entwich meinen blutleeren Lippen, während mir die kalte Spitze des Schwertes die Kehle entlangfuhr. Das Eisen brannte scharf, als es meine Haut zerschnitt.
„So? Habe ich das?“, fragte ich fauchend, was meinen Ehemann gepresst fluchen ließ. Der Rothaarige lachte leise. „Woher ... woher sollte ich die Macht nehmen, meinem Schicksal zu entrinnen?“ Die Worte kamen mir nur schwer über die Lippen. Meine Kehle fühlte sich an wie ausgedörrt. Ich spürte meinen Puls unter der Eisenspitze pochen, wobei mich die glasigen Augen meines Mannes bereits auf dem Scheiterhaufen brennen sahen. Ich erkannte die lodernde Flamme in seinen Augen, während der dunkle Wahnsinn darin das letzte Fünkchen Seele verschluckte, das er wohl zuvor besessen haben mochte.
Sollte ich diesen Weg gehen?
Sollte ich mich von meinem Ehemann töten lassen? Mich von meinen Sünden reinwaschen, um darauf zu hoffen, dass das letzte Gericht zu meinen Gunsten entschied? Oder sollte ich zu ihm gehen?
Aus dem Augenwinkel sah ich zu dem Rothaarigen. Seine dunklen Hörner blitzten erfreut.
Sollte ich wirklich diesen Weg nehmen? Fürchtete ich den Tod so sehr, dass ich mich lieber für den Teufel entschied?
Zitternd sah ich in das hässliche Gesicht meines Mannes, fühlte dessen Verderbtheit und Hass in seinen Venen pulsieren. Das fahle Mondlicht hatte es indessen geschafft, hinter der dichten Wolkenwand hervorzutreten, und schnitt kalte Kerben in sein grobschlächtiges Gesicht. Das silberne Leuchten spiegelte sich auf der Schwertschneide an meinem Hals, sodass ich meine eigenen dunklen Augen darin funkeln sah. Sie wirkten gehetzt und hungrig. Ein Hunger, der jedoch nichts mit Nahrung zu tun hatte. Einen kurzen Augenblick sah ich nur mich selbst. Eine quälende Sekunde, die mein dunkelstes Inneres nach außen kehrte.
„Also schön, dann bin ich eben verdammt“, knurrte ich grimmig und entschied mich. Ruckartig schlug ich das Schwert von meiner Kehle, wodurch der Schnitt an meinem Hals schmerzhaft weiter aufriss. Blut spritzte nach allen Seiten, als ich mich schluchzend in die stählernen Arme des Rothaarigen stürzte, die sich fest um meine zitternde Gestalt schlossen.
Triumphierend hob der Teufel seinen Kopf und begann zu lachen. Bittersüße Genugtuung in der honigweichen Stimme, während die brennenden Flammen der Hölle über unseren Köpfen zusammenschlugen.
*
Hexe: Ein Jahr zuvor / Iuvavum / Jahr 1415 / Frühling
„Hexe!“
„Teufelsbrut!“
„Verbrennt sie!“
„Leiden soll sie, läutert ihren Körper!“
„Tilgt ihre Schande von dieser Welt!“
„Die Buhlin Satans!“
Die Stimmen drangen wirr und dumpf an meine Ohren. Es war das erste Mal, dass ich so viele Menschen auf den Straßen unseres Dorfes umherlaufen sah. Iuvavum war nicht groß. Es war ein Örtchen am Rande des Flusses Luarum, das inmitten hoher Schieferberge lag, die die Siedlung schützend einkesselten. Die Dorfgemeinschaft bestand zu großen Teilen aus Bauern und Bergarbeitern, die für ihre Lehensherren aus den salzhaltigen Gebirgen das weiße Gold schürften. Die Siedlung war eine Ansammlung hoher Steingebäude mit glatten Fassaden und einfacher enger Straßen, die von den üblichen Gerüchen nach Menschen, Vieh und Bergluft durchdrungen waren. Normalerweise war es ein ruhiger Ort mit normalen Leuten, die tagein, tagaus ihren Beschäftigungen nachgingen und deren Familien ernährt werden mussten. Die Bäcker buken Brot, die Müller mahlten das Mehl, der Schmied schlug sein Eisen, bis es sich in die gewünschte Form gebogen hatte, Händler boten ihre Waren feil und die Waschweiber tratschten, wie sie es wohl schon immer getan hatten und immer tun würden. Ein Ort wie die meisten. Abgeschieden, wenn auch etwas wohlhabender, da die hohen Herrschaften oftmals für Jagdausflüge in dem Dörfchen rasteten. Es passierte selten etwas Unerwartetes. So jedoch nicht an diesem Tag.
Die Leute rannten wild durcheinander und wirbelten den lehmigen Boden auf, bis der schlammige Grund auf die Hauswände spritzte. Der Frühling hatte seit einigen Wochen die Bäume sprießen lassen, der Schnee der letzten Zeit war geschmolzen und förderte reines, klares Bergwasser zutage. In jenen Monaten schien das Dorf meist belebter zu sein als in den strengen, kalten Tagen des Winters oder den arbeitsreichen Wochen im Sommer. Dennoch war so viel Aufregung unter den Dorfbewohnern ungewöhnlich. Das Vieh des Schlächters nebenan rumorte unruhig, angestachelt von den Menschen, die wild schreiend durch die Gassen rannten.
Ich konnte Edel, die alte Gerberin, erkennen, die mit ihrem braunen Kleid und den fleckigen Händen an unserer Haustür vorbeilief und lauthals kreischte. Ich verstand nur schwach die aufgeregten Worte, die sie in die noch frische Morgenluft schrie. Ihre Augen waren weit aufgerissen, sodass man das Weiße darin beinahe übermächtig hervorquellen sah, während ihr der Speichel von den Lippen spritzte. Sie schien entweder äußerst aufgeregt zu sein oder kurz vor einer Panikattacke zu stehen. Beide Optionen waren unerfreulich. Die Frau des Gerbers genoss die Aufmerksamkeit der Dorfbewohner viel zu sehr, als dass sie sich die Chance entgehen lassen konnte, einen großen Aufruhr zu verursachen. Jedoch waren die engen Straßen des Dorfes dermaßen mit Menschen vollgestopft, dass die sonst immer im Mittelpunkt stehende Frau unbeachtet in der Masse verschwand, ohne ihren üblichen dramatischen Auftritt zum Besten gegeben zu haben.
Hinter ihr kam auf kurzen Beinen Olgier, der örtliche Metzger, angerannt. Er war mir schon immer wie ein Zwerg vorgekommen. Mit kurzen, krummen Beinchen, die schwer daran arbeiteten, die Fettmassen darüber zu tragen. Eben jenes Fett wogte nun aufgeregt, als er mit seinem langen, struppigen Schnauzbart an des Gerbers Frau Edel vorbeihechtete und in Richtung Dorfplatz verschwand.
„Evening! Ich habe gesagt, du sollst den Flur fegen und nicht aus dem Fenster starren!“
Schuldbewusst zuckte ich zusammen und blickte zu dem Besen, der vergessen in einer Ecke lehnte. „Da draußen ist was los“, sagte ich aufgeregt zur Frau meines Vaters.
Apollonia war eine große Frau mit langen, glatten Haaren, die sie sich so straff unter ihre weiße Haube kämmte, dass es zumeist aussah, als würde ihre Gesichtshaut schmerzhaft nach hinten gespannt werden. Ihre Augen waren dunkel und flink, ähnlich dem Blick eines Adlers, der seine Beute beobachtete. Apollonia war nicht hässlich. Im Gegenteil, für ihr Alter war sie wohl noch recht attraktiv. Doch sie war keine herzliche Frau und schon gar nicht eine liebenswerte Mutter.
Mein Vater war sich dessen bewusst gewesen, als er sie geehelicht hatte. Als Witwe des Steuereintreibers hatte sie jedoch genug Geld in die Bäckerei meines Vaters eingebracht, dass dieser seine Backstube hatte ausbauen können und somit mehr Gewinn einstrich. Es war keine Ehe, die aus Liebe geschlossen worden war, doch beide schienen gut miteinander arbeiten zu können. Mein Vater war zufrieden und Apollonia hatte einen recht vermögenden Ehemann.
„Was soll denn da draußen sein?“, fragte sie nun kaltschnäuzig. Ihre große Gestalt steckte in einem schwarzen Kleid, dessen Leinen voller Mehl waren. Offensichtlich hatte sie soeben die Bestände meines Vaters überprüft, als sie mich beim Nicht-Arbeiten erwischt hatte.
„Sie sagen, eine Hexe solle brennen!“, berichtete ich aufgeregt und riss die knorrige Holztür ein Stückchen weiter auf, sodass Apollonia die aufgeregten Menschenmassen sehen konnte.
Die Augen der Bäckersfrau wurden groß, wobei ihr ein kleines Zischen entwich. Schneller als ich reagieren konnte, stand sie plötzlich neben mir und stürmte zur Tür hinaus. Schmerzhaft riss sie mir die Türklinke aus der Hand und schnappte sich den erstbesten Burschen, der ihr in die langen Finger kam. Es war Peter, der Stallbursche, dessen Haut voll roter Pusteln war, während seine Stimme seit einigen Monaten von sehr hoch zu sehr tief wechselte. Erschrocken kreischte dieser auf und starrte Apollonia entsetzt in die dunklen Augen.
„Sag, Bursche, wer ist die Hexe?“, fauchte sie den armen Jungen an, der sich vor Panik beinahe in die Hosen pinkelte.
Kichernd schlug ich mir die Hände vor den Mund. Apollonia hatte einen furchterregenden Ruf bei den jungen Burschen im Dorf.
„D...d...die junge W...witwe v...vo...vom Schmied Hans-Peter steht am P...p...pranger. Sie wollen sie richten ... wegen ... wegen Schwarzzauberei“, stammelte er schließlich.
„Ich wusste es!“, kreischte Apollonia, noch ehe der arme Junge ausgeredet hatte, und schleuderte den Stallburschen von sich, der mit einem ängstlichen Quieken das Weite suchte. „Ich wusste von Anfang an, dass mit dem jungen Ding was nicht stimmen kann.“ Aufgeregt wischte sie sich das Mehl von dem dunklen Kleid und schnappte sich ungestüm meine Hand, als sie auch schon zur Tür hinausstürmte und mich hinter sich her zerrte. „Das sehen wir uns an, Eve. Das ist eine Lektion fürs Leben.“
„Was ist denn passiert?“, fragte ich verwirrt und stolperte hinter Apollonia her.
Ihr Griff klammerte sich schmerzhaft um mein Handgelenk, als sie mich aufgeregt in eine Gasse zerrte, die sich stetig mit aufgeregten Menschen füllte. Alle rannten sie laut rufend und wild gestikulierend in Richtung Dorfplatz. Ein bulliger Mann stieg mir auf die Zehen, als ich keuchend versuchte, mit meiner Stiefmutter Schritt zu halten.
„Pass auf, wo du hintrittst!“, blaffte mich der Kerl grob an, sodass ich einen Sprühregen aus Spucke ins Gesicht bekam.
Empört riss ich den Mund auf, doch bevor ich antworten konnte, zog mich Apollonia schneller durch die Menge auf die zwar breitere, jedoch regelrecht von Menschen überquellende Straße, die zum Dorfplatz führte. Schlamm spritzte nach allen Seiten und Hühner rannten aufgeschreckt um die Beine der vielen Menschen herum. Manche wurden sogar niedergetrampelt, doch keinen schien es zu kümmern. Gesichter spähten neugierig aus den Fenstern und ein Nachttopf wurde knapp neben mir ausgeleert. Der stinkende Unrat machte den Schlamm noch glitschiger, was so manchen Passanten fluchend ausrutschen ließ. Die Menschen schubsten und drängelten, während wir uns langsam, aber stetig unserem Ziel näherten. Wie ein kleiner Wasserlauf, der in einen größeren Teich mündete, sammelten sich die Menschen auf dem Marktplatz. Ich hatte in meinem gesamten Leben noch nie so viele Leute auf einmal gesehen.
Alle scharten sie sich um ein Podest, das notdürftig aus alten Brettern zusammengenagelt in der Mitte des Platzes stand, sodass man von überall einen guten Blick auf das Geschehen hatte. Die Bretterstruktur sah schäbig aus. Ein wenig, als hätte man wahllos ein paar Holzscheite zusammengeschustert und das Beste gehofft. Auf dem Podest befanden sich vier Gestalten. Eine Frau kauerte gefesselt zu Füßen von drei Männern, deren Gesichter von strengen Runzeln zerfurcht waren.
„Wer sind diese Männer?“, fragte ich Apollonia leise. Ich traute mich nicht, lauter zu reden als in einem zaghaften Flüsterton. Der Anblick jener finster wirkenden Gesellen jagte mir schreckliche Angst ein.
„Das sind die Untersuchungsrichter“, zischte mir meine Stiefmutter zu, sah dabei jedoch kein einziges Mal zu mir hinab. Ihre Hand umklammerte weiterhin die meine, als fürchtete sie, mich in der unübersichtlichen Menschenmenge zu verlieren.
Ich wusste nicht, was Untersuchungsrichter waren, doch ich sah das Entsetzen in den Augen der angeklagten Frau, als ein vierter Mann auf sie zutrat. Ich kannte sie. Ihr Name war Elsbeth. Man hatte sie letztes Jahr mit dem örtlichen Schmied verheiratet. Sie war nur die Tochter eines einfachen Tagelöhners, doch der Schmied, der kürzlich verstorben war, hatte sie wegen ihrer ungewöhnlichen Schönheit zur Frau genommen. Elsbeth besaß einen wunderschönen Körper mit blasser Haut. Ihre großen blauen Augen starrten nun voller Entsetzen auf die Menschen unter sich. Dichtes sonnenbleiches Haar fiel ihr in verfilzten Strähnen über die nackten Schultern, während dunkle Tränenspuren tiefe Furchen in ihre samtigen Wangen gruben.
Erst jetzt bemerkte ich, dass sie kein Oberteil trug. Ihre Bluse lag zerfetzt um ihre Hüfte, der Rock war voller Dreck und Schleifspuren. Zitternd presste sie die Arme um ihren nackten Oberkörper und bebte jämmerlich.
„Was tun sie gerade?“, hörte ich Apollonia aufgeregt fragen.
„Sie untersuchen sie auf ein Dämonenmal“, ertönte die hilfreiche Antwort einer Frau in unserer Nähe. Ich kannte sie flüchtig. Sie war die Magd eines benachbarten Großbauern.
„Haben sie schon etwas gefunden?“, fragte Apollonia. Ihre Stimme schraubte sich vor Aufregung zwei Oktaven höher.
Die Magd schüttelte den Kopf. „Noch nicht, aber ...“
Das Geschwätz der beiden Frauen ausblendend, starrte ich wieder zu Elsbeth hinauf. Ein Mann mit wulstigem Bauch und langem grauem Bart grabschte gerade nach ihren Armen. Die junge Frau schluchzte erbärmlich. Fügte sich jedoch und entblößte ihre Brüste. Beschämt versuchte ich, den Kopf zu senken, merkte jedoch, dass ich viel zu fasziniert von dem Schauspiel war, um wirklich wegsehen zu können.
Ein Raunen ging durch die Masse der Schaulustigen, als unter der Brust von Elsbeth ein schwarzes Muttermal sichtbar wurde. Es war groß. Größer als all die Flecken, die ich an meinem Körper trug. Es leuchtete aus der milchigen Haut heraus wie der Vollmond in einer sternenklaren Nacht.
„Wir haben ein Mal!“, keifte der Mann mit dem Bart selbstzufrieden und die Untersuchungsrichter nickten ernst.
Die gedemütigte junge Frau zitterte, während sie jämmerliche Schluchzer ausstieß.
„Holt den Medicus. Wir werden die Nadelprobe durchführen!“, rief einer der Untersuchungsrichter. Er war etwas untersetzt und besaß flachsblondes Haar, das ihm in fettigen Strähnen ins Gesicht fiel. Doch seine Kleider sahen fein aus. Schwarzer Samt, der ähnlich einer Robe seinen Körper verhüllte.
Die Menschen tuschelten aufgeregt, als wenige Wimpernschläge später ein Mann auf die Tribüne gestoßen wurde. Ich kannte ihn nicht, hatte aber schon von ihm gehört. Es hieß, er schnitte den Menschen Hände und Füße ab, wenn diese brandig wurden. Indes zog er auch Zähne, wenn diese faulten, oder nähte Wunden, wenn dies nötig war. Seine Haut war braun gebrannt und zäh wie Leder. Er war kein Mann, den man gerne ansehen mochte. Und dies noch weniger, als er mit gewichtiger Miene eine grobe Tasche abstellte, aus der ein metallisches Klirren zu hören war. Die Angeklagte brach bei seinem Anblick in bitterliche Tränen aus.
„Stecht ihr ins verdorbene Fleisch, um zu sehen, ob es sich wirklich um ein Mal des Teufels handelt!“, befahl der Richter mit dem Flachshaar dem Chirurgen gelangweilt.
Dieser nickte eifrig und kramte in seinen Gerätschaften herum, bis er eine lange Nadel zum Vorschein brachte, bei der es sich eigentlich um ein Hilfsmittel zum Nähen tiefer Wunden handelte.
„Was machen sie?“, fragte ich leicht atemlos. Ich war nicht fähig, die Augen von der Nadel abzuwenden, die sich langsam auf das Muttermal niedersenkte. Es kam mir alles so surreal vor. Mein Herz pochte vor Aufregung, während meine Augen gespannt einem Schweißtropfen folgten, der über Elsbeths entblößtes Schlüsselbein rann.
„Sie überprüfen, ob es sich bei dem Mal um eine Kennzeichnung des Teufels handelt. Sie stechen hinein, und wenn kein Blut herausfließt, kann sie nicht mehr verbergen, dass sie mit dem Bösen im Bunde ist“, zischte Apollonia mir zu. Ihre Augen glänzten vor Aufregung, als wenige Sekunden später der Chirurg tief in das Fleisch der Frau stach, die gequält aufschrie. Bohrend malträtierte er die Stichwunde, aus deren zerfetzten Rändern sofort das Blut sickerte. Dicke Tropfen, die laut auf das Holz darunter platschten.
Fluchend riss der Chirurg die Nadel aus dem Fleisch und zuckte die Schultern. „Eindeutig Blut“, sagte er zu den Untersuchungsrichtern.
Hoffnung machte sich in meinem Magen breit und auch Elsbeth schien vor Erleichterung im Griff des bärtigen Mannes zusammenzubrechen. Nur das Beben ihrer Schultern verriet, dass sie nicht ohnmächtig war.
Die Männer runzelten die Stirn. Einer kratzte sich verhalten das stoppelbärtige Gesicht, während die anderen wild zu diskutieren begannen.
„Die Hexe lügt!“, schallte es aus der Zuschauermasse und nun begannen alle, wild durcheinanderzubrüllen.
„Macht die Feuerprobe!“, keifte eine schrille Stimme. Verwundert bemerkte ich, dass es Apollonia gewesen war, die gesprochen hatte.
Köpfe drehten sich in unsere Richtung, was mir mehr als unangenehm war.
„Ja, die Feuerprobe!“, stimmte die Magd neben uns zu.
Bald darauf forderte mehr als die Hälfte der Menschen eine weitere Probe, bis die Männer auf der Tribüne schließlich nickten.
„Sie war die Frau des Schmieds“, sagte der Flachshaarige.
„Also soll sie durchs Feuer gehen!“, brüllten die Menschen aufgeregt.
„Bringt uns ein glühendes Stück Eisen!“, bellte ein anderer Richter.
Mein Blick blieb an ihm hängen. Er war groß. Größer als all die Männer, die ich im Dorf kannte. Er hatte ein ausgesprochen junges Gesicht. Kantig und ausgeprägt, von dunklen Locken umrahmt, die er sich mit einem einfachen Lederband aus dem Gesicht hielt. Er war nicht wirklich attraktiv. Besaß jedoch etwas Charismatisches und Wildes, das ihn äußerst anziehend wirken ließ. Wie ein Wolf, der sich knurrend an seine Beute heranschlich. Abstoßend und faszinierend zugleich.
Ich spähte hinüber zu Apollonia, deren Augen ebenfalls auf dem Mann zu ruhen schienen und einen falkenähnlichen Ausdruck zeigten, den ich noch nie an ihr gesehen hatte. Er erinnerte mich vage an Bewunderung, doch durchdrungen von etwas Dunklerem.
Es dauerte nicht lange und ein glühendes altes Hufeisen, dessen metallischer Geruch schwer in der bereits viel zu stickigen Luft lag, wurde an uns vorbei zur Tribüne geschafft. Elsbeth begann wieder zu zittern. Diesmal heftiger.
„Wir brauchen jemanden, der ihre Arme festhält“, sagte der junge Richter mit den dunklen Haaren.
„Ich mach’s!“, erhob sich zu meinem tiefen Entsetzen Apollonias Stimme über Menge der Schaulustigen.
Dutzende Köpfe wandten sich der Bäckersfrau zu, die mit schnellen Schritten auf das Podest zustrebte und mich dabei erbarmungslos hinter sich her zerrte. Instinktiv wollte ich die Fersen in den Boden stemmen und mich weigern, mit ihr zu kommen. Doch damit würde ich mir sicher nur eine Ohrfeige einhandeln und diese Demütigung vor all den Menschen wollte ich mir ersparen. Also trottete ich still hinter ihr her, stieg mit klammen Schritten die klapprigen Stufen nach oben und wurde vor die Richter gestellt.
„Ich helfe!“, sagte Apollonia ein weiteres Mal und lächelte gewinnend den jungen Richter an. Die Menge murrte zustimmend und das Lächeln meiner Stiefmutter wurde noch ein Stückchen breiter.
Die Männer nickten ernst und ich wurde ohne viel Federlesens zu dem jungen Richter gestoßen. Ich konnte seinen Blick auf mir spüren, der mich einem Raubtier gleich sofort ins Visier nahm.
„Stell dich neben mich, Kind, und sieh, wie wir Gottes Werk verrichten“, sagte der flachsblonde Richter hochnäsig und ich stellte mich, so schnell ich konnte, neben ihn.
Dabei bemühte ich mich, so klein wie möglich zu wirken. Ich konnte Elsbeths Blick auf mir spüren, konnte ihre Angst riechen, die wie Essig in meiner Nase brannte. Hatte ich vorher nicht die Augen von ihr wenden können, so konnte ich es diesmal nicht über mich bringen, sie anzusehen. Mein Herz pochte wild und ich konnte Salz auf meiner Zunge schmecken.
„Sieh hin, Mädchen!“, sagte da eine tiefe Stimme und eine große Hand klatschte mir in den Nacken. Erschrocken zuckte ich zusammen, als der junge Richter meinen Kopf anhob. „Nicht die Augen abwenden“, murmelte er mir streng zu, während ich seinen Körper an meinem fühlen konnte.
Ich wollte es nicht. Wollte es wirklich nicht. Doch ich sah hin. Beobachtete, wie Apollonia grob Elsbeths Hände packte, während der grauhaarige Mann weiterhin ihre Schultern umklammerte. Ich roch das Metall und hörte ein lautes Zischen, als das Eisen auf nackte Haut traf.
Elsbeth begann zu schreien. Ein schriller Ton, der in meinen Ohren vibrierte, während die blonde Frau die Augen verdrehte, bis man nur noch das Weiße darin erkennen konnte. Übelkeit stieg in mir auf, als ich den Geruch von verbranntem Fleisch wahrnahm. Die große Hand blieb unerbittlich in meinem Nacken liegen, als mir vom Gestank bereits die Augen tränten. Ich sah nicht weg und beobachtete das Schauspiel so lange, bis der flachsblonde Richter ein Zeichen gab und das glühende Eisen von den Händen der schreienden Frau genommen wurde. Ihre Haut war nicht mehr als ein Klumpen rohen Fleisches.
Mein Blick zuckte zu Apollonia, die etwas blass um die schmale Nase aussah. Als ihr der junge Richter jedoch ein Zeichen gab, ließ sie die arme Elsbeth ohne viel Federlesens fallen. Diese stürzte ohnmächtig auf die schmutzigen Bretter nieder und rührte sich nicht mehr.
„In drei Tagen werden wir die Wunden der Angeklagten untersuchen“, sagte der graubärtige Richter geschwollen und rieb sich über sein verschwitztes Gesicht. Unter seinen Achseln hatten sich ob der Anstrengung Schweißflecken gebildet. „Sollte die Angeklagte Wunden aufweisen, wird sie für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen brennen, bevor ihre arme Seele dem letzten Gericht übergeben wird. Sollte sie jedoch frei von jedem Makel sein, wird sie für unschuldig befunden und aus der Anklage entlassen werden. Das Gericht hat entschieden.“
Die Menschenmassen brachen in aufgeregtes Gemurmel aus, während zwei Männer der Inquisition in weißer Uniform die ohnmächtige Elsbeth packten und die Treppen nach unten schleiften. Dabei hinterließen sie ein Rinnsal aus rotem Blut, das langsam in der warmen Sonne trocknete.
„Sieh es dir gut an, Mädchen“, sagte der junge Richter neben mir. Verzagt hob ich den Blick und begegnete zwei stahlgrauen Augen, die mich aufmerksam musterten. „Sieh genau hin, was mit einer Hexe geschieht.“
„Aber sie ist doch noch nicht schuldig gesprochen worden. Vielleicht ist sie gar keine Hexe“, flüsterte ich, unfähig, den Blick von diesen eiskalten Augen abzuwenden.
Der Richter lächelte milde. „Vielleicht“, erwiderte er. Es klang beinahe wie ein Knurren.
Drei Tage später wurde Elsbeth auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
*
Pech und Schwefel: 600 Jahre später / Höllenstadt Dis / Jahr 2015
Das Monster kroch vor mir aus der Erde.
Knirschend brach es den trockenen Boden auf, sodass mir eine Wolke aus dunklem Staub die Sicht verdeckte. Stinkender Schwefel brannte mir in den Augen, wobei sich der faulige Geschmack nach Eiern auf meine Zunge legte. Schützend hob ich die Arme und bedeckte mein Gesicht, als die Erde unter meinen Füßen rumorte.
Der Untote stöhnte. Es war ein lang gezogener, undefinierbarer Laut, bei dem seine halb verfaulte Zunge aus dem zerfetzten Fleisch seiner Wange herausragte. Lange Finger, knochig und abgefressen von Gewürm und Alter, krallten sich in mein Hosenbein und brachten mich zum Stolpern. Schreiend stürzte ich auf den harten Grund und stieß mir schmerzhaft den Kopf dabei.
„Du wirssst sssterben“, hauchte der Untote, während er einen penetranten Gestank nach verwesendem Fleisch in meine Richtung ausstieß. Leere Augenhöhlen sahen mich hämisch unter ein paar losen Haarsträhnen, die einen kahlen Knochenschädel bedeckten, an. „Sssstirb, Hexe!“, fauchte der Untote, als sich seine fleischlosen Finger tiefer in meine Haut gruben.
Knurrend trat ich nach seiner Hand, von der krachende Splitter absprangen. Vollkommen unbeeindruckt schnappte das unheimliche Wesen blitzschnell mit seinem schleimigen Mund nach meiner Wade. Ein angeekelter Schrei entfuhr meiner Kehle, als sich seine Zähne genüsslich in meinem Fleisch verbissen. Zitternd hob ich meine Finger und spürte, wie meine eigene dunkle Magie in kleinen Stromschlägen über meine Fingerspitzen zuckte. Ich würde mich heute verdammt noch mal nicht verspeisen lassen! Die Hölle war Hölle genug, ohne auch noch tot zu sein.
Der Untote lachte indessen schrill auf. Von seinen blanken Zähnen troff mein rotes Blut, während sein verfaultes Zahnfleisch schwarz in der Dämmerung glänzte. Finster kniff ich die Augen zusammen und atmete unter Schmerzen zittrig ein. Ich würde diesen Zombie in Stücke reißen! Jetzt!
Konzentriert kniff ich die Augen zusammen und dachte an eine Verteidigungsrune, die ihn in kleine verfaulte Stückchen zerschlagen würde. Magie zuckte wütend durch meine Adern, als der Untote kreischend von mir abließ und reflexartig nach meiner Kehle schnappte. Keuchend wurde ich ein weiteres Mal umgerissen, als sich der Verwesende speichelleckend in meine ungeschützte Kehle verbiss. Der Schmerz war scharf und unglaublich ekelhaft, als seine verfaulten Zähne meine Haut aufrissen und seine Zunge das Blut mit einem animalischen Grunzen abschleckte.
Meine Finger zuckten und zeichneten die todbringende Rune. So schnell ich konnte, malte ich die magischen Schnörkel in die Luft, während mein Wille die gewünschte Form erschuf. Krächzend ließ der Zombie von mir ab und fletschte knurrend die zerfetzten Zähne. Beinahe fasziniert starrten wir beide auf die leuchtenden Runen, die sekundenlang in der Luft tanzten, bevor sie sich in einen todbringenden ... Brokkoli verwandelten?
„Verdammt noch mal, Evening, ist das dein Ernst?“
„Entschuldigung.“ Schlaff ließ ich mich auf den staubigen Boden zurücksinken und starrte wütend auf das Gemüse in meiner Hand.
„Ein Brokkoli, Evening? Ein Brokkoli? Du sollst eine Knarre zaubern und mir den Kopf damit zerschießen, keinen verfluchten Brokkoli!“
„Es sollte eine Peitsche werden!“, fauchte ich wütend und starrte den Untoten giftig an, der immer noch auf mir lag und sich seine kümmerlichen Härchen auf dem Kopf raufte. Dabei rieselten Hautfetzen und andere Dinge auf mich herab, die ich lieber nicht genauer definieren wollte. Als Untoter war man wahrlich keine Augenweide.
„Oh, entschuldige“, knurrte mein Gegenüber unwirsch und pflückte einen Teil seines angefaulten Ohres von meiner Brust.
Schnaufend setzten wir uns ein Stückchen auf.
„Und? Funktioniert es?“, fragte ich skeptisch, als der Zombie leicht die Augen zusammenkniff.
„Ja, warte kurz!“, zischte er mich an und griff sich erneut an den beinahe kahlen Schädel.
Einige Augenblicke später begann es tatsächlich. Erst so langsam, dass es mir beinahe nicht aufgefallen wäre. Doch schon Sekunden später nahmen die kümmerlichen Härchen einen satten Braunton an. Schimmernd wuchsen sie aus seinem Schädel hervor, der sich langsam mit rosigem Fleisch bedeckte. Zerfall und Fäulnis bröckelten von ihm ab, wie Wassertropfen an einer fettigen Unterlage abperlten, als sich ein fein geschnittenes Gesicht mit großen grünen Augen und vollen Lippen formte. Muskeln formten sich um lose Knochen und der Gestank nach Fäulnis wich dem Geruch feinen Salzes und männlicher Haut. Bis ein hochgewachsener, leicht staubiger Mann auf mich herabgrinste.
„Zumindest das hat funktioniert“, grinste der Untote und streckte sich genüsslich.
Das Adrenalin unserer kleinen Auseinandersetzung wich nur Augenblicke später aus meinem Körper und hinterließ einen dumpfen Schmerz in Wade, Hals und Kopf. Seufzend drückte ich eine Hand gegen die blutende Wunde an meinem Hals und knirschte frustriert mit den Zähnen. Hätte ich durch meine Unsterblichkeit nicht solch effiziente Selbstheilungskräfte, wäre die Wunde wohl ein wenig ... problematischer. Mhmm ... höchstwahrscheinlich tödlich. So jedoch ließ der klebrige Blutstrom bereits nach und würde in wenigen Sekunden vollkommen gestoppt sein, um heller, blasser Haut zu weichen.
„Geh runter von mir!“, knurrte ich meinen besten Freund Erhard frustriert an und stieß ihn etwas unsanft von mir.
„So geht das nicht, Evening“, murrte dieser genervt und klopfte sich den Staub von den altmodischen Klamotten. Mit Reitstiefeln, einer groben Leinenhose und einem offenen Baumwollhemd entsprach Erhard dem Bildnis eines jungen Mannes des Mittelalters.
Er war mir schon, als wir jung, naiv und um einiges menschlicher gewesen waren, nicht von der Seite gewichen. Das hatte sich auch in der Hölle nicht geändert. Beide gehörten wir zu den Untergebenen Luzifers. Ich als Hexe und Erhard als Untoter. In den vergangenen Jahrhunderten, nach unserem Sturz in die Hölle, hatte uns viel voneinander abhängig werden lassen. Zum Teil war es Freundschaft, zum anderen die Vertrautheit zweier Menschen, die sich schon ein ganzes Leben lang kannten, und vor langer, sehr langer Zeit war es wohl sogar Liebe gewesen.
Erhard war die einzige Person, die mir aus der Zeit als Mensch geblieben war. Der Rest meiner Familie hatte es höchstwahrscheinlich in den Himmel geschafft, wo sie kitschige Loblieder auf den Weltfrieden sangen.
Natürlich war es meine eigene Schuld, dass ich in der Hölle festsaß. Ich hatte mich immerhin dazu entschieden. Ich hätte auch den Tod wählen können. In dieser Hinsicht war die Höllenpolitik zumindest fair. Sie machte keinen Unterschied zwischen Adel und Fußvolk. Ob Frau oder Mann, jung oder alt, ging man einen Pakt mit einem der sieben Herrscher der Unterwelt ein, blieb man mehr oder weniger am Leben. Leider zahlte man dafür einen hohen Preis.
Mitleidig sah ich zu Erhard auf, der sich inzwischen ächzend aufgerichtet hatte und entschuldigend meinen Hals beäugte, an dem die Wunde bereits vollständig geschlossen war. Ein Ausdruck von schlechtem Gewissen huschte über seine glatten Gesichtszüge. Beruhigend tätschelte ich ihm die Hand und rappelte mich ebenfalls auf. Ich wusste, dass er es hasste, mir Schmerzen zuzufügen, doch zu Übungszwecken ließ sich die eine oder andere Fleischwunde nicht vermeiden.
„So geht das nicht weiter, Evening. Ich will dir nicht immer wehtun müssen oder dir Angst einjagen, nur damit eventuell deine Magie funktioniert. Du bist eine Hexe. Das alles sollte von selbst klappen.“
„Ich weiß, dass meine Magie von selbst funktionieren sollte, Erhard. Aber was soll ich machen? Es klappt nun mal nicht. Auf mir liegt ein Fluch und der lässt sich offensichtlich immer noch nicht brechen“, grummelte ich missmutig.
Frustriert fuhr sich Erhard durch die braunroten Locken und schüttelte betrübt den Kopf. „Aber du bist eine Hexe, Eve! Du hast dir diese Macht erkauft. Wir können nicht weitere 600 Jahre damit verbringen, deine Kräfte zurückzuholen. Der Fluch muss ganz einfach gebrochen werden. Irgendwann wird etwas passieren und dann wirst du dich durch Magie retten müssen, nur dass der Angreifer sich nicht von einem Brokkoli töten lassen wird.“
Lustlos zuckte ich mit den Schultern und kratzte mich an der angeknabberten Wade. Die bereits verheilten Wunden an Hals und Bein juckten unangenehm, während mein Kopf von dem harten Aufprall pochte.
„Was beschwerst du dich? Nicht alle meine Kräfte sind nutzlos. Du siehst doch wieder fabelhaft aus.“
„Ja, für die nächsten Stunden oder Minuten und danach ... puff.“ Erhard deutete eine explosionsartige Handbewegung an und schüttelte traurig den Kopf.
Das stimmte leider. Schon jetzt wurde seine Haut fahler und schimmerte grau, während sich ein leichter Geruch nach Fäulnis in meine Nase stahl. Er hatte diesmal nicht viel Blut abbekommen, sodass er bald wieder in seinem ausgemergelten Körper stecken würde.
„Zumindest funktioniert mein Blut bestens“, bemerkte ich spitz.
„Jaaaaa, was nach 600 Jahren ein wahres Wunder ist!“, knurrte Erhard.
Wütend warf ich den Brokkoli gegen seinen Kopf. „599! Mach mich nicht älter, als ich bin!“
Der Untote grinste schief, wobei seine Lippen langsam zu faulen begannen. „Es sind 600 Jahre, Eve, mach dich nicht jünger, als du bist. Trotzdem sieht man dir dein Alter nicht an. Was man von mir allerdings nicht behaupten kann ...“
Etwas mitleidig starrte ich seinen Körper an, der in Minutenschnelle alterte und schließlich zu faulen beginnen würde. Mit seinen letzten Worten hatte er wohl recht.
Erhard war ein guter Mann, ein guter Freund. Doch das Erbe seines Dämonen-Vaters hatte ihn dazu verdammt, für immer einem Teufel dienen zu müssen. Leider spielten die Teufel nicht immer fair. Demnach war Erhards unsterbliche Seele nach seinem Tod in seinen bereits faulenden Körper zurückgezwungen worden.
Ich war mir nicht sicher, was dieser Pakt genau beinhaltete, der Menschen dazu verdammte, in ihrer verwesenden Hülle herumlaufen zu müssen. Die Feinheiten eines jeden Vertrags unterschieden sich bei den einzelnen Teufeln genauso wie bei den Menschen. Dennoch wusste ich, dass Erhard nicht sehr glücklich gewesen war, als er zu mir in die Hölle herabsteigen musste. Einmal gestorben, war es äußerst schmerzhaft, aus dem Totenreich zurückgezerrt und in seinen faulenden Körper gesperrt zu werden. Zudem sollte man von keinem Teufel ausgeprägtes Feingefühl erwarten.
Schon gar nicht von Luzifer.
Mmmpf, Luzifer, dieser Mistkerl. Er war in den letzten Jahren nicht unbedingt eine große Hilfe gewesen. Dieser eingebildete, muskelprotzende, nervtötende ...
Erhards liebevolle Berührung ließ mich ruckartig zusammenfahren und riss mich aus meinen Gedanken. „Alles in Ordnung?“, fragte er lächelnd. „Du hattest einen hochroten Kopf. Beschimpfst du wieder Luzifer in Gedanken?“
Leicht verlegen blickte ich auf unsere verflochtenen Hände hinab, wobei die meines Freundes bereits wieder zur Hälfte verfault waren. Die Haut pellte sich nass von seinem glänzenden Fleisch, seine Nägel waren kränklich und stachen lilafarben aus seinem Nagelbett hervor.
„Genug trainiert für heute. Wir sollten zusehen, dass wir in die Stadt kommen. Gestern hat die Jagdsaison begonnen“, wich ich seiner Frage aus und blickte prüfend in den Himmel hinauf.
Blendendes Licht fiel auf uns herab. Auch wenn hier unten genau genommen keine Sonne existierte, brannte das Höllenfeuer unablässig. Dabei dörrte es unbarmherzig die Erde zu unseren Füßen aus, sodass wir kilometerweit nichts weiter als karge, wüstenähnliche Dürre vor, hinter und neben uns sahen. Wir befanden uns hier im Grenzgebiet zwischen der Höllenstadt Dis, die im Zentrum der Unterwelt lag, und dem anschließenden Sumpfland des zweiten Höllenkreises, in dem die Vergewaltiger und Mörder ihr Dasein fristeten. Dis war neben den übrigen sechs Höllenkreisen zwar bei Weitem nicht die einzige Stadt, besaß jedoch das Privileg, von Luzifer als seine Residenz auserkoren worden zu sein.
„Lass uns gehen“, stimmte Erhard mir leise zu.
Unsere Füße schlurften bereits über den aufgerissenen Höllengrund. Das Letzte, was ich jetzt noch wollte, war, in eine Jagd zu geraten. Einmal gefangen und geköpft, konnte nur einer der sieben Teufel einen freikaufen. Ansonsten hatte man das Pech, die nächsten Jahrtausende seinen Kopf mit sich herumtragen zu müssen. Stumm stapften wir der Stadt Dis entgegen, die schwach flimmernd in der Ferne auftauchte. Noch war sie zu weit entfernt, um mehr als eine Ansammlung von Flecken erkennen zu lassen, doch schon bald würde sich die Stadt so monumental vor ihnen erheben, dass man sich für Jahrhunderte darin verirren konnte.
„Fühlst du dich auch manchmal so klaustrophobisch hier unten wie ich?“, fragte Erhard plötzlich.
Auf unserem kurzen Weg hatte er bereits den Großteil seiner braunroten Haare verloren und sein blanker Schädel leuchtete im Schein des Höllenfeuers.
„Wie meinst du das?“, fragte ich und besah mir einen kargen Baum, der kränklich aus der bröckelnden Erde herausstach. Über einen seiner kahlen Äste war eine Henkersschlinge geworfen worden, die leer über dem Grund baumelte. Wie aufbauend! Selbstmord funktionierte hier nur leider nicht. Was wahrscheinlich auch der Grund dafür war, warum die Leute nicht unbedingt Schlange standen.
„Ich komme mir gefangen vor“, murmelte Erhard, was meine Konzentration auf sein fauliges Gesicht zurücklenkte, das traurig in Richtung unserer staubigen Füße gesenkt war. „All die Angst und das Davonlaufen vor den Stärkeren. All das Kämpfen um die eigene Existenz, während wir ein ums andere Mal in einen sinnlosen Krieg ziehen müssen, um Ländereien für Luzifer zu sichern. Ich fühle mich in der Unendlichkeit eingeschlossen. Verstehst du, was ich meine?“ Seine Augen sahen mich unendlich müde an, während sie langsam eintrockneten. Das leuchtende Grün ging in einem milchigen Ton unter, bis der gesamte Augapfel zusammengeschrumpft war und zu Staub zerbröckelte.
Ein freudloses Lächeln huschte über meine Lippen, als ich mir das rabenschwarze Haar aus dem staubigen Gesicht strich. Noch heute wundere ich mich, dass ich trotz meiner mehr als 600 Jahre nicht älter als 19 aussah. In diesem Alter war ich etwa gewesen, als ich zur Hölle gefahren war.
„Du vergisst, dass ich bei Luzifer im Palast leben muss. Ich wache jeden Morgen mit dem Geschrei der Gefolterten auf.“
„Ja, aber du bist freiwillig gegangen!“, stieß der Untote zischend hervor.
Erstaunt hob ich eine Augenbraue. „Du etwa nicht?“, fragte ich, bekam jedoch keine Antwort.
Natürlich war er wie ich freiwillig hier unten. Jeder in der Hölle war das. Das war schließlich das geltende Prinzip: die Möglichkeit, wählen zu können.
Einige Augenblicke sagte keiner von uns beiden ein Wort. Erhard schien tief in seine Gedanken versunken zu sein, während er sich den letzten Rest Haut vom Schädel kratzte. Dabei fiel seine Nase mit einem lauten Reißen in den Staub. Wir ließen sie beide achtlos liegen.
Das Brachland vor uns schien sich immer weiter in die Endlosigkeit auszubreiten, selten unterbrochen von einem kargen Baum oder Stein. Mit jedem trockenen Schritt wirbelten wir Sand auf, der uns in die Augen wehte, wobei ich wohl die Einzige war, die sich daran noch störte.
„Hast du eigentlich schon etwas von Luzifer gehört? Wirst du wieder ausrücken müssen?“ Nun brach ich die Stille doch. Erhards stummes Grübeln gefiel mir nicht. Normalerweise war es sein munteres Geplauder, das mich von meinen eigenen finsteren Gedanken fernhielt.
Mein Freund sah mich mit leeren Augenhöhlen an und kratzte sich grunzend die nackte Schädeldecke. Es war schwerlich zu glauben, dass ihn noch etwas juckte, doch manche Angewohnheiten ließen sich selbst nach Jahrhunderten des Todes nicht ablegen.
„Luzifer ist seltsam zurückhaltend in letzter Zeit. Die Kämpfe werden weniger. Ich habe das Gefühl, dass er etwas plant. Doch ich bin wohl einer der Letzten, der davon erfahren wird.“ Resigniert zuckte er mit den halb zerfressenen Schultern und grinste melancholisch. „Ich bin nämlich nicht der Liebling des Teufels.“
„Ich bin auch nicht sein Liebling“, erwiderte ich ein wenig giftig, was mir jedoch nur ein höhnisches Lachen einbrachte.
Erhard und ich hatten unterschiedliche Ansichten, was den großen Herrscher der Unterwelt anging. Er selbst sah Luzifer als eine Art gerechte Strafe für die Sünden seines alten Lebens. Ich hingegen hielt ihn für einen nervtötenden Plagegeist, der ganz und gar kein Schamgefühl besaß. Vor allem wenn es um die Privatsphäre ging. Luzifer war ein verdammter Spanner!
„Luzifer will mich als Spielzeug. Er ist frustriert, weil ich mich weigere, mit ihm ins Bett zu steigen. Sonst nichts!“ Meine Stimme klang eine Spur zu hoch und schrill, denn Erhard warf mir einen äußerst ungläubigen Blick zu.
„Liebes, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber er hat angedroht, jeden ein Jahrhundert lang in den Kerker zu werfen, der es wagen sollte, eine Liebesbeziehung mit dir anzufangen. Für mich klingt das nach ein wenig mehr als ... frustriert.“
„Ich weiß ganz genau, was er gesagt hat!“, fauchte ich entnervt, während ich gleichzeitig vor Scham mit den Zähnen knirschte. Er hatte es nicht nur angedroht, sondern es in der gesamten Stadt mit jungfräulichem Blut an die Hauswände schmieren lassen!
Erhard brach in schallendes Gelächter aus und schüttelte knirschend den Kopf. „Ich weiß nicht, warum du dich überhaupt so zierst. Luzifer hat schon lange dein Herz erobert. Du bist nur zu stolz, um es zuzugeben.“
Ich schnaubte ungehalten und warf ihm einen finsteren Blick zu. Wie konnte er so etwas sagen? „Ja, es brächte mir Vorteile für die nächsten Jahre, bis er genug von mir hat und meinen Kopf aufspießen lässt. Eine Trophäe mehr in seiner Sammlung von Ge... Duck dich!“ Mit aller Kraft packte ich Erhard am Nacken und presste ihn zu Boden.
„Was? Was ist los?“, fragte er alarmiert und wollte sich prompt aufrappeln.
„Pech und Schwefel!“, zischte ich warnend und drückte ihn wieder in den Staub.
Der Untote erstarrte vor Entsetzen. Mein Herz schlug vor Angst augenblicklich schneller. „Der Hund ist da! Dann können die Reiter nicht allzu weit entfernt sein. Ich dachte, wir hätten noch genug Zeit“, flüsterte Erhard panisch.
Zitternd presste ich mich enger an den Boden und beobachtete mit pochendem Herzen das Höllenwesen, dessen massiger Leib auf das offene Stadttor zuschlich. Die karmesinroten Mauern, die das Innere der Siedlung umschlossen, schienen wie ausgestorben. Der Ort, der ansonsten von Verdammten nur so wimmelte, lag verlassen vor uns.
Die aufgespießten Köpfe der Verurteilten auf den Mauerzinnen riefen indessen wüste Verwünschungen und Schmähungen auf den zweiköpfigen Hund herab. Dieser schien jedoch vollkommen unbeeindruckt von den Kommentaren zu sein. Der Zerberus, auch Pech und Schwefel genannt wegen seiner zwei Köpfe, schnüffelte mit seinen schwarzen Nasen in der Luft herum, die Lefzen zu einem stummen Knurren nach oben gezogen, während seine Muskelmassen mit jedem Schritt vibrierten.
Er schien zu lauschen. Seine Ohren zuckten, als die Krallen seiner Pfoten den trockenen Boden aufrissen und tiefe Narben darin hinterließen.
Ich konnte die aufgespießten Köpfe fluchen hören. Einer schien nach unten spucken zu wollen, während ein weiterer ein ums andere Mal „Husch, Hündchen, husch!“ brüllte.
„Was ... was tut er?“, fragte Erhard, der die Anspannung nicht mehr auszuhalten schien.
„Psssst!“, zischte ich panisch, doch es war schon zu spät. Der Hund hob abrupt die massigen Köpfe und schien uns direkt anzuvisieren. „Verdammt noch mal, Erhard!“, keifte ich, indem mir aus allen Poren der Angstschweiß ausbrach. Der verdammte Hund hatte uns entdeckt!
„Entschuldigung“, stöhnte der Untote.
Zerberus stellte knurrend seine Nackenhaare auf. Seine zwei Köpfe schnellten in unsere Richtung und beide Mäuler begannen, ohrenbetäubend zu bellen. Sein monströser Körper setzte sich in Bewegung und polterte auf uns zu.
„Lauf! Lauf!“, rief ich und spürte einen Ruck durch meine Glieder fahren. Mein Überlebensinstinkt übernahm die Kontrolle. Meine Beine rasten über den trockenen Boden, wirbelten Steine und Sand auf, während hinter mir das bedrohliche Hecheln immer näher kam.
Wie ich es hasste, gejagt zu werden! Vor Anstrengung kam ich kurz ins Straucheln und konnte nur mit knapper Not einem der schnappenden Kiefer ausweichen. Ich spürte die scharfen Zähne dicht über meinem Kopf zusammenkrachen.
Hektisch keuchend sah ich mich um und knirschte frustriert mit den Zähnen. Wie bereits befürchtet, ließen die Besitzer des Höllenhundes nicht lange auf sich warten. Ich fühlte das Dröhnen der galoppierenden Pferdehufe unter meinen Fußsohlen und hörte das Grölen, während sie ihren Vierbeinern die Sporen gaben.
Mein Herz raste vor Anstrengung, als ich schlitternd zum Stehen kam. Mit einer Hand fasste ich nach unten und schleuderte eine Handvoll Dreck in die Augen des Hundes, der gerade erneut nach meinem Kopf schnappen wollte. Er fiepte erschrocken auf und stolperte über seine eigenen Hinterläufe. Erleichtert schlug ich einen weiten Haken um den strauchelnden Hund und stürmte auf das nahegelegene Stadttor zu. Erhard lief einige Schritte vor mir, während das dröhnende Hufgedonner unserer anderen Verfolger erbarmungslos aufholte. Das Tor schien immer näher zu rücken, während die aufgespießten Köpfe uns bei unserem Sprint aufgeregt anfeuerten.
Erhard erreichte das Tor als Erstes und flüchtete sich in den rettenden Schatten der Stadt. Ich konnte seinen ängstlichen Blick auf mir spüren. Seine leeren Augenhöhlen folgten panisch meinen schnellen Bewegungen. Vor Anstrengung kam ich leicht ins Straucheln.
„Fast da! Fast da!“, keuchte ich, als ich erschöpft nach Luft schnappte.
„Eve, pass auf!“, hörte ich Erhard plötzlich schreien, obwohl seine Worte durch das laute Pochen meines eigenen Herzens seltsam leise klangen.
Glücklicherweise roch ich das Eisen, noch bevor es mir den Hals zerschneiden konnte. Schreiend ließ ich mich zu Boden fallen und rollte zur Seite. Krachend schlug eine Axt neben meinem Kopf ein und riss Brocken aus der trockenen Erde. Mein Blick erfasste schwarze Hufe. Ein dunkles Pferd mit einem ebenso schwarzen Reiter darauf, der wortlos seine Axt aus dem Boden zog und ein weiteres Mal damit ausholte.
„Du musst zaubern!“, hörte ich irgendwo hinter mir Erhard rufen.
Meine Hände flogen durch die Luft und zeichneten eine geschwungene Rune. Augenblicklich leuchtete diese blau vor meinem Gesicht. Die Luft schien sich eklektrisch aufzuladen. Meine Nackenhaare stellten sich auf. Ein lautes Zischen war zu hören und der schwarze Reiter vor mir ging plötzlich in blauen Flammen auf. Es geschah so schnell, dass ich beinahe von den Hufen des hysterisch wiehernden Pferdes niedergetrampelt wurde, als der Reiter erschrocken aufschrie und auf die lodernden Flammen einschlug, während seine drei Gefährten im gestreckten Galopp auf uns zuritten. Die Axt des schwarzen Reiters prallte knapp neben meiner Hand auf den Boden und spießte die Erde auf, gerade als das schwarze Pferd wiehernd scheute und seinen Reiter abschüttelte. Dieser krachte ebenfalls zu Boden und versuchte verzweifelt, die Flammen zu ersticken, die ihn knisternd verschlangen.
„Evening, lauf!“
Ich wusste nicht, ob dieser Befehl von mir oder Erhard kam. Dennoch beherzigte ich ihn. Ohne weiter zu überlegen, schnappte ich mir die silberne Axt des schwarzen Reiters und rannte, so schnell ich konnte, weiter. Erhards Gesicht kam quälend langsam näher. Doch bevor ich den rettenden Schritt durch das Tor machen konnte, traf etwas meinen Rücken und schleuderte mich zu Boden. Steine rissen mir das Gesicht auf und Staub füllte meinen Mund, als ich das Schnappen der Hundeköpfe im Nacken fühlte. Zähne rissen mir das Hemd vom Rücken, indem sie blutende Kratzer in meinem blassen Fleisch zurückließen. Blind vor Angst und Schmerz tat ich das Einzige, was ich noch zustande brachte, und rammte die Axt des Reiters in einen der Hundeschädel. Etwas knackte, der Zerberus jaulte schmerzerfüllt auf, während mir eine warme Flüssigkeit ins Gesicht spritzte. Das Höllenvieh gab ein ohrenbetäubendes Fiepen von sich, was mich jedoch nicht davon abhielt, die Axt noch ein Stückchen tiefer in seinen Schädel zu jagen. Knurrend schnappte der verbliebene Kopf nach mir. Seine Konzentration schien jedoch nachzulassen, sodass ich dem tödlichen Gebiss mit knapper Not ausweichen konnte.
Schnaufend presste ich die Lippen aufeinander und zog die vom Blut glitschige Axt aus dem gespaltenen Schädel, wobei ein schmatzender Laut zu hören war. Mir wurde mit jedem Atemzug unwohler. Ich schmeckte Blut auf der trockenen Zunge, als der verbliebene Hundekopf wie von Sinnen nach meinem Hals schnappte. Meine Brust hob und senkte sich in hektischen Atemzügen, während ich bereits meinem Ende entgegenblickte. Der verbliebene Kopf des Zerberus stieß geiferspritzend nach unten.
Ein entsetztes Stöhnen entfuhr meinen Lippen, doch in diesem Augenblick wurde ich von zwei kräftigen Händen am Kragen gepackt und nach hinten gerissen. Knochige Finger stießen mich mit aller Kraft durch das Stadttor, wo ich bewegungslos im Straßenschlamm landete und nach Luft rang. Fluchend presste mich Erhard an seine halb verfaulte Brust, während das wütende Gebell des Höllenviehs die Stadtmauer zum Beben brachte. Sein zweiter Kopf hing in einem seltsamen Winkel herab, als Zerberus seinen massigen Körper mit voller Wucht gegen das Stadttor warf. Es knallte laut, als er von einer unsichtbaren Mauer zurückgeschleudert wurde.
Der Hund fletschte knurrend die Zähne. Seine Nackenhaare stellten sich auf, während blutiger Speichel in den Schlamm vor uns tropfte. Doch der Höllenhund blieb, wo er war. Die Stadt ließ ihn nicht ein. Genauso wenig wie den Rest unserer Verfolger.
„Es reicht!“, unterbrach eine Stimme das hysterische Knurren des Zerberus, der augenblicklich verstummte. Seine Ohren stellten sich fragend auf. „Sie hat gewonnen. Diesmal.“ Die Worte kamen von dem grauen Reiter. Er saß beinahe gelangweilt auf seinem Pferd und um seinen schönen Mund zuckte ein amüsiertes Lächeln.
Neben ihm standen die anderen drei Reiter der Apokalypse. Das einzige weibliche Mitglied mit glänzenden, hüftlangen roten Haaren und einem irren Grinsen auf dem Gesicht zwinkerte mir belustigt zu. Der dritte Reiter war vollkommen in Weiß gekleidet, wogegen der letzte nun wieder in nichtssagendem Schwarz auf seinem Pferd saß. Die Flammen schienen gelöscht, allein der Geruch nach verbranntem Haar verriet den kleinen Zwischenfall von vorhin. Die Mienen unserer Verfolger schwankten zwischen Belustigung und Langeweile. Nur die Waffen in ihren Händen ließen den Schrecken erahnen, den zu verbreiten sie in der Lage waren.
Die Reiter der Apokalypse existierten, wie wohl die Hölle selbst, seit Urzeiten. Niemand wusste, wann sie genau aufgetaucht waren, doch jeder wusste, dass man Angst vor ihnen haben sollte. Sie waren laut Überlieferungen die Vorboten des Weltuntergangs. Der schwarze Reiter verkörperte Hunger und Armut der Menschheit. Die rote Reiterin symbolisierte die alles verschlingende Zerstörung und das Chaos. Der weiße Reiter, dessen ebensolche Haare kühl und abweisend im Höllenfeuer leuchteten, sollte das todbringende Nichts hinterlassen, so wie der graue und letzte ihrer Gruppe die Niedertracht in der Welt verbreiten würde. Ruchlosigkeit und Anstößigkeit waren jene Gaben, mit denen er problemlos eine ganze Stadt zum Einsturz bringen konnte.
Ob alle Überlieferungen der Wahrheit entsprachen, war eher fragwürdig. Dennoch stellten die Reiter das Grauen der gesamten Unterwelt dar, was in der verfluchten Hölle schon etwas heißen wollte. Dieser Titel war hier unten hart umkämpft. Das Einzige, was die Reiter der Apokalypse hinderte, selbst mächtiger als die Höllenfürsten zu werden, war die Stadtgrenze von Dis, deren Überschreiten ihnen verwehrt blieb. Trotzdem jagten sie in den umliegenden Gebieten alles und jeden, der ihnen in die Finger kam. Ihnen entkommen zu sein glich einem verfluchten Wunder.
Keuchend starrte ich den schwarzen Reiter an. Dieser musterte mich seinerseits. Seine Hände waren leer. Seine schimmernde Axt hielt noch immer ich umklammert, als würde mein Leben davon abhängen. Was eigentlich vollkommener Unsinn war, da ich bereits in der Hölle und unsterblich war. Dennoch wollte ich meinen Kopf möglichst lange behalten.
Es vergingen einige Minuten, ohne dass sich jemand von uns rührte. Mein Herzschlag beruhigte sich ein wenig. Gleichsam verringerte sich der Adrenalinausstoß, sodass sich langsam mein schmerzender Körper zurückmeldete. Schließlich nickte der schwarze Reiter. Sein Pferd schnaubte, als er es stumm wendete. Das Zaumzeug klirrte laut in der angespannten Stille. Genauso schnell, wie sie gekommen waren, verschwanden die Reiter der Apokalypse in einer übel riechenden Staubwolke. Hinter ihnen Pech und Schwefel, der ihnen lammfromm, wenn auch ein wenig desorientiert folgte.
Erhard hielt mich weiterhin fest umklammert. Zumindest so lange, bis einer der abgeschlagenen Köpfe sich mit einem vernehmlichen Räuspern zu Wort meldete. „Du kannst sie jetzt loslassen, Kumpel. Die kommen so schnell nicht mehr zurück.“
„Oh ... äh, ja.“ Erhards Hände fielen von mir ab, als hätte er sich verbrannt, bevor er sich mit einem etwas rötlich angelaufenen Schädel aufrappelte.
„Das war knapp“, seufzte ich und schloss für einige Sekunden die Augen.
„Das hast du gut gemacht“, murmelte Erhard beruhigend. Seine Hände tätschelten bekräftigend meinen Rücken, als er mich sanft in eine schlammige Gasse dirigierte, die sich langsam mit Menschen zu füllen begann.
Ich lächelte schief und starrte auf die blanke Axt in meiner Hand. Meine Fingerknöchel waren eingeschlagen, tiefe Schnitte zogen sich über meine Haut und das Blut des Höllenhundes verkrustete bereits braun unter meinen Fingernägeln. Ein amüsiertes Lächeln legte sich auf meine Lippen, als ich die Axt sirrend durch die Luft zog und herausfordernd der Höllenstadt entgegenblickte. „Wer will noch seinen Kopf verlieren? Ich hab heute einen guten Tag!“
*
Hexe: Iuvavum / Jahr 1415 / Frühling
Die Hexe sollte brennen. Es war die zweite Frau, der innerhalb von nur zwei Wochen auf dem Marktplatz der Prozess gemacht wurde. Nach der armen Elsbeth hatten die Richter nun eine Amme an den Pranger gestellt. Das Podest, auf dem das Urteil vollstreckt worden war, hatte diesmal schon um einiges weniger notdürftig ausgesehen als bei der vorherigen Verurteilung. Der örtliche Tischler hatte seine besten Gesellen kommen lassen, um ein großes Podium zu erbauen. Unentgeltlich natürlich, im Namen der Kirche. Dunkles, schweres Holz hatte die Schritte der Richter gedämpft, als diese die Amme in die Hexengrube hatten werfen lassen. Drei Tage waren vergangen, in denen die Menschen diskutiert hatten, ob die Amme nun eine Hexe sei oder nicht.
Letztlich war das Urteil gefallen.
Die Hexe würde heute auf dem Scheiterhaufen brennen. Die Menschen strömten bereits seit der Morgendämmerung auf den Marktplatz. Stände hatten begonnen, Waren feilzubieten. Ich roch die süßen Kuchen meines Vaters, die er an einer der neu erbauten Buden verkaufte.
Daneben bot der Tischler handtellergroße Kreuze an, die einen gegen den bösen Blick schützen sollten. Am anderen Ende des Marktplatzes verkaufte der Schlachter Hasenpfoten und Hühnerbeine gegen Schwarze Magie, während die örtlichen Bauern altes Gemüse verteilten. Hühner und Schweine wurden zwischenzeitlich ebenfalls verkauft und man munkelte, dass die Burgherren gedachten, einen dauerhaften Markt zu genehmigen.
Der aufregende Funke der Hexenjagd hatte das gesamte Dorf wie ein Lauffeuer angesteckt. In unserem Ort, wo sonst selten etwas Spannendes passierte, brodelte das Leben, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Während man Geschichten von Siedlungen und Städten hörte, in denen die Hexen bereits vollkommen ausgerottet waren, hatte unser Dorf gerade erst damit begonnen, Blut zu lecken.
„Eve! Eve! Geh deinem Vater helfen, ich habe etwas mit den Richtern zu besprechen.“ Apollonias schlanker Körper trat in mein Blickfeld und sie sah ungeduldig zu mir herab. In einer Hand hielt sie einen Weidenkorb, während sie mit der anderen nervös auf ihre Hüfte trommelte.
Ich selbst hielt in meinen Händen eine verfaulte Rübe, die mir der Bauerngeselle mit einem Augenzwinkern in die Hand gedrückt hatte. Das Gemüse roch schimmlig und die Haut verfärbte sich bereits ein wenig grünlich. „Kann ich nicht zusehen?“, bat ich meine Stiefmutter und sah mich aufgeregt um.
Hinter Apollonia stand Catherina, die Tochter des Metzgers, mit ihren Brüdern Wendel und Erhard. Es war nur schwer zu übersehen, dass die drei Geschwister waren. Allesamt besaßen sie braunrotes Haar. Die Brüder waren Zwillinge, etwas untersetzt und nicht wirklich groß wie manch andere Jungen des Dorfes. Doch ihre geringe Größe machten sie mit ihren muskulösen Oberarmen und Schenkeln, die ungeheure Muskelkraft in sich bargen, wieder wett. Catherinas rote volle Wangen leuchteten vor Aufregung, während sie mir hektisch zu verstehen gab, dass ich mich zu ihnen gesellen sollte.
Verstohlen linste ich zu ihrem Bruder Erhard hinüber, der meinen Blick aus leuchtend grünen Augen erwiderte. Verlegen kichernd fühlte ich in diesem Moment Schmetterlinge in meinem Bauch vor Aufregung tanzen und wünschte mir insgeheim, Apollonia würde schnellstmöglich verschwinden.
Die Inquisition würde die Hexe alsbald auf dem Scheiterhaufen verbrennen und das gesamte Dorf wollte Zeuge dieses Spektakels werden. Apollonias scharfer Blick zuckte zu den Geschwistern hinüber und Catherinas Winken fror auf der Stelle in der Bewegung ein. „Geh zu deinem Vater, Evening! Du kannst später zu deinen Freunden“, knurrte sie unwirsch. Ihre Augen blitzten warnend in Richtung der beiden Brüder, die ängstlich die Köpfe einzogen und sich schleunigst davontrollten.
Catherina sah mitleidig zu mir herüber, winkte ein letztes Mal und verschwand hinter ihren Brüdern in der Masse der Dorfbewohner.
„Schön“, schnaubte ich enttäuscht und machte mich auf den Weg zum Stand meines Vaters.