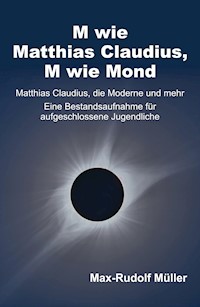
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Autor Max-Rudolf Müller möchte Jugendliche mit seinem Buch zum Lesen anregen. Zu diesem Zweck rezitiert er Stellen aus von ihm für wichtig erachteten Büchern. Es sind Bruchstücke aus Wissenschaft, Kunst, Philosophie und Theologie. Neben den Originaltexten liefert der Autor seinen jungen Lesern aber auch Kommentare, die zur Auseinandersetzung mit der Lektüre anregen sollen. Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Zunächst geht es um die Theorie und der Autor gibt sein Wissen über Literatur weiter. Der zweite Teil widmet sich der Prosa der Gegenwart, während es im letzten Teil vorwiegend um Matthias Claudius und seine Zeit geht. Der Hamburger Dichter lebte im 18. Jahrhundert, einer Zeit mit brisanten Problemen. Doch Claudius vertrat zeit seines Lebens den Standpunkt christlicher Gelassenheit. Schließlich geht der Autor noch - vor ein paar abschließenden Quizfragen - kurz auf das sogenannte »Enneagramm« ein, ein antikes Symbol, das unterschiedliche Charaktereigenschaften miteinander vergleicht und in Beziehung setzt. Heute wird es vor allem in der Analyse von Persönlichkeitsstrukturen verwendet. Der große Physiker und Theologe Karl Philberth beglückwünscht den Autor: »… dass das Anliegen Ihres Buches eine wichtige Aufgabe erfüllt. Kinderbücher gibt's viele, aber einem Glaubensbuch, das sich speziell an Jugendliche wendet, bin ich noch nicht begegnet.«Dem »Wissensteil« folgt die Hinwendung zur Gegenwart und im Schlussteil geht es vor allem um Matthias Claudius und seine Zeit. In dieser Zeit mit brisanten Problemen vertritt Claudius einen Standpunkt christlicher Gelassenheit. Der dritte Teil geht dann auch noch kurz auf das sogenannte »Enneagramm« ein und er endet mit einem Quiz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Max-Rudolf Müller
M wie Matthias Claudius, M wie Mond
Max-Rudolf Müller
M wie Matthias Claudius,
M wie Mond
Matthias Claudius, die Moderne und mehr
Eine Bestandsaufnahme für aufgeschlossene Jugendliche
für Jacek, Valerie und Carola
Copyright: © 2020 Max-Rudolf Müller
Auszüge aus Karl Philbert: Geschaffen zur Freiheit. 2. Aufl. Plumpton: BAC Austria, 1988. – ISBN 0-9585578-5-3 (Auslieferung: fe-Medienverlag, 88353 Kißlegg, www.fe-medien.de) mit freundlicher Genehmigung des Autors
Weitere Zitate erfolgten mit freundlicher Genehmigung der Autoren Paul Badde und Johannes Heinrichs. Für die Zitierung aus dem »Philosophischen Wörterbuch« bedanken wir uns beim Herder-Verlag und für die Zitierung von Hans Urs von Balthasar beim Johannes Verlag Einsiedeln.
Bilder: Bildagentur »akg-images«
Fotografien »griechischer Tempel«, »gotische Kathedrale«, »gotisches Fenster von innen«: Volker Hennig
Umschlag & Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-347-02459-5 (Paperback)
978-3-347-02460-1 (Hardcover)
978-3-347-02461-8 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Einführung
1. Hinführung
2. Die IV Teile in Umrissen
Teil I
1. Einleitung
2. Vorspiel – Die Ästhetik eines universalen Instruments: die
Schrift
3. Naturforschung
4. Reisen (Architektur, Malerei: Tempel, Gotik, Barock, C. D.
Friedrich, Die Moderne, Ikonen, Manoppello)
5. Kurze Zitate, Gedichte, spirituelle Reflexionen
6. Philosophie, Theologie
Teil II
1. Einleitung
2. Das ausgeführte Alphabet
Teil III
1. Einleitung
2. »An meinen Sohn Johannes«
3. Spinoza und Pascal
4. Noch einmal Claudius
5. Das Enneagramm
6. Ein vornehmlich musikalisches Quiz
Teil IV
Bilder
Literaturangaben
Internet-Adressen zu Teil II
Einführung
1. Hinführung
Wer geht, sieht mehr als wer fährt. Ich halte den Gang für das Ehrenvollste und Selbständigste in dem Manne. Ich bin der Meinung, dass alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge.
(Johann Gottfried Seume: Spaziergang nach Syrakus)
Anlässlich meines sich zu Ende neigenden siebten Lebensjahrzehntes rekapitulierte ich noch einmal die im letzten Halbjahr des Dezenniums gelesene Literatur und von dieser Literatur wiederum exzerpierte ich nur diejenigen Stellen, mit denen ich wohl immer etwas werde anfangen können. Es sind Bruchstücke aus Wissenschaft, Kunst, Philosophie und Theologie, die natürlich in ihrer Rezeption meine ganz persönliche Signatur aufweisen.
Ich entschied mich dann, das Exzerpierte – möglichst historisch und systematisch geordnet – nicht nur als erledigt abzulegen, sondern es auch für meine Kinder als ein stark subjektiv gefärbtes Lexikon wichtiger einschlägiger Begriffe und bemerkenswerter Denkmäler aus Wissenschaft und Kultur bereitzustellen oder – wenn man so will – es als Steinbruch anzubieten, in dem sie nach Belieben sollten wirken und wüten könnten.
Der nächste Schritt erfolgte dann beinahe wie von selbst: eine Veröffentlichung zu bewerkstelligen für jeden des Lesens fähigen, für jeden des Wissens begierigen, für jeden um den Lebenssinn bemühten Jugendlichen. Damit stellte sich sozusagen wie von selbst etwas ein, das für alle, die schreiben, ein bekanntes Phänomen ist: Das eine treibt das andere aus sich hervor. Das aber hieß im Konkreten: Der Wissensakkumulation sollte ein anderer Teil korrespondieren. Auf der einen Seite also Spuren, die auf ein Wissen verweisen – Spuren, die zu einer, oder besser, zu vielen großen Kulturschöpfungen führen und sozusagen nur die Fährte dahin legen sollen, eine Fährte in die Vergangenheit, die immer eine Wirksamkeit hat auf Gegenwart und Zukunft – und auf der anderen Seite dann der erinnerten Vergangenheit gegenüber der Ausblick auf eine wie auch immer antizipierte Zukunft. Wichtiger jedoch als eine große Spekulation schien mir persönlich das Betonen dessen, was auch in Zukunft Tragfähigkeit atmen kann, und zwar als Spiritualität und Glauben.
Um diesen Aspekt zu erfassen, bot sich mir ein Text an, den ich vor circa zehn Jahren geschrieben hatte, in Auseinandersetzung mit Matthias Claudius. Claudius schrieb 1799 ein Testament mit dem Titel »An meinen Sohn Johannes«, gleichsam ein Vermächtnis eines Boten einer Weltsicht aus ganz besonderer Perspektive. Ein weiterer Grund für die Hinwendung zu Claudius war, dass sich in dem von mir Exzerpierten des letzten Jahrzehnts Auszüge fanden, von ausdrücklichen Betrachtungen des besagten Autors zu den Religionen und darunter natürlich zu der christlichen Religion.
Zwei Teile standen sich nun gleichsam gegenüber: hier Rückblick und dort mit testamentarischem Blick geschärfte Erfassung des Lebens und seines Sinnes in zu gestaltender Gegenwart und zu erwartender Zukunft. Dazwischen drängte sich dann ein dritter Teil – auch wieder wie von selbst –, nämlich die tatsächlich zu bestreitende Gegenwart mit ihrem unvorstellbar großen Reservoir an Phänomenen, deren mannigfaltige Disparatheit sich widerspiegelt in beinahe ebenso mannigfaltig heterogenen »Theorien« menschlichen Selbst-, Welt- und Gottesverständnisses.
Wir haben nun also drei Teile: Erstens eine im Wissen von großen Theologien, von großen Philosophien, von großen Wissenschaftlern und von großen Schriftstellern und Künstlern erinnerte Vergangenheit, zweitens eine im Leben erfahrene Gegenwart (dargestellt durch das Alphabet im mittleren Teil des Buchs) und drittens eine bestehende und gleichzeitig ausstehende Zeit – eine Zeit der utopisch oder eschatologisch verstandenen Zukunft –, die gestaltet sein will im politischen Gemeinwillen von vielen zur Vernunft kommenden Einzelwillen, die letztlich ihre Kraft aber nur empfangen können aus einem sittlichen und einem vor allem religiösen Bindungswillen einer Macht gegenüber, die Claudius einfach akzeptierte als etwas Positives und als etwas durchaus Vernünftiges, da aus einer verheißungsvollen Zukunft heraus schon das hiesige Leben sinnvoll gestaltet werden kann.
2. Die IV Teile in Umrissen
Teil I im Umriss
Hat das Buch insgesamt eher ein clustermäßiges Vorgehen, so ist dies besonders für dessen ersten Teil der Fall. Hinter all den verschiedenen Gebieten und hinter allen einzelnen Momenten wirkt jedoch unsichtbar eine leitende Hand. Wie wird nun vorgegangen? Nun: Begriffen aus der Physik folgen Darstellungen von Kunstwerken der Geschichte, die man mit eigenen Augen wahrnehmen kann, es folgen kurze Zitate, Gedichte und spirituelle Reflexionen. All dies rundet sich ab mit Begegnungen von philosophischtheologisch grundsätzlichen Begrifflichkeiten. Zum Staunen veranlasst die Natur, zur Reiselust lädt die Kunst ein, die Dichtung lädt ein zur Besinnung und die Philosophie wiederum lädt ein zu ihrer ihr eigentümlichen Besinnungsart.
Einiges wird dogmatisch vorgesetzt – nicht vorausgesetzt! – und fordert im Selbststudium zu weiterführender Auseinandersetzung und Kritik auf.
Der geheime Mittelpunkt des Ganzen ist selbstverständlich offenbar, aber das Spektrum ist doch weit angelegt, sodass keine Beklemmungen auftauchen können, sondern eher Anregungen aufblitzen. Über den Zank des Alltags hinaus gibt es anderes und Wegweisendes.
Der Zank tritt ja besonders im zweiten Teil auf. Hingegen wird er auf höherer Ebene auch im dritten Teil sichtbar. Es geht dort letztlich um die noch heute bewegende Frage nach der Transzendenz und Personalität Gottes, die angeblich aufgehoben ist in seiner immanenten Weltlichkeit.
Es ist müßig, noch einmal zu betonen, dass es sich bei dem Vorgestellten nur um Abbreviaturen handeln kann von demjenigen, was wissenswert ist. Zudem ist in keiner Weise auf Originalität Wert gelegt und so sind beinahe alle Gedanken wortwörtlich zitierte Gedanken aus einschlägigen Lexika und einschlägiger Fachliteratur. Wenn nicht wortwörtlich, dann sind Änderungen wegen eines flüssigeren sprachlichen Duktus vorgenommen. Den Zitaten folgen knappe Quellenangaben in Klammerform. In Klammerung erscheinen auch die Lebensdaten der meisten Autoren. Die bibliographischen Angaben finden sich im Literaturverzeichnis des Anhangs, dort werden nur die uns besonders wichtigen Werke aufgeführt.
Teil II im Umriss
Im zweiten Teil erfolgt das ausgeführte Alphabet.
Teil III im Umriss
Im dritten Teil nun wird nicht nur zitiert, sondern in der Auseinandersetzung mit Matthias Claudius auch ein wenig Eigenes beigesteuert. Dort komme ich im Abschnitt III,3b auch auf den Antipoden des dem Claudius wohlbekanntem Spinoza zu sprechen: auf Pascal – auch den kennt Claudius gut. Wie sehr unterscheidet sich doch dieser geniale Naturwissenschaftler von dem soeben erwähnten außergewöhnlich begabten Karl Philberth, wieviel mehr Vertrauen in den Kosmos hat – bei allen »Unbestimmtheiten« – Philberth als Pascal. Beide sind große Physiker. Während die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse der anbrechenden Neuzeit den großen Pascal eher verunsichern – Pascal selbst trägt zu bahnbrechenden Erkenntnissen in der Mathematik und der Physik bei – und er sicheren Boden in der Religion sucht, fasst Philberth gerade die Doppelbödigkeit physikalischer Phänomene in ihrer strukturellen gegenseitigen Bedingung und Bedingtheit als Beleg eines göttlichen Schöpfungsplans.
Das theologische Augenmerk ist aber nun im dritten Teil auf die oben erwähnten Antipoden gerichtet. In der Forschungsliteratur wird gar nicht so sehr auf diesen Antagonismus eingegangen, ich halte ihn nichtsdestotrotz für sehr bedeutsam, weil alle Jahrhunderte hindurch bis auf unsere Zeit an dem sich dort kundtuenden Gegensatz Wesentliches offenbart, das die modernen Menschen mehr oder minder unbewusst bewegt.
Das letzten Endes eigentliche Augenmerk ist nun die »Auseinandersetzung« mit dem testamentarischen Ansinnen von Claudius. Inwieweit ist für uns Heutige das dort Anvisierte noch anwendbar und lebbar, wenn unser Leben und Erleben von der Zeit eines Claudius doch so weit entfernt ist? Wer z. B. von den heutigen Schriftstellern würde sein Werk noch dem speziellsten aller Freunde widmen – dem Tod? Matthias Claudius hat jeden Tag seines Lebens als Christ gelebt und damit mehr oder weniger unerschrocken den Tod vor Augen gehabt. So hat er sein Werk »Der Wandsbecker Bote« einfach dem Freund Hain dediziert: Ihm dediziere ich mein Buch, und er soll als Schutzheiliger und Hausgott vor der Haustüre des Buches stehen.
Der dritte Teil hat nun fünf Abschnitte: das Testament für seinen Sohn Johannes, die Gegenüberstellung von Spinoza und Pascal, nochmals einiges zu Claudius, während das ganze Unternehmen dann in Abrundung ausklingt mit Gedanken aus dem Enneagramm, in dem es darum geht, den Menschen aus einer letztlich selbst verschuldeten Unmündigkeit herauszuführen, um ein Glück zu finden, das dann schließlich nur in wie auch immer gestalteter Gemeinsamkeit mit sich selbst zu finden ist, mit seinesgleichen, mit dem Kosmos, mit Gott. Ein Quiz bildet dann den tatsächlichen Abschluss. Im Zusammenhang mit diesem wird auch die Musik gestreift als eine der bedeutenden Kunstgattungen – im ersten Teil war ja von der Architektur, der Malerei und der Dichtung die Rede.
Teil IV Anhang
Bildteil und Literatur
Teil I
1. Einleitung
Da meine Arbeit ja im Grunde einen hungrig machenden Abglanz von dem aufschimmern lassen möchte, was für die Bildung eines jedweden jungen Menschen notwendig ist, insofern dieser auch interessiert ist, um seiner Bildung wegen das zu lernen, was über bloßes Leben der Unmittelbarkeit hinausgeht und somit auch Anstrengung und Fleiß erfordert, um sich schließlich die Welt anzueignen und sich in ihr sicher und heimisch zu fühlen, unterlasse ich nichts, was eine junge Seele neugierig auf die Welterfahrung machen könnte: Allein schon in der Darstellung verschiedener Schriften spiegelt sich der ungeheure Reichtum der Menschheit auf einer ihrer zahlreichen Ebenen wider. In diesen Schriftzeichen nun entbergen sich berühmte gedankliche Äußerungen bestimmter Kulturen. Ferner werden in dem Buch als Ziele möglicher Reisen eines sich bildenden Menschen – dem in dem heutigen Vergnügungsreisezeitalter die Bildung im eigentlichen Sinne immer seltener schmackhaft gemacht werden kann von einer Menschheit, die nun endlich auch einmal erst rein äußerlich nachholen möchte, was aristokratische und großbürgerliche Zeitalter wie selbstverständlich für sich beanspruchten – bestimmte Fotografien von sakralen und profanen Kunstwerken gezeigt, die jeder einmal gesehen haben sollte, durch einen Besuch vor Ort in der betreffenden Stadt, in dem betreffenden Land. Die genannten Kunstwerke sind natürlich nicht einmal der Tropfen auf einem heißen Stein im Vergleich zu dem, was ein strenger Bildungskanon fordern könnte.
Wenn einiges an Essenziellem vermittelt werden soll, dann ist das Genannte aber immerhin schon etwas und immerhin gibt es in unserem Land auch noch Schulen – noch.
PS: Im »ABC« vermerkte ich bei meiner allerersten Abwandlung des »Güldenen Alphabet« von Matthias Claudius unter dem Buchstaben »R« den Begriff »Reisen, ich behielt ihn bei – das ganze Alphabet erhielt dann zum guten Schluss eine sehr viel prosaischere Konzeption und Ausführung als insgesamt am Anfang.
2. Vorspiel – Die Ästhetik eines universalen Instruments: die Schrift
Wie schon gesagt, offenbaren alle Kulturen auf eigentümliche Weise ihren Geist in unterschiedlichen Formen der schriftlichen Fixierung. Exemplarisch stellen wir aus der Fülle der Kulturen fünf Schriftgattungen vor. Zuerst sehen wir eine chinesische Schrift – bekanntermaßen bestehen die Träger dieser Schrift aus Zeichen, die nicht wie in unserem Alphabet einen Laut repräsentieren, sondern eine Bedeutung; nur in sehr eingeschränktem Maße kann man von ihnen als Bildern im Sinne von Picto- und Ideogrammen reden, das Gleiche darf von den Hieroglyphen gesagt werden – in einem buddhistischen Tempel, dann folgt zweitens ein Beispiel für eine hieratische Schrift par excellence: die Hieroglyphen der großen ägyptischen Kultur. Dann sollten drittens die hebräischen Schriftzeichen des Satzes Ich bin der Ich bin folgen, es folgten aber andere Verse aus der Bibel, dann folgen viertens – in griechischem Alphabet geschrieben – die nicht minder berühmten Definitionen des Menschen als das Vernunft habende die Polisgemeinschaft begründende Lebewesen. Schließlich folgen fünftens wunderbar gestaltete Suren aus dem Koran. Eine erste Begegnung über ein gleichsam synoptisches Erfassen verschiedener Schriften macht schon allein auf dieser Ebene mit dem Reichtum der Kulturen vertraut. Was aber heißt »schon allein auf dieser Ebene«? Denn ist nicht die Erfindung der Schrift, ob sie sich profan oder sakral – einem höheren als dem Alltagszweck dienend – versteht, ein göttliches Geschenk? Selbst eine nicht in kultischen Rahmen eingebundene Schrift ist ein handwerkliches Kunstwerk sui generis.
Ist so zum Beispiel schon diese griechische Schrift nicht einfach ansprechend? Sie führt in die Welt der Hellenen und übersetzt geht es hier um die Definition des Aristoteles: der Mensch als mit Vernunft begabt, die sich (in der Vorlage hatte ich das so formuliert.) dann vollendet im Menschen als dem Wesen, das teleologisch auf die Polis hin angelegt sei. Die höchste Bestimmung sei dann schließlich der Mensch als das der Theorie – des Studiums und der Betrachtung der göttlichen Dinge – fähige Wesen. Hier die zwei ersten in griechischer Schrift geschriebenen Definitionen:
ζῷον λόγον ἔχον, ζῷον πολιτικόν
Dass die griechische Schrift als solche, wie beinahe jede Schrift überhaupt, nicht von dem transportierten Inhalt abhängt, versteht sich von selbst. Wir hätten z. B. auch fürchterlichste Verwünschungen in den geschmeidigen Schriftzeichen des griechischen Alphabets niederschreiben können.
3. Naturforschung
Wichtig wären uns die herausragenden Gestalten eines Kopernikus, eines Kepler, eines Newton und die ganze Reihe der großen Physiker und anderer Naturwissenschaftler in Gestalt zum Beispiel von Werner Heisenberg (1901–1976), Max Planck (1858– 1947), Niels Bohr (1885–1962) gewesen, dies ging leider nicht. Durch Karl Philberth kann uns aber schon ein Licht aufgehen für das Verstehen bisher noch mehr oder weniger dunkler Seiten der Natur. Wichtige Begriffe der Physik werden einbezogen und auch eine Linie sollte sichtbar werden für die Entwicklung in den Naturwissenschaften, ein Anstoß für die Beschäftigung mit der grandiosen Wühlarbeit des menschlichen Geistes, wo es einem ganz anders wird bei der Feststellung, sich damals nicht ausreichend auf das Gebiet der Naturwissenschaften eingelassen zu haben und wo dann die Hoffnung bleibt, die Jugend möge die Fridays doch auch nutzen, um zum Beispiel über die Gravitation, die Masse, die Raum-Zeit, die thermodynamischen Grundsätze oder über die Entropie etwas zu erfahren, deswegen muss ja kein berechtigtes Aufbegehren ausfallen. Nicht alle markanten Begriffe sind im jetzigen Abschnitt markiert, der Leser wird sie selbst finden müssen. Eine Linie soll erkennbar werden, die in den andeutenden Darstellungen von Entropie und Evolution, von Evolution und Schöpfung mündet. Ein weites Feld für konträre Theorien in Naturwissenschafft, Philosophie und Theologie – auch heute noch oder vielmehr: gerade heute. Auch der Mond als Objekt der Wissenschaft, heute vor allem als Objekt der politischen Begierden Amerikas und Chinas, sollte vorgestellt werden, leider muss diese Vorstellung ausfallen. Matthias Claudius und Caspar David Friedrich werden nicht traurig sein.
Dass die Naturwissenschaften hier in dieser Schrift vor allem in dem schon zitierten Karl Friedrich Philberth





























