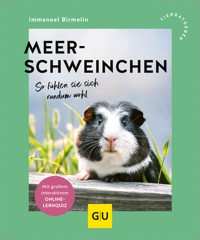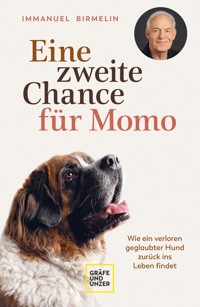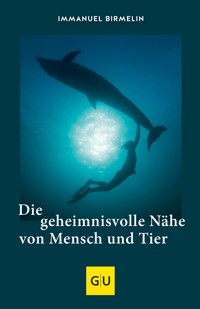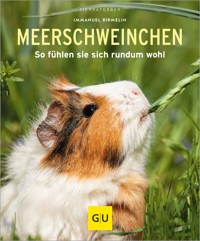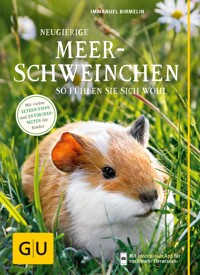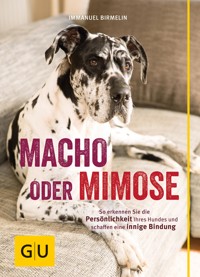
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gräfe u. Unzer
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: GU Tier Spezial
- Sprache: Deutsch
Macho, Angsthase, Abenteurer oder Mimose? Mit welchem Hundetyp teilen Sie Ihr Zu-hause? Die Antwort gibt Ihnen der international bekannte Verhaltensbiologe Dr. Immanuel Birmelin im GU Buch "Macho oder Mimose - So erkennen Sie die Persönlichkeit Ihres Hundes und schaffen eine innige Beziehung". Er zeigt jedem Hundehalter, wie sein Hund gestrickt ist. Dabei übersetzt er wissenschaftliche Erkenntnisse - etwa wie und wo die Persönlichkeit entsteht - unterhaltsam und leicht verständlich für jeden Hundehalter. Tests verraten Ihnen alles über das Wesen Ihres Vierbeiners. Das Wissen um die Persönlichkeit erleichtert auch die Erziehung und Ausbildung des Hundes. Übungen aus der Praxis fördern den Hund und sagen etwas über seine Intelligenz aus. Tipps und Tricks helfen, richtig auf die Persönlichkeit des eigenen Vierbeiners einzugehen. Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie Ihren Hund mit anderen Augen sehen und eine noch innigere Beziehung zu ihm haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jeder Hund ist eine feinfühlige Persönlichkeit
Wer ich bin, bin ich dank meiner lieben Mutter und meiner Hunde. Sie haben meine Persönlichkeit geprägt. Meine Mutter hat mich mit fünf Jahren auf den Hund gebracht. Sie schenkte mir einen Chow-Chow. Seitdem habe ich nie mehr ohne Hunde gelebt. Ich habe ihre Seelen berührt und sie die meine. Schon als junger Mensch erkannte ich, dass jeder Hund eine eigene Persönlichkeit hat – was alles andere als selbstverständlich ist. Die Wissenschaft beschäftigt sich erst seit wenigen Jahren mit der Persönlichkeit von Tieren. Aber bis heute ist ein Großteil unserer Gesellschaft nicht bereit, Tiere als Persönlichkeiten zu betrachten. Wenn es um gute Hundehaltung geht, liegt der Fokus häufig nur auf artgerecht. Dabei ist das Eingehen auf das individuelle Wesen ebenso wichtig wie Art und Rassezugehörigkeit. Gerade beim Erziehen und Ausbilden des Hundes wird seine Persönlichkeit viel zu wenig berücksichtigt. Die Hundehalter-Welt ist voll von Erziehungsrezepten. Glauben Sie nicht alles. Erst die richtige Prise Gefühl und Verstand schafft innige Nähe. Viel Spaß beim »Entdecken« Ihres Hundes!
Der Persönlichkeit auf der Spur
Selbst wenn alle Welpen eines Wurfes gleich aussehen, so hat doch jeder von ihnen eine eigene Persönlichkeit. Wem es gelingt, das Wesen seines Vierbeiners zu ergründen und entsprechend darauf einzugehen, der macht sich selbst und seinen Hund glücklich.
Ein Hund namens Felix
Felix war ein langhaariger Altdeutscher Schäferhund – ein wahrer Prachtkerl. Er hatte als einziger seiner Geschwister lange Haare und sah aus wie ein Kuschelbär. Schon aus diesem Grund fiel die Wahl meiner Frau und mir nicht schwer. Felix zog als neues Familienmitglied bei uns ein. Felix wurde gut sozialisiert und lernte das ABC der Hundeerziehung im Nu. Er war sehr neugierig, abenteuerlustig und verträglich – sowohl Artgenossen als auch Menschen gegenüber. Angst kannte er kaum. Unser vierbeiniger Liebling war ein verschmuster Draufgänger, der es liebte, hinter den Ohren gekrault zu werden. Acht Jahre lebten wir zusammen im Glück, aber dann, an einem Frühsommertag, geschah es. Felix wurde schwer krank. Er bekam starken Durchfall, konnte keine Nahrung mehr bei sich behalten und hatte hohes Fieber. Er war so geschwächt, dass er sich kaum noch bewegen konnte.
Die niederschmetternde Diagnose der Tierärzte: Felix litt an der gefährlichen Viruserkrankung Staupe. Diese Krankheit verläuft oft tödlich, wenn der Hund nicht dagegen geimpft ist. Doch vor 1960 gab es noch keine lebensrettende Impfung. Meine Frau, seinerzeit als junge Ärztin an der Uni-Klinik tätig, nahm den Kampf gegen die Krankheit auf. Ihre Mittel waren zu damaliger Zeit sehr begrenzt. Sie kochte Karottengemüse und Suppe in allen erdenklichen Variationen und fütterte den Patienten Löffel für Löffel, bis der Durchfall endlich stoppte. Nach einer Woche intensiver Betreuung war der Kot von Felix wieder normal geformt. Unser Vierbeiner schien über dem Berg und erholte sich rasch. Doch die Freude währte nur kurz ... Etwa vierzehn Tage später passierte es: Meine Frau trank stehend einen Kaffee in der Küche, als Felix aus heiterem Himmel anfing zu knurren. Ich nahm die Bedrohung gar nicht ernst, sondern las weiter in meinem Buch im Wohnzimmer. Küche und Wohnzimmer grenzten aneinander, die Tür stand offen. Plötzlich setzte Felix zielgerichtet zum Sprung an, mit der Absicht, meiner Frau in die Kehle zu beißen. Solch einen Angriff eines Hundes auf einen Menschen habe ich bis heute nie wieder gesehen. In allerletzter Sekunde konnte ich Felix am Schwanz packen und ihn von meiner Frau wegziehen. Ich ging auf Felix los und schrie ihn an. Glücklicherweise reagierte er auf mich. Er ließ von seinem Angriff ab. Nach dieser Attacke verhielt sich Felix wieder »normal«. Er ließ sich streicheln und beschmusen, als wenn nichts gewesen wäre. Doch meine Frau war enttäuscht. Sie hatte so viel Liebe, Kraft und Empathie in den kranken Felix gesteckt. Sollte dies der Dank sein?
Krankheit kann die Persönlichkeit verändern Nach ausgiebiger Recherche fanden wir heraus, dass das Staupevirus auch das Gehirn angreifen und schädigen kann. Die Folge sind schwere neurologische Erkrankungen. War dieser aggressive Angriff auf meine Frau eine Konsequenz der Erkrankung von Felix? Die Tierärzte waren dieser Meinung. Wir machten uns Sorgen, wie es mit uns dreien weitergehen sollte. Einige Tierärzte rieten uns, Felix einschläfern zu lassen, weil seine Aggressivität eine schlummernde Zeitbombe sei. Niemand wusste, welche Veränderungen in seinem Gehirn stattgefunden hatten, geschweige denn, wie man ihn heilen konnte. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch entschlossen wir uns, mit Felix weiterzuleben. Menschen griff Felix nicht wieder an. Aber seine Gelassenheit und Friedfertigkeit anderen Artgenossen gegenüber hatte er verloren. Er wurde ängstlicher und aggressiver, und manche Begegnung mit anderen Hunden endete in einer Keilerei. Der Friede war dahin. Felix lebte noch drei Jahre. Wir machten das Beste aus dieser Situation. Einige seiner Persönlichkeitsmerkmale wie Zuverlässigkeit, Fruchtlosigkeit und Neugierde waren verschwunden. Felix war nicht mehr der Alte. Seine Persönlichkeit hatte sich verändert. Die Persönlichkeit von Tieren war in jener Zeit für die Wissenschaft noch kein Thema. Der Wandel fand erst in den letzten zehn Jahren statt, als man sich der Tierpersönlichkeit mit neuen biochemischen und bildgebenden Verfahren näherte.
Wenn Medikamente Segen bringen Erst zwanzig Jahre nach meinem Erlebnis mit Felix sah ich mich plötzlich wieder durch Cody, einen Dalmatiner-Rüden, mit der Veränderung der Persönlichkeit konfrontiert. Wir drehten gerade in den USA für unseren Film »Wenn die Tiere reden könnten«. Cody lebte in einem Vorort von Philadelphia. Von einem Tag auf den anderen änderte er sein Verhalten schlagartig. Er drehte sich im Kreis und versuchte sich in den Schwanz zu beißen. Jede Einmischung in sein sinnloses Tun beantwortete er mit Knurren und Schnappen. Seine Besitzer Mike und Mary waren ratlos, entsetzt, hilflos und sehr traurig. Kein Tierarzt der Umgebung konnte ihnen helfen. Durch Zufall hörten sie von Doktor Karen Overall, einer Spezialistin für psychische Erkrankungen bei Hunden. Karen Overall diagnostizierte bei Cody eine Zwangsneurose (→ >) und verabreichte ihm ein Medikament, das auf die Psyche der Hunde einwirkt. Dieses Medikament – ein Psychopharmakon – wurde im Tierversuch an Hunden erprobt und dann bei Menschen mit einer Zwangsneurose erfolgreich eingesetzt. Auch bei Cody zeigte es Wirkung. Nach einigen Tagen trat Besserung ein. Cody lief weniger im Kreis herum und schnappte kaum noch nach seinem Schwanz. Er wurde vollständig von seiner Zwangsneurose befreit, aber nicht geheilt, denn ohne die Pille kommt es unweigerlich zu einem Rückfall. Oder anders ausgedrückt: Nur mit der Pille kann Cody seine Persönlichkeit stabilisieren. Ohne sie bricht das chemische Gebäude seines Gehirns ein, und er ist ein anderer.
SCHON GEWUSST ?
Europäische Jäger und Sammler haben vor etwa 19.000 bis 32.000 Jahren als erste Menschen Hunde gehalten. Das fanden finnische Forscher heraus. Zuvor vermutete man den Ursprung der Hunde in Ostasien. Doch nachdem DNA-Proben von Hunden und Wölfen, die vor 1000 bis 36.000 Jahren lebten, und heute lebenden Hunden und Wölfen verglichen wurden, spricht vieles dafür, dass der Ursprung der heutigen Hunde Europa ist.
Wo die Persönlichkeit verankert ist
Die Persönlichkeit von Mensch und Tier ist im Gehirn verankert. Unterschiedliche Gehirnteile arbeiten zusammen, um aus einem Organismus eine Persönlichkeit entstehen zu lassen. Aber darüber später mehr, wenn wir uns mit dem Aufbau des Menschen- und Hundegehirns beschäftigen (→ >). Zuerst wollen wir der Frage nachgehen: Was versteht man unter Persönlichkeit, und wie kann man die Persönlichkeit von Menschen und Tieren erfassen?
Der Verhaltensphysiologe und Hirnforscher Gerhard Roth schreibt in seinem Buch »Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten«: »Menschen zeigen in dem, was sie tun, ein zeitlich überdauerndes Muster. Dies nennen wir ihre Persönlichkeit. Sie ist eine Kombination von Merkmalen des Temperaments, des Gefühlslebens, des Intellekts und der Art zu handeln, zu kommunizieren und sich zu bewegen. Personen unterscheiden sich gewöhnlich untereinander in der Art dieser Kombinationen.
Zur Persönlichkeit gehören insbesondere die Gewohnheiten, das heißt die Art und Weise, wie sich eine Person normalerweise verhält.« (→ Literatur, >) Folgt man dieser Definition, fällt es einem nicht schwer, Tieren eine Persönlichkeit zuzuordnen.
Für Hundehalter steht es außer Frage, dass ihr Vierbeiner eine Persönlichkeit besitzt. Sie zweifeln keine Minute daran, denn täglich setzen sie sich bewusst oder unbewusst mit ihr auseinander – manchmal mit Freude, manchmal mit Ärger.
Aber warum haben sich die Verhaltenswissenschaftler so schwergetan, die Persönlichkeit der Tiere zu untersuchen? Es ist doch ein zentrales und spannendes Forschungsgebiet und führt zu einem tieferen Verständnis unserer Mitgeschöpfe. Das hat mehrere Gründe:
Individualität oder Persönlichkeit erschwert die Forschungsarbeit. Viele wissenschaftliche Erkenntnisse, Regeln und Gesetze gelten nämlich nur unter Ausblendung der persönlichen Eigenschaften des untersuchten Lebewesens. Erkenntnisse, die unter bestimmten Bedingungen durch Einzelbeobachtungen an Individuen gewonnen wurden, sind nicht problemlos zu verallgemeinern. Es fehlt die statistische Überprüfung, daher ist das Weglassen individueller Unterschiede oft notwendig, um überhaupt Zusammenhänge erkennen zu können.
Die Eigenschaften einer tierischen Persönlichkeit zu erfassen, ist sehr schwierig, denn die Definition von Gerhard Roth erklärt zwar, was eine Persönlichkeit ausmacht, aber sie sagt nichts über die Persönlichkeitseigenschaften, sprich Merkmale aus.
TIPPS & TRICKS
Die individuelle Persönlichkeit des Hundes ist wichtiger als seine Rassemerkmale. Ein ängstlicher Hund braucht beispielsweise sehr viel Zuspruch und Zuwendung. Ein forscher Hund dagegen muss ab und zu gebremst werden.
Wer die Persönlichkeit seines Vierbeiners erkennt und entsprechend darauf eingeht, tut sich mit dessen Erziehung leichter.
Auf der Suche nach den »Big Five«
Ein schwerer und langer Weg Forschung lag vor den Persönlichkeitsforschern – gleich, ob sie nun Mensch oder Tier ergründen wollten. Ein erster, aber wichtiger Schritt war die Erkenntnis, nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale für sich alleinstehend zu bestimmen oder zu messen, sondern zu fragen, in welchen Persönlichkeitsmerkmalen Menschen sich quantitativ und qualitativ voneinander unterscheiden. Die jahrelange Suche nach den sogenannten »Big Five« hatte begonnen. Zunächst wurden aus gängigen Lexika alle nur erdenklichen Wörter gesucht, mit denen menschliche Eigenschaften beschrieben wurden. Aus der Vielzahl der Wörter und Begriffe blieben die »Big Five« übrig. Die Mehrzahl der Psychologen und Verhaltensforscher sind der Auffassung, dass durch die »Big Five« die Persönlichkeit am ehesten beschrieben wird. Was verbirgt sich hinter den »Big Five«?
Es sind fünf Merkmalsbereiche oder Verhaltensdimensionen, die durch die Angaben ihrer gegensätzlichen Extremformen charakterisiert sind. Allerdings gibt es dazwischen viele Abstufungen.
Verträglichkeit – Unverträglichkeit Sie bezeichnet im positiven Sinn die Eigenschaften: mitfühlend, nett, bewundernd, herzlich, warm, großzügig, vertrauensvoll, hilfsbereit, nachsichtig, kooperativ, feinfühlig. Und im negativen Sinn: kalt, unfreundlich, streitsüchtig, hartherzig, grausam und knickerig.
Extraversion – Introversion Diese Persönlichkeit ist: selbstsicher, energisch, offen, dominant, sozial und abenteuerlustig. In ihrer negativen Ausprägung: reserviert, still, scheu und zurückgezogen (→ >).
Offenheit – Verschlossenheit Sie umfasst die positiven Eigenschaften: interessiert, originell, wissbegierig, begeisterungsfähig und neugierig.
Negativ besetzt dagegen: wenig interessiert, Angst vor Neuem, intellektuell eng, einseitig.
Gewissenhaftigkeit – Nachlässigkeit Positiv gesehen: organisiert, sorgfältig, planend, berechenbar. Negativ gesehen: unorganisiert, sorglos, zerstreut, unzuverlässig und unordentlich.Natürlich ist das Modell der »Big Five« nicht unumstritten, weil es den Eindruck erweckt, dass eine Person mithilfe von fünf starren etikettierten Schubladen charakterisiert wird. Aber dem ist nicht so. Die Persönlichkeitsforscher sind sich durchaus bewusst: Es gibt jeweils unzählige Unterschubladen und fließende Übergänge. Diese Kategorisierung wurde rein quantitativ und statistisch gewonnen. Über die neurobiologischen Vorgänge in unseren Köpfen sagt sie aber nichts aus.
Ein Persönlichkeitsmerkmal meines Berner Sennenhundes Rico ist die Angst. Selbst jedem Artgenossen nähert er sich nur mit eingeklemmtem Schwanz.
Persönlichkeitsmerkmale der Tiere
In der Persönlichkeitsforschung des Menschen hat man in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Aber wie steht es mit der Erforschung der tierischen Persönlichkeit? Dem amerikanischen Psychologen Samuel D. Gosling von der Universität Berkley in Kalifornien gelang es, eine Brücke über den tiefen Graben der Psychologie und Verhaltensbiologie zu bauen. Ob die Brücke hält, wird die Zukunft zeigen. Aber erste wesentliche Schritte wurden getan. Gott sei Dank, denn wer Zugang zur Persönlichkeit seines Hundes hat, hält den Schlüssel für dessen Wohlbefinden und Gesundheit in der Hand. Warum das so ist, werden wir im Einzelnen noch genau besprechen. Aber so viel sei vorweg gesagt: Sowohl Mensch als auch Hund geht es besser, und der Mensch erspart sich viel Ärger und Zeit bei der Ausbildung seines Tieres. Beide wachsen harmonisch zusammen. Insofern ist die Arbeit von Samuel D. Gosling nicht hoch genug einzuschätzen (→ Literatur, >).
Gosling hat sich die Mühe gemacht, die Literatur zu durchforsten.
Akribisch suchte er nach Berichten, in denen tierische Persönlichkeiten beschrieben wurden. Die Wissenschaftler fragten sich: Was sind die wesentlichen Persönlichkeitsmerkmale der Tiere? Sie versuchten das in der Psychologie erfolgreiche Modell der »Big Five« auf die Tiere zu übertragen. Ihre Mühe hat sich gelohnt. Sie fanden bei den unterschiedlichsten Tierarten wie Schimpansen, Gorillas, Hyänen, Schweinen, Ratten, aber auch unter Vögeln, Fischen (Guppys) und Kraken Persönlichkeitsmerkmale, die man den »Big Five«-Kategorien zuordnen konnte. Natürlich kann man dieses Modell nicht eins zu eins auf die restliche Tierwelt übertragen. Bei Einzelgängern wie bei Hauskatzen oder Orang-Utans, einer Menschenaffenart, wird der Faktor Verträglichkeit innerhalb der Art eine untergeordnete Rolle spielen. Bei Schimpansen, unseren nächsten Verwandten, passt das »Big Five«-Modell von allen Tieren am besten. Und wie weit ist das »Big Five«-Modell bei unseren Hunden anwendbar?
Rico, der Schwierige
Antworten darauf geben Flocke, ein Schäferhundmix, Barry, eine Bernhardinerhündin, Robby, ein Retriever, und Rico, ein Berner Sennenhund. Mit Rico machte ich die schrecklichste und traurigste Erfahrung, die ich je mit einem Tier hatte. Er war der erste Hund, den ich mir als Kind selbst aussuchen durfte. Ein Freund meiner Eltern schwärmte von Berner Sennenhunden. Er erzählte mir, wie treu und anhänglich diese Hunde sind. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur Erfahrung mit älteren Chow-Chows, die sehr selbstständig sind und ihren eigenen Dickkopf haben. Für einen 11-jährigen Jungen keine geeigneten Partner. Ich träumte von einem Berner Sennenhund. Diese Rasse war Ende der 1950er-Jahre ausgesprochen selten in Deutschland. Aber der Zufall half. In unserer »Badischen Zeitung« wurden Berner Sennenhunde zum Kauf angeboten – 700 Kilometer entfernt von unserem Wohnort, in Hannover.
Rico wurde vom Züchter in eine Transportkiste gepackt und mit dem Zug nach Freiburg geschickt.
Völlig verängstigt, mit eingezogenem Schwanz, sah er uns an, als wir die Transportkiste öffneten. Er gab keinen Ton von sich. Wir führten seine Angst auf den Transportstress zurück und dachten uns nicht viel dabei.
Zu Hause hatten wir alles vorbereitet, Schlafecke mit Decke im Flur unserer Wohnung, Futter, Wasser und ein Seil, an das wir mehrere Zweige zum Spielen angebunden hatten. Spielsachen für Hunde gab es in jener Zeit noch nicht. Meine Mutter und ich waren guten Mutes. Wir versuchten, Rico zu streicheln, aber jeder Annäherung wich er aus und rannte davon. Wir gaben ihm Zeit, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, wir drängten ihn nicht. Als sich Ricos Verhalten nach einer Woche immer noch nicht änderte, wurden wir stutzig. Er ließ sich nur durch Futter anlocken, nahm es vorsichtig, aber schnell zwischen die Zähne und rannte davon. Rico reagierte wie ein wilder Fuchs oder Wolf. Auch nach drei Wochen änderte sich sein Verhalten nicht. Um mit ihm spazieren zu gehen, musste man ihn einfangen und anleinen. Mit eingezogenem Schwanz und vollkommen ängstlich näherte er sich anderen Hunden. Artgenossen und Menschen mied er. Dennoch war er an der Umwelt interessiert. Riechend und hellwach untersuchte er die Felder, die mein Elternhaus umgaben. Leider konnte man ihn nur selten von der Leine lassen, weil immer die Gefahr bestand, dass er wegrannte. Auf Zuruf reagierte er nur, wenn er hungrig war und ich ihm etwas zu fressen gab. Ich war verzweifelt. Rico bekam all meine Liebe und Kraft. Immer und immer wieder versuchte ich, ihn zu streicheln, und ging, sooft ich konnte, mit ihm spazieren. Ein Zusammenleben mit ihm in der Wohnung war auf die Dauer nicht möglich, denn er wurde nie stubenrein. Nach sieben Monaten vergeblichen Versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen, ließ mein Vater einen großen Zwinger auf dem Fabrikgelände bauen. Ich hatte den Eindruck, dass Rico sich im Zwinger wohler fühlte. Hier war er frei von menschlicher Belästigung. Trotz leichter Besserung blieb Rico zeitlebens ein scheuer, ängstlicher Hund und mied die Menschen.
TIPPS & TRICKS
Bei der Auswahl eines Welpen sollten Sie genauestens darauf achten, dass der Kleine gut sozialisiert ist. Er sollte unbedingt Kontakt zu verschiedenen Menschen und Artgenossen gehabt haben und mit vielen Umweltreizen vertraut sein.
Waren Menschen Rico fremd? Eine eindeutige Antwort auf Ricos Verhalten gibt es nicht, aber Hypothesen, die sein Verhalten erklären können. In ihren Experimenten konnten die Forscher Scott, Fuller und Freedman zeigen, dass Hunde Menschen meiden, wenn sie im Alter von neun bis 14 Wochen keinen Kontakt mit Menschen hatten. Hunde müssen frühzeitig lernen, was Menschen sind. Fehlt ihnen die Erfahrung, dass Menschen Teil ihrer sozialen Umwelt sind, entwickeln sie keine Vorstellung für den Umgang mit Menschen. Das Fenster, in dem gelernt wird, was Menschen sind, ist nur in einer ganz bestimmten Entwicklungsphase geöffnet. Dieses Zeitfenster ist maßgeblich für die Prägung eines Tieres. All dies wusste man zu der Zeit, als ich Rico bekam, noch nicht. Die Entdeckung der Prägung durch den Nobelpreisträger Konrad Lorenz fand erst später statt. Die Prägung ist ein spezifischer Lernvorgang, der dadurch gekennzeichnet ist, dass man das Gelernte kaum vergisst und dass der entsprechende Lernvorgang nur in einer bestimmten Entwicklungsphase stattfindet. So müssen etwa die australischen Zebrafinken in ihrer Kindheit die Merkmale lernen, wie ihr späterer Sexualpartner aussieht. In diesem Fall spricht man von sexueller Prägung. Die Sozialisation des Hundes mit dem Menschen ist ein prägungsähnlicher Vorgang, von dem man Mitte der 1950er-Jahre noch keine Vorstellung hatte. Vermutlich hatte Ricos Züchter keinen Kontakt zu seinen Welpen, und sie hatten nie einen Menschen in der wichtigen Prägungsphase zu Gesicht bekommen. Das würde Ricos Verhalten weitgehend erklären, allerdings nicht seinen Umgang mit Artgenossen. Warum mied er auch sie?
»Hier bin ich der Größte.« Robby, der Retriever, fühlt sich im Wasser besonders wohl und sicher. An Land wirkt er dagegen eher unsicher.
War Rico ein Autist? Ich stelle eine gewagte Hypothese auf, denn ich vermute, Rico war ein tierischer Autist. Für Autisten ist der Umgang mit anderen Menschen schwierig. Viele meiden Blick- und Körperkontakt und können Mimik und Gestik nur schlecht deuten. Neben Kommunikationsstörungen gehören dazu auch Wiederholungen bestimmter Bewegungen und Wortäußerungen. Ob Tiere Autisten sein können, ist heute noch eine Streitfrage. Die Pharmaindustrie ist da schon weiter. Sie hat Mäuse geschaffen, die autistische Merkmale aufweisen. Die Versuchsmäuse putzen sich unaufhörlich, andere hüpfen ständig auf der Stelle, und sie zeigen kein Interesse an Käfiggenossen. An diesen Tieren versucht man Medikamente zu entwickeln, die die Symptome des Leidens erleichtern. Erste Erfolge sind schon zu verzeichnen, zumindest bei Mäusen. Wie immer der Streit auch ausgeht, ich bin überzeugt, Rico war einer der seltenen Fälle eines autistischen Hundes, denn er mied nicht nur Menschen, sondern auch Artgenossen.
SCHON GEWUSST ?
Hunde verstehen und nutzen die Gesten des Menschen besser als Schimpansen. Das fanden Forscher des Max-Planck-Instituts Leipzig heraus. Keiner der Menschenaffen konnte etwas mit der Zeigegeste des Menschen anfangen. Die Hunde dagegen achteten auf die Geste und brachten den Gegenstand, auf den der Mensch gezeigt hat.
Barry, der Fels in der Brandung
Nachdem es mir nicht gelungen war, das Eis zwischen Rico und mir zu brechen, kauften mir meine Eltern einen zweiten Hund: einen Bernhardinerwelpen namens Barry. Die ganze Familie war hin und weg. Jeder knuddelte dieses kuschelige, 14 Wochen alte Bernhardinermädchen. Der Einzige, der Barry links liegen ließ, war Rico. Er nahm keine Notiz von ihr, und das blieb auch so. Barry war in allen Punkten das Gegenteil von Rico. Sie war anhänglich, zutraulich, selbstbewusst und frei von jeglicher Angst. Sie war ein Bilderbuchhund – eine Hundepersönlichkeit, wie man sie selten findet. Wendet man auf sie das »Big Five«-Modell an, so stellt man fest, dass vier von fünf Persönlichkeitsmerkmalen bei ihr zutreffen.
Verträglichkeit Barrys Verträglichkeit machte das Leben mit ihr leicht. Man musste nie Angst haben, dass sie nach anderen Hunden oder Menschen schnappte. Auf sie war hundertprozentig Verlass. Meine ein- bis dreijährigen Nichten und Neffen turnten auf ihr herum. Selbst wenn sie ihr mit ihren kleinen Händen ins Maul fassten oder sie am Schwanz zogen, ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen.
Extraversion Die Bernhardinerhündin kannte ihre Stärke genau und verhielt sich Artgenossen gegenüber selbstsicher und dominant – immer bereit, mit ihnen auf Entdeckungstouren zu gehen. Einmal musste sie ihre Abenteuerlust fast mit dem Leben bezahlen. Barry spazierte mit einem befreundeten Hund in das anliegende Trinkwasserschutzgebiet. Ein Jäger hatte nichts Besseres zu tun, als auf sie zu schießen. Zum Glück wurde sie nur schwer verletzt und konnte sich mit aller Mühe die etwa einen Kilometer lange Strecke nach Hause schleppen. Aber der Schock oder die Anstrengung waren so groß, dass sie fast alle Haare verlor und selbst der einst buschige Schwanz kahl war. Es ist nicht selten, dass der Körper von Mensch und Tier so auf einen extremen Schock reagiert. Nachdem die Schrotsplitter aus ihrem Körper entfernt wurden, erholte sich Barry rasch. Sie war wieder die Alte und hatte auch keine Angst vor Schüssen.
Offenheit Barry war sehr lernfreudig. Ihre Neugierde entzückte die Arbeiter in der Fabrik meines Vaters. Oft schlenderte sie durch die Fabrikhalle und beschnupperte die Maschinen. Welcher Hund interessiert sich schon für Maschinen? Ihr besonderes Interesse galt einer großen Zugmaschine, die zur Herstellung von Kerzen diente. Die Maschine bestand aus zwei großen Trommeln, die im Abstand von etwa fünf Metern angeordnet waren. Auf beiden Trommeln war Kerzendocht aufgespannt, der durch die Bewegung der Trommel durch ein flüssiges Wachsbad gezogen wurde. Eines Tages siegte die Neugier über die Vorsicht. Barry hüpfte in das Wachsbad. Glücklicherweise war das Wachs nicht heiß. Mit »Wachsbeinen« stand sie vor den Arbeitern und schaute sie Hilfe suchend an.
Emotionale Stabilität Wie stabil ihr Nervenkostüm war, demonstrierte Barry wahrlich in einer Feuerprobe. Durch menschliches Versagen brannte die Fabrik bis auf die Grundmauern ab. Dabei explodierten Gasflaschen, und drei Menschen kamen ums Leben. Meine Schwester behielt die Nerven. Sie rannte zum Zwinger, um Rico und Barry zu befreien. Doch nur Barry kam ihr entgegen, Rico dagegen flüchtete in das Gartenhaus, seinem Schlaf- und Ruheraum. Noch so häufiges lautes Rufen half nicht: Rico blieb im Gartenhaus. Selbst als meine Schwester beherzt ins Gartenhaus eintrat und ihn hinausjagen wollte, bewegte er sich nicht von der Stelle. Diese Instinkthandlung wurde ihm zum Verhängnis. Rico verbrannte. Barry dagegen zeigte keinerlei Panikreaktion oder Angst. Brav folgte sie meiner Schwester an einen sicheren Ort.
Zum Punkt Gewissenhaftigkeit Ob Hunde gewissenhaft sind, glaube ich nicht, denn das würde voraussetzen, dass sie ihr Handeln planen und berechnen und im Kopf durchspielen, wie effektiv und wirkungsvoll ihr Tun ist. Das traue ich Hunden nicht zu, obwohl wir in unseren eigenen Versuchen zeigen konnten, dass Hunde eine Vorstellung von dem haben, was sie tun. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zu wissen, was man tut, oder zu wissen, wie man es tut.
Im Hinblick auf den Beschützerinstinkt Barry zeigte ein Persönlichkeitsmerkmal, das zwar bei Hunden unterschiedlich stark entwickelt ist, aber zum Wesen eines Hundes gehört: sein Frauchen oder Herrchen zu beschützen. Bei Menschen ist diese Eigenschaft nicht so ausgeprägt, daher wurde sie im »Big Five«-Modell nicht berücksichtigt. Barrys »Schutztrieb« war enorm. Sie verteidigte mich gegen jedermann, auch gegen meinen Bruder.
Mein Bruder war acht Jahre älter als ich, und wir bekamen wegen einer Lappalie einen fürchterlichen Streit. Mein Bruder schlug auf mich ein. Als Barry dies bemerkte, rannte sie zähnefletschend und knurrend herbei. Sie baute sich mit ihren 65 Kilo und gesträubten Nackenhaaren vor meinem Bruder auf, ihre Eckzähne funkelten. Mein Bruder verstand die Botschaft und schlich mit abgewendetem Kopf leise aus dem Zimmer.
Ich verbrachte jede freie Minute mit Barry. Zusammen durchstreiften wir die Wälder und waren immer auf Entdeckungstour. Barry legte den Grundstein meiner lebenslangen Liebe zu Hunden.
Das Charakteristische der meist selbstbewussten Chow-Chows sind ihre blaue Zunge, die Lefzen und der Gaumen.
Wisla und Robby
Wisla, die Bernhardinerhündin, ist die schillerndste Hundepersönlichkeit, die mir je begegnet ist. Wisla kam erst im Alter von 18 Monaten in unsere Familie. Hierzu gehörte schon seit Jahren Robby, ein lieber und manchmal sturer Retriever. Robbys Lebenselixier war das Wasser. Hier war er der König. Im Alltagsleben jedoch konnte er sich gegen die meisten Rüden nicht behaupten, sondern ordnete sich ihnen freiwillig unter. Im Wasser aber drehte Robby den Spieß um, gab sich mutig und draufgängerisch. Rüden, vor denen er Angst hatte, riss er im Wasser den Spielstock aus dem Maul und knurrte sie an. So lern- und begriffsstutzig Robby an Land war, so clever verhielt er sich im Wasser. Er tauchte sogar nach Gegenständen unter Wasser. Wisla und Robby vertrugen und respektierten sich bis zu jenem Tag ...
TIPPS & TRICKS
Ein älterer Hund, der neu in Ihre Familie kommt, braucht Zeit, seine neue Umgebung und für ihn fremde Menschen kennenzulernen. Begegnen Sie unerwünschtem Verhalten nicht gleich mit Härte und Strafe. Erst wenn das Tier eine Bindung zu Ihnen aufgebaut hat, können Sie sein Verhalten durch Belohnung verändern.
Auf Gefühle eingehen Meine Frau und ich kehrten von einer Afrikareise zurück. Schwanzwedelnd und bellend wurden wir von unseren beiden daheimgebliebenen Vierbeinern begrüßt. Robby drückte sich temperamentvoll an Wisla vorbei, um als Erster die Streicheleinheiten zu empfangen. Die Reaktion von Wisla kam prompt. Sie schnappte nach Robby und attackierte ihn. Ich ging sofort dazwischen und brüllte sie an. Wisla erschrak und ließ von Robby ab. Mir war klar, dass ich die beiden nicht mit ihren Gefühlen alleinlassen konnte, weil sich sonst später vielleicht Feindschaft unter ihnen ausbilden könnte. Wisla mit dem Gefühl der Eifersucht, Robby mit dem Gefühl der Angst. Nach dem Streit rief ich die beiden Tiere zu mir, streichelte sie mit der rechten bzw. mit der linken Hand, sprach mit ihnen und drückte sie an mich. Ziel meiner Handlung war, Robby Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln und Zuneigung zu zeigen. Und Wisla sollte spüren, dass sie von uns geliebt und nicht zurückgesetzt wird, aber Robby nicht angreifen darf. Die beiden Vierbeiner vertrugen sich wieder – zumindest ein Jahr lang.
Dann trat ein schlagartiger Wandel im Verhalten von Wisla ein. Wir kehrten von einer Reise zurück. Meine Frau und ich freuten uns auf unsere Vierbeiner, nicht so Wisla auf uns, besser gesagt auf mich. Mit grimmigem Gesicht, gefletschten Zähnen und knurrend kam sie auf mich zu. Ich war fassungslos, aber nicht ängstlich, blieb stehen, wich keinen Zentimeter zurück und redete mit liebkosenden Worten auf Wisla ein, um ihre Aggression zu mindern. Es half nichts. Als Wisla jedoch meine Frau erblickte, stürmte sie auf sie zu und begrüßte sie freudig. Mich ließ sie im wahrsten Sinne des Wortes links liegen. War dieses Verhalten ein Machtspiel um die Alphaposition (→ Wissen kompakt, >), wie viele Hundetrainer glauben? Oder war es die Wut, dass ich sie so lange alleine gelassen hatte. Nach etwa fünf bis zehn Minuten wandelte sich ihr aggressives Verhalten in Zärtlichkeit um. Sie leckte mich an den Händen, sabberte mir ins Ohr und sprang um mich herum. Wir waren wieder ein Herz und eine Seele. Ich halte es für falsch, in solch einer Situation auf der Alpharolle zu bestehen, denn verletzte Gefühle werden durch Herausstellen der Dominanz nicht geheilt. Nach meiner Auffassung war Wisla enttäuscht, dass ich sie alleine ließ. Wisla hat mich vermisst und litt darunter. Da sie zu mir die stärkste Bindung hat, wurde meine Frau verschont. Zugegeben, das ist eine sehr menschliche Sicht des Sachverhalts, aber vieles spricht dafür.
Wisla für ihr Verhalten zu bestrafen oder zu rügen, halte ich für falsch. Bei Kindern würde niemand auf die Idee kommen, sie zu tadeln, wenn sie bei der Rückkehr der Eltern mürrisch reagieren. Und das ist gut so, denn ob Kind oder Hund – beide befinden sich im Zwiespalt der Gefühle. Einerseits beherrscht sie die Freude des Wiedersehens, andererseits die Wut, verlassen worden zu sein. Wisla zeigt ihre Gefühle deutlich. Sie knurrt, bleibt wie angewurzelt stehen, und ihre gesamte Mimik verrät ihre Wut. Nur bis zum Schwanz reicht ihre Wut nicht, denn der verrät etwas anderes, nämlich Freude. Sie wedelt mit dem Schwanz. Man sieht ihr den Konflikt an. Währenddessen spreche ich mit ihr, bis sich der Knoten löst. Erst nach etwa zehn Minuten ist der Spuk vorbei, denn offenbar braucht das Gefühl ihrer Wut so lange, um sich zu verflüchtigen.
Das Verlassenwerden ist für Wisla ein großes Problem, obwohl während unserer Abwesenheit nur Personen in unserem Haus wohnen, die sie liebt – wie etwa Corina. Doch meine Frau und ich akzeptieren und respektieren Wislas Verhalten uns gegenüber, weil es Teil ihrer Persönlichkeit ist. Und die möchten wir auf keinen Fall verändern.
Wislas Vorgeschichte Marianne und Kim sind Dänen. Sie haben Wisla als Welpen gekauft und großgezogen. Obwohl sie Wisla sehr liebten, mussten sie das Tier abgeben, denn ihre gesamte Zeit verschlang ihr geistig und körperlich behinderter Sohn. Insgeheim hofften sie, dass der Hund dem Jungen helfen könnte, aber dem war leider nicht so. Zwei Jahre später besuchten Marianne und Kim Wisla bei uns in Freiburg.
Würde Wisla die beiden freudig begrüßen oder aggressiv reagieren? Als Wisla Kim und Marianne in einer Entfernung von etwa 30 Metern bemerkte, stutzte sie und blieb stehen. Kim rief sie auf Dänisch beim Namen. Wisla ging vorsichtig einige Meter auf die beiden zu, machte dann aber wie von der Tarantel gestochen kehrt und rannte zurück zu meinem Auto. Sie hatte Marianne und Kim erkannt, wollte aber nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Als ich Wisla anleinte und sie zu Marianne und Kim zurückführte, schaute sie in eine andere Richtung. Und als Kim sie am Rücken streicheln wollte, duckte sie sich weg. Diese Verhaltensweise kannte ich bis dahin von Wisla nicht. Normalerweise knurrt sie, wenn sie Personen nicht mag. Doch Wisla ist eben eine Persönlichkeit , die nicht in unsere übliche Denkschablone von Hunden passt. Vielleicht ist die frühere Trennung von Marianne und Kim die Ursache für ihr aggressives Verhalten, wenn ich von einer Reise zurückkehre. Der Begriff Trennungsschmerz verdeutlicht, wie sehr ein Tier unter solch einer Situation leidet. Bei Graugänsen haben Professor Kotrschal und sein Team von der Uni Wien festgestellt, dass die Stresshormone ansteigen, wenn man den Ganter von seiner Gans trennt. Der Hormoncocktail im Blut verändert sich. So ähnlich stelle ich mir auch die biochemischen Vorgänge in Wislas Kopf vor.
Wisla und die Männer Wisla und Robby respektierten sich zwar, aber von großer Liebe keine Spur. Beide waren im besten Alter, sich fortzupflanzen, als sie zusammentrafen. Ich wollte keinen der beiden Hunde kastrieren lassen, doch Hundekinder wollte ich auch nicht. Insgeheim hoffte ich, dass Wisla Robby verschmähte. Doch gibt es überhaupt Sympathie und Antipathie zwischen Rüde und Hündin, wenn es um den Fortpflanzungstrieb geht? Wisla beantwortete die Frage eindeutig. Sie ist alles andere als ein triebgesteuerter Roboter, der keine Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten hat. Wisla verschmähte Robby. Sie ließ sich nicht von ihm decken. Wenn er versuchte aufzureiten, knurrte sie ihn unmissverständlich an und schnappte nach ihm – jedes Mal, wenn er es bei ihr versuchte. In den vielen Jahres ihres Zusammenlebens wehrte Wisla Robby immer ab. Andere Rüden dagegen hätten – ohne mein Eingreifen – leichtes Spiel bei Wisla gehabt. Ihre Abneigung oder Zuneigung beschränkte sich aber nicht nur auf Artgenossen, sondern auch auf Menschen. Einem alten Studienfreund meiner Frau verwehrt Wisla knurrend und bellend den Eintritt in unser Haus. Es dauert etwa fünf bis zehn Minuten, bis ich ihr klargemacht habe, dass dieser Mensch willkommen ist. Ich nehme Wisla am Halsband und sage mit scharfer eindeutiger Betonung »Stopp!«. Zwischendurch will ich Vertrauen gewinnen, indem ich ruhig auf sie einrede und ihr erkläre, dass er unser Freund ist. Mit der freien Hand klopfe ich ihm auf die Schulter. Hat sie verstanden, brauche ich den ganzen Abend nicht zu befürchten, dass sie ihn attackiert. Sie mag unseren Freund nicht, die Frage ist nur, warum. Er kann mit Tieren nichts anfangen, sie interessieren ihn nicht. Vielleicht spürt Wisla das. Andere Freunde sind auf Anhieb willkommen und werden schwanzwedelnd begrüßt ...
SCHON GEWUSST ?
Ihre Chef-Stellung in der Mensch-Hund-Beziehung wird nicht gefährdet, wenn Sie Ihren Hund im Spiel gewinnen lassen. Wissenschaftler führten mit Besitzer und Hund einen Wettkampf im Tauziehen durch. Gleich, wie oft der Besitzer oder der Hund gewann, an den Dominanzverhältnissen änderte sich daraufhin nichts.
SCHON GEWUSST ?
Die DNA-Analyse von Wolf und Hund ergab, dass sich beide kaum unterscheiden. 99,6 Prozent der Gene haben Wolf und Hund gemeinsam. Aber der kleine genetische Unterschied hat es in sich. Er ist für das Aussehen der Hunde verantwortlich und bringt Zwerge wie den Chihuahua und Riesen wie den Bernhardiner hervor (→ Saetre, Literatur >).
Begegnung mit der Wissenschaft
Kein Zweifel – alle meine Hunde waren und sind unverwechselbare Persönlichkeiten und besondere Charaktere. Und für sie alle gilt, was Gosling in seinen Studien an Hunden feststellte: dass das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit (= conscientiousness) bei Hunden nicht existiert (→ >). Wer aber die Berichte und Veröffentlichungen unterschiedlicher Tierarten nach Persönlichkeitsmerkmalen durchforstet, wie es Gosling und sein Team getan haben, stellt fest: Um den Tieren gerecht zu werden, muss das »Big Five«-Modell um zwei Merkmalskomplexe erweitert werden – und zwar um Dominanz und Aktivität (→ Literatur, >). Die Dominanzbeziehungen im Hunderudel spielen im Leben eines Hundes und in der Entwicklung seiner Persönlichkeit eine bedeutendere Rolle als bei uns Menschen in unserer Gesellschaft.
Die Forscher Kenth Svartberg und Björn Forkman haben 15.329 Hunde unterschiedlicher Rassen und Mischlinge verschiedenen Tests unterzogen (→ Literatur, >). Bei einem der Tests wurden die Reaktionen der Hunde auf eine fremde Person geprüft. Man protokollierte alle Verhaltensweisen der Vierbeiner: Rennt der Hund beispielsweise weg, zieht er den Schwanz ein, knurrt er und sträubt das Nackenfell, oder kratzt er sich. Gleich welche Verhaltensweisen ein Hund zeigte, sie wurden festgehalten und geordnet. Im Klartext heißt das zum Beispiel: Knurrt der Hund, sträubt er das Nackenfell und fletscht die Zähne, wurden diese Verhaltensweisen als Aggression bezeichnet. Die Auswertung aller Tests ergab, dass Verspieltheit, Neugierde, Furchtlosigkeit, Jagdneigung, Geselligkeit und Aggressivität typische Persönlichkeitsmerkmale von Hunden sind. Gosling und Svartberg näherten sich auf zwei unterschiedlichen Wegen der Persönlichkeit, daher sind auch ihre Forschungsergebnisse etwas unterschiedlich.
Gosling benutzte die Methode der Psychologen, indem er Fragebogenaktionen durchführte, die auf Hunde abgestimmt sind. Besitzer und Hundesachverständige beobachteten die Hunde, während diese mit anderen Artgenossen, Gegenständen und Menschen interagierten. Zu diesen Handlungen der Hunde wurden Fragen gestellt, die sowohl Besitzer als auch Sachverständige beantworten mussten. Svartberg hingegen benutzte eher die verhaltensbiologische Methode, indem er Hunde Testreihen aussetzte und deren Verhalten protokollierte und analysierte. An der Front der Persönlichkeitsforschung bei Hunden tut sich einiges – und das ist gut. Nur wenn ich weiß, welche Hundepersönlichkeit ich vor mir habe, kann ich auf das Wesen eingehen.
Beispielsweise einen ängstlichen Hund als Schutzhund auszubilden, ist kontraproduktiv und Zeitverschwendung. Ohne zu vergessen, dass beide Testmethoden verlässliche und gültige Persönlichkeitsmaße bieten, ist es mir ein großes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass sich damit nur die groben, testbaren Wesenszüge eines Lebewesens darstellen lassen. Eine Wisla hätte damit nur oberflächlich beschrieben werden können, und der wahre Kern ihres Wesens bliebe unentdeckt. Um die Persönlichkeit eines Menschen zu erfassen, braucht man vielleicht ein ganzes Leben. Für Tiere und speziell für Hunde gilt das Gleiche. Nur ein Zusammenleben auf der Basis von Respekt und Liebe gibt uns die Chance, die Persönlichkeit des Gegenübers zu entdecken.
Zusammenfassend können wir feststellen, dass Forscher gezeigt haben, dass Hunde über Persönlichkeitsmerkmale verfügen und damit eine Persönlichkeit besitzen. Die Kategorisierung der Merkmale ist aber rein qualitativ und statistischer Natur. Sie sagt nichts darüber aus, wo und wie Persönlichkeit entsteht, geschweige denn über die neurobiologischen Vorgänge eines Organismus.
DER GROSSE PERSÖNLICHKEITSTEST
Wie schätzen Sie Ihren Hund ein? Ist er eher mutig oder ängstlich, von Natur aus offen oder Neuem gegenüber misstrauisch? Gehört Spielen für ihn zu den Highlights, und liebt er knifflige Aufgaben? Finden Sie es mit diesem Persönlichkeitstest heraus.
1. Ist Ihr Hund ein Spieler?
Objektspiel – Werfen eines Gegenstandes
Sie werfen Ihrem Hund ein Spielzeug, wie zum Beispiel ein Apportierholz, einen Ball oder ein Stoffseil, einige Meter weit weg.
Kann Ihr Hund es kaum erwarten, dass Sie das Spielzeug werfen, und rennt er diesem sofort und schnell hinterher?
Rennt Ihr Hund dem Spielzeug hinterher?
Rennt der Hund auch dann dem Spielzeug hinterher, wenn es eine fremde Person wirft?
Rennt der Hund dem Spielzeug nicht hinterher?
Kampfspiel – Kämpfen beispielsweise um ein Dummy, ein Seil oder ein Tuch
Bewegen Sie vor den Augen Ihres Hundes das Dummy, das Seil oder das Tuch.
Beißt Ihr Hund sofort hinein, beginnt zu zerren und versucht den Gegenstand für sich zu gewinnen?
Beißt Ihr Hund zaghaft in den Gegenstand hinein?
Zeigt Ihr Hund keinerlei Interesse an dem Gegenstand?
Verfolgungsspiel – Hunde jagen sich gegenseitig
Sie und ein anderer Hundebesitzer lassen beide Hunde gleichzeitig von der Leine und beobachten, was die Vierbeiner tun. Verhält sich Ihr Hund wie Hund A?
Hund A fordert Hund B zum Spielen auf und rennt weg. Hund B versteht die Signale von Hund A und verfolgt diesen. Während der häufigen Spielszenen tritt oft ein Rollentausch auf. Der Gejagte wird zum Jäger und umgekehrt.
Nachdem sich die Hunde 2- bis 3-mal gejagt haben und hintereinander hergerannt sind, beenden sie ihr Spiel. Einer der Spieler oder beide Vierbeiner haben die Lust verloren und interessieren sich jetzt für andere Dinge, die um sie herum vorgehen.
Hund B geht auf die Spielaufforderung von Hund A nicht ein.
Frauchen oder Herrchen als Spielpartner des Vierbeiners
Spielaufforderung. Fordert Sie Ihr junger Hund mit einem Spielzeug im Maul auf, jetzt mit ihm zu spielen?
Rollentausch. Verfolgt Sie Ihr Hund, wenn Sie die hündische Spielaufforderung (Vorderkörper-Tiefstellung)nachahmen, indem Sie die Hände mit dem Boden berühren und den Vierbeiner auffordern, Ihnen zu folgen?
Versteckspiel. Sucht Sie Ihr Hund, wenn Sie sich beispielsweise hinter einem Baum oder Busch verstecken? Dies macht jungen Hunden besonders viel Freude. In dieser Enwicklungsphase lernen sie nämlich auf diese Weise spielerisch, dass Objekte auch dann noch da sind, obwohl man sie gar nicht sehen kann.
Desinteresse. Hat der Hund grundsätzlich keine Lust, mit Ihnen zu spielen?
2. Ist Ihr Hund ängstlich?
Hat Ihr Vierbeiner Angst vor neuen optischen Reizen wie etwa flatternden Tüchern im Wind oder unbekannten Gegenständen auf dem Spaziergang?
Flüchtet Ihr Vierbeiner vor dem unbekannten Objekt?
Wendet sich der Hund vor dem angstauslösenden Objekt mit dem ganzen Körper langsam ab und läuft schließlich davon?
Dreht der Hund nur den Kopf zur Seite und geht dann auf das Objekt zu?
Hat der Vierbeiner Angst vor lauten Geräuschen, zum Beispiel wenn ein Buch vom Tisch fällt, die Tür laut ins Schloss fällt oder das Fenster zuknallt?
Flüchtet Ihr Hund vor der angstauslösenden Quelle, beziehungsweise sucht er Schutz bei Ihnen?
Erschrickt er kurz, bleibt aber ansonsten an Ort und Stelle stehen beziehungsweise liegen?
Bleibt der Hund unbeeindruckt von dem lauten Geräusch?
Hat Ihr Hund Angst vor Menschen, die vorbeirennen beziehungsweise sich schnell und ruckartig bewegen?
Wendet sich der Hund ab und zieht sich zurück?
Macht der Vierbeiner sich klein, indem er die Ohren angelegt und den Schwanz einzieht?
Verbellt der Hund den Menschen?
Beißt der Hund in die Luft, oder schnappt er vielleicht sogar nach dem Menschen?
Hat Ihr Vierbeiner Angst gegenüber fremden Artgenossen, wenn er ihnen unangeleint begegnet?
Läuft er beim bloßen Anblick des anderen Hundes weg?
Bleibt er stehen, duckt sich, dreht den Kopf seitlich nach unten und klemmt den Schwanz ein?
Knurrt der Vierbeiner, hebt den Kopf, sträubt die Nackenhaare und schaut den Kontrahenten direkt an?
3. Ist Ihr Hund eher neugierig oder ängstlich?
Sie betreten mit Ihrem angeleinten Hund einen fremden, möglichst leeren Raum, zum Beispiel die Garage. Zuvor haben Sie in die Mitte des Raumes einen Gegenstand, etwa eine große Kiste oder eine Tonne, gestellt. Wichtig ist, dass der Hund den Gegenstand nicht kennt. Schließen Sie die Tür hinter sich, sodass nur Sie und der Hund im Raum sind. Leinen Sie den Hund ab.
Geht der Hund ohne langes Zögern und ohne Umwege auf den unbekannten Gegenstand zu?
Verbellt er den Gegenstand und nähert sich ihm schnuppernd?
Nähert er sich dem Gegenstand mit leicht eingeklemmtem Schwanz?
Bleibt der Vierbeiner stehen und verbellt den Gegenstand?
Bleibt er mit angelegten Ohren und leicht eingeklemmtem Schwanz stehen?
Versucht er, in den Gegenstand zu beißen oder ihn zu manipulieren?
4. Ist Ihr Hund mutig oder ängstlich?
Der Hund begegnet einem Menschen, der einen Regenmantel trägt und sein Gesicht durch einen Hut weitgehend verdeckt hat.
Zieht der Hund den Schwanz ein und wendet sich ab?
Reagiert er nicht und läuft weiter?
Bellt der Hund die Person an?
Bellt der Hund die Person an, knurrt, stellt seine Nackenhaare und trägt den Schwanz erhoben?
Eine Person steht vor dem Hund. Der Hund ist angeleint und beobachtet die Person. Plötzlich öffnet diese einen Regenschirm.
Weicht der Hund aus, versucht er wegzurennen und lässt sich zudem kaum beruhigen?
Weicht er aus, bleibt dann stehen beziehungsweise sitzen, schaut die Person und den Regenschirm an und beruhigt sich sofort?
Weicht der Hund aus, nähert sich dann aber dem Regenschirm und schnuppert daran?
Verbellt der Hund den Regenschirm?
5. Ist Ihr Hund offen?
Ist Ihr Hund fremden Menschen gegenüber offen und zutraulich?
Verhält sich Ihr Vierbeiner freundlich, und lässt er sich von fremden Personen streicheln? Sucht er den direkten Kontakt?
Geht der Hund auf die fremde Person zu, beriecht sie und wendet sich dann aber ab?
Hält der Hund einen gewissen Abstand zur fremden Person und zeigt kein Interesse?
Wie verhält sich Ihr Hund gegenüber einer Gruppe von Hunden?
Sucht er den direkten Kontakt zu anderen Gruppenmitgliedern, indem er beispielsweise zum Spiel auffordert, Blickkontakt herstellt oder andere Interaktionen anbietet?
Ignoriert Ihr Hund größtenteils andere Hunde in der Gruppe?
Reagiert er schnell gereizt, wenn sich andere Hunde zu stark nähern (Indivi- dualdistanz unterschritten)?
Provoziert Ihr Hund häufig Auseinandersetzungen?
6. Besitzt Ihr Hund Durchstehvermögen, und löst er schnell ein Problem?