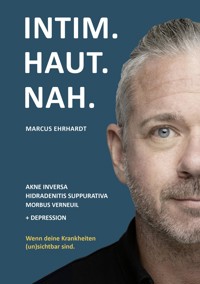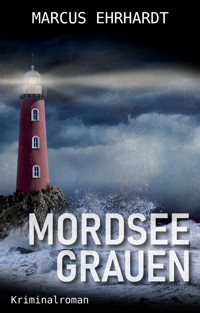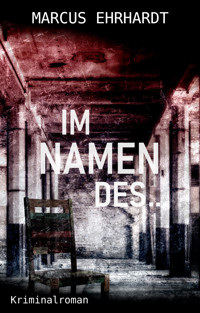3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Titel wurde bereits unter dem Pseudonym Bradley R. Sullivan mit identischem Inhalt veröffentlicht. »Wehr dich, sonst macht es keinen Spaß!« Chicago hält den Atem an. Innerhalb kürzester Zeit werden zwei Frauen ermordet aufgefunden. Beiden wurde das Herz herausgeschnitten und vom Täter mitgenommen. Mit Hilfe der FBI-Profilerin Amber Raven gelingt es den Detectives Miller und Rosenthal vom Chicago Police Department, den Killer in die Enge zu treiben. Für ihn jedoch ist das alles nur ein perverses, blutiges Spiel, das durch den Druck der Ermittler noch mehr an Reiz gewinnt. Weitere Frauen sterben. Erst spät bemerkt Detective Miller, dass der Psychopath ihn selbst ins Visier genommen hat. Zu spät? ---------------------------------------------------------------------------- Chicago, die Wiege Al Capones, dem größten Mafia-Paten aller Zeiten, ist auch Jahrzehnte später von Gewalt und Kriminalität gezeichnet. Die Reihe "Chicago Crime" erzählt fiktive, spannende Storys, in denen sich Detective Miller vom Chicago Police Department Serienmördern und anderen Gewaltverbrechern mit aller Entschlossenheit in den Weg stellt. Nimmt er in Band 1 noch eine kleine Nebenrolle ein, wächst sein Anteil und der seines Kollegen Rosenthal, bis sie ab Band 3 schließlich zu den dominierenden Protagonisten werden. Später erhalten die beiden Cops Unterstützung von der FBI-Profilerin Amber Raven.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
MÄDCHENBLUT
Thriller
Marcus Ehrhardt
Inhaltsverzeichnis
Impressum:
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
Impressum:
© 2021
Marcus Ehrhardt
Vorstadtstraße 14
74417 Gschwend
Korrektorat / Lektorat: Tanja Loibl
Covergestaltung: MTEL-Design
unter Verwendung von Motiven
von pixabay und shutterstock
Alle Rechte vorbehalten. Jede Weitergabe oder Vervielfältigung in jeglicher Form ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors erlaubt.
Kapitel 1
Ja, das wird ein guter Abend, dachte Abigail, bevor sie aus dem Bus stieg.
»Bye«, sagte sie zum Fahrer und nickte ihm knapp zu.
»Schönen Abend noch, Miss«, erwiderte dieser und drückte auf einen Knopf, woraufhin sich die Tür leise zischend öffnete.
Abigail machte einen kleinen Satz, damit sie mit dem Fuß neben und nicht in der Pfütze landete, die sich vor der Haltestelle gebildet hatte. Sie spannte den Regenschirm auf. Die Tropfen prasselten auf den Stoff.
Die junge Kellnerin freute sich trotz des aufziehenden Unwetters auf den verdienten Feierabend. Zu lange hatte sie heute wieder im Diner schuften, raubeinigen Truckern und genervten Geschäftsleuten Kaffee einschenken und Eier mit gebratenem Speck servieren müssen. Sicher würden ihr eine Folge Criminal Minds oder ein paar Seiten aus dem neuen John Grisham-Thriller, den sie sich vor kurzem auf ihren Reader geladen hatte, die ersehnte Entspannung verschaffen. Egal, worauf die Wahl fallen würde, sie würde es aus der horizontalen Position von ihrem Sofa aus genießen. Jetzt musste sie nur noch das ›dunkle Ende‹ hinter sich bringen, wie sie den Weg zwischen der Haltestelle und ihrer Wohnung bezeichnete. Viel zu weit standen die Laternen an dieser Straße auseinander und leuchteten sie äußerst dürftig aus. In den Frühlings- und Sommermonaten störte Abigail dieser Makel nicht, weil es lange genug hell blieb, doch nun im Oktober sah das anders aus. Sie dachte an die vor ihr liegenden Wintermonate und verzog das Gesicht. Nicht nur, dass sie es hasste, wenn ihr auf dem Heimweg die Fingerspitzen vor Kälte blau anliefen, durch die Vereisung fielen zudem die Laternen gern mal aus. »Was der Stadt und dem Bürgermeister scheißegal ist, schließlich wohnt hier ja nur die Unterschicht«, sagte sie laut vor sich hin, um sich etwas von der gruseligen Atmosphäre abzulenken. Anfangs glaubte sie, sich irgendwann daran zu gewöhnen, was ein Irrtum war.
Abigail erinnerte sich an die Worte ihrer Mutter, wenn sie als Kind abends darauf bestanden hatte, die Zimmertür offen und die Nachttischlampe angeschaltet zu lassen: „Abi, wenn du Angst hast, fang an, laut zu singen, dann verschwindet sie ganz schnell.“ Damals kümmerte sich ihre Mom noch um sie; so änderten sich die Zeiten.
Kurz darauf lief sie am lieblos gestalteten Spielplatz vorbei. Sie war froh, endlich die Umrisse des tristen Wohnblocks am Ende der Straße zu erkennen, in dem sie seit zwei Jahren lebte.
»Hoffentlich schlafen die Kleinen schon«, murmelte sie. Die beiden jetzt noch zu bespaßen, würde sie nicht überleben. Abigail liebte ihre Töchter, doch sie hatte nicht damit gerechnet, dass sie die beiden als Alleinverdienerin durchbringen müsste. Also blieb Abigail nichts anderes übrig, als es auf sich gestellt hinzubekommen. Bislang gelang ihr das auch, abgesehen von ihrer ständigen Müdigkeit; die zehnstündigen Schichten raubten ihr die letzte Energie.
Nur noch wenige Schritte trennten sie von ihrer Tür. Sie hielt den Schlüssel schon in der Hand, da glaubte Abigail, eine Bewegung hinter sich wahrzunehmen. Dort, an der Ecke, von wo aus man in den Hinterhof gelangte. Obwohl sie niemanden sah, stieg ihr Puls an und sie spürte, wie sich die feinen Härchen in ihrem Nacken aufstellten. Vielleicht sollte ich gleich doch etwas Romantisches im TV ansehen, dachte sie, da zerriss ein Blitz die Dunkelheit. Erneut erschrak sie und schluckte, als sie die Silhouette eines Menschen ausmachte, wo sie eben das Geräusch verortet hatte. Sie zwinkerte und zwang sich, erneut hinzuschauen. »Du bist so ein feiges Huhn«, flüsterte sie, als sie die vermeintliche Gestalt erkannte, »pinkelst dir wegen einer Stehlampe fast in die Hose.« Sie lächelte in sich hinein. Klar, ihre Nachbarn eine Etage über ihr waren gestern ausgezogen und hatten einiges an Sperrmüll neben dem Haus gelagert, der in den nächsten Tagen von der Müllabfuhr abgeholt werden würde. »Dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzzwanzig, –.«
Gleichzeitig mit der sechsundzwanzig schien ein Donnerschlag die Stadt zu erschüttern. Obwohl sie ihn erwartet hatte, fuhr ihr der Krach durch Mark und Bein. Abigail trat auf die Fußmatte, sperrte auf und betrat die Wohnung. Das Adrenalin ließ ihren Puls nur langsam zur Ruhe kommen. »Puh«, stieß sie aus. Erleichterung breitete sich aus. Einerseits wegen des Gewitters, das der Zeitspanne zwischen Blitz und Donner nach zu folgern, noch drei bis vier Meilen entfernt sein musste, andererseits wegen der Gestalt, die sich als ein ausrangiertes Möbelstück entpuppt hatte. Sie lehnte sich von innen an die Haustür und atmete tief aus.
»Hi, Abigail«, quietschte Pam, die auf dem Sofa saß und mit ihrem Smartphone spielte, während auf der anderen Seite des Tisches das TV lief. Sie nahm einen der Ohrstöpsel heraus. »Irgendwas stimmt mit deinem WLAN nicht.«
»Hallo Pam, ist sicher wegen des Gewitters.«
»Welches Gewitter?«
Abigail schüttelte den Kopf über ihre Babysitterin. Selbst mit Kopfhörern hätte sie den Donner doch hören müssen.
»Dem da draußen. Ist alles klar hier? Schlafen sie?« Abigail hängte ihre Jacke an die Garderobe und schoss ihre Pumps in die Ecke. Normalerweise ließ sie die Schuhe in ihrem Spind im Diner, doch ein Absatz hatte sich gelockert. Morgen würde sie die anderen mitnehmen, die fast neu und noch nicht eingelaufen waren. Sie hasste diese Dinger und sie hasste ihren Chef Trevor. Er bestand darauf, dass die Servicekräfte ihre Füße mit solchen Schuhen vergewaltigten; er musste den Hallux valgus ja nicht in Kauf nehmen. Irgendwann würde sie ihm einen Absatz in seinen Plattfuß bohren, damit er sich mal ein Bild davon machen konnte, was Fußschmerzen waren.
»Ja, schon `ne halbe Stunde«, antwortete der etwas füllige Teenager mit der viel zu hohen Stimme, während Abigail an Pam vorbei und auf die Toilette ging.
Kaum hatte sie die Tür hinter sich zugezogen, bekam sie mit, wie ihre Babysitterin durch das Wohnzimmer trampelte. »Mein Dad ist da!«, hörte sie sie rufen. »Bis morgen!«
»Ja, ciao, bis morgen«, erwiderte Abigail durch die geschlossene Toilettentür. Im nächsten Moment fiel die Wohnungstür ins Schloss. »Endlich Ruhe«, sagte sie seufzend, lehnte sich zurück und entleerte ihre Blase.
Auf die Dusche verzichtete sie, stattdessen schlüpfte sie direkt in ihr Nachtzeug. Im Anschluss sah sie nach den Kindern und verzog sich mit einer Schüssel Porridge auf das Sofa. Abigail dimmte das Licht, sodass es kaum heller leuchtete, als eine Handvoll Kerzen es vermochten. Sie schnappte sich die Fernbedienung und schaltete auf die Seite ihres Streaminganbieters, wo sie schnell fündig wurde. Sie hatte sich jetzt endgültig gegen die Romantik und für etwas Spannendes entschieden. Doch die Folge ihrer Lieblings-Crime-Serie startete nicht, stattdessen stockte das Bild. »Verdammtes Buffering!« Kopfschüttelnd griff sie nach der Handtasche, die unter dem Glastisch stand, und holte ihr Smartphone raus. Auch auf diesem funktionierte das WLAN nicht. Jetzt fiel ihr ein, dass Pam vorhin so etwas erwähnt hatte.
»Scheiß Internet«, fluchte sie und suchte über das Mobilfunknetz die Seite ihres Anbieters. Bevor sich die Homepage komplett aufgebaut hatte, klingelte es an der Tür. Um diese Uhrzeit? Das konnte nur eines bedeuten.
„Mom, hast du wieder keine Kohle mehr für deinen Schnaps?“, murmelte sie, während sie vom Sofa aufstand. Ist ja nicht das erste Mal, dass die zum Schnorren vorbeikommt, dachte Abigail und spürte den Ärger in sich aufwallen. »Ich komme«, sagte sie gedämpft in Richtung Tür, in der Hoffnung, dass es einerseits draußen zu hören war, andererseits aber keines der Mädchen aufweckte; wenn das nicht schon durch das Klingeln passiert war.
Sie drehte den Knauf herum und öffnete die Tür, soweit es die Sicherungskette erlaubte. »Ja?«, fragte Abigail verwirrt, als sie anstatt ihrer Mutter einen Mann im dunkelblauen Overall auf der Fußmatte stehen sah. Er trug einen Werkzeugkasten in der Hand.
»Guten Abend, entschuldigen Sie die Störung«, sagte der Mann mit freundlicher Stimme. »Ich bin von AT & T. Uns wurden Internetstörungen in dieser Gegend gemeldet, daher überprüfen wir stichprobenartig die Leitungen.«
»Ah«, sagte Abigail und tippte sich mit den Fingern an die Stirn. Jetzt erkannte sie das Abzeichen des größten Telekommunikationsunternehmens der USA wieder, das sie auf dem Brustbereich des Arbeitsanzuges sah. Eine Kugel, die sicher den Globus darstellen sollte und spiralförmig von einem blauen und einem weißen Streifen umrundet wurde. »Das stimmt, bei mir zum Beispiel funktioniert das WLAN nicht.« Der Mann nickte lächelnd. Jetzt kam ihr sein Gesicht auch bekannt vor. Hatte er nicht sogar beim Einzug ihren Anschluss freigeschaltet?
»Das dachte ich mir. Ich müsste nur für eine Minute an Ihren Router, dann können Sie wieder surfen, wohin Sie wollen.«
»Könnte ich bitte Ihren Ausweis sehen?«, fragte Abigail und dachte für einen Moment, dass sie es mit ihrer Vorsicht etwas übertrieb.
»Selbstverständlich«, sagte der Techniker und hielt ihr die Plastikkarte hin. Schnell verglich sie das Foto mit seinem Gesicht und den Namen mit dem auf dem Overall. Es stimmte überein.
»Danke, einen Moment bitte«, sagte Abigail. Dann schob sie die Tür zu und löste die Kette, um die Tür vollständig öffnen zu können. Sie trat zur Seite. »Der Router steht dort auf der Anrichte.« Sie zeigte auf den kleinen Kasten, an dem zwei Lampen blinkten.
»Okay.«
»Brauchen Sie sonst noch was?«, fragte sie lächelnd und nahm einen Geruch nach Minze wahr. Statt einer Antwort gluckste er nur. Sie ließ den Mann vorbeigehen, der sie um einen Kopf überragte, schloss die Tür und sah ihm hinterher. Sie wunderte sich nicht darüber, dass er auf halbem Weg den Werkzeugkasten abstellte. Dass er sich Handschuhe überstreifte, befremdete sie allerdings.
***
Es war so einfach, fast zu einfach. Doch wunderte ihn das nicht, hatte er doch alles bis ins Detail geplant und durchdacht. Nichts durfte dem Zufall überlassen werden, denn der Zufall war der unerwünschte Gehilfe des Scheiterns. Von daher überraschte ihn das Zutrauen dieser Frau nicht, die ihn fast wie einen alten Bekannten in ihre Wohnung gebeten hatte. Womit sie nicht vollends falschlag, ging ihm durch den Kopf. Sie hielt es nicht einmal für nötig, sich etwas überzuziehen. Trug nur einen dürftigen Morgenmantel, der mehr zeigte, als er verbarg. Da half es kaum, dass sie ihn weiter zuzog und den Stoffgürtel enger schnallte.
Während er sich den zweiten Handschuh anzog, wandte er sich zu ihr und musterte sie. Von ihren schmalen Füßen, deren Nägel knallrot lackiert waren, weiter zu ihrem Becken über die Brüste hinweg, die sich deutlich auf dem Stoff abzeichneten, bis zu ihren angsterfüllten, geweiteten Augen, die von einer dunkelblonden Kurzhaarfrisur gerahmt wurden. Er genoss diesen Anblick.
Aber nur für einen Wimpernschlag, dann sprang er mit einem Satz auf sie zu und presste eine Hand auf ihren Mund, während er sie mit der anderen spielend zu Fall brachte. Ihr ersticktes Schreien unter dem Leder seiner Hand und das wilde Strampeln und Aufbäumen versetzten ihn in Hochstimmung. Diese Wucht! Er sog sie auf, absorbierte sie förmlich, spürte fast die energetischen Teilchen. Sie kämpfte mit all ihrer Kraft, wollte sich befreien, ihn schlagen und beißen, doch er war zu schwer, zu stark und es kostete ihn kaum Anstrengung, sie unter sich am Boden zu halten.
»Bitte nicht«, stieß sie gurgelnd hervor, kaum verständlich, da seine Hand noch immer auf ihrem Mund lag, nur nicht mehr so fest.
»Pst«, flüsterte er, »lass es zu.«
»Bitte ...«
Besser. Es war besser, als er erwartet hatte. Nach jedem ihrer panischen Atemzüge rutschte er mit seinem Körper ein kleines Stück weiter in Richtung ihres Brustkorbes, sodass sie bei jeder erneuten Atembewegung weniger Sauerstoff inhalieren konnte. Schnell wurde sie schwächer, wehrte sich kaum noch.
Als sie das Messer sah, das er aus dem Werkzeugkasten zog und über ihrem Gesicht hin- und herdrehte, mobilisierte sie ihre letzten Reserven. Für einen Moment dachte er, sie würde sich etwas Raum verschaffen können. Anerkennend lächelte er ihr zu, dann führte er die Klinge an Abigails Hals und durchschnitt ihre Kehle. Wie durch Butter glitt der Stahl durch das Gewebe der Frau und erzeugte eine klaffende Öffnung.
Fasziniert beobachtete er, wie mit jedem Herzschlag Blut aus der Wunde gepumpt wurde. Nach dem vierten oder fünften griff er erneut in den Werkzeugkasten und holte ein Gefäß hervor, das er seitlich an den Hals der Frau hielt. Bis zur Hälfte füllte es sich mit ihrem Lebenssaft, dann setzte der Herzschlag aus. Abigail rührte sich nicht mehr, ihre Pupillen starrten jetzt regungslos zur Decke. Er setzte das Glas an und leerte die warme, rote Flüssigkeit in einem Zug.
»Aahhhh!«, entfuhr es ihm und er wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Danke«, murmelte er, erhob sich und betrachtete bewundernd sein Werk. Er beugte sich zu dem leblosen Frauenkörper hinunter, griff nach ihrem Handgelenk und suchte den Puls. Nichts. Er konnte ihn nicht mehr ertasten. Im Gegenteil zu seinem Schritt: Da hatte er das Gefühl, gleich zu explodieren. Er ließ den Arm der Frau fallen und öffnete ihren Mantel. Mit brachialer Gewalt zerriss er ihr Shirt und ihren Slip. Jetzt lag sie in ihrer ganzen Schönheit vor ihm – tot und bereit. Erneut setzte er das Messer am unteren linken Rippenbogen an, stellte es aufrecht und stieß fest zu. Weder die Haut noch die Unterhaut, der Zwerchfellmuskel oder sonstiges Gewebe konnten die schwere Klinge vom Eindringen abhalten. Präzise führte er den Schnitt, bis er bequem mit der Hand in den Körper der Frau hineingreifen konnte. Kurz darauf spürte er unter seinen Fingern, was er suchte. Er packte fest zu, wollte es mit einem Ruck herausziehen, doch das gestaltete sich schwieriger als erwartet. Schwieriger, als er es von den Hasen, Hühnern und Eichhörnchen her kannte, die er in jungen Jahren gerne und häufig seziert hatte.
So musste er mit der anderen Hand erneut das Messer einführen und damit die störenden Fasern und Bänder durchtrennen. Dann endlich riss er es heraus. Fasziniert besah er sich das warme, blutgetränkte Herz in seiner Hand. Den Motor des Lebens. Er näherte sich mit dem Gesicht und küsste es fast, doch kurz bevor seine Lippen das Organ berührten, wandte er den Kopf und drückte es vorsichtig gegen die Wange. Beinahe, als würde er damit kuscheln wollen. Er seufzte zufrieden. Nach einem Moment legte er es bedächtig neben dem blutverschmierten Glas ab und griff an seine Gürtelschnalle. Der Druck, der sich seit Minuten immer stärker in seinem Schoß ausbreitete, war kaum noch auszuhalten. Doch bevor er den Gürtel öffnen konnte, vernahm er hinter sich ein Geräusch.
»Mama? Wer ist der Mann?« Die Stimme eines Kleinkinds drang zu ihm. Er ließ von seinem Schritt ab und drehte sich zu dem Mädchen. Es stand mit einem Teddy im Arm, in einen rosaroten Schlafanzug gekleidet, im Türrahmen und musste offensichtlich auf die Toilette, so wie es von einem Bein aufs andere trat. Sämtliche Erregung in ihm war verschwunden. Verdammt, das konnte doch nicht sein. Er hatte alles so gut geplant. Dieses verfluchte Gör sollte eigentlich im Bett liegen und schlafen. Er musste sich beherrschen, nicht loszuschreien.
»Ich bin ein Freund deiner Mutter. Sie schläft gerade. Und wer bist du?«, sagte er mit ruhiger Stimme, was ihn selbst erstaunte.
»Ich bin Ella und ich muss Pipi«, sagte das Mädchen, dessen Gesicht von langem, gelocktem, braunem Haar gerahmt wurde.
»Freut mich, Ella«, sagte der Mann und ging zu dem Mädchen. »Wo ist denn eure Toilette?«
Ella drehte sich um und zeigte auf eine schmale Tür. Er legte seine Hand in den Nacken des Kindes und spürte durch den Handschuh hindurch die warme, weiche Haut unter seinen Fingern. Der Hals des Mädchens war so dünn und so zart, ein kleiner Ruck und er würde zerbrechen wie ein spröder Ast. »Dann los«, sagte er und schob Ella sanft ins Bad, die Hand immer noch im Nacken des Kindes liegend.
Kapitel 2
Es gab gute Tage, es gab schlechte Tage und es gab diese undefinierbaren Tage, an denen Detective Miller nicht recht wusste, was er mit ihnen anfangen sollte. Und genau so ein Tag war heute. Woran es lag, wusste er nicht, jedoch vermutete er, dass es mit Darcie Flowers zusammenhing.
»Was guckst du so seltsam, Miller? Sitzt etwas in deinem Verdauungstrakt quer?«, nahm ihn sein Kollege Ted Rosenthal auf die Schippe, der gerade ins Büro stolziert kam und sich auf den Stuhl gegenüber des Schreibtisches fläzte, ungeachtet der Jacke und des Hemdes, die darauf lagen.
»Danke der Nachfrage«, erwiderte der Angesprochene knapp, ohne den Blick von der vor ihm aufgeschlagenen Akte zu heben.
»Lass mich raten – es ist wegen deiner Nichte. Lässt sie dich nicht schlafen?« Ted musterte sein Gegenüber und nickte wissend. »Also hab ich recht: Die kleine Darcie macht Onkel Frederic ganz kirre.«
»Sie redet in einer Tour, ohne Punkt und Komma«, klagte Miller sein Leid. Er bereute es jetzt schon, seiner Schwester Lucy zugesagt zu haben, dass Darcie die Ferien bei ihm in Chicago verbringen dürfte. Dabei war sie gerade mal seit einem Tag bei ihm. Ted lachte schallend auf, sodass Miller zusammenzuckte.
»Etwa noch mehr als ich?« Er stand auf und ging zur Tür. »Warte, ich hol uns einen Beruhigungskaffee. Soll ich deinen veredeln?«
»Das wäre wahrscheinlich das Beste, aber ich glaube nicht, dass Alkohol mir wirklich weiterhilft. Du kannst dir nicht vorstellen, worüber diese Dinger in dem Alter alles reden wollen.«
»Ich dachte immer, mit sechzehn ist man eher zurückhaltend und wortkarg, jedenfalls alten Säcken wie uns gegenüber.«
»Schön wär´s. Aber Darcie labert und labert. Cheerleading hier, der Quarterback da, ihre nervige Mom und was weiß ich nicht alles. Und das Schlimmste ist: Sie kommt nachher ins Department, um zu sehen, wo ihr Lieblingsonkel seine Füße hochlegt. Das sagte sie wörtlich.«
»Cleveres Mädchen, hat dich gleich durchschaut«, sagte Ted. »Aber hast du nicht gesagt, du wärst ihr einziger Onkel?« Miller seufzte nur, woraufhin Ted losging. Der Detective sah seinem Kollegen hinterher, der sich mit einer Hand über den Oberarm rieb. Eine Folge der Schussverletzung, wegen der er monatelang nur Innendienst ableisten durfte, da die Beweglichkeit seiner Schulter massiv eingeschränkt war. Kurz dachte Miller an den spektakulären Fall aus dem letzten Jahr zurück, in dessen Zuge sie es mit einer perfiden Psychopathin aufnehmen mussten, die sie vor einige Herausforderungen gestellt hatte. Perfide, aber eine willkommene Abwechslung zu den Gangmorden, die in der Windy City, wie Chicago auch genannt wurde, leider an der Tagesordnung waren. Meist stellte sich sehr schnell heraus, welche andere Gang dahinter steckte. Jedoch führte das nur höchst selten zu einer Verhaftung, denn der tatsächliche Täter war nur durch Glück zu ermitteln.
Vor einigen Tagen hatte Ted grünes Licht vom Doc bekommen und konnte es seitdem kaum abwarten, wieder den Dreck der Straße zu inhalieren, wie er es nannte. Obwohl Ted eher zu der Sorte Mensch gehörte, die sich nicht so gern die Hände schmutzig machten, was in seinem Fall nicht nur wörtlich, sondern auch im übertragenen Sinne zutraf. Miller vertraute Ted zu einhundert Prozent und würde ihm sein Leben anvertrauen, auch wenn er die lockere Art und den nicht selten frivolen Humor des jüdischen Mannes manchmal höchst befremdlich fand.
Kurz darauf servierte Ted den versprochenen Kaffee, auch wenn das Gebräu diesen Namen nicht verdiente. Doch wenigstens roch er so, wie es sein sollte.
»Danke.«
»Für dich doch immer gern. Also, wann kommt die kleine Grazie?«
»Du meinst Furie.« Miller warf einen Blick auf die Armbanduhr. »In etwa zwei Stunden. Es sei denn, wir bekommen noch einen Fall rein. Dann ticker ich ihr, dass sie zu Hause bleiben soll.«
»Hm, jetzt weiß ich gar nicht, was ich bevorzugen würde: endlich wieder einen Tatort beschnuppern, das frische Blut quasi inhalieren, durch die Schwaden des Pulverdampfes staksen, immer damit rechnend, von einem Gangmitglied hinterrücks beschossen zu werden – oder dir in deiner Verzweiflung zuzusehen, wie du Girlsitting betreibst.«
»Was hast du gesagt? Ich bin nach deinem ›hm‹ ausgestiegen.«
»Hey, du kannst ja witzig sein, Miller«, sagte Ted grinsend. »Versuch das mal bei Darcie und wer weiß, vielleicht habt ihr dann beide was von ihrem Besuch bei dir.«
»Boah, du hörst dich so weichgespült an. Was ist los mit dir?« Miller schüttelte den Kopf. »Ich glaube, es wird wirklich höchste Zeit, dass du wieder raus kommst.« Bevor Ted etwas erwidern konnte, klingelte das Tischtelefon. Miller griff nach dem Hörer und lauschte dem Anrufer. »Okay, verstanden. Danke«, sagte er am Ende des Gesprächs und legte auf.
»Ist es, was ich denke?«, wollte Ted mit hoffnungsvollem Blick wissen.
Miller nickte knapp und schnappte seine Lederjacke von der Stuhllehne.
»Jo, wir müssen los. Ich erklär dir unterwegs alles.«
***
Von weitem sahen die Detectives bereits die Blaulichter der Streifenwagen, die den Bereich vor dem Haus weiträumig absperrten und die neugierigen Nachbarn davon abhielten, ihre Nasen zu weit in den Tatort zu stecken.
»Guck dir die Geier an«, sagte Miller verächtlich und deutete zu einem Übertragungswagen eines TV-Senders, vor dem bereits der Kameramann und eine Reporterin mit einem Mikro in der Hand auf Gesprächspartner lauerten. Sicher hatten sie den Polizeifunk abgehört. »Das Blutbad sollte für eine gute Quote sorgen.«
»Die machen auch nur ihren Job. Ach, das sind Clarice und Carl«, erwiderte Ted und lächelte der dunkelhäutigen Reporterin von den Fox-News zu, während sie daran vorbeifuhren. »Und wenn sie dann noch so attraktiv sind ...« Miller warf seinem Kollegen einen Seitenblick zu. Doch er verzichtete auf unnötiges Gequatsche, da er sich mental darauf vorbereitete, was er gleich zu sehen bekommen würde. Und das, so wusste er bereits vom Einsatzbefehl, würde es in sich haben.
Kaum waren sie aus dem Wagen gestiegen, kam die Fernsehfrau auf sie zugelaufen.
»Hey, Ted, Miller«, begrüßte sie die beiden. »Jungs, seid ihr hier zuständig?«
Dass die Frage rhetorischer Natur war, stand für Miller außerhalb jeder Diskussion. Dazu brauchte es auch die mobile Rundumkennleuchte nicht, die er während der Fahrt auf dem Dach des Wagens angebracht hatte.
»Gib uns eine Minute, damit wir uns ein Bild machen können«, sagte Ted mit geduldiger Stimme, »dann bekommst du alles von mir, was du willst.« Er zwinkerte ihr zu und beeilte sich, zu Miller aufzuschließen, der die Reporterin hatte einfach stehenlassen. Sie grüßten den uniformierten Officer, der ihnen das gelbschwarze Absperrband hochhielt.
»Es ist wirklich übel, macht euch auf was gefasst«, gab er den Detectives mit auf den Weg und ließ das Band wieder los, nachdem sie darunter hindurchgeschlüpft waren.
»Mh«, machte Miller.
»Danke«, sagte Ted und klopfte dem Officer auf die Schulter. Kurz vor der Wohnungstür blieb er neben Miller stehen und zog ein Päckchen aus der Jackentasche. »Kaugummi?«
»Jop«, sagte Miller, nahm einen Steifen und schob ihn sich in den Mund. Der kräftige Pfefferminzgeschmack würde es erträglicher machen. Ein hektisch wirkender Cop kam ihnen entgegen.
»Da seid ihr ja.«
»Ja, was hast du für uns, Pete?«
»Abigail Winston, 24, alleinerziehend. Servicekraft in Trevor´s Diner drüben im Westend.«
»Ganz schön weiter Weg für einen einfachen Job«, ließ Miller fallen.
»Den sie wohl mit dem Bus und der ›L‹ zurückgelegt hat«, erwiderte Pete. »Zumindest ist kein Fahrzeug auf sie zugelassen.«
»Das habt ihr schon recherchiert? Respekt. Bus und Bahn, das lob ich mir«, sagte Ted und schnalzte mit der Zunge, woraufhin ihn der Kollege mit einer hochgezogenen Braue ansah.
»Wir machen unseren Job. Nicht mehr, nicht weniger.« Sie folgten ihm ins Wohnzimmer, wo die Frau mit offenen Augen auf dem Rücken liegend das Zentrum des Raums bildete. Neben der von Blut überzogenen Leiche hatte sich, von ihrem Kopf ausgehend, eine Pfütze gebildet. »Die Todesursache könnt ihr hier sehen. Wir gehen zur Zeit von einem Messer als Tatwaffe aus.« Er deutete auf die klaffende, horizontale Wunde am Hals der Leiche. »Todeszeitpunkt gestern Abend zwischen 21 und 23:30 Uhr.«
»Aufgeschlitzt.«, murmelte Miller und hockte sich zu der Toten.
»Aufgeschlitzt und ausgeweidet. Der Killer hat ihr das Herz gestohlen.«
Miller wanderte mit den Augen über den größtenteils nackten Körper der jungen Frau. Er zeigte auf die Blutergüsse direkt an den Handgelenken. »War sie gefesselt?«
»Der Doc meinte, nein«, sagte Pete kopfschüttelnd. »Keine Faserspuren. Er meint, dass jemand sie festgehalten hat und auf ihr saß oder kniete. Daher wohl die Hämatome am Becken.«
»Aber Genaueres kann er uns natürlich erst sagen, wenn er sie auf seinem Seziertisch hatte, richtig?«, mutmaßte Ted, der die Antwort bereits kannte.
»Natürlich. Du kennst ihn doch.«
»Mh.«
»Ist sie vergewaltigt worden?«, wollte Miller wissen.
»Tendenz nein«, gab Pete die Einschätzung des Pathologen wieder.
»Okay«, sagte Miller und stand auf. Er sah von oben noch einmal auf die Frau herab, deren Arme eng am Körper und Beine lang ausgestreckt nebeneinanderlagen; ganz so, als wäre sie nach ihrem Tod bewusst so drapiert worden. »Was für eine Schande!« Sein Blick fiel auf einen Kreis in der Blutlache zwischen dem Ohr und der Schulter des Opfers. »Was ist das?«
»Keine Ahnung«, sagte Pete, »aber wir haben es fotografiert. Liegt nachher auf eurem Tisch.«
»Was hast du sonst für uns?«, fragte Ted.
»Keine Einbruchspuren«, antwortete Pete und blickte dabei zur Wohnungstür. »Ebenfalls keine nennenswerten Kampfspuren.« Nach einer Pause fügte er hinzu: »Vorausgesetzt, ihre Töchter haben nicht hinterher aufgeräumt.«
»Verdammt, was für Töchter?«, fragte Miller entsetzt. Auch Ted schaute verstört zu dem Kollegen des Tatortteams, das für die Erstbegutachtung zuständig war. Der zuckte mit den Schultern.
»Hat man euch das nicht gesagt?«
»Nein!«
»Deswegen brauchst du mich nicht anzufahren, Miller. Also, sie hinterlässt zwei Töchter im Alter von acht Monaten und vier Jahren, Deborah und Ella. Die sitzen wahrscheinlich schon bei euch auf der Dienststelle. Jedenfalls haben wir sie mit einer Jugendamtbediensteten dahin geschickt.«
»Die Kommunikation läuft ja fantastisch«, sagte Miller und schnaufte. »Noch andere Überraschungen?«
»Der Vater der Kinder, ein gewisser Jeff Kruger, hat sich vor der Geburt der Jüngsten aus dem Staub gemacht.«
»Wissen wir, wo er ist?«, fragte Miller.
»Der sitzt ein für insgesamt drei Jahre. Statt eines Jobs hat er ein paar Brüche drüben im Hyde Park gemacht.«
»Ah«, machte Miller. Klar, in dem bürgerlichen Stadtteil fanden sich zuhauf Adressen, bei denen sich ein Einbruch lohnte.
»Doch statt auf schnelle Knete traf er auf unsere Kollegen, die ihm noch schneller die Handschellen angelegt haben.«
»Dann können wir ihn also ausschließen«, stellte Miller fest und atmete hörbar aus.
»Wer hat sie gefunden?«, fragte Ted.
»Das Kindermädchen, eine Pamela Holyfield. Sie besitzt einen eigenen Schlüssel und ist wahrscheinlich auch die Letzte, die das Opfer gestern Abend lebend gesehen hat. Außer dem Täter natürlich. Wenn ihr mich fragt, ist es nur einer, soviel verraten die Spuren.«
»Die habt ihr hoffentlich gleich mitgeschickt«, sagte Miller und merkte gleich, dass diese Bemerkung überflüssig war.
»Natürlich«, erwiderte Pete und versuchte gar nicht erst, die Gereiztheit in seiner Stimme zu verbergen.
»Sorry«, sagte Miller, »ich hab einen Scheißtag heute.«
»Was soll sie erst sagen?«, sagte Pete und deutete auf die Tote, die gerade mit einem Laken bedeckt wurde.
»Was ist mit den Nachbarn, haben die etwas mitbekommen?«
»Du kennst doch diese Gegend«, wandte sich der Angesprochene an Ted. »Hier geht niemand freiwillig nach Sonnenuntergang aus dem Haus. Also nein, nichts Verwertbares.« Er fuhr sich mit der Hand durch das schüttere Haar, während er sich umblickte und eine Kollegin anwies, den Laptop zusammen mit dem Handy des Opfers einzutüten und zur Technik bringen zu lassen. »Vielleicht finden wir dort etwas, das euch weiterhilft.«
»Wir nehmen alles, was du uns gibst«, sagte Miller freundlich, um Schadensbegrenzung bemüht.
»Hör auf zu schleimen, Miller«, grunzte Pete und stieß ihm leicht den Ellbogen in die Rippen. »Ich kenn dich lang genug, um zu wissen, dass du kein Arsch bist.«
»Ist mir da was entgangen?«, fragte Ted zwinkernd.
»Halt die Klappe, Ted«, erwiderte Miller und Pete rollte mit den Augen.
»Guck an, da sind sich die feinen Herren wieder einig.«
»Danke, Pete«, sagte Miller und ignorierte Teds Anstrengungen, witzig zu sein. Dann wandte er sich an seinen Kollegen. »Wegen mir können wir.«
»Wegen mir schon lange. Aber ich wollte eurem Techtelmechtel nicht im Wege stehen.«
Auf dem Weg zum Wagen wartete bereits Clarice Bennet auf die von Ted zugesagte Stellungnahme. Sie hielt ihm mit ausgestrecktem Arm ein Mikrofon unter die Nase.
»Tut mir leid, Clarice, wir können im Moment keine Details rausgeben, da wir noch nicht alle Fakten kennen«, erklärte er der Reporterin, die ihn verärgert ansah.
»Komm schon, Detective Rosenthal, irgendetwas für unsere Zuschauer wirst du doch haben.«
Ted schüttelte den Kopf und hob die Hände zu einer entschuldigenden Geste.
»Wissen Sie was, Ms. Bennet?«, mischte sich Miller ein, der um Teds Zugewandtheit zur Presse wusste und prinzipiell nichts dagegen einzuwenden hatte. Zumal sich gerade Clarice Bennet in der Vergangenheit mehrfach als wertvolle Partnerin erwiesen hatte. »Kommen Sie in zwei Stunden zum Department, dann kriegen Sie von Detective Rosenthal exklusiv, was wir haben.«
»Okay, ich nehme Sie beim Wort, Miller.«
»Das kannst du, Clarice«, bestätigte Ted und stieg in das Dienstfahrzeug.
»Zwei Stunden«, hörten sie die durch die Scheiben gedämpfte Stimme der Reporterin, die es zusätzlich mit dem Zeigen von zwei Fingern unterstrich. »Zwei Stunden.«
***
Monica wachte mit einem Dröhnen auf, als würde jemand einen Presslufthammer auf ihrem Schädel auf- und niederschlagen lassen.
»Wo bin ich?«, fragte sie benommen und hob langsam ein Augenlid. Der Schmerz wurde nicht schlimmer, daher wagte sie es, auch das andere anzuheben. »Hallo?«, rief sie fragend, doch wieder nichts. Diesmal antwortete ihr aber der Schmerz, indem er sich wie ein Stromschlag über ihren Körper entlud. Monica stöhnte auf. Sie wollte sich einrollen, die Hände schützend über ihren Kopf legen, sich möglichst klein, möglichst unsichtbar machen. Doch nichts davon konnte sie in die Tat umsetzen und bevor sie den Kopf aus ihrer liegenden Position anhob und zu den Händen und Füßen drehte, um sich Gewissheit zu verschaffen, ahnte sie es bereits: Sie war gefesselt. Jetzt spürte sie die Riemen, mit denen ihre Fußgelenke und Unterarme an etwas fixiert waren. Sie erkannte, dass es sich um ein altes Feldbett handelte, wenn auch nur schemenhaft, da durch das vergitterte Fenster, das knapp unterhalb der Zimmerdecke einen trüben Blick nach draußen ermöglichte, kaum Licht in den Raum fiel.
Nur einmal schaffte es Monica, sich aufzubäumen, mit all ihrer verbliebenen Kraft den Versuch zu unternehmen, sich von den Fesseln zu befreien. »Komm schon!«, schrie sie und zerrte, riss und strampelte, bis der Schmerz und die Erschöpfung die Oberhand gewannen. Sie befürchtete, ohnmächtig zu werden, und kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit an, doch sie konnte nicht verhindern, dass ihre Bauchmuskeln sich zusammenzogen. Schwallartig schoss eine bitter-säuerliche Flüssigkeit aus ihrem Mund und landete platschend auf dem Boden.
Sie fühlte, wie die Tränen heiß ihre Wangen hinunterliefen, spürte, wie ein Zittern ihren Körper durchrüttelte, während der Geruch der Kotze zunehmend den Raum erfüllte. Mit der Zeit ließ der Schmerz nach, doch statt dass es Monica besser ging, bahnte sich die Erinnerung grausam den Weg in ihr Bewusstsein.
Sie war vorhin – oder war es gestern? – mit Kommilitoninnen feiern, da sie die letzte Klausur hinter sich gebracht hatten. Das und die laue Luft, die zur Zeit noch über den Lake Michigan wehte, hatten für Partystimmung gesorgt. Vom vorhergesagten Unwetter hatten weder sie noch die anderen Mädchen etwas mitbekommen. Monicas Spaß hielt allerdings nicht lange an. Sie vertrug die Cocktails nicht gut, möglicherweise aufgrund der kürzlich abgeschlossenen Antibiotikabehandlung, und verabschiedete sich früher von der Gruppe als erwartet. Je intensiver sie nachdachte, während sie gefesselt in diesem Kellerraum fror und vor Angst fast wahnsinnig wurde, desto mehr Erinnerungsfetzen tauchten auf. Der Typ zum Beispiel, der sie draußen vor dem Club angebaggert hatte, kam ihr in den Sinn. Sie hatte ihn gar nicht richtig angesehen, sondern ihm freundlich zu verstehen gegeben, dass sie kein Interesse hatte. Kurz darauf steuerte sie auf die U-Bahn-Station zu, als dieser Wagen neben ihr anhielt. Sie hörte noch, wie eine Schiebetür geöffnet wurde, doch das nahm sie in dem Moment nicht als Bedrohung wahr und lief weiter. Dann spürte sie nur noch einen kräftigen Schlag am Hinterkopf und wie ihr etwas ins Gesicht gedrückt wurde.
Nach und nach fügte sich das Puzzle zu einem schrecklichen Gesamtbild zusammen. Sie war entführt worden. Und da weder ihre Eltern noch irgendwer aus ihrem Bekanntenkreis den wohlhabenden oder gar reichen Familien dieses Landes angehörten, schloss sie eine Verschleppung wegen einer Lösegeldforderung aus. Sie weigerte sich, Gedanken über die Alternative in ihren Kopf zu lassen. Nein, sie würde hier herauskommen. Sie war intelligent, hatte als fünftbeste ihres Jahrgangs die High School abgeschlossen, das technische Studium ohne Schwierigkeiten durchlaufen. Sie war so fit, dass sie sogar den Männern noch bei deren Ausarbeitungen half. Kurzum, sie hatte das Zeug dazu, beruflich alles Denkbare zu erreichen. Und das Schicksal hatte es für sie auch so vorgesehen, sonst wäre das Drama im letzten Jahr anders ausgegangen. Da wäre es doch gelacht, wenn sie jetzt keinen Weg finden würde, der sie hier herausführte.
Plötzlich knarrte die Tür und jemand betrat ihr Gefängnis. Alle Zuversicht erlosch.
»Zeit zum Sterben«, hörte sie eine ihr fremde Männerstimme fröhlich sagen. Doch so gutgelaunt der Mann auch zu sein schien, Monica zweifelte keine Sekunde daran, dass er es ernst meinte und ihr Tod unmittelbar bevorstand.
»Was wollen Sie von mir?«, schluchzte sie, während sie verzweifelt versuchte, ihre Hände zu befreien, wodurch die Seile nur noch tiefer in ihre Haut schnitten. Vielleicht scheuerten sie auch schon auf den Unterarmknochen. Monica spürte keinen Schmerz, zu sehr hatte sie die Panik in ihrem eisernen Griff und es schien nur eine Frage von Sekunden, bis sie fester zudrücken würde. Plötzlich tauchte das Gesicht des Mannes dicht vor dem ihren auf. Sie zuckte zusammen.
»Dass du mir gibst, was ich brauche«, erwiderte er lachend. Sein Atem roch nach Pfefferminz oder Eukalyptus, genau konnte Monica es in ihrer Verfassung nicht einsortieren, ihr fiel lediglich auf, dass es ein angenehmer Duft war, den der Psychopath verströmte. Wie krank war das denn?, schrie sie innerlich. Der will dich killen und du findest, dass er gut riecht? Immer wilder verhedderten sich ihre Gedanken zu einem panischen Geflecht.
Erkennen konnte sie ihn nicht, dazu war er ihr viel zu nah. Das war ihm offenbar bewusst, denn er verschwand seitlich aus ihrem Sichtfeld, genau, wie er gerade dort erschienen war.
»I-ich verstehe nicht«, stammelte sie und strengte sich an, die Kontrolle über ihren Verstand zurückzugewinnen. Vielleicht würde sie doch noch hier herauskommen, wenn sie sich ihm anbot, alles mit ihm tat, was er verlangte. »Ich mache alles, was Sie wollen.« Er lachte. Ein fröhliches, fast unbeschwertes Lachen. Doch von einem Moment auf den anderen erstarb es.
»Natürlich wirst du das«, erwiderte er mit eisiger Stimme. Dann entfernten sich seine Schritte. Hoffnung brandete auf. Würde der Typ ihr eine Galgenfrist geben? Klick. Helligkeit durchflutete den kleinen Raum, als der Mann das Licht einschaltete. Langsam, als würde er es genießen, drehte er sich zu der hilflos auf der Pritsche liegenden Monica um. Sie wollte nicht zu ihm hinsehen, tat es aber doch, und als ihr dämmerte, woher sie sein Gesicht kannte, wusste sie es: Sie würde hier sterben.
***
Der Mann konnte sich gar nicht an den aufgerissenen Augen des Mädchens sattsehen, das er gestern Abend noch aufgelesen hatte. Hellblau funkelten sie ihn an, wobei der Tränenfilm ihnen einen besonderen Glanz verlieh.
Es musste eine Fügung, ein Zeichen sein, dass gerade diese Studentin ihm gesandt worden war. Keine zwei Stunden nach dem Desaster bei der Kleinen aus dem Diner, also lag er gut in der Zeit. Ja, bei dieser Abigail zu Hause, wo ihm dieser Engel Ella ein wenig die Tour vermasselt, ihn um seinen erlösenden Schuss gebracht hatte. Energien der Wut hatten sich dadurch ihn ihm aufgestaut, die man eher in einem Atomkraftwerk vermuten würde.
Später, wenn Ella einmal ›fertig‹ wäre, würde er sicher zu ihr zurückkehren und sich an ihr laben, aber soweit war sie noch lange nicht. Diese Monica hingegen – er hatte gehört, wie sie von einer Freundin vor dem Club mit diesem Namen angesprochen worden war – würde ihn für alles entschädigen. Sie war fertig und sie hatte alles, was nötig war. Obwohl sie es strenggenommen doch gar nicht mehr hatte, dachte er feixend.
Er ging langsam auf sie zu, neigte den Kopf und musterte das Mädchen, das reglos dort vor ihm lag. Kaum sichtbar hob und senkte sich ihr Brustkorb.