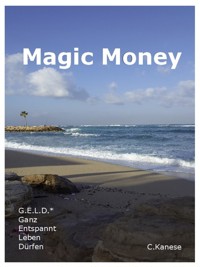
19,99 €
Mehr erfahren.
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind." (Einstein) Ich möchte Sie mit diesem Buch zum/r Geld-Held/in, der/die entspannt und befreit mit Geld umgehen kann. Zuerst analysieren wir gemeinsam, welche psychologischen Muster, also welche Gefühlsverknüpfungen, bei Ihnen mit dem Thema Geld verbunden sein können. Das Buch soll Ihnen nicht nur dabei helfen: 1. zu verstehen, wie unser Verhalten beim Geld begründet wird. 2. zu ergründen, wodurch Ihr Verhalten bei Geld bestimmt wird. sondern besonders auch: 3. wie ungewolltes Verhalten beim Geld in erwünschtes Verhalten verändert werden kann. Eltern führen selten ein Gespräch mit ihren Kindern über Funktionen von Geld in unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Es wird auch selten als Schulfach behandelt. Deshalb bleibt die Vorstellung, was Geld ist oder bedeutet, bei den meisten unbewusst. Mehr noch werden diese unbewussten Vorstellungen unbewusst an die eigenen Kinder weitergeben. Außerdem wird in Deutschland kaum über das Thema Geld und vorhandene Vorstellungen gesprochen. Deshalb entwickeln sich sehr individuelle Perspektiven zu diesem Thema. Jede Betrachtungsweise zum Aspekt Geld ist wie ein persönlicher Fingerabdruck. Dies führt zu ganz individuellen Blockaden und hemmenden Verhaltensweisen, die nur durch eine ebenso individuelle und "maßgeschneiderte" Herangehensweise überwunden werden können. Ich möchte aufzeigen, welche unterbewussten Verknüpfungen beim Thema Geld vorliegen können. Dann werden ökonomische Grundlagen zum Geld vorgestellt und danach die Möglichkeiten zur Veränderung hinderlicher Verhaltensmuster aufgezeigt. Dabei möchte ich in erster Linie, dass Sie beim Lesen Spaß haben und alles mit einem kritischen und offenen Auge betrachten. Übernehmen Sie nur die Gedanken, die Ihnen plausibel und übernehmenswert erscheinen. Ich bin auf Ihre Gedanken und Hinweise sehr gespannt. Schreiben Sie mir gerne unter kanesecoaching.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Magic Money
Für meinen geliebten Ehemann und Seelengefährten.
G.E.L.D. - Ganz Entspannt Leben Dürfen
C. Kanese
erschienen 2016
1. Auflage 2016
Copyright: (c) 2016 C. Kanese
Bildrechte: (c) C. Kanese oder Creative Commons
Umschlaggestaltung: C. Kanese
E-Book Version: M. Hoffmann
published by : epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Deutschland
ISBN 978-3-7418-4976-3
Über den Autor: C. Kanese www.Kanesecoaching.de
Inhaltsverzeichnis
1 Vorspiel
2 Vorwort und Leseleitfaden
3 Was ist Geld?
4 Was ist Geld-Intuition?
5 Was soll Geld?
6 Was ist Geld nicht?
7 Was ist hilf-reiche Geld-Intuition?
8 Reichtumserlaubnis & familiärer „Finanzcode“
9 Magic Money Meditation
10 Reiche Vorbilder als Wegweiser finden
11 Ihre persönliche Geld-Heldengeschichte
Literaturverzeichnis
Kapitel 1
Vorspiel
0
00
000
000000
1000000
1.000.000
–1.000.000
500
Fällt Ihnen dazu etwas ein? Nein? Dann suchen Sie aus Ihrem Portemonnaie einen beliebigen Euro-Schein heraus und sehen Sie ihn sich genau an.
Auf jedem Euro-Schein ist auf der Vorderseite ein stilisiertes Fenster, das für Offenheit gegenüber anderen Kulturen steht, und auf der Rückseite ist eine Brücke, die für eine gemeinsame Verbindung stehen soll.
Kapitel 2
Vorwort und Leseleitfaden
„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
Das Gehirn erfasst das Thema Geld nicht auf kognitive, sondern auf affektive Weise. Das heißt, das Bild, das sich unser Unterbewusstsein beim Thema Geld bildet, bestimmt unser Verhalten.
Das Unterbewusstsein lernt durch Imitation von den Vorbildern und schaut sich schon im frühen Kindesalter von 3 bis 4 Jahren die Verhaltensweisen der Vorbilder an und interpretiert sie.
Auf diese Weise wird das Motiv Geld ganz eng mit einem oder mehreren weiteren Aspekten verknüpft. Diese Punkte müssen an sich nicht unmittelbar etwas mit dem Gegenstand Geld zu tun haben, wie z.B. die Themengebiete Konflikt oder Sicherheit.
Zu diesen Angelegenheiten entwickelt das Unterbewusstsein ein Gefühl. Wenn z.B. die Eltern sich oft gestritten haben, wenn Geld im Spiel war, wird eventuell das Geld mit Streit oder Konflikt verknüpft. Verursacht Streit oder ein Konflikt ein Gefühl von Verkrampfung oder Schmerzen im Bauch, kann es passieren, dass Geld mit einer Verkrampfung oder mit Schmerzen im Bauch verknüpft wird.
Wenn dagegen die Eltern immer sehr sicher und gelassen regiert haben, weil genug Geld da war, und diese Sicherheit einem entspanntes und weiches Gefühl im Bauch hervorgerufen hat, wurde wahrscheinlich das Thema Geld mit Sicherheit und einem entspannten Gefühl verknüpft.
Dieses Gefühl bestimmt unser Verhalten bei Geld.
Viele Menschen wissen vom Kopf her bzw. kognitiv ganz genau, wie sie am besten mit Geld umgehen. Auch wenn sie immer wieder von Freunden oder Verwandten gut gemeinte Ratschläge hören, wie z.B. „Kauf doch nicht so viel“ bei Kaufsüchtigen oder „Spar Dein Geld doch lieber“ bei Menschen, die chronisch im Dispo sind.
Diese gut gemeinten Ratschläge sind den meisten Menschen selber klar. Und dennoch ist das Gefühl beim nächsten Kaufrausch in der Übermacht und bestimmt mit großer Stimmenmehrheit das Verhalten. Deshalb heißt es so salopp in Dan Arielys Buch über ökonomische Verhaltensforschung: „Denken hilft zwar, nützt aber nichts.“
Hierbei soll dieses Buch weiterhelfen.
Ich möchte Sie mit diesem Buch zum/r Geld-Held/in machen, der/die entspannt und befreit mit Geld umgehen kann. Zuerst analysieren wir gemeinsam, welche psychologischen Muster, also welche Gefühlsverknüpfungen, bei Ihnen mit dem Thema Geld verbunden sein können.
Das Buch soll Ihnen nicht nur dabei helfen:
zu verstehen, wie unser Verhalten beim Geld begründet wird, zu ergründen, wodurch Ihr Verhalten bei Geld bestimmt wird, sondern besonders auch wie ungewolltes Verhalten beim Geld in erwünschtes Verhalten verändert werden kann.Gerade in Deutschland gibt es kaum finanzielle Ausbildung. Eltern führen selten ein Gespräch mit ihren Kindern darüber, welche Funktionen Geld in unserer Wirtschaft und Gesellschaft hat. Es wird auch selten als Schulfach behandelt. Deshalb bleibt die Vorstellung, was Geld ist oder bedeutet, bei den meisten unbewusst. Mehr noch werden diese unbewussten Vorstellungen unbewusst an die eigenen Kinder weitergeben. Außerdem wird in Deutschland kaum über das Thema Geld und vorhandene Vorstellungen gesprochen. Deshalb entwickeln sich sehr individuelle Perspektiven zu diesem Thema. Jede Betrachtungsweise zum Aspekt Geld ist wie ein persönlicher Fingerabdruck. Dies führt zu ganz individuellen Blockaden und hemmenden Verhaltensweisen, die nur durch eine ebenso individuelle und „maßgeschneiderte“ Herangehensweise überwunden werden können.
Zu Beginn möchte ich aufzeigen, welche unterbewussten Verknüpfungen, Muster und Vorstellungen beim Thema Geld vorliegen können. Dann werden ökonomische Grundlagen zum Geld vorgestellt und danach die Möglichkeiten zur Veränderung hinderlicher Verhaltensmuster aufgezeigt.
Dabei möchte ich in erster Linie, dass Sie beim Lesen Spaß haben und alles mit einem kritischen und offenen Auge betrachten. Übernehmen Sie nur die Gedanken, die Ihnen plausibel und übernehmenswert erscheinen. Ich bin auf Ihre Gedanken und Hinweise sehr gespannt. Schreiben Sie mir gerne unter www.kanesecoaching.de
Kapitel 3
Was ist Geld?
Geld denkt nicht! Also was ist Geld?
„Das Geld soll den Menschen dienen, nicht die Menschen dem Geld.“
Ich saß mal bei einem Blind Date mit einem Mann im Café Paris in Hamburg. Das Gespräch entwickelte sich, und es schien ein netter Abend zu werden. Bis der Herr mir unbedingt seine Erfahrungen aus seiner Fastenzeit erzählen musste, bis hin zur Veränderung seiner Ausscheidungen während dieser Zeit. Schnell wurde mir das Gespräch zu viel, und ich ging im Geiste alle Gesprächsthemen durch, die noch unangenehmer wären, und mit denen ich den Mann in die Flucht treiben könnte. Welches Thema wäre noch unattraktiver als der Toilettengang?
Spinnen? Naja, damit würde ich vielleicht Frauen abschrecken, aber ob Männer das auch ekelt? Kuscheltiere? Da kamen wir der Sache schon näher.
Und dann fiel es mir ein: Geld! Es gibt wohl kein unattraktiveres Thema als Geld, Anlage und Wirtschaft, das eine Frau bei einem Kennenlerntreffen anschneiden könnte. So habe ich mir tatsächlich mit diesem Gesprächsfaden weitere unschöne Folgetreffen vom Hals gehalten.
Und - kennen Sie das auch? Es gibt sogar ein Sprichwort: „Über Geld reden bringt Unglück“. Denken Sie sich im Stillen, dass da etwas dran ist?
Diese Geschichte hat mich auf jeden Fall tatsächlich zu „meinem“ Themengebiet Magic Money gebracht. Ich habe mich dem Thema intensiver gewidmet und habe Bücher aus verschiedensten Fachgebieten dazu gelesen. Sie werden also in dieser Lektüre nicht nur wirtschaftliche, sondern auch philosophische Hintergründe, psychologische und manchmal auch spirituelle Faktoren zum Thema Geld kennen lernen. Sie werden unglaubliches, bestürzendes und unterhaltsames erfahren, das jedes Gespräch über Geld in den Schatten stellt.
Ist Ihnen jetzt ein wenig mulmig? Keine Angst! Es wird noch schlimmer!
Eine Forsa-Studie [2] fand heraus, dass die Deutschen sich eher über ihr Liebesleben und den Tod als über Geld auslassen. Offenbar wird hier ein Tabu berührt. Ist Ihnen beim Sprechen über Geld auch mulmig? Haben Sie dabei ein ungutes Gefühl? Dann sind Sie in Deutschland in guter Gesellschaft. Der Volksmund sagt sogar „Über Geld spricht man nicht“. Aber woher kommt das Sprichwort eigentlich?
Noch im Alten Testament war Reichtum mit Segen verbunden. Damals gab es aber auch schon das Zinsnahmeverbot, welches interessanterweise nicht nur für Geld galt, sondern auch für alle anderen Dinge [3].
Der Umgang mit dem schnöden Mammon und insbesondere das Verleihen von Geld war im Christentum nicht gerne gesehen. Auch im Mittelalter gab es lange Zeit ein absolutes Zinsverbot. Daran hat die katholische Kirche bis ins 20. Jahrhundert festgehalten. Im Judentum dagegen durften Zinsen genommen werden.
Im Mittelalter brauchte die Wirtschaft das Geld als Dreh- und Angelpunkt des Tausches und zur Entwicklung der Spezialisierung und Arbeitsteilung. Dazu werden Sie noch mehr im Kapitel 3.1 'Wie ist Geld entstanden?' erfahren. Kurz gesagt, die Wirtschaft brauchte Investitionen und dafür brauchte sie Kredite. Also mussten die Geldgeber dazu gebracht werden, Geld zu verleihen. Der Anreiz dafür war der Zins. Für jüdische Mitbürger war es verboten, im Handwerk tätig zu werden, und im Judentum galt das Zinsverbot nicht. Deshalb spezialisierten sie sich in Handel und Geldgeschäften. Obwohl die Wirtschaft ohne die Geldversorgung gar nicht florieren konnte, wurden die Geldgeschäfte von der Kirche als Inbegriff der Sündhaftigkeit gebrandmarkt.
Ist dieser geschichtliche Hintergrund wohl immer noch Grundlage dafür, dass in Deutschland über das Thema Geld so ungern gesprochen wird? Oft wird das Reden über Geld mit einem extrem unwohlen Gefühl assoziiert. Wirkt sich hier das Sündenbild der Kirche aus und kommt noch ein dumpfes Gefühl zur Schuld hinzu?
Im Laufe des Buches werden wir dort genauer hinschauen und ergründen, welche Denkmuster bei Ihnen mit Geld verbunden sind. Gemeinsam machen wir uns auf eine Reise, in der Sie Ihre unbewusste Sichtweise zu Geld entdecken und so verändern können, dass Sie am Ende mit Geld ganz entspannt Leben dürfen und zum/r Helden/in der Geschichte werden.
[2] Forsa-Studie März 2009: es wurden 1.060 Personen befragt, worüber sie mit Bekannten und Freunden sprechen.
[3]
3.1 Wie ist Geld entstanden?
„Geld ist, wie das Rad, eine sehr angenehme Erfindung des Menschen und ein Meilenstein in der Entwicklung. Nicht mehr und nicht weniger.“
Warum ist Geld eigentlich entstanden? Es gibt einen plausiblen Grund: um einfacher Tauschen, also Wirtschaften zu können. Stellen Sie sich vor, wie unbequem und umständlich eine Tauschwirtschaft ohne Geld heute noch wäre. Deshalb ist das Geld als Zwischentauschmittel entstanden, das zum weiteren Tausch mit dem nächsten Handelspartner eingesetzt werden kann.
Erst als Naturalgeld, dann als Münzgeld und schließlich als Papiergeld und Buchgeld. Als Naturalgeld oder Warengeld wurden Muscheln, Kamele oder auch Zigaretten verwendet. Dabei besaß das Naturalgeld immer einen Wert an sich.
Auf der Insel Yap in Mikronesien wurden Steine als Geld eingesetzt. Anhand der idyllischen Insel im Pazifik in der Nähe der Philippinen wird Studenten der Volkswirtschaftslehre im ersten Semester gerne erklärt, warum das Papiergeld entstanden ist. Es gehört zwar in das Reich der Legenden, aber dennoch lässt sich anschaulich erklären, warum so etwas wie Papiergeld entstanden ist.
Das Volk der Yap hatte also Steine als Geld. Die Größe eines Steins zeigte an, wie hoch sein Wert war. Sehr reiche Inselbewohner besaßen daher riesige Mühlsteine. Mühlsteine sind nun natürlich sehr umständlich zu transportieren und auch ansonsten ziemlich unhandlich.
Schließlich wurden in der Yap-Gemeinde, in der sowieso jeder jeden kannte, bei einem Tausch nicht mehr die Mühlsteine hin und her geschleppt, sondern ein Zettel mit dem Besitznachweis und dem Standort des Mühlsteines ausgetauscht. Irgendwann hat keiner mehr nachgesehen, wo die Mühlsteine lagen und ob es sie überhaupt gab, denn jeder hatte Vertrauen darin, dass die Zettel „gedeckt“ sind und sie wurden als Tauschmittel anerkannt.
In Europa waren es Goldmünzen, die in Goldsäcken mühsam transportiert werden mussten. Sie wurden z.B. vom Templerorden verwahrt, bewacht und später in einem Tauschsystem, das wie eine Bank funktionierte, gegen Geldanleihen getauscht [4].
Geld ist also von den Menschen wie das Rad erfunden worden. Geld ist dabei eine Erfindung, die nur durch unsere höheren Gehirnfunktionen verstanden werden kann. Es repräsentiert bestimmte Funktionen, die nichts mit dem materiellen Wert des Stückchens Papier zu tun haben. Geld representiert nur den Wert. Es ist ein Stellvertreter. Die aufgedruckte Zahl beziffert den representierten Wert, auch Nennwert bzw. nomineller Wert genannt.
Nicht direkt durch unsere Sinne können wir die Funktion des Geldes erfassen, sondern erst durch einen Denkvorgang verstehen und zuordnen. Geld an sich ist sozusagen ein Paket ohne Inhalt oder im übertragenen Sinne eine leeres Blatt Papier. Aber dazu später mehr im Kapitel über das Unterbewusstsein. Zum besseren Verständnis muss ich ersteinmal auf die Funktionen des Geldes eingehen.
3.2 Euro – Getting together
„Wat de Buer nich kennt, dat fret he nich.“ (Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht.)
So sagte mein Großvater immer und biss genüsslich in seine Leib- und Magenspeise: Kartoffeln. Er probierte noch nicht einmal so etwas Neumodisches wie Spaghetti oder Reis mit eben der Begründung, was er nicht kennt, das isst er nicht. Die Einstellung mag für Sie sehr veraltet klingen, doch tatsächlich funktioniert unser gesamtes Denken oft so. Damit Menschen etwas Neues und völlig Unbekanntes ausprobieren, bedarf es oft eines großen (Leidens-)Druckes oder großer Neugier.
So gibt es die Geschichte, dass auch die Kartoffel erst durch eine List von König Friedrich Wilhelm I. von Preußen den Norddeutschen schmackhaft gemacht werden konnte. Die war ja schließlich auch ursprünglich fremd, kam aus Südamerika und wurde erst 1738 in Preußen angebaut.
Die ersten Verbreitungen der Erdäpfel im ehemaligen Preußen sind kläglich gescheitert, weil die Norddeutschen nicht wussten, wie sie zubereitet wurden, und vor allem, welche Teile der Pflanze überhaupt genießbar sind. So manchem ging es nach dem Verzehr der leicht giftigen Früchte sehr schlecht. Schnell wurden alle misstrauisch und wollten von der Kartoffel nichts mehr wissen.
Die negativen Neuigkeiten über das neue Gestrüpp verbreiteten sich schnell. Niemand glaubte mehr, dass die Kartoffel gegen die winterlichen Hungersnöte helfen könne. Auch Aufklärung mit Kartoffelrezepten brachte keine Wende. „Der alte Fritz“ fühlte ich für das Überleben seines Volkes verantwortlich. So kam er auf die ungewöhnliche Idee, die Kartoffelfelder von Soldaten bewachen zu lassen. Kartoffeln mußten also sehr wertvoll sein. Da wurden die Norddeutschen neugierig.
Die Soldaten klauten heimlich hier und da ein paar Knollen, kochten sie und fanden sie sehr schmackhaft. Als dies auch andere mitbekamen, siegte die Neugier und die Kartoffel wurde schließlich zu einem Hauptbestandteil des norddeutschen Mittagessens.
Ob diese Anekdote wahr ist oder nicht, sei dahingestellt. Auf jeden Fall ist es bewiesen, dass nur mit Mut und Überwindung Neues und Fremdes ausprobiert wird. Auch Kinder müssen immer wieder zu neuem Essen ermuntert werden. Und es hilft, dieses Neue erst einmal kennen zu lernen.
Leider gibt es in der Erziehung kaum Kennenlern- und Aufklärungsgespräche zum Thema Geld, wie zum Beispiel die „Bienchen & Blümchen“-Aufklärungsgespräche über Sexualität. Bei den meisten Eltern ist das Thema Geld selbst kaum bewusst und auch in der Schule gibt es dazu keinen Unterricht. Selbst die Forschung steckt mit interdisziplinären Fächern wie Neuroökonomie oder Verhaltensökonomie noch in den Kinderschuhen.
Doch es gibt schon ein paar Erkenntnisse, und vor allen Dingen hilft es, mehr über unser Geld zu verstehen.
Als Erstes möchte ich Ihnen den Euro vorstellen.
Wussten Sie, dass die Euroscheine aus Baumwollfaserpapier sind? Deswegen sind sie besser haltbar als Papier aus Holzfasern und können auch noch nach einem versehentlichen Waschgang verwendet werden. Haben Sie Lust, einmal Ihr Portemonnaie hervorzuholen und die Geldscheine in die Hand zu nehmen? Befühlen Sie die Banknoten ganz bewusst, sie sollten sich griffig und fest anfühlen. Zudem sind erhabene Reliefs an den Rändern, beim Hauptmotiv und an der Zahl erfühlbar.
Fällt Ihnen etwas an den Motiven auf den Scheinen auf?
Ja, jede Banknote hat eine andere Farbe und ein anderes Motiv auf ihrer Vorder- und Rückseite. Bei den Motiven haben sich die Gründer zwei besondere Oberthemen für den Euro ausgedacht. Auf der Vorderseite sind Fenster und auf der Rückseite sind Brücken unterschiedlicher Architekturstile abgebildet. Die Brücken stehen für die Verbindungsfunktion der Währung beim weiteren Zusammenwachsen der europäischen Länder und die Fenster oder Tore stehen für Offenheit gegenüber den anderen europäischen Kulturen.
Gegen das Licht gehalten sehen Sie ein Portrait der Göttin Europa als Wasserzeichen und es gibt einen dunklen Sicherheitsfaden, auf dem sich das €-Zeichen und der Nennwert der Banknote (bei einem Fünf-€-Schein also 5) hell absetzen. Beim Kippen aller €-Scheine erscheinen außerdem Hologramme, und die Farbe der Zahl changiert von grün zu blau.
3.3 Funktionen des Geldes
„Arme, die Reiche hassen, sollten mal reich sein, um zu beweisen, dass sie anders wären.“
Das Geld im Grab
Ein reicher Mann liegt auf dem Sterbebett. Er will sein Vermögen mit ins Grab nehmen und lässt deshalb in seiner letzten Stunde seinen Arzt, seinen Anwalt und einen Pfarrer zu sich rufen. Jedem der drei übergibt er 100.000 Euro mit der Bedingung, dass sie dieses Geld bei der Beerdigung in sein Grab hineinlegen sollten.
Auf der wenig später stattfindenden Beisetzung des Mannes treten nun nacheinander der Pfarrer, der Arzt und der Anwalt an das Grab. Jeder von ihnen wirft einen großen Briefumschlag hinein.
Auf dem Weg nach Hause laufen dem Pfarrer die Tränen aus den Augen und er sagt mit brüchiger Stimme: „Ich habe gesündigt. Ich muss euch gestehen, dass ich nur 80.000 Euro in den Umschlag gesteckt habe. 20.000 habe ich für die Reparatur der Orgel in unserer Kirche genommen.“
Darauf sagt der Arzt: „Ich muss euch sagen, dass ich sogar nur 60.000 Euro ins Grab geworfen habe. Meine Praxis braucht dringend neue medizinische Geräte, dafür habe ich 40.000 Euro abgezweigt.“





























