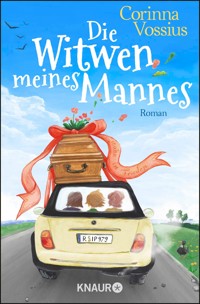6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem warmherzig-witzigem Roman, "Man hat ja seinen Stolz" zeigt Corinna Vossius, dass das Leben jenseits der Achtzig zwar nichts für Feiglinge, aber auch noch lange nicht vorbei ist. Mit Augenzwinkern und viel Respekt für ihre Figuren entwirft sie eine humorvolle Geschichte ums Älter werden, Sterben und Erben. Ihre ungewöhnlichen Heldinnen, die Schwestern Lilli und Berta Berburg, die sich im Alter immer ähnlicher sehen, »teilen« sich einen Platz im Seniorenstift, um sich halbwochenweise aufpäppeln zu lassen, ohne ihr trautes Heim ganz aufgeben zu müssen. Doch als Krankenschwester Ruth sich über das wechselhafte Wesen von ›Frau Berburg‹ wundert und eine beginnende Demenz befürchtet, ruft das eine Nichte auf den Plan, die schon lange ein Auge auf die Immobilie der beiden Damen geworfen hat. Zum Glück ist Schwester Ruth nicht der Drache, für den Lilli sie hält, und Hilfe annehmen nicht so schlimm, wie Berta befürchtet hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Corinna Vossius
Man hat ja seinen Stolz
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Schwestern Lilli und Berta Berburg, die sich im Alter immer ähnlicher sehen, »teilen« sich einen Platz im Seniorenstift, um sich halbwochenweise aufpäppeln zu lassen, ohne ihr trautes Heim ganz aufgeben zu müssen. Doch als Krankenschwester Ruth sich über das wechselhafte Wesen von ›Frau Berburg‹ wundert und eine beginnende Demenz befürchtet, ruft das eine Nichte auf den Plan, die schon lange ein Auge auf die Immobilie der beiden Damen geworfen hat. Zum Glück ist Schwester Ruth nicht der Drache, für den Lilli sie hält, und Hilfe annehmen nicht so schlimm, wie Berta befürchtet hat.
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 1
Lilli
Doktor Schreiner ist ein Idiot, eine aufgeblasene Kröte, ein arroganter Pinsel, und er kann nichts.
»Lauf die Treppen nicht so schnell hinauf!«, ruft Berta von unten. »Nachher hast du es dann wieder mit dem Herzen.«
Mühsam kommt sie hinter mir her. Der Weg von der Straßenbahn ist ihr schwergefallen.
»Lass uns ein Taxi nehmen«, habe ich vor Dr. Schreiners Praxis vorgeschlagen.
Und Berta hat wie immer gesagt: »Für mich ist es kein Problem, mit der Tram zu fahren. Aber ganz wie du willst.«
Meistens bin ich nett und entscheide mich für ein Taxi. Aber heute hatte ich zu schlechte Laune und bestand auf die Straßenbahn. Der Fahrer wurde fast böse, denn er musste extra aussteigen, um uns beiden die hohen Stufen hochzuhelfen, erst der einen, dann der anderen. Früher konnte man nur darauf hoffen, dass ein anderer Fahrgast so freundlich wäre, aber seit ein paar Jahren sind die Fahrer dazu verpflichtet, Alten, Behinderten und Müttern mit kleinen Kindern zu helfen. Früher allerdings hat uns das Einsteigen auch noch nicht so viel Mühe gemacht.
Berta schnauft in die Wohnung hinein und schließt sorgfältig ab, beide Schlösser, oben und unten. Sie lebt in dem festen Glauben, dass die Mieter über und unter uns nur darauf warten, uns auszurauben. In diesem Falle hätten sie allerdings die letzten zehn bis zwanzig Jahre auf eine passende Gelegenheit gewartet und wirklich Geduld bewiesen.
»Du hast deine Schuhe nicht ins Regal gestellt«, sagt sie. »Dir mögen zwar die Knie weh tun, aber mit meinem Rücken kann ich mich auch nicht mehr bücken. Und häng deinen Stock in die Garderobe, sonst fällt noch jemand darüber.«
Ich sage nichts dazu, denn ich weiß, dass sie das am meisten ärgert.
Berta ist meine Schwester, meine ältere Schwester, um genau zu sein, und wir kennen uns schon lange. Sie findet Dr. Schreiner einen gutaussehenden jungen Mann mit begnadeten Händen. Ich finde, er ist ein fünfzigjähriger, geldgieriger Orthopäde mit Tränensäcken vom Rauchen und einem Hängebauch vom Trinken. Aber ich gehe trotzdem immer wieder zu ihm. Einerseits, um Berta eine Freude zu machen, und andererseits, weil die anderen Orthopäden auch nicht besser sind. Nur Frauenärzte sind mir noch unsympathischer, aber bei einem Frauenarzt bin ich sowieso schon ewig nicht mehr gewesen. Ich brauche keine Vorsorgeuntersuchungen mehr, finde ich. Mit über achtzig kann ich genauso gut an Krebs sterben wie an etwas anderem. Aber ich finde es ärgerlich, dass mein Körper auf dem Weg zum Tod schon stückweise aufgibt. Wie auf einer Busreise, wo die meisten Fahrgäste bereits vor der Endstation aussteigen.
Meine Knie zum Beispiel sind zwei dicke, schmerzende Beulen, die weder zum Gehen noch zum Stehen taugen, und die mir im Weg sind, wenn ich mir die Schuhe binden will. Dr. Schreiner sagt, das ist das Alter. Das weiß ich selber. Und er sagt, mein Herz sei zu schwach für eine Operation. Dann lehnt er sich zurück, froh darüber, dass er fünfunddreißig Jahre jünger ist als ich, und fest davon überzeugt, dass ein großartiger Mann wie er sowieso nicht so hemmungslos altern wird wie wir, und er schreibt mir eine Packung Ibuprofen auf.
»Ach nein«, sagt er gleich darauf, »das sollen Sie mit Ihrem Herzen ja auch nicht nehmen. Tja, da bleiben wohl nur Paracetamol und warme Wickel.« Und er hält mir und meiner Schwester die Türe auf, froh, uns von hinten zu sehen. Für seinen Geschmack verlassen wir sein Sprechzimmer viel zu langsam. Zeit ist Geld, und während wir hinausschlurfen, verdient er keines.
Mit Orthopäden kenne ich mich aus. Bis zu meiner Pensionierung habe ich als Sprechstundenhilfe bei einem gearbeitet. Zuerst war ich allerdings bei einem Urologen. Dr. Kampmann. Das war nach dem Krieg. Dr. Kampmann war einer der Ersten, der sich wieder eine Praxis aufbaute. Ich hatte Glück, dass er mich damals nahm, denn ich hatte eigentlich gar keine richtige Ausbildung, nur ein bisschen Steno und Schreibmaschine, aber Dr. Kampmann war ein Bekannter meines Vaters. Später, als er seine Praxis zumachte, war es kein Problem mehr, eine Stelle zu finden. In den Sechzigern gab es genügend Arbeit. Ich wechselte damals in die orthopädische Praxis Schuhmacher, weil sie günstig gelegen war. Ich konnte zu Fuß hingehen. Da war ich schon über vierzig, und es war unwahrscheinlich, dass ich noch heiraten und umziehen würde. Und warum sollte ich es den Rest meiner Berufszeit nicht bequem haben?
Dr. Schuhmacher erfüllte sorgfältig jedes Klischee, das man von einem Orthopäden haben konnte. Er machte Ferien in Italien, er spielte Tennis, und er war sorgfältig gebräunt. Außerdem schlief er mit seinen Sprechstundenhilfen. Natürlich nicht mit mir, aber mit den jungen. Der Doktor und ich konnten einander nicht ausstehen, doch die Praxis hielt ich ihm tipptopp in Ordnung. Und da er die anderen Sprechstundenhilfen nach Gebrauch auswechseln musste, war ich die Einzige, die sich wirklich auskannte. Ab und zu erwog ich zu kündigen. Doch letztendlich war ich zu faul dazu. Ich wusste, was ich an Dr. Schuhmacher hatte, im Guten wie im Schlechten. Immerhin musste ich mich nicht bemühen, nett zu ihm zu sein, so wie all die anderen Mäuschen, die bei ihm hinein- und hinaushuschten. Ich verdarb ihm also konsequent die Laune – bis ich mit zweiundsechzig in Rente ging. Da war der Doktor auch schon nicht mehr so viril wie früher. Du meine Güte, das ist über zwanzig Jahre her.
Berta und ich sind in der Paul-Ehrlich-Straße geboren, und ich habe mein ganzes Leben lang hier gewohnt. Das Haus hat vier Stockwerke in guter Lage. Die Paul-Ehrlich-Straße ist weit genug von der Kennedyallee entfernt, um vor Verkehrslärm geschützt zu sein. Den Krieg hat sie fast unbeschadet überstanden. Überhaupt hat meine Familie den Krieg fast unbeschadet überstanden. Ein paar Verwandte sind gestorben, aber niemand, den wir sonderlich mochten. Die Zeit nach dem Krieg war schlimmer.
Schon meine Kindheit war eine Nachkriegszeit. Für uns war es die Zeit nach dem Großen Krieg. Nicht die paar Jahre vor dem nächsten. Mein Vater war Chirurg, deswegen wohnten wir auch so nah am Klinikum. Für die Chirurgie waren die zwanziger und dreißiger Jahre goldene Zeiten, und mein Vater war mit Leib und Seele Arzt. Um Politik kümmerte er sich nicht. Aber ich nehme mal an, dass ihm der Nationalsozialismus den einen oder anderen Konkurrenten aus dem Weg räumte, denn wir waren Arier bis in die dritte Generation. Wahrscheinlich noch länger.
Die zweite Nachkriegszeit traf uns sehr viel härter. In meiner Erinnerung ist es immer kalt, selbst wenn das ja schlecht sein kann. Und ich stehe immer für irgendetwas Schlange. Wir konnten die Wohnung nicht heizen. Nichts Anständiges zu essen kochen. Kaputte Schuhe waren eine Katastrophe. In dem strengen Winter 1946/47 starb mein Vater an einer Lungenentzündung, ausgekühlt und abgemagert, wie er war. Nur wenige Jahre später hätte es Penizillin gegeben, doch damals konnten wir nichts tun. Meine Mutter tauschte eine Rubinbrosche gegen einen Sarg, der, ehrlich gesagt, gebraucht aussah.
Im Jahr nach Vaters Tod bekamen wir noch Lebensmittelmarken. Aber nach der Währungsreform mussten wir plötzlich Geld verdienen, und die Einzige in der Familie, die etwas gelernt hatte, war ich. Mein großer Wunsch war es immer gewesen, Medizin zu studieren. Oder wenigstens Krankenschwester zu werden. Stattdessen hatte ich 1943, als ich mit der Schule fertig war und doch irgendetwas anfangen musste, einen Kurs für Schreibmaschine und einen für Stenographie belegt. An eine richtige Ausbildung war wegen des Krieges nicht zu denken, weder Sekretärin noch Krankenschwester und erst recht nicht Medizin. Nur diese Kurse. Jahrelang lebten wir alle drei von dem Gehalt, das ich bei Dr. Kampmann bekam. Viel war es nicht, aber viel gab es ja auch gar nicht zu kaufen. Zum Glück hatten wir das Haus und mussten daher keine Miete bezahlen. Meine Mutter hatte sich ganz der Trauer um meinen Vater ergeben. Berta war intensiv auf der Suche nach einem Ehemann. Ich hielt die Familie zusammen und ernährte sie. Ich besorgte mir sogar einen alten Werkzeugkasten, mit dem ich einfache Reparaturen in der Wohnung und bei unseren Mietern selbst ausführte. Das heißt, Miete zahlte damals kaum einer, wovon auch. Aber wir waren gezwungen, den Wohnraum zur Verfügung zu stellen, und konnten noch froh sein, dass wir keine Einquartierungen in die eigene Wohnung bekamen.
Statt Ärztin zu werden, habe ich es also nur zur Sprechstundenhilfe gebracht. Direkt nach dem Krieg fand man sich leichter damit ab, dass einem das Leben nicht jeden Wunsch von den Augen ablas, aber ich habe weder den Beruf ergreifen können, den ich mir wünschte, noch konnte ich heiraten und Kinder bekommen. 1950, als es langsam wieder bergauf ging, war ich bereits siebenundzwanzig Jahre. Selbst wenn die paar ledigen Männer, die es noch gab, gerne mit mir flirteten, als spätere Mutter ihrer Kinder sahen sie mich nicht. Ich war zu alt. Es gab genügend jüngere Mädchen, die dazu auch noch bessere Hausfrauen waren. Kleine Küchenfeen. Das war übrigens nicht schwer. Ich habe nie gerne gekocht, und das musste ich auch nicht. Denn wenn ich abends von der Arbeit kam, stand das Essen auf dem Tisch, und hinterher erledigten meine Mutter und Berta den Abwasch. Ich verdiente das Geld. Für Putzen, Einkaufen, Kochen und Waschen war ich nicht zuständig. Das fanden die Männer zwar interessant, aber in der eigenen Küche wollten sie so jemanden dann doch nicht haben. Und ich hätte auch nicht jeden genommen. Warum sollte ich?
Erst viele Jahre später, als ich endgültig eine alte Jungfer geworden war, da tat es mir leid. Da hätte ich eine Zeitlang alles für einen Ehemann gegeben. Aber gearbeitet habe ich immer gerne.
1952 fand Berta endlich ihren Karl. Es hatte keiner mehr damit gerechnet. Wie gesagt, es gab damals kaum Männer zum Heiraten. Die waren ja alle im Krieg geblieben. Doch Berta wollte einen Mann, der sie ernährte, und sie wollte Kinder. Keinen Ausländer, auch keinen Amerikaner, aber ansonsten war sie zu Kompromissen bereit. Auf diese Weise kamen wir zu Karl, der gut zehn Jahre älter als Berta war und außerdem kriegsversehrt. Aber nur ein bisschen versehrt, wie Berta bei jeder Gelegenheit betonte.
Da es keine Wohnungen gab, zog Karl bei uns ein. Meine Mutter räumte das Elternschlafzimmer und zog ins ehemalige Arbeitszimmer. Karl schlief von nun an im Bett meines Vaters. Und er saß auf seinem Stuhl am Esstisch. Überhaupt schwang sich Karl zum Familienoberhaupt auf, ließ sich von uns bedienen und hatte die unappetitliche Angewohnheit, nach dem Essen laut zu rülpsen. Ich nahm es ihm übel. Die Rülpserei natürlich sowieso. Aber auch, dass er so tat, als müsse er uns drei Damen beschützen, obwohl er in Wirklichkeit mir auf der Tasche lag. Die ersten Jahre schlug er sich als Gelegenheitsarbeiter durch, aber es kam selten genug vor, dass er zum Haushaltsgeld beitrug. Wenn er gerade Arbeit hatte, traf ich ihn morgens in der Küche, wo meine Schwester um ihn herumschwirrte, ihm Kaffee eingoss und Brote schmierte. Karl saß breitbeinig auf dem Stuhl, so als hätte er Sorge, seine Männlichkeit zu quetschen. Überhaupt machte er sich breit, wo es nur ging. Und Berta war immer schrecklich bemüht, ihm alles recht zu machen. Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte an ihrem Eheleben nicht so direkt teilgenommen. Aber da wir so dicht aufeinander lebten, blieb einem kein Detail erspart.
Erst drei Jahre später zogen die beiden in eine eigene Wohnung in Bornheim. Meine Mutter und ich blieben alleine zurück. Meine Mutter rundete gerade die sechzig und begann alt zu werden. Wenn ich von der Arbeit kam, musste ich immer öfter auch noch den Haushalt übernehmen. Aber das machte nichts. Karl endlich los zu sein, das war wie Frühling nach einem langen Winter.
Karl hatte, als die Wirtschaft allmählich in Schwung kam, eine Stelle als Revisor gefunden. Bei einer Firma, die Steckdosen herstellte. Und später, als die Firma expandierte, stieg er dort in der Verwaltung auf. Meine Schwester war ununterbrochen damit beschäftigt, die Wohnung einzurichten und »Karl das Leben zu verschönern«, wie sie es nannte. Wir sahen uns selten, und wenn, dann hatten wir uns wenig zu sagen. Berta überließ es mir, unsere Mutter zu pflegen und auch unser gemeinsames Erbe, das Haus, instand zu halten. Sie ging ganz in Haushaltsführung und Weiblichkeit auf. Allerdings blieb die Ehe zu Bertas großem Kummer kinderlos.
Am Ende bekamen weder Berta noch ich Kinder. Wir sind die letzte Generation eines Geschlechts, das man bis zum Dreißigjährigen Krieg zurückverfolgen kann. Das Einzige, was uns überdauern wird, ist das Haus in der Paul-Ehrlich-Straße. Heute ist es denkmalgeschützt, aber innen könnte man es natürlich in lauter kleine Appartements aufteilen und das Dreifache daran verdienen.
Bertas Ehe wurde in den siebziger Jahren geschieden. Karl war ja schon immer ein Kotzbrocken gewesen, und mit den Jahren wurde es schlimmer. Aber meine Schwester biss so lange die Zähne zusammen, bis eine Scheidung kein allzu großer Skandal mehr war. Da war sie schon über fünfzig und Karl kurz vor der Pensionierung. Eines Sonntagnachmittags stand Berta vor der Türe. Erst kam sie nur mit einem kleinen Koffer, der in ihrem alten Mädchenzimmer gut Platz fand. Aber nach und nach, als die gemeinsame Wohnung aufgelöst wurde, schaffte sie jede Menge Krempel heran, alles ganz modern und fürchterlich im Weg.
»Ist ja nur für ein paar Wochen«, sagte sie.
Ausgezogen ist sie bis heute nicht mehr.
Kurz nach der Scheidung wurde Karl auch noch entlassen. Er hatte Gelder unterschlagen, die ganzen Jahre lang. Nie viel auf einmal, deswegen war es auch so lange nicht aufgefallen. Doch kurz vor der Berentung war er gierig und unvorsichtig geworden, und die Sache flog auf. Mit viel Glück und einem guten Anwalt kam er mit einer Bewährungsstrafe davon. Aber Berta nahm das alles sehr schwer. Schon durch die Scheidung hatte sie einen Gutteil ihres Bekanntenkreises verloren. Jetzt traute sie sich kaum noch aus dem Haus vor lauter Scham. Dazu war das ganze Geld, das Karl in den letzten Jahrzehnten gespart hatte, futsch, und er konnte keinen Unterhalt mehr zahlen.
Berta war damals nur noch ein Schatten ihrer selbst, ganz dünn und mit den Nerven am Ende. Ich päppelte sie mit Kamillentee und warmen Fußbädern wieder auf. Nach dem Tod unserer Mutter 1969 war die große Wohnung etwas still gewesen. Jetzt gab es wieder jemanden, der sich ärgerte, wenn ich mir die Schuhe nicht ordentlich abstreifte oder das Frühstücksgeschirr stehen ließ. Jemanden, für den es selbstverständlich war, dass ich Geld nach Hause brachte, die Rechnungen bezahlte und das Leben in Ordnung hielt.
Ich glaube, an dem Tag, an dem Berta mit dem Koffer in der Hand an der Wohnungstür schellte, war sie mir ehrlich dankbar dafür, dass ich sie ohne viele Worte hineinließ. Aber später verschwendete sie kaum noch einen Gedanken daran, dass ich es war, die so gut für sie sorgte. Schließlich bin ich ihre Schwester.
In schlechten Nächten liege ich nachts wach und starre durch den Spalt in den Vorhängen in das Licht der Straßenlaternen. Die Nächte sind lang und die Liste meiner Sorgen auch. Meistens fängt es mit Schmerzen in den Knien an, oder im Rücken, oder dieses Ziehen in der Brust, auf das ich ängstlich warte. Natürlich tut mir eigentlich immer etwas weh, aber nachts ist es schlimmer, weil Berta aufwacht, wenn ich mich zu viel im Bett herumdrehe. Deswegen versuche ich, still zu liegen und an etwas anderes zu denken, und dann tut es natürlich erst recht weh. Sehnsüchtig warte ich darauf, dass es Zeit zum Aufstehen wird. Durch die Küche schlurfen, Teewasser aufsetzen, Tassen und Teller suchen, die letzten trockenen Brotscheiben schmieren, das ist besser.
Seit einigen Monaten kaufen wir Brot, das schon geschnitten ist und das man in einer Plastiktüte aufbewahren muss. Nach einem Tag schmeckt es trocken und alt. Mein Vater schnitt das Brot aus der Hand. Er hielt den Laib vor der Brust und drehte ihn langsam, während er mit einem Messer, das ganz scharf sein musste, dünne, gleichmäßige Scheiben abschnitt. Er war sehr stolz auf dieses Kunststück. Nach seinem Tod benutzten wir eine Brotschneidemaschine. Doch die ist letzten Herbst kaputtgegangen, nach fast sechzig Jahren. Seitdem haben Berta und ich davon geredet, dass wir eine neue kaufen sollten, denn mit unseren gichtknotigen Fingern können wir Brot nicht einmal schneiden, wenn wir es auf ein Brett legen. Aber bislang konnten wir uns nicht so recht dazu aufraffen. Ich habe sechzig Jahre lang die gleiche Brotschneidemaschine benutzt. Wahrscheinlich gibt es solche heute gar nicht mehr. Und wenn es eine gäbe, dann würde sie halten, bis ich hundertvierzig Jahre alt bin. Wenn ich mit meinen Überlegungen so weit gekommen bin, verliere ich jedes Mal den Elan, und wir essen weiter Brotscheiben aus Plastiktüten.
Die Nächte sind lang, aber die Tage sind merkwürdig kurz und unzureichend. Falls wir zu Dr. Schreiner oder irgendeinem anderen Arzt sollen, planen Berta und ich die ganze Woche darum herum, kochen vor und achten darauf, dass wir an diesem Tag nicht auch noch einkaufen müssen. Schon allein das Aufstehen dauert Stunden. Wir haben nur ein Badezimmer, und immer gibt es Streit, wer es zuerst benutzen darf. Ich erinnere mich, dass wir als Kinder am liebsten gemeinsam aufs Klo gingen. Berta wollte immer, dass wir uns zum Pinkeln gleichzeitig auf die Brille setzen.
Seit Berta bei Karl aus- und bei mir wieder eingezogen ist, habe ich sie kein einziges Mal mehr nackt gesehen, nicht einmal, als ich sie 1986 während ihrer Grippe pflegte.
Das Baden, Haarewaschen und Nägelschneiden sind langwierige, mühsame und heimliche Rituale, die den halben Vormittag dauern können. Vieles wäre einfacher, wenn Berta und ich einander helfen würden. Aber so weit ist es mit uns noch nicht gekommen.
Nein, das ist nicht ganz richtig. Vor ein paar Wochen musste ich nachts dringend auf die Toilette, und meine Knie, ungehalten darüber, aus dem Schlaf gerissen zu werden, ließen sich weder beugen noch strecken. Ich schaffte es aus dem Bett, aber dann klammerte ich mich an den Türrahmen und kam nicht vor und nicht zurück. Schließlich ließ ich einen See unter mich wie ein junger Hund. Ich stand mit den Füßen in der Pfütze, bis Berta mich endlich rufen hörte und mir zu Hilfe kam. Seitdem besteht sie darauf, dass unsere Zimmertüren nachts offen stehen, damit sie mich hört, falls ich sie brauche. Ich hätte, ehrlich gesagt, einen Toilettenstuhl vorgezogen, der neben meinem Bett steht. So habe ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich Berta wecke, denn ich weiß, sie schläft genauso schlecht wieder ein wie ich. Aber Berta will das nicht.
»Nein, Lilli. So weit ist es mit uns noch nicht gekommen, dass wir einen Nachttopf brauchen. Ausgeschlossen«, sagt sie.
Doch dann klagt sie am nächsten Morgen darüber, wie unausgeschlafen sie ist, und ich muss das Kochen übernehmen. Auch den Abwasch überlässt sie mir, weil sie sich hinlegen muss. Ich weiß, dass sie übertreibt, Berta war schon immer so. Aber gleichzeitig kränkt es mich, dass ich, die ich immer die Stärkere und Lebenstüchtigere von uns beiden war, plötzlich auf Bertas Hilfe angewiesen sein soll. In all den Jahren habe ich gedacht, was würde Berta ohne mich machen. Und jetzt ist es umgekehrt. Geduldig bietet sie mir auf der Straße den Arm, um meine Knie zu entlasten. Denn eisern gehen wir einmal am Tag ins Freie, egal, wie das Wetter ist. Wir haben zu oft von alten Menschen gehört, die jahrelang ihre Wohnung nicht mehr verlassen haben. Das passiert so schnell, denn wer hat schon Lust, immer um den gleichen Block zu tapern? An guten Tagen gehen wir bis zur Mörfelder Landstraße, wo der nächste Supermarkt liegt. An schlechten nur bis zur Tankstelle, wegen der Milch.
Andererseits – geduldig ist Berta eigentlich nicht. Im Gegenteil.
»Nun mach schon!«, zischt sie mir zu, wenn ich nicht schnell genug die Kante vom Bürgersteig nehme. Und dann zerrt sie mich hinter sich her wie eine eilige Mutter ihr Kind. Zu Hause ist es auch nicht besser. Erst lässt sie mich das Mittagessen kochen, und dann mäkelt sie daran herum. Dabei besteht kein Zweifel daran, wer von uns beiden die bessere Köchin ist. Ich habe nie etwas anderes behauptet. Immerhin lasse ich keine Haare im Waschbecken, und hinter mir muss auch keiner herräumen.
Je älter wir werden, desto mehr nickeln wir aneinander herum, den lieben langen Tag und werden niemals fertig damit. Während die Wohnung, das Haus und der Garten allmählich verkommen. Wir schaffen es gerade mal noch, zwischen Knie- und Schulterhöhe sauber zu machen, denn bücken kann sich keine von uns so recht und Spinnweben von der Decke holen auch nicht. Ich habe Berta vorgeschlagen, eine Putzfrau zu nehmen. Aber Berta wollte nicht.
»So weit ist es mit uns noch nicht gekommen, dass wir unseren eigenen Müll nicht wegräumen könnten«, sagte sie, und ich habe nicht weiter darauf bestanden.
Ehrlich gesagt, es wäre mir peinlich, eine Fremde in unserem Dreck wühlen zu lassen und unsere eigene Unzulänglichkeit bloßzustellen. Vielleicht hat das wirklich Zeit bis nach unserem Tod. Bis dahin runden sich die Zimmerecken in aller Ruhe unter Schichten von Staub, und die Silberfischchen gleiten wie kleine Geister durch das nächtliche Badezimmer.
Die beste Zeit des Tages ist nach dem Mittagessen, wenn Berta sich ein Stündchen hinlegt. Früher habe ich auch Mittagsruhe gehalten, aber jetzt nicht mehr. Die paar Stunden Schlaf, die ich brauche, hebe ich mir besser für nachts auf. Aber Ruhe ist es trotzdem. Mittags macht Berta die Tür zu ihrem Zimmer zu, und ich habe den Rest der Wohnung für mich alleine. Wenn ich mit dem Abwasch fertig bin, brühe ich mir einen Tee auf, setze mich an den Küchentisch und lese die Zeitung. Ich muss sagen, das ist einer der wenigen Vorteile daran, alt zu sein: Finanzkrisen, Erderwärmung, der Aufstieg Chinas – die wenigsten Katastrophen werden mich noch treffen. Und da wir keine Kinder oder Enkelkinder haben, die in der Postmoderne eine Zukunft brauchen, kann ich die Welt demnächst in aller Ruhe sich selbst überlassen. Die Zeitung lese ich nur zur Unterhaltung. Bei Tee und Keksen blättere ich mich gemütlich durch die Ungeheuerlichkeiten dieser Welt bis zu den Kleinanzeigen.
Hier findet sich immer etwas Interessantes. Bekanntschaften, Stellengesuche, Verloren und Gefunden. Insgeheim hoffe ich, eine gebrauchte Brotschneidemaschine zu finden, genauso eine, wie wir hatten. Stattdessen stoße ich auf die Werbeannonce für ein Altersheim. Geschmackloserweise ist sie gleich neben den Todesanzeigen. Nur teure Altersheime inserieren übrigens. Die billigen sind anscheinend sowieso voll.
HAUS ABENDSONNE
Seniorenwohnanlage.
Genießen Sie die letzten Jahre auf der Sonnenseite des Lebens.
Wir verbinden Pflege und Service mit Lebensfreude im Herzen Frankfurts.
Für Anfragen stehen wir telefonisch oder persönlich gerne zur Verfügung.
Lebensfreude. Ich lese nun schon seit vielen Jahren Anzeigen von Seniorenstiften, und dieses Wort kommt selten in Verbindung mit Altenpflege vor. Sonst erfährt man ja nicht viel aus dem Text. Die meisten dieser Annoncen lesen sich wie die Werbebroschüren von Luxushotels oder ambitionierter Landschulheime. Auf jeden Fall wortreich. Diese Anzeige hingegen enthält so wenig Information, dass ich mich fast ärgere. Ich blättere ein bisschen vor und zurück. Dann kommt Berta, und ich lege die Zeitung auf den Stapel mit dem Altpapier.
Am nächsten Tag sehe ich die Anzeige wieder, an der gleichen Stelle. Jeden Tag ist sie da und verspricht einen Platz an der Sonne und ein bisschen Spaß, während es eigentlich Februar ist und das Wetter so scheußlich, dass weder Berta noch ich Lust haben, vor die Türe zu gehen. Arm in Arm stemmen wir uns gegen den eisigen Wind, der mit Schnee und Regen vermischt ist, und warten auf bessere Zeiten. Für meine Knie sind die Kälte und die Nässe Gift. Sie schwellen an und werden rot und entzündet. Morgens kann ich kaum aufstehen, und ich muss Berta bitten, dass sie mir mit den Strümpfen hilft. Berta tut es, natürlich, aber mit einer so säuerlichen Miene, dass ich den Rest des Vormittages böse auf sie bin. Außerdem ist sie so grob, dass sie mir weh tut.
»Stell dich nicht so an!«, sagt sie nur.
Immerhin kocht sie heute Mittagessen, Karotten und Kartoffeln in weißer Soße, das mag ich besonders gerne. In unserer Familie kommen Kapern in die Soße, die sind das Beste. Danach legt Berta sich wie immer hin, während ich mühsam auf meinen schmerzenden Knien durch die Küche tappe und aufräume, nur das Nötigste. Schon seit Wochen nur noch das Nötigste. Müde setze ich mich an den Küchentisch und schlage die Zeitung auf.
HAUS ABENDSONNE
Die Anzeige springt mir ins Gesicht, als wäre die restliche Zeitung lediglich gedruckt worden, um diese eine Annonce ins rechte Licht zu rücken. Seniorenwohnanlage. Wer sich solche Worte nur immer ausdenkt. Berta schnarcht. Sie ist nachts wieder wegen mir auf gewesen. Wir schlafen beide kaum noch eine Nacht durch. Ich stelle mir vor, wie angenehm es sein muss, einfach an einer Klingelschnur zu ziehen, und umgehend erscheint eine verständnisvolle, weißgekleidete Person, die faktisch dafür bezahlt wird, dass sie die ganze Nacht wach bleibt, nur um einer Seniorin wie mir beim Wohnen zu helfen.
So leise ich kann, schleiche ich in den Flur und hole das Telefon. Das Kabel reicht so gerade um die Ecke in die Küche, und die Türe lässt sich nur anlehnen.
»Berburg«, flüstere ich deswegen, als eine freundliche Stimme sich mit »Haus Abendsonne. Hier spricht Jasmin Müller. Kann ich etwas für Sie tun?« am anderen Ende meldet.
»Vielleicht sprechen Sie ein kleines bisschen lauter? Ich kann Sie nur schwer verstehen.«
»Mein Name ist Berburg.«
»Ja, Frau Berburg. Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ich habe Ihre Anzeige in der Frankfurter Rundschau gelesen, und da …«
»Und da wollten Sie mehr über uns erfahren.«
»Nein. Ich will wissen, was es kostet.« Ich kann es nicht leiden, wenn man mich unterbricht.
Fräulein Müller nennt sanft einen unglaublichen Betrag. »Da ist aber alles inklusive«, fügt sie auf mein ungläubiges Schweigen hinzu.
»Geben Sie Mengenrabatt?«, frage ich nach einer Weile.
»Wie meinen Sie das?«
»Ich meine Mengenrabatt. Unter Umständen wären wir zu zweit.«
»Im selben Zimmer?«
»Natürlich nicht.«
Fräulein Müller bleibt unbeirrbar höflich. Offensichtlich hat sie Erfahrung mit unfreundlichen Anrufern. Ich bewundere sie ein bisschen, schließlich habe auch ich jahrelang das Telefon bedient und alle möglichen Leute dran gehabt. Gleichzeitig geht sie mir auf die Nerven, denn ich habe den Verdacht, dass sie mich nicht ernst nimmt.
»In diesem Fall können wir leider nichts nachlassen. Das tut mir leid«, sagt sie auf ihre angenehme Art. »Aber Sie müssen bedenken, dass ich Ihnen den Preis für die höchste Pflegestufe genannt habe. Brauchen Sie weniger Hilfe, sind die Kosten etwas geringer. Vielleicht möchten Sie ja einmal bei uns vorbeikommen und sich alles ansehen? Wir liegen ganz zentral, direkt in der Nähe des Palmengartens und des Grüneburgparks.«
Was bilden Sie sich denn ein, möchte ich sagen, ich telefoniere heimlich in der Küche. Meinen Sie, ich kann bis ins Westend fahren, um weiter mit Ihnen zu plaudern? Stattdessen antworte ich nur steif: »Nein, ich glaube nicht, dass sich das einrichten lässt.«
»Nun, in diesem Fall darf ich mir vielleicht Ihre Adresse notieren?« So leicht gibt Fräulein Müller nicht auf. »Ihren Namen weiß ich ja schon. Berburg, nicht wahr? Mit e oder ä? Und die Telefonnummer sehe ich hier auf dem Display. Wenn Sie mir gerade noch Straße und Hausnummer sagen? Dann kann ich Ihnen unsere Informationsbroschüre schicken. Und wir können Kontakt aufnehmen, falls wir Vakanzen haben.«
»Die Adresse ist Paul-Ehrlich-Straße Nummer …«
In diesem Augenblick merke ich, dass Berta hinter mir steht, und mitten im Satz lasse ich den Hörer auf die Gabel fallen.
Kapitel 2
Ruth
Rotweinmarinierte Damen um die fünfzig.
Das sagt mein Mann immer, wenn er uns von den Betriebsfesten zurückkommen sieht: eine Busladung voll älterer, etwas abgehalfterter Krankenschwestern und Pflegeassistentinnen, die den Abend über eifrig getrunken haben. Und dazu Ruben aus Sri Lanka, der auch schon seit den Neunzigern in Norwegen lebt, der einzige Mann auf diesen Festen und auch der Einzige, der keinen Alkohol trinkt. Ich frage mich, was er wohl denken mag über die westliche Zivilisation.
Zweimal im Jahr, einmal im Sommer und einmal in der Vorweihnachtszeit, spendiert uns die Betriebsleitung des Altersheimes, in dem ich arbeite, eine »Fahrt ins Blaue«, soll heißen, eine Bustour in die Umgegend von Brattesund. Wohin es genau geht, bleibt bis zum letzten Augenblick eine Überraschung. So sehr viel Auswahl gibt es allerdings gar nicht, und an den meisten Orten, die für so ein Fest in Frage kommen, bin ich in den letzten Jahren schon mehrmals gewesen. Brattesund hat gerade mal vierzigtausend Einwohner, und im Hinterland wird es schnell einsam. Häufig fahren wir mit dem Bus einfach ein bisschen durch die Gegend, nur um letztendlich zurück in die Stadt zu kommen. Aber die Busfahrten gehören dazu. Aufgebrezelt und in festlicher Stimmung steigen wir am späten Nachmittag in den Bus, alle haben Tüten und Taschen dabei, in denen es verheißungsvoll klirrt. Bis wir wieder aussteigen, sind die Ersten bereits betrunken. Und das ist nur der Anfang.
Martin und ich leben seit bald zwanzig Jahren in Brattesund, doch an den norwegischen Umgang mit Alkohol haben wir uns nie gewöhnen können. Alkohol ist ungeheuer wichtig, es wird ständig darüber geredet. Nur trinken darf man ihn nicht. Außer es ist Wochenende oder ein Fest, oder man ist im Ausland. Dann aber gibt es kein Halten. Selbst Leute in unserem Alter erzählen am nächsten Morgen stolz von ihrem Filmriss. Dass man keine Erinnerung an den gestrigen Abend hat, ist der ultimative Beweis dafür, dass es lustig war. Letztes Jahr hatte es aus irgendeinem Grund mit der Weihnachtsfeier vor Weihnachten nicht mehr geklappt, und deswegen war die Tour ins Blaue auf den Februar verschoben worden. Ich bin erst in den frühen Morgenstunden nach Hause gekommen, und jetzt sitze ich mit Kopfschmerzen und leichter Übelkeit in der Küche, froh, dass Martin Wochenenddienst hat und Martha und Helene ein Seminar mit ihrer Blaskapelle. Ich habe das Haus für mich alleine, bis auf den Hund, der auf seinen Spaziergang lauert.
Blaskapellen sind übrigens auch so etwas typisch Norwegisches. Jede Schule hat ihre eigene, und zum Nationalfeiertag am 17. Mai marschieren unsere Töchter musizierend und in Uniform durch die Straßen. Wer hätte das gedacht, als wir damals nach Brattesund kamen – Martin, weil er in Deutschland als Arzt keine Stelle fand, und ich aus Liebe zu Martin. Wir beide führen übrigens die klassische Arzt-Krankenschwester-Ehe: Martin arbeitet viel, er ist inzwischen leitender Oberarzt in der Chirurgie, und ich habe eine Teilzeitstelle im Altersheim, wegen der Kinder und weil irgendjemand ja auch den Haushalt machen muss. Anfangs dachten wir, dass wir nur ein paar Jahre bleiben würden, bis Martin den Facharzt hatte, zum Beispiel. Aber das Leben in Norwegen ist einfach. Natürlich ist Brattesund tiefste Provinz, aber wenn man zwei kleine Kinder hat, ist das gar nicht so unpraktisch. Zum Kindergarten: drei Minuten. Zur Schule: fünf Minuten. Krankenhaus: mit dem Fahrrad problemlos erreichbar.
Und unter dem Strich arbeiten wir hier weniger für mehr Geld. Der Ölreichtum gibt dem Land etwas wunderbar Entspanntes, und selbst wenn das Öl irgendwann zur Neige gehen wird, ist das ein Thema, über das die Norweger, im Gegensatz zum Alkohol, nur ungern reden. Außerdem könnte ich mich, ehrlich gesagt, nicht mehr daran gewöhnen, bei der Arbeit so oft angeschnauzt zu werden wie in Deutschland.
Das war die größte und die angenehmste Überraschung bei unserem Umzug. Zum ersten Mal wurde ich mit Respekt behandelt. Schließlich bin ich Krankenschwester und damit ein wertvolles Mitglied des Teams. In Norwegen redet man so viel über Teamarbeit, dass es schon wieder lästig wird, aber immerhin habe ich noch nie erlebt, dass sich ein Arzt einfach umdreht, während ich noch mitten im Satz bin. Für all das nehme ich den vielen Regen hier an der Westküste und die Eigenartigkeiten der Norweger in Kauf – mal mehr, mal weniger leichten Herzens.
Das Telefon schrillt. Ich zucke zusammen, stoße beinahe meinen Kaffee um, finde das Telefon zwischen den Zeitungen auf dem Küchentisch und halte es vorsichtshalber ein Stück weit von meinem Ohr entfernt. Wahrscheinlich ist das meine Mutter, und die spricht immer so laut. Aber die Stimme am anderen Ende ist klein und zaghaft.
»Ruth?«, fragt jemand.
»Ja?«
»Hier ist Onkel Detlef.«
Onkel Detlef ist der jüngere Bruder meines Vaters und der Einzige, der es wirklich zu etwas gebracht hat. In den siebziger und achtziger Jahren hat er als niedergelassener Kardiologe jede Menge Geld verdient, und vor fünfzehn Jahren, in einem Alter, in dem die meisten nur noch an den Ruhestand denken, hat er noch einmal alles investiert und ein Altersheim im Frankfurter Westend eröffnet. Beste Lage, Einrichtung wie in einem schicken Hotel, finanzkräftige Kunden: Das Ding ist eine Goldgrube, und es heißt natürlich auch nicht Altersheim, sondern Seniorenwohnanlage. Onkel Detlef hat nie geheiratet und, soweit wir wissen, keine Kinder. Warum er sein Leben lang allein geblieben ist, das weiß ich nicht. Ich würde nie auf die Idee kommen, ihn danach zu fragen. Onkel Detlef ist kein Mensch, der zu Vertraulichkeiten einlädt. Selbst sein Alter ist ein heikles Thema. Er ist jetzt siebenundsiebzig und tut viel dafür, zehn Jahre jünger auszusehen. Nach wie vor leitet er sein Altersheim, Haus Abendsonne, das will er sich auf keinen Fall nehmen lassen. Wenigstens hat er vor einigen Jahren die medizinische Leitung an eine Ärztin abgegeben, eine Frau Dr. Ziegler, von der er in den höchsten Tönen schwärmt.
Onkel Detlef hatte immer schon einen Auserwählten an seiner Seite, jemanden, der ihm eine »absolute Stütze« war oder ein »ganz prima Kerl« oder eine »echte Perle«, bis es plötzlich vorbei war und der Name nie wieder erwähnt wurde. Derzeit ist das offensichtlich diese Ärztin. Von seinen eigenen Verwandten ist mein Onkel leider weniger begeistert, gelegentliche Familienfeste sind ihm Nähe genug. Dies ist das erste Mal in meinem Leben, dass er mich anruft. Ich frage mich, woher er überhaupt die Nummer hat.
»Ruth«, sagt er, »ich binnim Krangenhaus.«
»Was?«, krächze ich. Meine Stimme ist immer noch vom Alkohol belegt. »Du bist im Krankenhaus? Warum?«
»Gessern … ich hatte einen Schalk… ein Schaf… einen Anfall. Meine rechte … mein Handel … Händel … Hemd … Sprechen ist auch weg … Ganz furchba…, Ruth.«
»Was meinst du? Hattest du etwa einen Schlaganfall? Gestern?«
»Ja. Händel… Hemd … Hand … Hand! Hand!«
»Beruhige dich, sonst komme ich ja gar nicht mit. Also, du hattest gestern einen Schlaganfall, und jetzt ist die eine Hand gelähmt, und du kannst nicht richtig sprechen?«
»Gans furchba, Ruth, gans furchba.«
»Ja, das ist natürlich furchtbar. Du Ärmster. Aber das mit dem Sprechen ist gar nicht so schlimm. Ich verstehe doch, was du sagst.« Ich versuche, zuversichtlich zu klingen. »Wie ist es denn mit der Lähmung? Kannst du gehen?«
»Gans furchba, Ruth! Konne …« Onkel Detlef schluckt ein paar Mal. Es hört sich an, als würde er mit den Tränen kämpfen. Dann holt er tief Luft und beginnt noch einmal: »Erst konnte ich gar nicht laufen«, sagt er. Die Worte kommen langsam, so als müsste er nach jedem einzelnen suchen, aber sie sind jetzt deutlicher artikuliert. »Aber seit heute Morgen geht es wieder. War schon auf dem … dem Klo. Auch die … Hand. Viel besser.«
»Gott sei Dank. Das hört sich doch schon sehr gut an. Du musst nur richtig trainieren, dann wird das sicher noch viel besser. Wahrscheinlich bist du in ein paar Wochen wieder ganz der Alte. Du bist doch Privatpatient. Und in Deutschland gibt es so gute Rehabilitationseinrichtungen. Wenn du willst, kann ich …«
»Nein!«
»Schon gut. Wenn du nicht willst, muss ich mich da nicht einmischen. Organisiert das Krankenhaus die Reha für dich? Das ist natürlich das Beste. Die haben bestimmt eine Klinik, mit der sie …«
»Keine Reha! Ich will da nicht hin!«
»Onkel Detlef, sei nicht kindisch. Du brauchst Physiotherapie und Ergotherapie und Logopädie und auch ein bisschen Pflege, damit du wieder auf die Beine kommst. So kannst du doch nicht nach Hause.«
Aber da ist nichts zu machen. Onkel Detlef will nicht. Auf keinen Fall will er ins Pflegeheim. Er hat selber ein Heim, sagt er, er weiß, wie es da ist. Nicht einmal für ein paar Wochen will er dahin. Nein! Nicht einmal, um wieder ganz gesund zu werden. Das Krankenhaus ist schon schlimm genug. Man ist ja gar kein Mensch hier, nur ein Schaf … ein Schalk … ein Anfall eben. Ach, ich weiß schon, was er meint, der Schlaganfall von Zimmer Fünfzehn, Gott sei Dank ein Einzelzimmer, aber er zahlt ja auch genug, will er sagen.
Was mein Onkel möchte, ist Folgendes: Ich soll nach Frankfurt kommen und ihm ein bisschen unter die Arme greifen, das Anziehen klappt nicht recht alleine, und er kleckert beim Essen. Wenn ich ihm dabei helfe, kann er tagsüber zu seinen Physio- und Ergo- und Logo-Dings. Aber fremde Leute im Haus, das will er nicht. Das geht über seine Kräfte. Ich muss kommen. Ich muss!
Dann kann er die Tränen nicht mehr zurückhalten.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kenne Onkel Detlef nur im Anzug und mit Einstecktuch in der Brusttasche. Jetzt weint er plötzlich am Telefon und will, dass ich ihm bei der Toilette helfe. Wäre es nicht für alle Beteiligten einfacher, er nähme sich eine bezahlte Pflegekraft? Jemanden, der hinterher wieder aus seinem Leben verschwindet? Dazu habe ich Kopfschmerzen und dieses gläserne Gefühl, das immer kommt, wenn ich kaum geschlafen habe.
»Onkel Detlef«, versuche ich es noch einmal, »sei doch vernünftig.«
Doch mein Onkel steigert sich nur mehr und mehr in seine Verzweiflung hinein, und seine Sprache gerät wieder völlig aus den Fugen. »So ein Schaf!«, ruft er in den Hörer. Offensichtlich meint er seinen Schlaganfall. »So ein Schaf! Lieber tot! Ganz furchtbar, Ruth, ganz furchtbar!«
»Kann ich dich vielleicht zurückrufen? Sag mir deine Nummer! Oder noch besser: Sag mir, in welchem Krankenhaus du bist. Das ist einfacher.«
Es ist hoffnungslos. Der Onkel wiederholt nur immer wieder: »Ein Schaf. Ganz furchtbar.«
Schließlich halte ich es nicht mehr aus. »Also gut, ich komme!«, rufe ich in sein Klagen und lege schnell auf.
Die plötzliche Stille tut meinen Kopfschmerzen gut. Gott, was für ein Tag. Ich schleppe mich zur Wohnzimmercouch. Jetzt ist mir wirklich schlecht. Harald, der Hund, winselt und wedelt auffordernd mit dem Schwanz. Wollten wir nicht spazieren gehen?
»Nein!«, sage ich energisch, und mit einem resignierten Seufzer legt sich auch Harald hin. So hätte ich es auch mit dem Onkel machen sollen: Willensstärke. Aktion statt Reaktion. Lernen Sie, nein zu sagen. Doch das ist gar nicht so einfach, wenn man einen Helferberuf hat. Nicht nur, dass alle immer fragen. Nein, man hilft doch auch gern und erst recht in der eigenen Familie. Ich drehe dem wartenden Hund den Rücken zu und versuche einzuschlafen. Aber ich finde keine Ruhe. Haralds Blick hypnotisiert meine Hinterseite. Ab und zu fiept er.
Ach, was soll’s. Wahrscheinlich tut mir ein Spaziergang sogar gut.
Winter an der norwegischen Westküste sind leider eine Enttäuschung. Obwohl wir so weit im Norden leben, fällt kaum Schnee. Das liegt am Meer und am Golfstrom. Dafür haben wir jede Menge Glatteis, vor allem morgens, ehe die Temperaturen tagsüber wieder auf zwei, drei Grad über null klettern. In manchen Jahren hat es auch schon von August bis Februar durchgehend geregnet. Nur ganz selten gibt es langen und harten Frost, dann kann man auf den umliegenden Seen Schlittschuh laufen. Doch dieser Winter war bislang eher mild. Es ist Anfang Februar, und alles, was einmal grün war, ist inzwischen braun und matschig. Um diese Zeit im Jahr kann ich immer gar nicht glauben, dass es wirklich wieder Frühling werden wird.
In dem frischen Westwind fällt der Regen fast waagerecht und klatscht mir um die Ohren. Trotzdem ist es schön. Brattesund heißt übersetzt so etwas wie »Steile Meerenge«, denn der Ort liegt auf zwei Hügeln, die steil ins Meer abfallen und durch eine Brücke (Brattesundbru natürlich) miteinander verbunden sind. Von fast überall hat man einen atemberaubenden Blick aufs Meer. Wenn man es nass, kalt und windig mag, ist dies wirklich der beste Platz der Erde. Wenn man schnell friert, so wie ich, bleibt einem immer noch die Aussicht.
Bei dem schlechten Wetter heute sind außer mir nur andere Hundebesitzer und ein paar Eltern mit Kinderwagen unterwegs. Harald jagt vergnügt die Möwen, die die Klippen entlangsegeln und in den starken Windböen vom Kurs abkommen. Mit vollem Namen heißt er Harald Schönhaar, weil er so blond und so behaart ist wie der erste norwegische König seinerzeit, aber wir rufen ihn nur Harald. Sein schönes Haar findet sich übrigens überall in der Wohnung wieder, vor allem im Frühjahr, wenn er den Winterpelz verliert. Aber er ist so ein freundliches Tier, und er würde mich mit seinem Leben verteidigen. Nehme ich zumindest an. Hoffe ich.