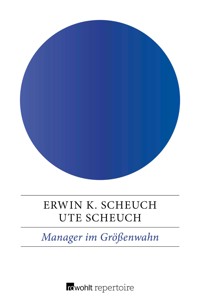
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Peanuts», Pleiten und «Nieten in Nadelstreifen» Firmenpleiten im großen Stil und der Absturz des Neuen Marktes führen uns drastisch vor Augen: In der Wirtschaft geht es keineswegs nur rational, berechenbar und kontrolliert zu. Die ökonomische Realität wird von denselben vielfältigen Motiven und Risiken geprägt wie das Leben selbst. Erwin K. und Ute Scheuch verfolgen hier weiter, was sich bereits 2001 beim Erscheinen ihres Hardcover-Titels «Deutsche Pleiten» andeutete: das absehbare Ende des größten Baukonzerns in Deutschland, Holzmann, oder die überfällige Entlassung des Telekom-Chefs Ron Sommer. An das Wirken der berühmten «unsichtbaren Hand» glauben sie nicht und schauen lieber nach, wer jeweils die Finger im Spiel hat und welche Einflüsse das Scheitern begünstigen: von der Macht der Banken und der Politik über Management-Moden, Fehlentscheidungen und verschlafene Entwicklungen bis hin zu Eitelkeit und kriminellen Energien der so genannten «Nieten in Nadelstreifen».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Erwin K. Scheuch • Ute Scheuch
Manager im Größenwahn
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Firmenpleiten im großen Stil und der Absturz des Neuen Marktes führen uns drastisch vor Augen: In der Wirtschaft geht es keineswegs nur rational, berechenbar und kontrolliert zu. Die ökonomische Realität wird von denselben vielfältigen Motiven und Risiken geprägt wie das Leben selbst. Erwin K. und Ute Scheuch verfolgen hier weiter, was sich bereits 2001 beim Erscheinen ihres Hardcover-Titels «Deutsche Pleiten» andeutete: das absehbare Ende des größten Baukonzerns in Deutschland, Holzmann, oder die überfällige Entlassung des Telekom-Chefs Ron Sommer.
Über Erwin K. Scheuch • Ute Scheuch
Ute Scheuch, Jahrgang 1943; Medienwissenschaftlerin bei der Deutschen Welle (bis 1998), Promotion in Soziologie an der Universität Köln, leitende Mitarbeiterin in verschiedenen Projekten der empirischen Sozialforschung.
Erwin K. Scheuch, Jahrgang 1928; war Direktor der Kölner Gesellschaft für Sozialforschung und Präsident des Institut International de Sociologie, ab 1965 Professor für Soziologie in Köln; bis zur Emeritierung zusätzlich Direktor von drei Instituten.
Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a. «Die Spendenkrise – Parteien außer Kontrolle».
Inhaltsübersicht
Vorwort zur Taschenausgabe
Dies ist die aktualisierte Fassung eines Buches, das im Herbst 2001 mit festem Einband unter dem Titel «Deutsche Pleiten. Manager im Größen-Wahn oder der irrationale Faktor» erschien. Eine Überarbeitung war kaum notwendig, weil wir im Wesentlichen nichts umschreiben mußten. Wir konnten fortsetzen und akzentuieren, was zum Zeitpunkt der Entstehung des Manuskriptes erst in Umrissen erkennbar war. So wurde aus der früheren Unterzeile der jetzige Titel des Buches.
2002 sind solche Entwicklungen offenbar geworden wie die absehbare Pleite des größten Baukonzerns in Deutschland, Holzmann, oder die längst fällige Entlassung des Telekom-Chefs Ron Sommer. Das Fiasko des erhitzten Neuen Marktes wurde am 26. September 2002 auch offiziell von der Deutschen Börse eingestanden – mit den Phantasiepreisen, die Mobilcom-Gründer Manfred Schmid bei der Ersteigerung der UMTS-Lizenzen versprach. Jetzt wissen wir von den Luftgeschäften des Telematik-Anbieters Comroad, der im Jahre 2000 97 Prozent (!) seines Umsatzes mit einem nicht existierenden Unternehmen in Hongkong getürkt hatte, ohne dass seine Wirtschaftsprüfer von KPMG es bemerkt hätten. Dieser Skandal dürfte noch die Potemkin’schen Dörfer von Flowtex in Schwaben übertreffen. Die Liste der Pleiten ließe sich beliebig verlängern, doch das Strickmuster ist stets ähnlich den Vorgehensweisen von «Managern im Größenwahn», die wir in der ersten Auflage kennzeichneten.
Gemeinsam mit dem Rowohlt Verlag haben wir die damalige Unterzeile «Manager im Größenwahn» nun als Titel gewählt, weil sie verdeutlicht, was inzwischen klarer wurde: wie sehr in den Spitzenetagen der Wirtschaft unternehmerische Entscheidungen zu Hasard-Spielen wurden. Hinzu kommt noch ein Ausmaß an Betrügereien einschließlich von Bilanzfälschungen und Falschtestaten von Wirtschaftsprüfern, das in den letzten Jahren und insbesondere bei der vormals bestaunten amerikanischen Wirtschaft im großen Stil eingerissen ist – auch bei Weltfirmen. In Amerika sind wie bei uns Spitzen der Politik in Schmutzgeschäfte mitverwickelt. All dies ist in Amerika gewaltiger als bei uns, aber wir sind ja auch ein weniger gewaltiges Land.
Dass eine Aktualisierung unserer ersten Ausgabe ausreichte und kein größeres Umschreiben nötig war, ist Grund zur Sorge. Das Buch bringt offensichtlich keine Momentaufnahme, sondern dokumentiert einen Trend, der so nicht weitergehen darf.
«Casino-Kapitalismus» nennen Kritiker in den USA inzwischen diesen Stil des Wirtschaftens, der bei uns und in anderen wohlhabenden Ländern die Chefetagen angesteckt hat. Mit sozialer Marktwirtschaft hat der Shareholder-Value – Glücksspielkapitalismus nichts zu tun.
Die Insolvenz des Kirch-Imperiums führt der Wirtschaftspsychologe Professor Dieter Frey auf vier einfache Lehrsätze zurück, an denen sichtbar wird, wie wenig ökonomische Modelle über das Handeln an den Spitzen von Großunternehmen aussagen.
Satz 1 stammt vom Börsenguru André Kostolany: «Wer beim ersten Mal gewinnt, der hat für immer verloren.» Frühe Gewinne führten Leo Kirch zur Unterschätzung der Gefahren.
Satz 2 ist das Streben nach Einmütigkeit in Führungscliquen. Wer da die Sicherheit stiftende Übereinstimmung stört, der wird weggebissen.
Satz 3: Wenn man sich einmal festgelegt hat, wird es schwierig, die getroffenen Grundsatzentscheidungen aufzugeben, auch wenn ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende wäre.
Satz 4: Wenn die Pleite offenbar ist, haben viele es schon immer so gewusst. Dann lässt sich statt einer Analyse das Missgeschick der Pleite leichter ertragen, indem Sündenböcke aufgespürt werden.
Gelegentliche Fehlverläufe sind normal. Katastrophal wird es, wenn sich an der Spitze eines größeren Unternehmens zusätzlich Spielermentalität durchsetzt. Die neuen Manager in Amerika und ihre Kopien in deutschen Firmen vergleichen sich mit den harten Burschen der Filmwelt und werden darin durch häufige eigene Medienpräsenz gestärkt. Nicht selten schlittern diese Machos dann in die Kriminalität ab. In den USA haben Politiker und Juristen durch Gesetzesänderungen und Rechtsprechung in den neunziger Jahren darüber hinaus dafür gesorgt, dass Betrügereien zulasten der Öffentlichkeit meist straffrei bleiben dürften. Zurück bleiben geplünderte Investoren und Heere von Arbeitslosen.
Wirtschaft ist, insbesondere in ihren Entscheidungsverläufen bei sehr großen Unternehmen, menschlich spannender, als es für den Wirtschaftserfolg gut ist. Und viel gefährlicher für uns alle, als uns gewärtig ist.
Wie rational ist unsere Wirtschaft? – Eine Einleitung
In der Wirtschaft sind solche Fehlentscheidungen, wie sie in der Politik oder im Kulturbetrieb alltäglich sind, die große Ausnahme. Denn im Wirtschaftsleben geht es kontrolliert zu. –
Ist das wirklich so? Wie aber lassen sich die großen Pleiten der deutschen Nachkriegsgeschichte von Borgward bis Herstatt, von co op bis Vulkan, von Schneider bis Holzmann erklären? Wie kommt es, dass monomanische Manager, überforderte Strategen oder sorglose Banker so lange an großen Rädern drehen können, bis alles zu spät ist?
Wirtschaftsführer selber, aber auch Wirtschaftsjournalisten weben an dem Sonntagsbild: In der Wirtschaft wird kühl kalkuliert. Der Gewinn – oder Verlust – sind objektive Maßstäbe für das Handeln. Insbesondere in Großbetrieben geht es rational zu. Von ausgefeilten Managementtechniken bis zum umfassenden Controlling werden Entscheidungen und Abläufe einer ständigen Überprüfung unterzogen. Da bleibt kein Raum für Willkür und Privatstrategien. –
Wirklich nicht? Wie ist es möglich, dass über die Hälfte aller Großfusionen ökonomisch scheitert? Welche wirtschaftliche Vernunft stand hinter dem BMW-Rover-Deal? Warum gingen Deutsche und Dresdner Bank das unkalkulierbare Risiko einer Elefantenhochzeit ein, die im Fiasko endete?
Solche Pleiten lösen Gegenbilder aus mit Überzeichnungen wie «Nieten in Nadelstreifen». Selbstverständlich ist ein Großteil aller Entscheidungen auf der Führungsebene großer Unternehmungen wirtschaftlich sinnvoll – aber andere eben nicht. Und angesichts der blitzartigen Wucht, mit der die Folgen von Misswirtschaft in und durch große Unternehmen heute in der Wirtschaftslandschaft einschlagen, beruhigt es nicht wirklich, dass der entstandene Flurschaden am Ende das Ganze nicht existenziell gefährdet.
Wir werden zeigen, dass und warum Wirtschaften oft nicht an eindeutigen Maßstäben orientiert sein kann, woraus sich dann auch Fehlentscheidungen ergeben – die wenigstens im Nachhinein als solche deutlich werden. Wirtschaftstheorie wird oft so wahrgenommen, als finde das Handeln der Akteure gleichsam unabhängig von Raum und Zeit statt, in einem Modell-Universum jenseits des sonst in unserem Alltag üblichen sozialen Verhaltens.
Hier wird das Gegenteil betont. Wir werden die Geschichte wichtiger deutscher Unternehmenspleiten erzählen, ihre Entwicklung, Abläufe, Hintergründe und Folgen. Eine Pleite muss nicht immer das Ende eines Unternehmens sein. Sie kann auch einen Erneuerungsprozess einleiten oder, auf einer höheren Ebene, Indikator grundlegenden Wandels des Wirtschaftens sein. Sie ist aber immer der Höhepunkt einer Entwicklung, an der wichtige, widerstreitende Akteure mitgewirkt haben, die für Dramatik sorgen: durch ihre Entscheidungen und die Motive, die zu ihnen führten – rationale Motive ebenso wie, überraschend oft, irrationale; ökonomische ebenso wie politische oder persönlich-private. Akteure von unterschiedlichem Charakter: Charismatiker oder Apparatschiks, Verantwortungsbewusste, Vorsichtige, Zauderer, Draufgänger, Eitle oder sogar Größenwahnsinnige.
Und sie bieten eben Stoff für dramatische «Geschichten», aus denen mehr gelernt werden kann als nur, dass in ihnen «Nieten in Nadelstreifen» am Werk waren, nämlich insgesamt etwas über die «Logik des Misslingens» dort, wo die großen Räder im Wirtschaftsleben gedreht werden. Sie sind zugleich ein Spiegel der bundesrepublikanischen Nachkriegs- und dann Vereinigungsgeschichte, Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels: das vermeidbare Scheitern großer Unternehmerpersönlichkeiten wie Carl Borgward, der letztlich ein frühes Opfer von Banken, Sanierern und Politikern wurde, das klägliche Scheitern von Kollegialvorständen an falschen Strategien oder Visionen wie bei AEG und Holzmann ebenso wie der ruhmlose Untergang im Strudel der Globalisierung einer Vielzahl von Internetunternehmen des Neuen Marktes. Einige Pleiten haben selbst die Gesellschaft verändert oder auf besondere Weise Geschichte gemacht wie der Zusammenbruch der Herstatt-Bank oder die Pleiten der Neuen Heimat und anschließend der co op, die das Ende des Genossenschaftsgedankens als Alternative des Wirtschaftens bedeuteten.
Schaut man genauer hin, so kann man sehen, dass es Arten von Managementfehlern gibt, die landesüblich und zeittypisch sind. In der Aufbruchs- und Goldgräberstimmung der neunziger Jahre gab es in Deutschland andere und zugleich häufigere Pleiten als in den frühen sechziger Jahren – als das Scheitern von Unternehmen oft in einem zu schnellen Wachstum nach der Kriegskatastrophe und mangelnden Eigenmitteln begründet war – und den siebziger bzw. achtziger Jahren, in denen sich der spätere Größen-Wahn zum ausgehenden Jahrhundert in ersten Konturen abzeichnete: das Anwachsen von Unternehmen und Gruppen zu immer gigantischeren Gebilden. Herstatt war ein erster Vorläufer der späteren Massenhysterie am Neuen Markt.
«Deutsche» Pleiten meint also: Die hier geschilderten Vorgänge haben die deutsche Wirtschaftsidentität berührt – durch ihre Besonderheiten, ihre Folgen oder ihre schiere Größe viele Menschen in unterschiedlicher Weise betroffen. Sie haben auch dazu beigetragen, diese Identität, den Bürgerstolz auf Wirtschaftswunder, Deutsche Mark und «deutsche Wertarbeit» zugunsten internationalerer Vorstellungen abzubauen. Identitätsformeln der fünfziger, sechziger und siebziger Jahre wie «Made in Germany» oder eben die «gute Deutsche Mark» büßen ihre Zauberkraft ein.
«Deutsche» Pleiten heißt auch, wenn auch nicht immer: Sie ereigneten sich, weil Faktoren eine Rolle spielten, die gerade den «Standort Deutschland» präg(t)en, zum Beispiel die Macht des (Universal-)Bankensystems oder die (Subventions-)Politik, etwa durch die Treuhand-Wirtschaft. In einigen Fällen heißt es, dass sie Ergebnis der Besonderheiten deutscher Geschichte sind. Und schließlich bedeutet «deutsche» Pleiten auch, dass eine Reihe von ihnen von Skandalen umwittert waren, die die Republik bewegten, wie der Fall Jürgen Schneider.
Uns geht es nicht um eine Art «Pleiten-Lexikon»; vielmehr haben wir eine Reihe gleichsam exemplarischer Fälle herausgesucht, die in etwa eine chronologische Abfolge bilden: Ihre Zahl ist klein genug, um tatsächlich ihre Geschichte nachzuzeichnen, und die ausgewählten Zusammenbrüche verdeutlichen dennoch in besonderer Weise das Umfeld, in das «deutsche» Pleiten eingebettet sind:
das Irrationale/die Irrationalen in der Wirtschaft
der Einfluss der Banken
die Verfilzung der Unternehmen zur «Deutschland AG»
wechselnde Moden und Theorien (zum Beispiel von John Maynard Keynes zu Milton Friedman, vom Mischkonzern zum Kerngeschäft), aber auch
verschlafene Entwicklungen (wie bei der AEG) und nicht zuletzt
der Einfluss der Politik.
Im 19. Jahrhundert wurden Entscheidungen durch Eigentümer-Unternehmer auf patriarchalische Art aus dem Bauch heraus getroffen. Persönliche Eitelkeiten und hemmungsloses Gewinnstreben überlagerten nüchternes Kalkül. Ist es damit vorbei? Wird Management-Trainern und Autoren von Management-Büchern geglaubt, gibt es heute die Dominanz der wissenschaftlichen Betriebsführung. Da regiere das Controlling, die wissenschaftlich veredelte Nachfolge der Buchführung. –
Wie kommt es da zu den Klagen, in den Büros der großen Unternehmen werde die Arbeit bis hinauf zu den höchsten Rängen durch Mobbing behindert? Wie erklären sich bei all diesen Kontrollen jahrelange Betrügereien wie bei Opel und Ford oder Fälschungen wie bei VW? Korruption und Schmiergeld gehören bei Unternehmen so sehr zum Alltagshandeln, dass die Aufwendungen hierfür von der Steuer absetzbar waren; inzwischen ist dies wenigstens auf Auslandsgeschäfte beschränkt.
Das blinde Nachvollziehen von Moden in der Art der Unternehmensführung ist als Grund für Fehlentscheidungen im Topmanagement nicht zu unterschätzen. Und je größer die Unternehmung, umso wahrscheinlicher wird, dass sich Privatstrategien einzelner Manager zulasten des Firmenwohls durchsetzen. Auch auf Vorstandsebenen verselbständigen sich Machtspiele von Managern gegenüber dem Firmenzweck, wird öfters weniger gewirtschaftet als Krieg geführt, Bürgerkrieg. In den USA (nur dort) gibt es einen florierenden Literaturzweig, der diese menschlich-emotionale Seite von Unternehmensführung und betriebsinternen Abläufen zum Thema hat, die «Business Novel».
Dieses Buch sollte indessen nicht vornehmlich als Schelte solcher Zustände verstanden werden oder als Tadel von persönlichem Fehlverhalten – auch wenn es immer wieder Thema ist. Wir wollen vielmehr ein Verständnis davon vermitteln, dass Wirtschaften kulturell eingebettet ist und nicht etwa abgelöst von der eigenen Gesellschaft nur objektiven Regeln folgt.[1] Das bedeutet: Auch im Wirtschaftsleben läuft ohne «Checks and Balances» vieles aus dem Ruder. Wie in der Politik gilt auch hier: Das Führungspersonal verwendet viel Einfallsreichtum darauf, sich den Kontrollen zu entziehen. Fehlentscheidungen und individuelles Fehlverhalten sollen hier als Teil des Systems «Wirtschaft in Deutschland» und als Folge von Zeitumständen geschildert, begriffen und analysiert werden.
In der Zeit, als der Eiserne Vorhang Europa und darüber hinaus einen Großteil der Welt teilte, schien im Prinzip ausreichend, zum Verständnis von Abläufen in der Wirtschaft ihre Teile grob als «kapitalistische» und «kommunistische» Zonen zu charakterisieren. Heute richtet sich das Interesse auch in der Wissenschaft zunehmend auf die Unterschiede zwischen den verschiedenen «kapitalistischen» Ländern. «Varieties of Capitalism» (Vielfalt des Kapitalismus) ist ebenso ein Wachstumsbereich empirisch vorgehender Vergleichsforschung[2] wie die Gegenüberstellung von Wohlfahrtsystemen, mit denen die Belastungen von Marktwirtschaften sozial abgefedert werden sollen.[3] Damit wird ein Stück Realität in die Analyse von Wirtschaft zurückgeholt, das verloren gegangen war, insbesondere in der Wirtschaftstheorie.
Um die Wende zum 20. Jahrhundert hatten Sozialwissenschaftler die zentrale Stellung des Wirtschaftens als kennzeichnend für die moderne Gesellschaft erkannt. In traditionalen Gesellschaften hatte Wirtschaften eine eher dienende Bedeutung für andere Zwecke gehabt – etwa für die militärische Macht eines Fürsten oder das Wohlergehen einer Priesterkaste. Die Kulturkritik sah und sieht in dem Bedeutungszuwachs des Wirtschaftens das eigentliche Ärgernis dieser modernen Gesellschaften: Was vordem für die Aufmerksamkeit nachdenkender Zeitgenossen randseitig war, wurde jetzt – weit jenseits dessen, was fürs bloße Überleben notwendig war – zum Zentrum der Welt, in der wir uns einrichten. Die Wirtschaft war zu einem Eigenbereich geworden, für den eigene Regeln galten. In der Soziologie wird ein solcher Vorgang «Ausdifferenzierung» genannt.[4]
Nehmen Sie an, Sie kaufen einen Gebrauchtwagen und Ihnen missfällt der geforderte Preis. Der Verkäufer sieht an Ihrer Nasenspitze, dass der Deal nicht läuft. «Weil Sie es sind, mache ich Ihnen einen Freundschaftspreis», lockt deshalb der Händler. Greifen Sie «zum Freundschaftspreis» zu, sind Sie der Dumme. In der heutigen Marktwirtschaft gilt: Dem Händler müssen alle Kunden gleich sein; Freundschaftspreise gibt es eben nur zwischen Freunden – und auch da nur ausnahmsweise. Im Mittelalter galt es als Sünde, Zinsen für verliehenes Geld zu nehmen; man dürfe an der Not eines Mitmenschen nicht verdienen. Heute verstehen wir den Zins als eine Gebühr dafür, dass ein anderer mit meinem Geld arbeitet. Wirtschaftsbeziehungen sollen dem Nutzen der Beteiligten dienen – anders als Beziehungen zwischen Menschen, die sich gegenseitig verpflichtet sind. Emotionen haben ihren Platz zwischen Freunden und Verwandten, nicht in «ausdifferenzierten» Bereichen wie Wirtschaft, Justiz oder Wissenschaft. Das ist eine für moderne Gesellschaften als Kulturen zentrale Norm.
Die Verselbständigung («Ausdifferenzierung») von Teilbereichen einer Gesellschaft ist durchweg mit einer gewaltigen Steigerung ihrer Wirksamkeit verbunden: Justiz wird sachlicher und kalkulierbarer, wenn Kirche und Politiker nicht mehr hineinreden dürfen, Wissenschaft wird besser, wenn sie von Wissenschaftlern statt Bürokraten oder Kapitalbesitzern gesteuert wird. Aber in all diesen Fällen droht durch Verselbständigung auch Entartung, Entfernung vom wie auch immer dienenden Zweck für das Ganze der Gesellschaft. Berüchtigt ist der Spruch von Juristen: fiat justitia, pereat mundus (Recht werde gesprochen, auch wenn die Welt daran zugrunde geht). Das sehen Nichtjuristen selbstverständlich anders. Über Grenzen der Wissenschaft hinweg mischen sich Nichtwissenschaftler ein, wenn von Genetikern Freiheit fürs Klonen gefordert wird. Und die Hinnahme von Marktmechanismen wird zweifelhaft, wenn Manager Tausende von Arbeitsplätzen streichen und durch die danach gestiegenen Aktienkurse mit ihren Aktienoptionen zweistellige Millionengewinne verbuchen. In solchen Reaktionen werden letztlich Unterschiede zwischen Kulturen deutlich, Kulturen, die auch den Rahmen abstecken, innerhalb dessen Wirtschaft ihre Eigendynamik entfalten darf.
Wenn wir also die erwähnte (Ideal-)Norm der Gefühlskälte bei Wirtschaftsbeziehungen wirklich verinnerlicht hätten, würden wir nicht öfters Konflikte dieser Norm mit anderen uns wichtigen Werten erleben – gäbe es keinen Stoff für dieses Buch. Aber Wirtschaften findet eben auf Erden statt, wo Menschen auch ihren anderen Gefühlen und Werten folgen, wenn es die Umstände zulassen. An der Spitze großer Unternehmen gibt es mehr Bewegungsraum als in den Etagen darunter; damit Topleute ihre Fähigkeiten zeigen können, brauchen sie Spielraum.
Und den nehmen sich Manager nicht ganz selten auch so, dass ihr Handeln zum Fehlverhalten wird. Und öfters hat das keine persönlichen Nachteile. Da machte unter der Leitung des heutigen Managers von DaimlerChrysler die Hightech-Firma Dasa Verluste von über fünf Milliarden Mark, und anschließend wird Jürgen Schrempp Chef von ganz Daimler-Benz. Da glaubt der Chef von VW, durch den Kauf von Rolls-Royce in die Welt der Edelautos vorzustoßen, und merkt erst anschließend, dass der Markenname nach wie vor einem Konkurrenten gehört. Und reihenweise ist die Deutsche Bank in Milliardenpleiten involviert, ohne dass es Umbesetzungen im Vorstand gab.
Da erlaubte sich ein Bankenboss, seine Geliebte zur Kunstberaterin zu machen, die über einen Etat von jährlich ca. sechs Millionen Mark mitentschied. Ein Vorstand der gleichen Bank vermieste dieses Vertragsverhältnis. Anschließend wollte dieser Vorstand eine Großfusion auf den Weg bringen. Der gekränkte vormalige Förderer der Kunstamateurin half nach Kräften, dass die große Fusion platzte. – Wir müssen (und werden) Namen, Zeit, Ort und Summen nennen, sonst werden die schädlichen Mechanismen nicht verständlich, wird zum Beispiel nicht einsichtig, warum privater Ärger ein großes Geschäft gefährden kann.
Auf den Topetagen ist der Wunsch nach mehr Geld nicht unwichtig. Auch bei einem Jahressalär von zwei Millionen Mark und üppigen Vergünstigungen lockt die Chance auf noch mehr Geld – und sei es als äußeres Zeichen der Anerkennung, besser als andere Topmanager zu sein. Wichtiger noch aber ist auf dieser Ebene unserer Gesellschaft das Streben der Führungskräfte nach Bekanntheit und Ehren; Eitelkeit ist oft eine stärkere Antriebskraft als das Materielle. Besonders seit den neunziger Jahren ist auffällig, dass Topmanager in die Medien drängen und damit Stimmungen in der Wirtschaft machen. Auch hier erfordert Verständnis für die Vorgänge das Nennen von Konkretem.
«Ein jeder Eigenbereich ist eine Verschwörung gegen die Öffentlichkeit», sei hier in Abwandlung ein Spottwort von Max Weber zitiert. Die «soziale Marktwirtschaft» war als eine Wirtschaftsordnung erdacht, in der die Einzelentscheidungen durch Märkte gesteuert werden, Märkte ihrerseits aber nach politisch-gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen.[*] Verständlicherweise wird in der Wirtschaft immer wieder versucht, die Rahmenbedingungen zu ignorieren und Interventionen zurückzuweisen. Weniger verständlich ist, dass heutzutage Politiker und zu einem großen Teil auch Wirtschaftsjournalisten hierzu schweigen. Die Globalisierung der Wirtschaft lasse angeblich eine Steuerung von Wirtschaftsabläufen nicht mehr zu. Es wird im Verlauf dieses Buches noch deutlich, dass diese Beschwörung der Globalisierung – übrigens auch von links zu haben – überwiegend Ideologie ist, Rechtfertigung für Verhalten nach dem Bild der drei Affen: nichts sehen, nichts hören, nichts tun.[5]
Der «Verschwörungsmechanismus» eines Eigenbereichs ist bereits wirksam, wenn Fehlverhalten in der Wirtschaft entsteht, und mehr noch, wenn darauf reagiert wird. Wir wollen zeigen, dass hier teilweise Maßstäbe wirken, die man außerhalb der Wirtschaft im Grenzbereich zwischen gerade noch hinnehmbar und kriminell ansiedeln würde. Wenn das so ist, sind solche Maßstäbe zu tadeln und nicht nur Personen. Noch bei Fehlverhalten, das unter Managerkollegen tatsächlich als Fehlverhalten gilt, wirkt in Deutschland (übrigens auch in Japan und Frankreich) ein Mechanismus, der vor Kontrolle und erst recht Sanktionen schützt: Deutschland ist ein «korporatistisches Land», in dem Kollegen gegen die Außenwelt zusammenhalten, selbst wenn sie untereinander verfeindet sind. Der gleiche Mechanismus wirkt als Auslöser von Fehlverhalten und hilft, es gegen die Außenwelt abzuschirmen: in allen Lebensbereichen dieses Landes, denen ein Eigenleben zugebilligt wird, wie der Verwaltung, der Wissenschaft und bedauerlicherweise nicht zuletzt der Politik.[6] Der Korporatismus ist ein Charakteristikum Deutschlands, ohne dessen Verständnis in vielen Fällen ein Fehlverhalten von Managern und das Ausbleiben von Sanktionen nur als punktuelles Versagen gedeutet wird. Wir müssen deshalb um etwas Geduld bitten, wenn wir bisweilen kurze Ausflüge, ohne Jargon, in soziologische Denkweise unternehmen, um dergleichen verständlicher zu machen.
Fangen wir gleich damit an: Mit der Entwicklung des Wirtschaftens als Eigenbereich zu einem der Kennzeichen moderner Gesellschaften hat sich zugleich eine Mentalität verbreitet, die der große Soziologe Georg Simmel (1858–1918) «Rechenhaftigkeit» nannte. Er meinte damit ein kalkulierendes Abwägen zwischen Alternativen. Gewählt werde am Ende diejenige, die den größten Vorteil verspricht. Solche Alternativen muss es allerdings erst einmal geben; in traditionalen Gesellschaften fehlten sie für viele Situationen und Lebensbereiche. Der Klassiker Max Weber (1864–1920) sah als charakteristisch für die Moderne die Vorherrschaft von Rationalität. Angewandt auf wirtschaftliches Verhalten fällt das mit Rechenhaftigkeit zusammen.
Die Begriffe Rationalität und Rechenhaftigkeit meinen nicht nur tatsächliches Verhalten, sondern bezeichnen darüber hinaus ein kulturell vorgegebenes Deutungsmuster. Damit ist gemeint, dass im Fall einer Entscheidung zwischen Alternativen diejenige als die wirtschaftlichste gewählt wird, die den größten, nach Möglichkeit errechneten, Erfolg verspricht. Das liest sich eindeutiger, als es ist. Wird mit Erfolg der hier und heute einzufahrende Vorteil gemeint oder der größte Nutzen im Zeitablauf? Lässt sich wirklich durchweg für mehrere Beteiligte verbindlich begründen, welche Alternative den Vorzug verdient? Oft hängt der eigene Erfolg mit ab von einem Verhalten anderer, das wir häufig nicht gut voraussagen können. Entscheidungen müssen getroffen werden, auch wenn uns bewusst wird, dass unser Wissen für eine schlüssige Begründung nicht ausreicht. Vor allem muss der angestrebte Nutzen nicht immer im materiellen Vorteil bestehen; es kann auch Ruhm sein, Ansehen und in der Wirtschaft häufig auch Macht. Wäre es anders, könnte über Wirtschaft nur langweilig geschrieben werden, ja wäre Wirtschaften lediglich eine langweilige Buchhalterei.
Unternehmertum ist jedenfalls etwas anderes, bedeutet Handeln im Bewusstsein von Risiken. Der heutige Zustand der Börse ist exemplarisch dafür, dass rechenhaftes Verhalten in einem übergeordneten Sinne irrational sein kann. Es gab einmal eine Zeit, da wurde an Hochschulen gelehrt, der Wert einer Aktie folge aus der erwarteten Rendite – genauer: dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, dem «KGV». Nicht einmal die Kurse des Börsenindex Dax, erst recht aber nicht die des amerikanischen Dow-Jones lassen sich damit im Jahr 2002 noch erklären. Die Preise von Aktien liegen noch heute oberhalb dessen, was je als Rendite an Käufer ausgezahlt werden könnte. Spekuliert wird auf den Kursgewinn.
Banken setzen immer ungenierter auf Zockermentalität, wenn sie neuerdings mit einer Stückelung von ca. 10000DM «Hedgefonds-Zertifikate» anbieten. Diese Hedgefonds sind eine Mischung von gegenläufigen Spekulationen auf Kursveränderungen. Bei solchen Papieren der Dresdner oder der Deutschen Bank verheimlicht das Geldinstitut dem Anleger, für welche Papiere der Anteilsschein steht, und ein schnelles Aussteigen wird nicht erlaubt. Das Bankenwesen nähert sich hier der Seriosität von Hütchenspielern. Ist der amerikanische Casino-Kapitalismus jetzt auch bei uns hinnehmbar geworden? Noch ist es zu früh für eine Diagnose, ob inzwischen ein bleibender Wandel in der Rangfolge von Werten – etwa fort von Sicherheitsdenken hin zu Wagnisorientierungen – stattgefunden hat. Jedenfalls gibt es solche Stimmungen, ohne die manches Risikoverhalten auch in den Spitzen von Unternehmungen unverständlich bliebe.
Der Devisenmarkt ist ein extremes Beispiel für hochriskante Spekulationen, die den Kern dessen ausmachen, was Globalisierung genannt werden könnte: weltweit flottierendes Finanzkapital. Denn gerade die USA, die eine fast völlige Deregulierung der Finanzmärkte im größten Teil der Welt erzwungen haben, betreiben für die Warenwelt durchaus Schutzzoll-Politik. Heute werden an einem einzigen Tag auf den Devisenmärkten Umsätze verbucht, deren Umfang die Hälfte des Gesamtwertes aller Währungen der Erde übertreffen. Weit weniger als 20 Prozent dieser Transaktionen haben indessen etwas mit dem Kauf oder Verkauf von Waren oder Wertpapieren zu tun.
Bis zum – zumindest vorläufigen – Fehlschlag der Daimler-Benz-Fusion mit Chrysler herrschte eine regelrechte «Fusionitis», ein Streben nach Größe durch Verschmelzung von Unternehmen auch über Grenzen hinweg. Mehr als die Hälfte aller großen Fusionen haben sich bislang schon zumindest teilweise oder auch völlig als Fehlschlag erwiesen. So liegt der Börsenwert des fusionierten Unternehmens DaimlerChrysler inzwischen im Verhältnis unter den Werten vor der Fusion. Zumindest war die DaimlerChrysler-Fusion für die deutschen Manager vorteilhaft: Ihre Bezüge bewegen sich nach oben und nähern sich den Werten für die amerikanischen Manager.
Womit wir einen Fall benannt hätten, der für Entscheidungen mit mehreren Akteuren unbestimmt werden lässt, wann ein Handeln rational ist. Eindeutig ist dies nur, wenn alle Beteiligten das gleiche Ziel haben – im Jargon der Wirtschaftswissenschaften: wenn ihre Nutzenfunktionen übereinstimmen. Unterscheiden sich jedoch die Ziele bis hin zum Gegeneinander, dann wird Entscheidung zum Machtkampf, und der Prozess selbst folgt den Gesetzmäßigkeiten der Politik. Machtkämpfe in und zwischen Unternehmen sind oft sogar wesentlich farbiger als die in der Politik. Wie in der Politik auch, gehen die Folgen aber zulasten Unbeteiligter.
Die hier und heute vorherrschende Wirtschaftswissenschaft hilft zum Verständnis der vorfindbaren Wirtschaft und ihrer Abläufe nur begrenzt. Seit der Wende zum 20. Jahrhundert hat sich insbesondere die Volkswirtschaftslehre in zwei Richtungen getrennt: Mit der Modell-Ökonomie (zunächst die Wiener Grenznutzenschule), die mit immer höheren Abstraktionen arbeitet, wird in der Gegenwart die Wirtschaftstheorie zu einem Zweig der angewandten Mathematik. Hierüber urteilen Kritiker: «Die moderne Wirtschaftstheorie ist krank; Wirtschaftstheorie ist zunehmend ein intellektuelles Spiel geworden, das um seiner selbst willen gespielt wird und nicht um irgendwelcher praktischen Folgen wegen.»[7] Noch härter formuliert ein Nobelpreisträger, Kenneth Galbraith: «Die Wirtschaftswissenschaft als Profession – ich wähle diese Worte mit Überlegung – ist intellektuell bankrott. Es wäre genauso gut, wenn es sie gar nicht gäbe.»[8]
Vorbild für die «Klassiker» der Ökonomie waren die Leitwissenschaften ihrer Zeit, die Astronomie und die Physik. Deren Erfolg wurde darin gesehen, dass sie von allen Eigentümlichkeiten einer Realität abstrahierten, um die «dahinter» wirkenden einfachen Bestimmungskräfte zu erkennen. Aber man kann zum Beispiel nur mit dem Fallgesetz nicht den Weg eines von einem Baum fallenden Blattes voraussagen, auch nicht die Zeit, die es braucht, um den Boden zu erreichen. Dazu ist orts- und zeitspezifisches Zusatzwissen erforderlich. Entsprechungen zum Fallgesetz glaubte die «Klassik» im Stecknadelbeispiel von Adam Smith oder dem «Gesetz der komparativen Kosten» von David Ricardo zu besitzen. Aus dem Zeitgeist heraus, der die Schach spielende Maschine wünschte, wurde als zentrale Denkfigur der «Homo oeconomicus» konstruiert. Er wurde als Akteur erdacht, der nichts anderes als die Maximierung seines wirtschaftlichen Vorteils im Sinne hat. Gewiss war er zu Anfang ein bloßes Gedankenexperiment; im heutigen Neoliberalismus jedoch wird dieser Homunculus verdinglicht und überdies als normativ vorbildlich behandelt.[9]
Ein solch künstliches Menschenbild, das eine modellhafte Rationalität konstruiert, lässt oft vergessen, dass das Wirtschaftsgeschehen keineswegs ein mechanischer Selbstläufer ist, sondern unablässig Wertungen erfordert.[10]
Selbst die Rechenwerte großer Firmen sind Ausdruck – manchmal riskanter – Wertungen und unterschiedlicher Kulturen. In Deutschland muss beispielsweise der Vorstand entscheiden, wie er der gesetzlichen Forderung nach einer «vorsichtigen» Gewinnermittlung nachkommt.[11] Nach dem US-Bilanzrecht kann dagegen der Überschuss eines Wirtschaftszeitraums bis an die Grenze zum Bankrott an die Aktionäre weitergereicht werden. Die in Deutschland beliebten «stillen Reserven» erscheinen den amerikanischen Anhängern des Shareholder-Value als Diebstahl an Aktionären. Wenn die Kurse steigen und weit über dem bei uns maßgebenden «Gewinn-Kurs-Verhältnis» (GKV) liegen, darf dieses Hochgefühl in der Bilanz aktiviert werden? Amerikaner tun dies zum Teil. Selbst die Buchführungsregeln sind uneinheitlich. Deutsche können wahlweise nach dem Recht des Handelsgesetzbuches oder nach den neuen europäischen International Accounting Standards (IAS) Buch führen, müssen sich aber an der Börse in New York den dortigen Generally Accepted Accounting Standards (GAAP) unterwerfen. Diese US-Standards erleichtern vergleichsweise das Verstecken von Überschuldungen durch Tricksereien.
Der Wirtschaftsablauf ist also nicht Ergebnis eines mechanischen Vorgangs, sondern das Produkt vieler Entscheidungen innerhalb erkannter und auch nicht hinterfragter Rahmenbedingungen. Dadurch wird Wirtschaft spannend – und das wiederum besonders dann, wenn Akteure irren oder versuchen, den Bedingungen für ihr Handeln und den Aufsichtsgremien ein Schnippchen zu schlagen. Da sie dies als Kinder ihrer Zeit tun, verspricht ein auch sozialwissenschaftlicher Ansatz einen Erkenntnisgewinn.
Rationalität im Wirtschaftsleben: Es gibt sie also. Aber als kulturelle Norm und nicht etwa als mathematisches Gesetz. Das heißt: Es gibt also auch das Gegenteil: Irrationalität in der Wirtschaft. Und sie folgt aus denselben kulturellen Normen.
In Abwandlung eines Spruchs von Horst Ehmke für die Politik lässt sich also sagen: Bei genauem Hinschauen – das hier angebracht ist – geht es in großen Unternehmen öfters so zu, wie «Klein Moritz» sich das aufgrund böser Filme über die Hochfinanz vorstellt; nur dass Klein Moritz sich dann doch nicht vorstellen kann, dass sein Bild zutrifft. Einige unserer Darstellungen können wie ein Krimi gelesen werden, und es geht auch gar nicht so selten kriminell zu, wenn große Pleiten heraufziehen. Aufgedeckt wird dann zögerlich; denn häufig haben Vorstände und Aufsichtsräte allen Grund zur Scham über die Fehler, die sie machten. Ohne die Arbeit bestimmter Medien bliebe vieles im Dunkeln.
Und wenn sich andere Passagen lesen wie ein Schelmenroman, dann ist auch das wichtig zum Verständnis, wie menschlich-fehlbar die Entscheider über die Schicksale tausender Mitarbeiter sind. Der irrationale Faktor ist im Wirtschaftleben, das sich an rationalen Entscheidungskriterien orientieren will, nicht zu unterschätzen.
Beunruhigt hat uns bei unseren Recherchen insbesondere die Anfälligkeit von Managern für Moden. Wo zum Beispiel wird es hinführen, wenn zur gleichen Zeit ein Dutzend von Unternehmen sich für den Bau von Prestige-Autos der Preisklasse zwischen 125000 und 750000 Euro entscheidet? Macht es wirtschaftlich Sinn oder wirkt hier schon der irrationale Faktor in Form von Herdentrieb? Es ist noch nicht abzusehen. In solchen Fällen übrigens verlässt sich mancher Manager sogar auf Wahrsager. Es gibt Topmanager, die sehr empfänglich für Okkultes sind. Auch das zu wissen, gehört zum Verständnis unseres real existierenden Wirtschaftssystems dazu.
I
Vom Kapitalismus zur Marktwirtschaft – Die Dominanz der Manager
Wer bestimmt, wie hierzulande die Wirtschaft läuft? Wer das Sagen hat, der ist dann auch verantwortlich für die Pleiten.
Kapitalistisch wird unsere Wirtschaftsordnung oft genannt – im Englischen durchweg, im Deutschen seltener. Der Grund für den Unterschied: Eine Wirtschaft, in der die Kapitaleigner allein oder ganz überwiegend das Sagen hatten, hat es bei uns nicht im gleichen Maße gegeben wie etwa in den USA. Jetzt ist in allen Ländern die Bezeichnung Marktwirtschaft angemessener. Die Kapitaleigner sind nur eine Einflussgröße unter mehreren, und die wichtigsten Drahtzieher sind bei den größeren Unternehmen die Manager. Deshalb sind auch ihnen die meisten, insbesondere die großen Pleiten anzulasten.
Der Eigentümer als zentrale Figur
In der Wirtschaftstheorie wurde früher unterstellt, dass die Eigentümer auch die Unternehmer waren, und mit Unternehmer wurde der gemeint, der auch in einer Situation der Unklarheit und im Wissen um Risiken Entscheidungen fällt. So verstanden ist «Unternehmer» eine Funktion und nicht eine ein für alle Mal feststehende Kategorie von Personen.
In entwickelten Wirtschaftssystemen sind nicht mehr einzelne Eigentümer von Firmen vorherrschend, sondern eher Kapitalgesellschaften. Die gab es auch schon in der Frühzeit des Kapitalismus: Wenn Handelsschiffe auszusenden waren, taten sich mehrere wohlhabende Personen zusammen und heuerten wagemutige Kapitäne an. Durch Streuung der Anteile auf verschiedene Unternehmer sollte das Risiko eines einzelnen Handelsschiffs verringert werden. Bedeutsam für die Wirtschaftsgeschichte waren Kapitalgesellschaften für den Kolonialismus der Holländer und der Engländer.
Die Ausbeutung von Indonesien und Indien geschah durch Gesellschaften wie die East India Company. Das war für den Staat billiger als die französische Art des Kolonialismus, in der er selbst die Initiative ergriff. Für den «Privatkolonialismus» war nur der nachträgliche militärische Schutz zu leisten.
Die wichtigsten Entwicklungen des 19. Jahrhunderts sind jedoch mit Einzelunternehmern verbunden, die persönlich haftend ihr Kapital riskierten, so in den Eisenbahngesellschaften und der Ölförderung der USA oder im deutschen Kaiserreich in der Schwerindustrie.
Konzerngründern wie Friedrich K. Krupp (1787–1826), Carl Röchling (1827–1910) oder August Thyssen (1842–1926) ging es um mehr als Gewinnmaximierung. Krupp und Röchling waren Firmendespoten, die als Unternehmensziel das Wohl ihrer Mitarbeiter gleichgewichtig mit der Entwicklung des jeweils günstigsten Angebots beachteten. Ihr Selbstbild und praktisches Handeln waren dem eines idealtypischen ostelbischen Großgrundbesitzers ähnlicher als einem Kapitalisten der Sorte «Räuberbaron» (robber baron). Dieses Vorbild wirkte so stark, dass im deutschen Kaiserreich Großindustrielle defizitäre Rittergüter im Osten des Reiches erwarben, um den von ihnen als Vorbild empfundenen Lebensstil eines nichtluxurierenden Adels nachzuahmen.[1]
Der Anblick der Villa Hügel reicht aus als steinernes Zeugnis für die Bedeutung nichtwirtschaftlicher Ziele des wirtschaftlichen Handelns bei damaligen Großunternehmern. Alfred Krupp (1812–1887) wollte patriotisch sein, ein Förderer der Wohlfahrt seiner einfachen Mitarbeiter (der «Kruppianer»), und strebte zugleich nach Ansehen in der etablierten Gesellschaft.[2]
Eine ganz besondere Spezies von Eigentümer-Unternehmern waren die Tüftler. Sie fanden sich insbesondere in den jungen Wirtschaftszweigen Elektromechanik und Automobil. Mit dem Erfolg ihres Tüftelns bauten Werner von Siemens (1816–1892) und Johann Georg Halske (1814–1890) ein Großunternehmen (die «Telegraphen Bau-Anstalt Siemens & Halske») auf, das andere Zwecke als bloße Gewinnmaximierung betonte. Das drückt sich unter anderem in den Bezeichnungen für das Personal der Führungsebene dieser Unternehmung aus, das bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg «Oberbeamte» hieß.
Die frühe Automobilindustrie beruhte in besonderem Maße auf den Einfällen von Tüftler-Unternehmern. Das wird sehr anschaulich an den USA, wo das Auto zwar nicht erfunden wurde, die aber dennoch das erste Autoland wurden.[*] Wichtige Namen sind Charles E. und J. Frank Duryea (welche die ersten Sportautos konstruierten) und Ransom E. Olds (der Erbauer der ersten Autofabrik). In Deutschland war die Motorenentwicklung mit Gottlieb Daimler (1834–1900) und Karl Benz (1844–1929) verbunden, sowie mit August Horch (1868–1951) als dem Entwickler des Kardan-Antriebs und der Reibungskupplung. Für Frankreich sind in dieser Reihe von Tüftler-Unternehmern anzuführen der Fahrradbauer Armand Peugeot (1849–1915) und für Italien bzw. Frankreich der Rennfanatiker Ettore Bugatti (1881–1947), ein Franzose italienischer Herkunft.
Der Name Ford wird in diesem Zusammenhang zwar oft, aber auch zu Unrecht genannt. Henry Ford (1863–1947) war kein Tüftler, er hat gar nichts an Technik erfunden, aber er war ein Pionier.
Was seine Fabrik auszeichnete, nämlich zunächst Fertigung austauschbarer Teile und dann deren Zusammenbau am Fließband (im Englischen treffender «assembly line» genannt), war alles bereits bekannt – unter anderem aus der Waffenproduktion (Ersatzteile) oder dem fabrikmäßigen Schlachten (Fließband). Das senkte Kosten – und Kostensenkung war Voraussetzung, wenn Ford seine Marketingvision umsetzen wollte. Als Erster sah Henry Ford die Erfolgsaussichten, wenn aus dem Auto als Luxusgut ein Produkt des Alltagsgebrauchs würde. Das setzte er dann auf seine despotische Weise durch, indem er den Wunsch von Kunden nach Vielfalt in Typen und Farben ignorierte und mit dem Preis warb. Möglich wurde dies durch die damals modernsten Formen der Produktion und der Menschenführung. Für Betriebsfrieden sorgte eine sehr gute Bezahlung der Arbeiter und der Ausbau einer Art von Wohlfahrtsstaat.
Ford als Patriarch war in seinen Äußerungen zu öffentlichen Angelegenheiten von der Überzeugung geleitet, für Massenprodukte wie Autos seien autoritäre Regime wie das in der Sowjetunion und später das der Nationalsozialisten ein besserer Rahmen als Demokratien. Es war ein Topos des Zeitgeistes bei Autoren von W.I. Lenin über Thorstein Veblen bis Ernst Jünger, Demokratie und Marktwirtschaft als hinderlich für optimales Umsetzen des technisch Möglichen anzusehen. Dabei wurde «technisch Optimales» ohne weiteres Hinterfragen mit wirtschaftlicher Rationalität gleichgesetzt.
Das Unternehmerbild bei Joseph Schumpeter (1883–1950) ist nach diesem Eigentümer-Unternehmer modelliert.[3] Dieser Unternehmer ist der Motor des Fortschritts, indem er eine Möglichkeit der Verbesserung des Gewinns erkennt und durchsetzt. Das bedeutet aber auch, dass ein bereits verwirklichter Fortschritt nach dem Muster «Das Beste ist der Feind des Guten» zerstört wird. Fortschritt wird bei Schumpeter zur «schöpferischen Zerstörung». Am wohlsten fühlen sich diese Eigentümer-Unternehmer in einem geregelten Umfeld, bestimmt etwa durch die Kombination von Staat und Kartellen. Dies regt die Unternehmer an, sich zu knorrigen Persönlichkeiten hochzustilisieren.[4]
Solche Eigentümer-Unternehmer finden wir heute bei uns und in den USA meist nur noch bei mittelständischen Firmen. Da die mittelständischen Unternehmen quantitativ und oft qualitativ das Rückgrat unserer Wirtschaft sind – und übrigens auch der Wirtschaften der USA und Japans –, ist das Geringschätzen der heutigen Bedeutung von Eigentümer-Unternehmern eine Überreaktion auf eine tatsächliche Veränderung.
Ein aktuelles Beispiel für die Wirkung mittelständischer Eigentümer-Unternehmer ist für uns die Firma ABS-Pumpen. Der Besitzer hatte sich bereits als Ingenieurstudent gewundert, warum unter Wasser betriebene Pumpen so wenig zuverlässig funktionierten. Schließlich gelang es ihm, ein Abdichtungsverfahren auszutüfteln. Heute ist die Firma weltweit präsent und in vielen Ländern Marktführer auf einem allerdings nicht sehr großen Markt. Der Inhaber stand deshalb vor der Alternative, sich auf weitere Produktionsbereiche auszudehnen oder mittelständisch zu bleiben. Er entschied sich für das Letztere, hat einen absehbar wirtschaftlich stabilen Betrieb und ist als bedeutender Mäzen für den kleinstädtischen Standort ein hoch angesehener Bürger.
Die Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg war durch wiederkehrende Krisen gekennzeichnet, die wiederum massenhaft Pleiten zur Folge hatten. Dagegen versuchten Eigentümer-Unternehmer, sich durch Absprachen zu schützen: durch Gebietskartelle, mit denen geographisch festgelegt wurde, wer wo aktiv werden durfte; durch Preisabsprachen; sowie durch Vereinbarungen über Produktionsmengen.
Ob Eigentümer von Wirtschaftseinheiten sich unternehmerisch in diesem Sinne verhalten, ist ebenso eine Tatfrage wie beim angestellten Manager. Die Krisen, die Ende des 19. Jahrhunderts die rasche Entwicklung der Wirtschaft in den USA und im Deutschen Reich begleiteten, motivierten dagegen Versuche zur Minderung oder sogar Ausschaltung von Konkurrenz als Steuerungskriterium kapitalistischer Wirtschaftssysteme. Ein Vergleich zwischen den USA und dem Deutschen Reich zeigt, dass unter diesen Umständen mit Wirtschaften, die alle durch Eigentümer bestimmt werden, dennoch gegenteilige Wirtschaftsordnungen möglich sind.
Die Wirtschaften Frankreichs und Deutschlands einerseits und der USA andererseits unterschieden sich in der Reaktion auf diese Versuche zur Kanalisierung des Wettbewerbs als Steuerungskraft kapitalistischer Wirtschaften. Das ist nicht zuletzt mit einem anderen Verständnis von Eigentum und Zweck des Wirtschaftens in angelsächsisch geprägten Ländern zu erklären. Entsprechend der Philosophie des Utilitarismus sollte der Zweck der Wirtschaft in den USA das Glück der größtmöglichen Zahl sein, also die Maximierung des Nutzens für die Verbraucher. Der Gewinn der miteinander konkurrierenden Kapitalisten war insofern gerechtfertigt, als er eine Risikoprämie bedeutete. Die gleichfalls möglichen Verluste werden bei einer solchen Wirtschaft «privatisiert». Damit werden Versuche zur Ausschaltung des Wettbewerbs oder sogar eine Unterstützung solcher Versuche durch den Staat eine Verschwörung gegen den Nutzen der Mehrheit; denn das sind die Verbraucher. Die Kapitalisten der Gründerzeit in den USA wie beispielsweise John D. Rockefeller (1839–1937) oder die großen Eisenbahngesellschaften handelten oft sehr brutal – bis hin zur Bezahlung von Privatarmeen, mit denen Streiks blutig unterdrückt wurden. Zugleich sind die USA auch das Land des Widerstandes gegen unbegrenzte Freiheit für Großunternehmer. Hier wurden die ersten Gesetze gegen Marktbeschränkungen erlassen: 1890 der Sherman Act, 1914 als dessen Weiterentwicklung der Clayton Act.
Ganz anders die Entwicklung in Deutschland. Hier wurden Kartelle und andere Formen der Beschränkung von Konkurrenz nicht nur geduldet, sondern erhielten Rechtscharakter. 1897 erkannte das Reichsgericht Kartellverträge als rechtlich bindend an, sodass auf Erfüllung der Absprachen zur Konkurrenzbeschränkung geklagt werden konnte. Der damals wohl einflussreichste Wirtschaftspolitiker Gustav Schmoller erklärte 1906 vor dem Verein für Socialpolitik: «Ich habe seit langem betont, dass die wirtschaftliche Freiheit nur an bestimmten Stellen Segen bringe, dass nur die maßvolle, da und dort mannigfach regulierte Konkurrenz anregend wirke.»[5]
Die Perspektive, unter der in Deutschland die Wirtschaft betrachtet wurde, war die des Produzenten. Anfang der fünfziger Jahre wurde das Werben für eine Orientierung am Konsumenten von Sprechern der Wirtschaft als «Konsumenten-Sozialismus» zurückgewiesen. Kartelle waren dann eine Verteidigung legitimer Rechte aus Eigentum, und zu ihrer Kontrolle sei nur auf Missbräuche zu achten. 1933 gab es in Deutschland weit mehr als 2500 Kartelle. Internationale Kartelle wählten gern das Deutsche Reich als Amtssitz wegen seiner Toleranz gegenüber Kartellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat auch die Bundesrepublik das Verbotsprinzip gegen Kartelle («Gesetze gegen Wettbewerbsbeschränkung» 1957) eingeführt. Es ist dies jedoch nie Teil unserer kulturellen Selbstverständlichkeiten geworden und wird nur halbherzig angewandt.
Auch in heutigen Marktwirtschaften sind Eigentümer-Unternehmer bedeutsam geblieben, aber sie sind nicht mehr strukturbestimmend für moderne Wirtschaften. Eigentümer-Unternehmer gibt es seit den fünfziger Jahren bei uns als häufigen Typus unter zwei Umständen:
Es entwickelt sich ein neuer Wirtschaftsbereich.
Ein Wirtschaftssystem ist zerstört und bedarf unternehmerischer Initiativen für den Aufbau.
Ein hervorragendes Beispiel in unseren Tagen für die Bedeutsamkeit des ersten Umstandes ist die Computerbranche. Am zunächst beherrschenden Branchenriesen IBM vorbei – den übrigens Thomas Watson, auch er eine sperrige Persönlichkeit, im Jahr 1914 gegründet hatte –, wurden in den USA die Garagenunternehmer zu Finanzgrößen. Der Entwickler von Microsoft, Bill Gates, und der Motor für den Aufstieg von Oracle, Larry Ellison, sind herausragende Unternehmerpersönlichkeiten im klassischen Sinn.
Die Zeit nach 1945 bot auch in Deutschland Unternehmertypen im Verständnis von Schumpeter angesichts der Totalzerstörungen Spielraum für Entwicklungen, die durch Persönlichkeiten geprägt waren. Max Grundig ist ein Beispiel, Carl F.W. Borgward ein weiteres. Beide Fälle zeigen aber auch, dass diese Eigentümer-Unternehmer sich in eine andere Form des Kapitalismus einfügen müssen, wenn die Zeiten «normaler» werden.
Die explosionsartige Vermehrung der Verbreitungsmöglichkeiten medialer Inhalte bot dann in den sechziger und siebziger Jahren bei uns wieder einmal Unternehmertypen den Raum zum Aufbau von Medienimperien – wie Axel Springer oder Franz B. Burda, Georg von Holtzbrinck und Reinhard Mohn (Bertelsmann). Sie haben allerdings inzwischen auch Größenordnungen erreicht, die die Anpassung der Entscheidungsstrukturen während der Gründerphasen nun an den «normalen» Kapitalismus ratsam machen.
Der Kapitalismus der Manager
Es war im Jahre 1932, auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, als die beiden Autoren Adolf A. Berle (Konzernanwalt) und Gardiner C. Means (Wirtschaftswissenschaftler) ihr Buch über die moderne Großfirma und die Bedeutung des Eigentums veröffentlichten.[1] Auf der Grundlage einer dichten Empirie problematisierten sie einen neuen Abschnitt in der Entwicklung des Kapitalismus: den Kapitalismus der Konzerne («Corporate Capitalism»), der den Industriekapitalismus abgelöst habe.[2]
Bereits in den zwanziger Jahren waren Zweifel aufgekommen, ob der Kapitalismus noch als gesteuert durch Eigentümer-Unternehmer zu verstehen sei. Der amerikanische Soziologe und Publizist James Burnham (1905–1987) hatte darauf verwiesen, dass in sehr vielen Großunternehmen die Manager sich gegenüber den Eigentümern verselbständigt hätten. Das gelte insbesondere für Unternehmen mit Streubesitz an Aktien. Burnham gilt heute allgemein als derjenige, der die These von der Revolution der Manager als Entmachtung der Eigentümer begründet hat.[3] Es tut zur Wirksamkeit dieser These nichts, dass Burnham das weder belegt noch als zukünftige Normalität behauptet hat. Für ihn war die in den zwanziger Jahren beobachtete Trennung von Verfügungsgewalt der Manager und Einfluss der Eigentümer ein vorübergehender Zustand; er werde durch den Normalzustand der Kontrolle von Entscheidungen aufgrund von Eigentum abgelöst. Bezeichnend ist aber, dass sich die Aussage über diesen vorübergehenden Zustand gegenüber dem Autor Burnham verselbständigt hat, weil eben die Wirklichkeit seine Beschreibungen bestätigte.[4] Mit einem Wachsen vieler amerikanischer Unternehmen zu riesigen Komplexen stellte sich für eine Reihe von Ökonomen und Juristen die Frage, ob dies noch als ein System auf der Grundlage von Privateigentum verstanden werden könnte. 1928 hatte der US Social Science Research Council dem Justitiar Adolf A. Berle einen Forschungsauftrag zu diesem Thema erteilt. Als Mitarbeiter gewann Berle den Wirtschaftsprofessor Gardiner C. Means, und beide zeichneten 1932 gemeinsam den Abschlussbericht, der unter der Aufsicht des Universitätsrates für sozialwissenschaftliche Forschung der Columbia-Universität (New York) erstellt wurde. Das Buch erregte im englischsprachigen Bereich größte Aufmerksamkeit, schien es doch zum damaligen Höhepunkt der Wirtschaftskrise eine Erklärung zu geben, warum der vertraute Kapitalismus an sein Ende gekommen sei. In der Folgezeit teilte diese Schrift das Schicksal vieler besonders erfolgreicher Werke: viel zitiert, aber wenig gelesen zu werden. Dabei pflegt sich dann eine Argumentation bis auf (oft vermeintliche) Kernaussagen abzuschleifen. Dies war wohl der Grund, 1991 den Text neu aufzulegen und um sehr ausführliche Kommentare zu ergänzen.
Berle und Means wählen als Ausgangspunkt die bei Adam Smith (1723–1790) – dem «Vater» der Wirtschaftswissenschaften – als selbstverständlich vorausgesetzten Bedingungen: Die Wirtschaftseinheiten sind klein – vielleicht neben dem Eigentümer noch ein paar Hilfskräfte –; Eigentum und Kontrolle über dessen Verwendung fallen zusammen; Reichtum (wealth) bezieht sich auf «handfeste» Dinge. Alle diese Voraussetzungen dafür, dass Märkte die bestmöglichen Ergebnisse zur Folge haben, treffen auf die zeitgenössische Wirtschaft nicht mehr zu.[5] Insbesondere sind heute die beiden entscheidenden Dimensionen des Eigentums – durch eigenes Profitstreben das Wohlergehen des Kollektivs zu mehren und zugleich beim Misserfolg des Unternehmens persönliche Verantwortung zu tragen – voneinander getrennt. «Die meisten Eigentümer … managen nicht; und die meisten Manager sind nicht Eigentümer.»[6] Diese Kritik ist bis hierhin von heute aus betrachtet in erster Linie ein moralischer Tadel: Wer eine Mehrung oder Minderung kollektiver Wohlfahrt bewirkt – die Manager insbesondere größerer Unternehmen –, haftet nicht für die Folgen; das Wirtschaftsgeschehen ist durch die Trennung von Eigentum und Entscheidung verantwortungslos geworden.
Berle und Means leiten aus solchen Erwägungen ein Programm für eine Wirtschaftsordnung ab, die später zum Teil während der Präsidentschaft von Franklin D. Roosevelt als «New Deal» versucht wurde. Neben der Forderung eines sozialen Netzes für alle Amerikaner steht die Forderung nach einem Gleichgewicht zwischen regulierendem Staat und dem System der Großunternehmen.
Bevor «Shareholder-Value» in der Wirtschaftsjournalistik als alleiniger Maßstab für die Führung von Unternehmen behauptet wurde, argumentierten Wirtschaftstheoretiker in den USA, dass sich im Gegensatz zu den Kapitaleignern die Manager als Treuhänder verstünden, die eine Balance zwischen oft einander widerstrebenden Interessen herzustellen hätten. Nach 1945 wurde auch in den USA die soziale Verantwortung der großen Unternehmen betont, und hiernach hatte der Manager nicht nur zwischen den Aufsichtsgremien der Firma, den Anteilseignern und den Kunden einen Mittelkurs auszumachen, sondern auch sozialen Kriterien zu entsprechen.[*] Nach Untersuchungen unter anderem der Harvard Business School waren bei Managern nach 1945 tatsächlich zwei Prioritäten vorherrschend. Die eine ist das Wohl der Firma, so wie die Manager dieses sehen, und dabei hat dann absolute Priorität das Überleben des Unternehmens. Hinzu kommt das Eigeninteresse der einzelnen Manager, was keineswegs im Gegensatz zum Firmeninteresse stehen muss, aber durchaus kann.
Berle und Means haben als Leitbild einen Aktionärs-Kapitalismus, wie er tatsächlich in den USA einmal ausgeprägter war als heute und wie er bei uns nie vorherrschte. Tatsächlich wird nach 1945 in den USA ein Manager-Kapitalismus dominant. Und bei diesem ist die Kontrolle des Eigeninteresses von Managern ein Kernproblem. Allgemein kann das formuliert werden als ein Auseinanderfallen von kollektiver (= Wohl des Unternehmens) und individueller Rationalität (= Eigeninteresse). Solange das den Beteiligten nicht deutlich wird, muss das als ein Führungsfehler verstanden werden.[7] Ist das Abweichen des vom Manager verfolgten Eigeninteresses vom Firmenwohl dem Akteur jedoch bewusst, wird damit eine Machtfrage gestellt.[8]
In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur wird das Problem entweder übergangen oder durch hoch abstrakte Formalisierung eskamotiert. Für Letzteres wird gewöhnlich das Modell des «Gefangenen-Dilemmas» herangezogen (Prisoner’s Dilemma).[9] Im einfachsten Modell werden zwei Verdächtige in Einzelhaft genommen. Der Staatsanwalt benötigt zur Überführung ein Geständnis – etwa: «Jawohl, ich verfolgte Eigeninteressen» –, ohne das er nicht eingreifen kann. Wenn einer der Verdächtigten den anderen beschuldigt, geht der Kronzeuge straffrei aus; der Beschuldigte erhält die Höchststrafe. Gestehen beide, wirkt das strafmildernd; gesteht keiner, muss auf Strafe verzichtet werden. Das geringste Risiko ist für jeden der Gefangenen, die sich untereinander nicht verständigen können, zu gestehen. Jeder von beiden muss gewärtig sein, dass ohne Absprache untereinander dagegen ein Ableugnen mit höchstem Risiko verbunden ist. Durch Zusatzannahmen z.B. über Strafhöhe oder unterschiedliche Belastung kann das Modell sehr kompliziert werden, aber sachdienlicher zum Erkennen egoistischen Verhaltens wird es dadurch nicht.
Aufbau – Währungsreform und Wirtschaftswunder
Deutschland nach 1945 – der Lebensinhalt vieler war zunächst das bloße Überleben. Weichen für die Zukunft konnten noch nicht gestellt werden. Das wollten zwar die Alliierten auch, aber ihre Pläne waren untereinander nicht abgestimmt und widersprüchlich. Mit dem Marshall-Plan wurde schließlich vorentschieden, dass die Wirtschaftsordnung Westdeutschlands Teil der westlichen Welt sein würde. Aber selbst das war zunächst im wirtschaftlichen Chaos der Nachkriegszeit nicht eindeutig.
Geld war vorhanden: Die Nazis hatten die Notenpresse immer schneller rotieren lassen, um ihren Krieg zu finanzieren. 320 Milliarden Reichsmark waren im Umlauf oder auf Bank- und Sparkonten angelegt; zu kaufen gab es für dieses Geld aber so gut wie nichts. Und mit den Lebensmittelkarten, die die Alliierten in Fortführung des im Dritten Reich eingeführten staatlichen Bewirtschaftungssystems ausgaben, war zeitweilig maximal die Hälfte dessen zu erwerben, was eine zum Überleben ausreichende Ernährung gesichert hätte.[1]
Schwarzhändler und Schieber füllten die Lücken aus, aber selbstverständlich war nicht jeder fähig und in der Lage, Nylonstrümpfe in Speisekartoffeln zu tauschen oder Zigaretten – möglichst Chesterfield oder Lucky Strike – gegen viel Papiergeld zu verkaufen. Deutschland war vorübergehend zum Naturalhandel gezwungen. Ein Kleinhändler konnte damit auch nur auf kärglichem Niveau überleben. Wer aber in den oberen Rängen des Schwarzmarktes mitmischen wollte, musste Regeln des Verbrechertums beherrschen. Solchen «Aufsteigern» in die kriminelle Zone sollte später die Rückkehr ins normale Leben nicht mehr ohne Schwierigkeiten glücken.
Das Elend der Zeit zwischen 1944 und etwa 1949 war umfassend. 1947 konnte eine Hungersnot nur durch Hilfslieferungen der Amerikaner abgewendet werden. Die extreme Wohnungsnot und die katastrophale Unterversorgung mit Brennstoff wurden durch den Zustrom von ca. zwölf Millionen Flüchtlingen noch verschlimmert. Friedrich Wilhelm Henning schätzt, dass in den Westzonen die industrielle Produktion auf 30 Prozent des Standes von 1938 abgesunken war.[2] Zusätzlich wurde die Wirtschaftskraft durch Demontagen geschwächt. Das Land war in ein Nebeneinander lokaler Einheiten zerfallen, die sich um Selbstversorgung bemühten – eine Situation nicht unähnlich der in Russland während der letzten Dekade.
Dieses düstere Bild überdeckt, dass es daneben eine Reihe wichtiger Voraussetzungen für die spätere rasante Entwicklung gab. Auch von Zeitgenossen wird unterschätzt, welch gigantisches Kapital die nur beschädigte, aber nicht vernichtete Infrastruktur war. Selbst für eine so stark zerstörte Stadt wie Köln konnte der Wert der Versorgungsleitungen und des Straßennetzes als gleichwertig gegenüber dem Verlust an Gebäudesubstanz geschätzt werden. Das sehr gute Verkehrsnetz des Landes war reparabel, das Geflecht von Institutionen regenerierbar. Das Wissen in den Köpfen und die erlernten Fertigkeiten wirkten weiter, ebenso wie die gewohnten Formen von Kooperation.
«Einem hungrigen Freunde wurde ein Pfund Butter für 320 Reichsmark angeboten. Er nahm sie auf Kredit, weil er so viel Geld nicht hatte. Er wollte sie morgen bezahlen. Ein halbes Pfund bekam seine Frau. Mit dem Rest gingen wir ‹kompensieren›: In einem Tabakladen gab es für das halbe Pfund 50 Zigaretten. Zehn Stück behielten wir für uns. Mit dem Rest gingen wir in eine Kneipe. Wir rauchten eine Zigarette, und das Geschäft war perfekt: Für die 40 Zigaretten erhielten wir eine Flasche Wein und eine Flasche Schnaps. Den Wein brachten wir nach Hause. Mit dem Schnaps fuhren wir auf das Land. Bald fand sich ein Bauer, der uns für den Schnaps zwei Pfund Butter eintauschte. Am nächsten Morgen brachte mein Freund dem ersten Butterlieferanten sein Pfund zurück, weil es zu teuer war. Unsere Kompensation hatte 1 1/2 Pfund Butter, eine Flasche Wein, zehn Zigaretten und das Vergnügen eines steuerfreien Gewerbes eingebracht», heißt es in einer zeitgenössischen Darstellung.[3]
Der Wirklichkeit der überwiegenden Mehrheit in Deutschland entsprach allerdings eher die folgende Schilderung des Schwarzmarktes: «Gefälschte Raucher- und Zuckermarken, gute Beziehungen zu einem Vetter auf dem Wohnungsamt, unterschlagene Bezugsscheine …, aus diesen Stoffen wurden die heiteren Geschichten der Schwarzmarktzeit geformt … Ich habe darüber nie lachen können. Meistens fielen mir rechtzeitig diejenigen ein, für die am Ende nichts zu lachen übrig blieb, die den letzten Goldring schon im Sommer 1946 versetzt hatten und im Hungerwinter 1947 nichts Versetzbares mehr besaßen. An die Kältetoten des Eiswinters habe ich denken müssen und an alle Leute, die nicht mehr die Kraft besaßen, mit dem Rucksack über Land zu reisen. Meiner Belustigung im Wege stand stets auch die Erinnerung an jene Eltern, die ihre letzten Werte zusammenkratzten, um auf dem schwarzen Markt das Wundermittel Penicillin für ihr krankes Kind zu kaufen, und die nur ein wirkungsloses Pulver erhielten. In dem berühmten Film ‹Der dritte Mann› geht es um diese bitterböse Seite der Schwarzmarktzeit. Kein Zweifel, es war eine ernste Zeit …»[4]
Schwarzhändler, die zum Teil büschelweise Reichsmark gehortet hatten, erlebten mit der Währungsreform ihr Desaster. Nicht nur, dass die Grundlage für den Schwarzmarkt entfallen war; schlimmer war für manchen Schwarzhändler die bürokratische Abwicklung der Umstellung. Die Reichsmark war im Verhältnis 10:1 abgewertet worden. Die Besitzer von Reichsmark hatten den Umtausch in die neue Deutsche Mark zu beantragen, und ab einem Guthaben von mehr als 5000 Reichsmark mussten Unbedenklichkeitserklärungen des Finanzamtes vorgelegt werden. Dies erforderte aber den Nachweis, wo denn das Geld verdient worden war. Verständlicherweise zog so mancher Schwarzhändler es vor, sein Bündel an Reichsmark lieber zu vernichten, als sich peinlichen Fragen auszusetzen.[5]
Inzwischen war deutlich, dass die Grenze zwischen dem sowjetisch besetzten Teil Deutschlands und den drei westlichen Besatzungszonen eine Trennung zwischen zwei Regimen war. Zugleich war eindeutig, dass das Nachkriegschaos zu einem Ende kommen musste, wobei eine gesunde Währung Voraussetzung für eine geordnete Wirtschaftsentwicklung war. Die Notwendigkeit der Währungsreform war nicht strittig, die Art ihrer Durchführung jedoch sehr. Deutsche Politiker wollten die Reform der Währung verbinden mit einer tief greifenden Sozialreform. Durch einen «Lastenausgleich» sollte die Zufälligkeit, mit der in der Bevölkerung die Kriegsschäden zu tragen waren, korrigiert werden. Die Alliierten, insbesondere die Amerikaner, hielten von einem solchen Experiment in sozialer Gerechtigkeit allerdings nichts.
Am 20. Juni 1948 war der Währungsschnitt als bloße Geldreform schlagartig durchgeführt. Mit der Währungsreform geschah etwas, was den Zeitgenossen als Wunder erschien: Es gab gegen gutes Geld auch gute Ware zu kaufen. Im Wortsinne über Nacht füllten sich die Regale der Geschäfte. Damit wurde die Zuteilung von Waren über Berechtigungsscheine («Bezugsscheine», Lebensmittelkarten) überflüssig. Die Nachfrage wurde wieder durch die Verfügbarkeit von Geld geregelt.
Jetzt wurde Deutschland auch zum Nutznießer des sich bald verschärfenden «Kalten Krieges». War nach 1918 die Politik der beiden Siegerstaaten Frankreich und England auf ein Niederhalten Deutschlands ausgerichtet, so sorgte nach 1947 vor allem die US-Regierung für eine möglichst rasche Wiederherstellung der Wirtschaftskraft Deutschlands. Zwar erhielt der Westen des geteilten Deutschlands relativ zur Bevölkerungszahl wesentlich weniger Wirtschaftshilfe (über den Marshall-Plan) als Frankreich, aber angesichts des Kapitalmangels im Westen war diese Hilfe doch ein wesentlicher Umstand für das rasche Wachstum nach 1945.
Ursprünglich verstand sich die Militärregierung als Instrument der Bestrafung Deutschlands mit dem Auftrag, die Strukturen umzubauen, die als verantwortlich für die Entstehung des Nationalsozialismus verstanden wurden. Mit großem bürokratischen Aufwand wurde ein Programm der Entnazifizierung begonnen. Etwas mehr als zwölf Millionen Deutsche wurden in solchen Verfahren überprüft, zunächst ca. 1,5 Millionen aus Ämtern entfernt und Wirtschaftsriesen in Teile zerlegt. Aber insgesamt erwiesen sich die überkommenen Strukturen als zählebig, und das galt besonders für die Netzwerke von Personen in Führungsstellungen.
Als wichtiger Förderer der Nationalsozialisten in der Wirtschaft galten die IG Farben. Mit einer als beispielhaft gemeinten Order wurde dieser gigantische Konzern von den Militärregierungen für Westdeutschland aufgelöst; die drei größten Nachfolger, Hoechst, Bayer und BASF, blieben in der Folgezeit selbständig und verfolgten unterschiedliche Firmenpolitiken. Anders verlief es nach der Zerschlagung der drei deutschen Großbanken, die von den Siegermächten alle als Förderer des NS-Regimes eingestuft wurden.
«Keine Großbank verschrieb sich Nazi-Deutschland stärker als die Dresdner Bank … Die beherrschende Stellung, zu der sie in den zwölf Jahren der Nazi-Herrschaft aufstieg, resultierte aus ihrer skrupellosen Ausnutzung aller Bereicherungsmöglichkeiten, die das Nazi-Regime ihr bot, zunächst innerhalb Deutschlands, später in allen eroberten Ländern Europas», heißt es im OMGUS-Bericht der US-Militärregierung über die Rolle der Banken im Nationalsozialismus.
Die Dresdner Bank vergrößerte sich erheblich durch die «Arisierung» jüdischen Wirtschaftseigentums, wobei KZ-Häftlinge unter Todesdrohung ihren Besitz an die Dresdner übereignen mussten. Die Dresdner führte das Konsortium, das die «Hermann Göring Werke» finanzierte. In Vorstand und Aufsichtsrat saßen SS-Führer. Zusammenfassend kommt der Bericht zu dem Schluss, Vorstand, Aufsichtsrat und leitende Mitarbeiter seien «Kriegsverbrecher, die von wichtigen Positionen im politischen und wirtschaftlichen Leben Deutschlands zu entfernen und für die Zukunft davon auszuschließen» seien.[6]
In Bezug auf die Deutsche Bank kam der OMGUS-Bericht ebenfalls zu dem Schluss, dass alle verantwortlichen Mitarbeiter als Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen und von der Übernahme verantwortlicher Positionen in Wirtschaft und Gesellschaft auszuschließen seien. Die Commerzbank wirkte ebenso massiv an der Rüstungsfinanzierung des NS-Staates mit; auch ihren Fortbestand wollten die Alliierten nach dem Krieg verhindert wissen.
1952 wurde verfügt, Deutsche Bank, Dresdner Bank und Commerzbank seien in Einzelinstitutionen aufzulösen. Bereits 1957 jedoch fusionierten die früheren Teile der Deutschen Bank wieder und im gleichen Jahr auch die der Dresdner Bank. 1958 folgten die Teile der früheren Commerzbank. Die alten Strukturen hatten sich nach nur fünf bis sechs Jahren wieder durchgesetzt.
Sehr wenig bewirkte auch der Entschluss, die Helfer des NS-Regimes und selbst Kriegsverbrecher aus dem deutschen Management zu entfernen. Exemplarisch für die Kontinuität des Personals auf den Führungsebenen ist Hermann Josef Abs, der bereits 1937 in den Vorstand der Deutschen Bank berufen und später dessen Sprecher wurde. Bereits 1951 wurde Abs dann Leiter der Delegation, die 1953 das Londoner Schuldenabkommen vereinbaren konnte. Abs häufte als neuerlicher Vorstandssprecher der Deutschen Bank in der Folgezeit so viele Aufsichtsratsmandate auf seine Person, dass der Bundestag eine «Lex Abs» zur Begrenzung der Zahl von Mandaten erließ, die eine einzelne Person gleichzeitig ausüben durfte. Immerhin war Abs noch 1993 Ehrenvorsitzender der Aufsichtsräte von acht der hundert damals bedeutendsten deutschen Unternehmen.
Dass die Entnazifizierung des Leitungspersonals der deutschen Wirtschaft durchweg misslang, ist im Nachhinein betrachtet nicht verwunderlich. Die Entnazifizierung gelang ja auch in anderen Lebensbereichen für die Führungsebene nicht. Auf Dauer waren nur einige hunderttausend in ihren Karrieren behindert; hauptsächlich waren dies Personen in eher nachgeordneten Stellungen. Professionen wie Richter oder Chefärzte erwiesen sich jedoch als Schutz- und Trutzgemeinschaft, ungeachtet auch eigener interner Streitigkeiten. Führende Juristen und eine Großzahl der KZ-Ärzte, die an lebenden Menschen experimentiert hatten, blieben unbehelligt. Für uns ist der wichtigste Grund hierfür der Korporatismus als bestimmendes Element der deutschen Sozialstruktur. Hier decken sich die Leitungspersonen eines Lebensbereichs gegenüber Außenstehenden gegenseitig, selbst wenn sie intern einander feindselig gegenüberstehen.
Darüber später mehr. Hier sei nur als Faktum festgehalten, dass es auf der Leitungsebene größerer deutscher Unternehmen Kontinuität gab, dass also der Systemwechsel keine Elitetransformation zur Folge hatte. Auch in der DDR konnten hohe Nazis im SED-Regime Karriere machen. Die Brauchbarkeit erwies sich für das neue Regime als wichtiger als moralische Maßstäbe.[7]
Bis zum Jahr 1970 hatten dann schließlich deutsche Gerichte gegen 12900 Personen wegen der Anschuldigung von Kriegsverbrechen Verfahren eröffnet. 5200 davon erhielten Gefängnisstrafen, 26 auf Lebenszeit.[8] Als Verfolgung individueller Vergehen war die Entnazifizierung wohl überwiegend nicht sehr erfolgreich, aber zur Delegitimierung des NS-Staates und seiner Ideologie war sie sicherlich notwendig und geglückt.
Die Bundesrepublik entsteht
Mit der Währungsreform und der Einführung von Märkten eröffneten sich für die deutschen Unternehmer und Politiker wieder eigene Gestaltungsräume. Vieles am heutigen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem ist allerdings nicht «gestaltet» im innovativen Sinne, sondern eine Weiterführung früherer Entwicklungen, zum Beispiel die Art des Städtebaus, das Justizwesen, das duale System der Ausbildung und generell die korporatistische Organisation unserer Formen des Zusammenwirkens. Manches Neue entstand erst im Laufe der Zeit, ergab sich wie von selbst – wie Veränderungen im Führungsstil und im Umgang mit dem neuen Phänomen «Freizeit» oder auch das Parteiensystem. Wichtige Entscheidungen fielen jedoch in den ersten zehn Jahren der Bundesrepublik auch als absichtsvolles Wollen.
Da ist zunächst die Mitbestimmung zu nennen. Ob man sie schätzt oder in ihr eine Bremse für Handeln aus wirtschaftlicher Vernunft sieht – sie ist ein Grundelement unserer Wirtschaftsordnung, wenn sie auch vielen heute als Hemmnis für ausländische Investitionen erscheint. Aber damals war sie unvermeidlich. Bereits in den zwanziger Jahren hatte der Wirtschaftspolitiker Fritz Naphtali die Mitbestimmung als «dritten Weg» zwischen Kapitalismus und Sozialismus den deutschen Gewerkschaften anempfohlen, und in diesem Sinne wurde sie auch 1951 in der Montanindustrie durchgesetzt – nämlich als Kompromiss zwischen den damals auch im Westen florierenden Forderungen nach Sozialisierung und der Beibehaltung einer Eigentümerordnung. In abgemilderter Form, nämlich als formell verfasster Korporatismus, wurde sie dann ziemlich flächendeckend 1952 als «Betriebsverfassungsgesetz» eingeführt und wirkt seitdem auch als Einbindung der Gewerkschaften in die Wirtschaftsordnung.
Eine bedeutende Erfindung war die Entwicklung eines Alterssicherungssystems, mit dem die Rentner an der Wohlstandsentwicklung der Erwerbstätigen beteiligt wurden. Das ist der Sinn der Formel von der «dynamischen Rente», die 1957 Gesetz wurde. Dass diese Rentenreform die Finanzierung im Umlageverfahren vorsah, war unter den damaligen Bedingungen nicht wirklich strittig. Durch die Vernichtung aller Rücklagen des Sozialversicherungssystems kam ein Kapitaldeckungsverfahren zunächst nicht in Frage.





























